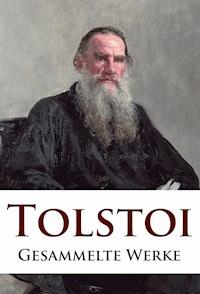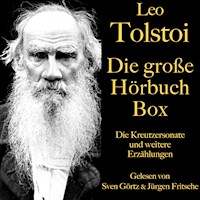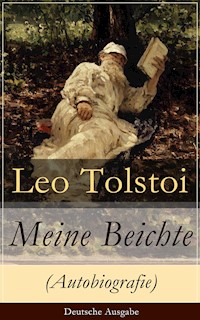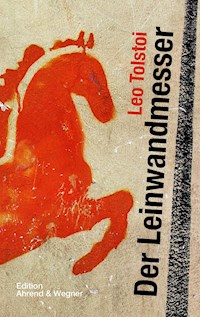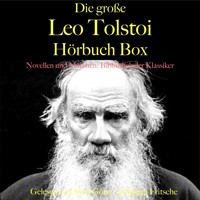Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pretorian Media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie in eine epische Welt, in der persönliche Schicksale und Geschichte aufeinanderprallen. "Krieg und Frieden" ist ein komplex aufeinander abgestimmtes Meisterwerk zwischen den Spannungsfeldern Krieg und Liebe. Vor dem Hintergrund des napoleonischen Russlands verbindet dieses monumentale Werk die Schicksale unvergesslicher Figuren, die alle mit ihren eigenen Wünschen, Träumen und Schicksalen konfrontiert sind. Folgen Sie dem rätselhaften Pierre Besuchow, der bezaubernden Natascha Rostowa und dem stoischen Fürsten Andrej Bolkonski, wie sie inmitten der Kriegswirren von Liebe und Ehrgeiz getrieben werden. Tolstois brillante Erzählung zeichnet ein lebendiges Porträt des Russlands des 19. Jahrhunderts, das Sie einlädt, die Pracht der Gesellschaftsbälle, die Brutalität des Schlachtfelds und die Abgründe der menschlichen Seele zu erfahren. Mit seiner üppigen Prosa und seinen tiefgründigen Einsichten ist "Krieg und Frieden" mehr als nur ein Roman; es ist eine Erkundung des menschlichen Daseins selbst. Egal, ob Sie ein erfahrener Literaturliebhaber sind oder Ihre literarische Reise gerade erst beginnen, "Krieg und Frieden" ist ein zeitloser Klassiker, der in jedes Bücherregal gehört. Tauchen Sie ein in seine Seiten und erleben Sie die Höhen und Tiefen des Lebens in all ihrer Pracht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 3002
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Erster Teil
Kapite I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Zweiter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Dritter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Vierter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Fünfter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Sechster Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Siebenter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Achter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Neunter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Zehnter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Kapitel XXXVI
Kapitel XXXVII
Kapitel XXXVIII
Kapitel XXXIX
Elfter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Zwölfter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Dreizehnter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XIX
Vierzehnter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Fünfzehnter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Epilog
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Impressum
Titel: Krieg und Frieden
Autor: Leo Tolstoi
Herausgeber: Pretorian Media GmbH, Ul. Yanaki Bogdanov 11, BG-9010 Varna
Datum: 2023
Erster Teil
Kapite I
»Nun, sehen Sie wohl, Fürst: Genua und Lucca sind weiter nichts mehr als Apanagen der Familie Bonaparte. Nein, das erkläre ich Ihnen auf das bestimmteste: wenn Sie mir nicht sagen, daß der Krieg eine Notwendigkeit ist, wenn Sie sich noch länger erlauben, all die Schändlichkeiten und Gewalttaten dieses Antichrists in Schutz zu nehmen (wirklich, ich glaube, daß er der Antichrist ist), so kenne ich Sie nicht mehr, so sind Sie nicht mehr mein Freund, nicht mehr, wie Sie sich ausdrücken, mein treuer Sklave. – Jetzt aber guten Tag, guten Tag! Ich sehe, daß ich Sie einschüchtere; setzen Sie sich und erzählen Sie!«
So sprach im Juni 1805 Fräulein Anna Pawlowna Scherer, die hochangesehene Hofdame und Vertraute der Kaiserinmutter Maria Feodorowna, indem sie den durch Rang und Einfluß hervorragenden Fürsten Wasili begrüßte, der sich als erster zu ihrer Soiree einstellte. Anna Pawlowna hustete seit einigen Tagen; sie hatte, wie sie sagte, die Grippe (»Grippe« war damals ein neues Wort, dessen sich nur einige wenige feine Leute bedienten). Die Einladungsschreiben, die sie am Vormittag durch einen Lakaien in roter Livree versandt hatte, hatten alle ohne Abweichungen folgendermaßen gelautet:
»Wenn Sie, Graf (oder Fürst), nichts Besseres vorhaben und die Aussicht, den Abend bei einer armen Patientin zu verbringen, Sie nicht zu sehr erschreckt, so werde ich mich sehr freuen, Sie heute zwischen sieben und neun Uhr bei mir zu sehen. Anna Scherer.«
»Mein Gott, was für eine hitzige Attacke!« antwortete der soeben eingetretene Fürst, ohne über einen derartigen Empfang im geringsten in Aufregung zu geraten, mit einem heiteren Ausdruck auf seinem flachen Gesicht.
Er trug die gestickte Hofuniform, Schnallenschuhe, Strümpfe und mehrere Orden und sprach jenes auserlesene Französisch, welches unsere Großväter nicht nur redeten, sondern in dem sie auch dachten, und zwar mit dem ruhigen, gönnerhaften Ton, wie er einem hochgestellten, im Verkehr mit der besten Gesellschaft und in der Hofluft altgewordenen Mann eigen ist. Er trat zu Anna Pawlowna heran, küßte ihr die Hand, wobei er ihr den Anblick seiner parfümierten, schimmernden Glatze darbot, und setzte sich dann in aller Seelenruhe auf einen Lehnsessel.
»Vor allen Dingen, liebe Freundin, sagen Sie mir, wie es mit Ihrer Gesundheit steht, und beruhigen Sie Ihren Freund«, sagte er, ohne seine Stimme zu verändern, und in einem Ton, bei dem man durch alle Höflichkeit und Anteilnahme doch seine innere Gleichgültigkeit und sogar ein wenig Spott hindurchhörte.
»Wie kann ich körperlich gesund sein, wenn ich seelisch leide? Wer, der überhaupt Gefühl in der Brust hat, kann denn in unserer Zeit seine seelische Ruhe bewahren?« sagte Anna Pawlowna. »Ich hoffe, Sie bleiben den ganzen Abend bei mir?«
»Und die Fete beim englischen Gesandten? Heute ist Mittwoch; ich muß mich dort zeigen«, erwiderte der Fürst. »Meine Tochter wird herkommen und mich dorthin begleiten.«
»Ich glaubte, die heutige Fete sei abgesagt worden. Ich muß gestehen, alle diese Feten und Feuerwerke werden einem allmählich unerträglich.«
»Wenn der Gesandte geahnt hätte, daß dies Ihr Wunsch sei, so hätte er gewiß die Fete absagen lassen«, antwortete der Fürst; er redete eben gewohnheitsmäßig, wie ein aufgezogenes Uhrwerk, etwas hin, wovon er selbst nicht erwartete, daß es jemand glauben werde.
»Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Welcher Beschluß ist denn nun infolge von Nowosilzews Depesche gefaßt worden? Sie wissen ja doch alles.«
»Wie soll ich Ihnen darauf antworten?« erwiderte der Fürst in kühlem, gelangweiltem Ton. »Sie wollen wissen, wie man die Sachlage auffaßt? Man ist der Ansicht, daß Bonaparte seine Schiffe hinter sich verbrannt hat, und es hat den Anschein, daß wir uns anschicken, mit den unsrigen das gleiche zu tun.«
Fürst Wasili sprach immer in trägem, lässigem Ton, etwa wie ein Schauspieler eine schon oft von ihm gespielte Rolle spricht. Dagegen sprühte Anna Pawlowna Scherer trotz ihrer vierzig Jahre von Lebhaftigkeit und Leidenschaftlichkeit.
Die Rolle der Enthusiastin war ein wesentliches Stück ihrer gesellschaftlichen Stellung geworden, und manchmal gab sie sich, auch wenn ihr eigentlich nicht danach zumute war, dennoch als Enthusiastin, nur um die Erwartung der Leute, die sie kannten, nicht zu täuschen. Das leise Lächeln, das beständig auf Anna Pawlownas Gesicht spielte, obwohl es eigentlich zu ihren verlebten Zügen nicht paßte, dieses Lächeln besagte, ähnlich wie bei verzogenen Kindern, daß sie sich ihrer liebenswürdigen Schwäche dauernd bewußt sei, aber nicht beabsichtige, nicht imstande sei und nicht für nötig halte, sich von ihr freizumachen.
Als das Gespräch über die politische Lage einige Zeit gedauert hatte, wurde Anna Pawlowna hitzig.
»Ach, reden Sie mir nicht von Österreich! Mag sein, daß ich nichts davon verstehe, aber Österreich hat den Krieg nie gewollt und will ihn auch jetzt nicht. Österreich verrät uns. Rußland muß allein der Retter Europas werden. Unser Wohltäter auf dem Thron kennt seinen hohen Beruf und wird diesem Beruf treu bleiben. Das ist das einzige, worauf ich mich verlasse. Unserm guten, herrlichen Kaiser ist die größte Aufgabe in der Welt zugefallen, und er ist so reich an trefflichen Eigenschaften und Tugenden, daß Gott ihn nicht verlassen wird. Unser Kaiser wird seinen hohen Beruf erfüllen, die Hydra der Revolution zu erwürgen, die jetzt in der Gestalt dieses Mörders und Bösewichts noch entsetzlicher erscheint als vorher. Wir allein müssen das Blut des Gerechten sühnen. Auf wen könnten wir denn auch rechnen, frage ich Sie? England mit seinem Krämergeist hat kein Verständnis für die ganze Seelengröße Kaiser Alexanders, und kann ein solches Verständnis nicht haben. Es hat sich geweigert, Malta zu räumen. Es will erst noch sehen und findet in allem, was wir tun, einen Hintergedanken. Was haben die Engländer auf Nowosilzews Anfrage geantwortet? Nichts. Sie haben kein Verständnis gehabt, können kein Verständnis haben für die Selbstverleugnung unseres Kaisers, der nichts für sich selbst will und in allem nur auf das Wohl der ganzen Welt bedacht ist. Und was haben sie versprochen? Nichts. Und was sie versprochen haben, selbst das werden sie nicht zur Ausführung bringen! Preußen hat bereits erklärt, Bonaparte sei unüberwindlich und ganz Europa vermöge nichts gegen ihn. Und ich glaube diesen beiden, Hardenberg und Haugwitz, kein Wort, das sie sagen. Diese vielgerühmte Neutralität Preußens ist weiter nichts als eine Falle. Ich glaube nur an Gott und an die hohe Bestimmung unseres geliebten Kaisers. Er wird Europa retten!« Sie hielt plötzlich inne mit einem spöttischen Lächeln über die Hitze, in die sie hineingeraten war.
»Ich glaube«, erwiderte der Fürst gleichfalls lächelnd, »hätte man Sie an Stelle unseres lieben Wintzingerode hingeschickt, Sie hätten die Zustimmung des Königs von Preußen im Sturm errungen. Sie besitzen eine erstaunliche Beredsamkeit. Darf ich Sie um eine Tasse Tee bitten?«
»Sogleich. Apropos«, fügte sie, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte, hinzu, »es werden heute zwei sehr interessante Persönlichkeiten bei mir sein: der Vicomte Mortemart (er ist durch die Rohans mit den Montmorencys verwandt; die Mortemarts sind eine der besten Familien Frankreichs; das ist einer der wirklich achtungswerten Emigranten, einer von der echten Art) und dann der Abbé Morio. Kennen Sie diesen tiefen Geist? Er ist vom Kaiser empfangen worden; Sie wissen wohl?«
»Ah! das wird mich außerordentlich freuen«, antwortete der Fürst. »Sagen Sie«, fügte er, als ob ihm soeben etwas einfiele, in besonders lässigem Ton hinzu, obgleich das, wonach er fragen wollte, der Hauptzweck seines Besuches war, »ist es richtig, daß die Kaiserinmutter die Ernennung des Baron Funke zum ersten Sekretär in Wien wünscht? Dieser Baron ist doch allem Anschein nach ein wertloses Subjekt.« Fürst Wasili hegte den Wunsch, daß sein eigener Sohn diese Stelle erhalten möge, welche andere Leute auf dem Weg über die Kaiserinmutter Maria Feodorowna dem Baron zu verschaffen suchten.
Anna Pawlowna schloß die Augen beinahe vollständig, um zu verstehen zu geben, daß weder sie noch sonst jemand sich ein Urteil über das erlauben dürfe, was der Kaiserinmutter beliebe oder genehm sei.
»Baron Funke ist der Kaiserinmutter durch ihre Schwester empfohlen worden«, begnügte sie sich in melancholischem, trockenem Ton zu erwidern. In dem Augenblick, wo Anna Pawlowna von der Kaiserinmutter sprach, nahm ihr Gesicht auf einmal den Ausdruck einer tiefen, innigen Ergebenheit und Verehrung, gepaart mit einer Art von Traurigkeit, an, ein Ausdruck, der bei ihr jedesmal zum Vorschein kam, wenn sie im Gespräch ihrer hohen Gönnerin Erwähnung tat. Sie äußerte dann noch, Ihre Majestät habe geruht, dem Baron Funke großes Wohlwollen zu bezeigen, und wieder zog dabei ein Schatten wie von Traurigkeit über ihren Blick.
Der Fürst machte ein Gesicht, als ob ihm die Sache gleichgültig sei, und schwieg. Anna Pawlowna hatte mit der ihr eigenen höfischen und weiblichen Gewandtheit und schnellen Erkenntnis dessen, was taktgemäß war, dem Fürsten etwas dafür auswischen wollen, daß er sich erdreistet hatte, über eine von der Kaiserinmutter protegierte Persönlichkeit so abfällig zu urteilen; nun aber wollte sie ihn doch auch wieder trösten.
»Um auf Ihre Familie zu kommen«, sagte sie, »wissen Sie wohl, daß Ihre Tochter, seit sie Gesellschaften besucht, das Entzücken der gesamten höheren Kreise bildet? Man findet sie schön wie den Tag.«
Der Fürst verneigte sich zum Zeichen der Verehrung und Dankbarkeit.
»Ich denke oft«, fuhr Anna Pawlowna nach einem kurzen Stillschweigen fort (sie rückte dabei dem Fürsten näher und lächelte ihm freundlich zu, als wollte sie damit andeuten, daß die Unterhaltung über Politik und Angelegenheiten der Gesellschaft nun beendigt sei und jetzt ein vertraulicheres Gespräch beginne), »ich denke oft, wie ungerecht manchmal das Glück im Leben verteilt ist. Warum hat Ihnen nur das Schicksal zwei so prächtige Kinder gegeben (Anatol, Ihren jüngeren Sohn, schließe ich dabei aus; ich mag ihn nicht«, schaltete sie in einem Ton ein, als dulde sie keinen Widerspruch, und zog dabei die Augenbrauen in die Höhe), »so entzückende Kinder? Wahrhaftig, Sie wissen deren Wert weniger zu schätzen als alle anderen Leute, und daher verdienen Sie nicht, solche Kinder zu haben.«
Ihr Gesicht war wieder von dem ihr eigenen enthusiastischen Lächeln verklärt.
»Was ist da zu machen? Lavater würde sagen, daß mir der Kopfhöcker der elterlichen Liebe fehlt«, erwiderte der Fürst.
»Scherzen Sie nicht darüber. Ich wollte ernsthaft mit Ihnen reden. Wissen Sie, ich bin mit Ihrem jüngeren Sohn nicht zufrieden. Unter uns gesagt« (hier nahm ihr Gesicht wieder einen trüben Ausdruck an), »es wurde bei Ihrer Majestät von ihm gesprochen, und Sie wurden bedauert.«
Der Fürst antwortete nicht; sie aber blickte ihn schweigend und bedeutsam an und wartete auf eine Antwort. Der Fürst runzelte die Stirn.
»Was soll ich denn dabei machen?« sagte er endlich. »Sie wissen, ich habe für die Erziehung meiner Söhne alles getan, was ein Vater nur tun kann, und doch haben Sie sich beide übel entwickelt. Ippolit ist wenigstens nur ein ruhiger Narr, aber Anatol ein unruhiger. Das ist der einzige Unterschied«, sagte er und lächelte dabei gekünstelter und lebhafter als gewöhnlich, wobei mit besonderer Schärfe in den um seinen Mund liegenden Falten ein überraschend roher, unangenehmer Zug hervortrat.
»Warum werden solchen Männern, wie Sie, Kinder geboren? Wenn Sie nicht Vater wären, hätte ich gar nichts an Ihnen zu tadeln«, sagte Anna Pawlowna, nachdenklich aufblickend.
»Ich bin Ihr treuer Sklave, und Ihnen allein kann ich es gestehen: meine Kinder sind die Fesseln meines Daseins. Das ist eben mein Kreuz. So fasse ich es auf. Was soll ich da tun?« Er schwieg und drückte durch eine Gebärde seine Ergebung in dieses grausame Schicksal aus. Anna Pawlowna überlegte.
»Haben Sie nie daran gedacht, Ihrem Anatol, diesem verlorenen Sohn, eine Frau zu geben?« sagte sie dann. »Es heißt immer, alte Jungfern hätten eine Manie für das Ehestiften. Ich verspüre diese Schwäche noch nicht an mir; aber ich habe da ein junges Mädchen, das sich bei ihrem Vater sehr unglücklich fühlt, eine Verwandte von uns, eine Tochter des Fürsten Bolkonski.«
Fürst Wasili antwortete nicht, gab jedoch mit jener schnellen Auffassungsgabe, wie sie Leuten von Welt eigen ist, durch eine Kopfbewegung zu verstehen, daß er diese Mitteilungen zum Gegenstand seines Nachdenkens mache.
»Wissen Sie wohl, daß mich dieser Anatol jährlich vierzigtausend Rubel kostet?« sagte er dann, anscheinend nicht imstande, von seinem trüben Gedankengang loszukommen. Dann schwieg er wieder eine Weile.
»Was soll daraus werden, wenn es noch fünf Jahre so weitergeht? Das ist der Segen davon, wenn man Vater ist. Ist sie reich, Ihre junge Prinzessin?«
»Der Vater ist sehr reich und geizig. Er lebt auf dem Land. Wissen Sie, es ist der bekannte Fürst Bolkonski, der noch unter dem hochseligen Kaiser den Abschied erhielt; er hatte den Spitznamen ›der König von Preußen‹. Er ist ein sehr kluger Mensch, hat aber seine Sonderbarkeiten und ist schwer zu behandeln. Das arme Kind ist kreuzunglücklich. Sie hat noch einen Bruder, der bei Kutusow Adjutant ist; er hat vor einiger Zeit Lisa Meynen geheiratet. Er wird heute bei mir sein.«
»Hören Sie, liebe Annette«, sagte der Fürst, indem er plötzlich die Hand der Hofdame ergriff und in etwas wunderlicher Weise nach unten zog. »Arrangieren Sie mir diese Sache, und ich werde für alle Zeit Ihr treuester Sklave sein (›Sklafe‹, wie mein Dorfschulze immer in seinen Berichten an mich schreibt, mit einem f). Sie ist von guter Familie und reich. Das ist alles, was ich brauche.«
Und mit jenen ungezwungenen, familiären, graziösen Bewegungen, die ihn auszeichneten, ergriff er die Hand des Fräuleins, küßte sie und schwenkte dann diese Hand hin und her, während er sich in den Sessel zurücksinken ließ und zur Seite blickte.
»Warten Sie einmal«, sagte Anna Pawlowna überlegend. »Ja, ich will gleich heute mit Lisa, der Frau des jungen Bolkonski, reden. Vielleicht läßt sich die Sache arrangieren. Ich werde bei Ihrer Familie anfangen, das übliche Gewerbe der alten Jungfern zu erlernen.«
Kapitel II
Anna Pawlownas Salon begann sich allmählich zu füllen. Die höchste Noblesse Petersburgs fand sich ein, Menschen, die an Lebensalter und Charakter höchst verschieden waren, aber doch etwas Gleichartiges hatten durch die gesellschaftliche Sphäre, in der sie alle lebten. Da kam die Tochter des Fürsten Wasili, die schöne Helene, die ihren Vater abholen wollte, um mit ihm zusammen zu der Fete des Gesandten zu fahren; sie war in Balltoilette und trug als Abiturientin des Fräuleinstiftes eine Brosche mit dem Namenszug der Kaiserin. Dann kam die als »die reizendste Frau Petersburgs« bekannte, junge, kleine Fürstin Bolkonskaja, die sich im letzten Winter verheiratet hatte und, weil sie sich in anderen Umständen befand, größere Festlichkeiten nicht mehr besuchte, während sie an kleinen Abendgesellschaften noch teilnahm. Es erschien Fürst Ippolit, der Sohn des Fürsten Wasili, zusammen mit dem Vicomte Mortemart, den er vorstellte; auch der Abbé Morio fand sich ein, und viele andere.
»Haben Sie meine liebe Tante noch nicht gesehen, oder sind Sie vielleicht noch gar nicht mit ihr bekannt?« fragte Anna Pawlowna die eintreffenden Gäste und führte sie sehr feierlich zu einer kleinen alten Dame mit einem Kopfputz von hochragenden Bandschleifen, welche, sobald die Gäste begonnen hatten sich einzufinden, aus dem anstoßenden Zimmer zum Vorschein gekommen war. Anna Pawlowna nannte die Namen der einzelnen Gäste, indem sie langsam ihre Augen von dem betreffenden Gast zu der Tante hinüberwandern ließ, und trat darauf ein wenig zurück. Alle Gäste machten die Begrüßungszeremonie mit dieser lieben Tante durch, die niemandem bekannt war, niemanden interessierte und mit niemandem irgendwelche Beziehungen hatte. Anna Pawlowna beaufsichtigte mit wehmütig feierlicher Teilnahme diese Begrüßungen, wobei sie ein beifälliges Stillschweigen beobachtete. Die Tante sprach mit jedem Gast in denselben Ausdrücken von seinem Befinden, von ihrem eigenen Befinden und von dem Befinden Ihrer Majestät, welches heute, Gott sei Dank, besser sei. Alle Gäste, die die Tante begrüßt hatten, traten dann mit einem Gefühl der Erleichterung, wie nach Erfüllung einer schweren Pflicht, höflichkeitshalber jedoch, ohne irgendwelche Eile merken zu lassen, von der alten Dame wieder fort, um nunmehr den ganzen Abend über auch nicht ein einziges Mal mehr zu ihr heranzukommen.
Die junge Fürstin Bolkonskaja hatte sich in einem samtenen, goldgestickten Beutelchen eine Handarbeit mitgebracht. Ihre hübsche Oberlippe mit dem leisen Schatten eines schwärzlichen Schnurrbärtchens war etwas zu kurz für die Zähne; aber um so reizender sah es aus, wenn sie sich öffnete, und noch mehr, wenn sie sich manchmal ausstreckte und zur Unterlippe hinabsenkte. Wie das immer bei hervorragend reizenden Frauen der Fall ist, erschien ihr Mangel, die Kürze der Lippe und der halbgeöffnete Mund, als eine besondere, nur ihr eigene Schönheit. Es war für alle ein herzliches Vergnügen, diese hübsche, von Gesundheit und Lebenslust erfüllte Frau anzusehen, die bald Mutter werden sollte und ihren Zustand so leicht ertrug. Die alten Herren und die blasierten, finsterblickenden jungen Leute hatten die Empfindung, als würden sie selbst ihr ähnlich, wenn sie ein Weilchen in ihrer Nähe geweilt und sich mit ihr unterhalten hatten. Wer mit ihr sprach und bei jedem Wort, das er sagte, ihr strahlendes Lächeln und die glänzend weißen Zähne sah, die fortwährend sichtbar wurden, der konnte glauben, daß er heute ganz besonders liebenswürdig sei. Und das glaubte auch ein jeder.
Die kleine Fürstin ging in schaukelndem Gang, mit kleinen, schnellen Schritten, den Arbeitsbeutel in der Hand, um den Tisch herum, setzte sich auf das Sofa, nicht weit von dem silbernen Samowar, und legte vergnügt ihr Kleid in Ordnung, als ob alles, was sie nur tun mochte, eine Erheiterung für sie selbst und für ihre gesamte Umgebung sei.
»Ich habe mir eine Handarbeit mitgebracht«, sagte sie, sich an alle zugleich wendend, während sie ihren Ridikül auseinanderzog.
»Aber hören Sie mal, Annette«, wandte sie sich an die Wirtin, »solche häßlichen Streiche dürfen Sie mir nicht spielen. Sie haben mir geschrieben, es wäre bei Ihnen nur eine ganz kleine Abendgesellschaft. Und nun sehen Sie, in was für einem Aufzug ich hergekommen bin.«
Sie breitete die Arme auseinander, um ihr elegantes graues, mit Spitzen besetztes Kleid zu zeigen, um welches sich ein wenig unterhalb der Brust an Stelle eines Gürtels ein breites Band schlang.
»Seien Sie unbesorgt, Lisa, Sie sind doch immer die Netteste von allen«, antwortete Anna Pawlowna.
»Sie wissen, daß mein Mann mich verlassen wird«, fuhr sie, zu einem General gewendet, in demselben Ton fort. »Er will sich totschießen lassen. Sagen Sie mir, wozu nur dieser abscheuliche Krieg?« sagte sie zu dem Fürsten Wasili und wandte sich dann, ohne dessen Antwort abzuwarten, zu seiner Tochter, der schönen Helene.
»Was ist diese kleine Fürstin für ein allerliebstes Wesen!« sagte Fürst Wasili leise zu Anna Pawlowna.
Bald nach der kleinen Fürstin trat ein plumpgebauter, dicker junger Mann ein, mit kurzgeschorenem Kopf, einer Brille, hellen Beinkleidern nach der damaligen Mode, hohem Jabot und braunem Frack. Er war ein unehelicher Sohn des Grafen Besuchow, der einst unter der Kaiserin Katharina einer der höchsten Würdenträger gewesen war und jetzt in Moskau im Sterben lag. Dieser dicke junge Mann war noch nie im Staatsdienst tätig gewesen, war soeben erst aus dem Ausland, wo er erzogen worden war, zurückgekehrt und befand sich heute zum erstenmal in Gesellschaft. Anna Pawlowna begrüßte ihn mit derjenigen Art von Verbeugung, mit welcher die auf der hierarchischen Stufenleiter am niedrigsten stehenden Besucher ihres Salons sich zu begnügen hatten. Aber trotz dieses niedrigsten Grades von Begrüßung prägte sich beim Anblick des eintretenden Pierre auf Anna Pawlownas Gesicht eine Unruhe und Furcht aus, wie man sie etwa beim Anblick eines übergroßen Gegenstandes empfindet, der nicht an seinem richtigen Platz ist. Obwohl aber Pierre tatsächlich etwas größer war als die andern im Zimmer befindlichen Männer, so konnte doch diese Furcht nur durch den klugen und zugleich schüchternen, beobachtenden und ungekünstelten Blick seiner Augen veranlaßt sein, durch den er sich von allen anderen in diesem Salon Anwesenden unterschied.
»Sehr liebenswürdig von Ihnen, Monsieur Pierre, daß Sie eine arme Patientin besuchen«, sagte Anna Pawlowna zu ihm, indem sie mit der Tante, zu der sie ihn hinführte, einen ängstlichen Blick wechselte. Pierre murmelte etwas Unverständliches und fuhr fort, etwas mit den Augen zu suchen. Mit frohem, vergnügtem Lächeln verbeugte er sich vor der kleinen Fürstin wie vor einer guten Bekannten und trat dann zu der Tante hin. Anna Pawlownas Furcht erwies sich als nicht unbegründet, da Pierre, ohne die Äußerungen der Tante über das Befinden Ihrer Majestät zu Ende zu hören, von ihr wieder zurücktrat. Erschrocken hielt ihn Anna Pawlowna mit den Worten auf: »Sie kennen den Abbé Morio wohl noch nicht? Er ist ein sehr interessanter Mann ...«
»Ja, ich habe von seinem Plan gehört, einen ewigen Frieden herzustellen, und das ist ja auch sehr interessant, aber allerdings schwerlich ausführbar.«
»Meinen Sie?« erwiderte Anna Pawlowna, um nur überhaupt etwas zu sagen und sich dann wieder ihren Aufgaben als Wirtin zuzuwenden; aber Pierre beging nun die andere Unhöflichkeit. Vorher war er von einer Dame weggegangen, ohne das, was sie zu ihm sagte, bis zu Ende anzuhören, und jetzt hielt er eine Dame, die von ihm fortgehen wollte, durch sein Gespräch zurück. Den Kopf herabbiegend, die dicken Beine breit auseinanderstellend, begann er der Hofdame zu beweisen, warum er den Plan des Abbé für eine Schimäre halte.
»Wir wollen das nachher weiter besprechen«, sagte Anna Pawlowna lächelnd.
Damit verließ sie den jungen Mann, der so gar keine Lebensart hatte, und nahm ihre Tätigkeit als Wirtin wieder auf. Sie hörte aufmerksam zu und ließ ihre Augen überall umherschweifen, bereit, an demjenigen Punkt Hilfe zu bringen, wo etwa das Gespräch ermattete. Wie der Herr einer Spinnerei, nachdem er den Arbeitern ihre Pläne angewiesen hat, in seiner ganzen Fabrik umhergeht, und, sobald er merkt, daß eine Spindel stillsteht oder einen ungewöhnlichen, kreischenden, überlauten Ton von sich gibt, eilig hinzutritt und sie anhält oder in richtigen Gang bringt: so wanderte auch Anna Pawlowna in ihrem Salon hin und her, trat hinzu, wo eine Gruppe schwieg oder zu laut redete, und stellte durch ein Wort, das sie hinzugab, oder durch eine Veränderung der Plätze wieder einen gleichmäßigen, anständigen Gang der Gespräche her. Aber mitten in dieser geschäftigen Tätigkeit konnte man ihr immer eine besondere Befürchtung in betreff Pierres anmerken. Besorgt beobachtete sie ihn, als er herantrat, um zu hören, was in der um Mortemart herumstehenden Gruppe geredet wurde, und dann zu einer anderen Gruppe hinging, wo der Abbé das Wort führte. Für Pierre, der im Ausland erzogen worden war, war diese Soiree bei Anna Pawlowna die erste, die er in Rußland mitmachte. Er wußte, daß hier die Vertreter der Intelligenz von ganz Petersburg versammelt waren, und seine Augen liefen, wie die Augen eines Kindes im Spielzeugladen, bald hierhin, bald dorthin. Immer fürchtete er, es möchte ihm irgendein kluges Gespräch entgehen, das er mitanhören könne. Wenn er die selbstbewußten, vornehmen Gesichter der hier Versammelten betrachtete, erwartete er immer etwas besonders Kluges zu hören. Endlich trat er zu Morio. Das Gespräch interessierte ihn, er blieb stehen und wartete auf eine Gelegenheit, seine eigenen Gedanken auszusprechen, wie das junge Leute so gern tun.
Kapitel III
Die Unterhaltung auf Anna Pawlownas Soiree war in vollem Gang. Die Spindeln schnurrten auf allen Seiten gleichmäßig und unausgesetzt. Abgesehen von der Tante, neben welcher nur eine bejahrte Dame mit vergrämtem, magerem Gesicht saß, die sich in dieser glänzenden Gesellschaft etwas sonderbar ausnahm, hatte sich die ganze Gesellschaft in drei Gruppen geteilt. In der einen, welche vorwiegend aus Herren bestand, bildete der Abbé den Mittelpunkt; in der zweiten, wo namentlich die Jugend vertreten war, dominierten die schöne Prinzessin Helene, die Tochter des Fürsten Wasili, und die hübsche, rotwangige, aber für ihr jugendliches Alter etwas zu volle, kleine Fürstin Bolkonskaja. In der dritten Gruppe waren Mortemart und Anna Pawlowna das belebende Element.
Der Vicomte war ein nett aussehender junger Mann mit weichen Gesichtszügen und angenehmen Umgangsformen, der sich offenbar für etwas Bedeutendes hielt, aber infolge seiner Wohlerzogenheit der Gesellschaft, in der er sich befand, bescheiden anheimstellte, seine Persönlichkeit zu genießen, soweit es ihr beliebe. Anna Pawlowna betrachtete ihn augenscheinlich als eine Art von Extragericht, das sie ihren Gästen anbot. Wie ein geschickter Maître d’hôtel dasselbe Stück Rindfleisch, das niemand essen möchte, der es in der schmutzigen Küche sähe, als etwas ganz außergewöhnlich Schönes präsentiert, so servierte bei der heutigen Abendgesellschaft Anna Pawlowna ihren Gästen zuerst den Vicomte und dann den Abbé als etwas ganz besonders Feines. In der Gruppe um Mortemart drehte sich das Gespräch sogleich um die Ermordung des Herzogs von Enghien. Der Vicomte bemerkte, der Herzog von Enghien habe seinen Tod seiner eigenen Großmut zu verdanken und der Ingrimm Bonapartes gegen ihn habe seine besonderen Gründe gehabt.
»Ach, bitte, erzählen Sie uns dieses, Vicomte!« sagte Anna Pawlowna erfreut; sie hatte dabei das Gefühl, daß der Ausdruck: »Erzählen Sie uns dieses, Vicomte!« wie eine Reminiszenz an Ludwig XV. klang.
Der Vicomte verbeugte sich zum Zeichen des Gehorsams und lächelte höflich. Anna Pawlowna wirkte darauf hin, daß sich ein Kreis um den Vicomte bildete, und forderte alle auf, seine Erzählung anzuhören.
»Der Vicomte ist mit dem Herzog persönlich bekannt gewesen«, flüsterte Anna Pawlowna dem einen zu. »Der Vicomte besitzt ein bewundernswürdiges Talent zum Erzählen«, sagte sie zu einem andern. »Wie man doch sofort einen Mann aus der guten Gesellschaft erkennt!« äußerte sie zu einem Dritten, und so wurde der Vicomte in der besten und für ihn vorteilhaftesten Beleuchtung der Gesellschaft präsentiert wie ein mit allerlei Gemüse garniertes Roastbeef auf einer heißen Schüssel.
Der Vicomte wollte nun seine Erzählung beginnen und lächelte fein.
»Kommen Sie doch hierher zu uns, liebe Helene«, sagte Anna Pawlowna zu der schönen Prinzessin, welche etwas entfernt saß und den Mittelpunkt einer anderen Gruppe bildete.
Die Prinzessin Helene lächelte; sie erhob sich mit ebendemselben unveränderlichen Lächeln des vollkommen schönen Weibes, mit welchem sie in den Salon eingetreten war. Mit ihrem weißen Ballkleid, das mit Efeu und Moos garniert war, leise raschelnd und von dem weißen Schimmer ihrer Schultern und dem Glanz ihres Haares und ihrer Brillanten umleuchtet, ging sie zwischen den auseinandertretenden Herren hindurch. Sie blickte dabei keinen einzelnen an, lächelte aber allen zu und schien in liebenswürdiger Weise einem jeden das Recht zuzuerkennen, die Schönheit ihrer Gestalt, der vollen Schultern, des nach damaliger Mode sehr tief entblößten Busens und Rückens zu bewundern; es war, als ob sie in ihrer Person den vollen Glanz eines Balles in diesen Salon hineingetragen hätte. So schritt sie geradewegs zu Anna Pawlowna hin. Helene war so schön, daß an ihr auch nicht die leiseste Spur von Koketterie wahrzunehmen war; ja im Gegenteil, sie schien sich vielmehr gewissermaßen ihrer unbestreitbaren und allzu stark und siegreich wirkenden Schönheit zu schämen. Es war, als ob sie den Eindruck ihrer Schönheit abzuschwächen wünschte, es aber nicht vermöchte.
»Welch ein schönes Weib!« sagte jeder, der sie sah. Gleichsam überrascht von etwas Ungewöhnlichem, zuckte der Vicomte zusammen und schlug die Augen nieder, als sie sich ihm gegenüber niederließ und auch ihn mit ebendemselben unveränderlichen Lächeln anstrahlte.
»Ich fürchte wirklich, daß einer solchen Zuhörerschaft gegenüber mich meine Fähigkeit im Stich läßt«, sagte er und neigte lächelnd den Kopf.
Die Prinzessin legte ihren entblößten vollen Arm auf ein Tischchen und fand es nicht nötig, etwas zu erwidern. Sie wartete lächelnd. Während der ganzen Erzählung saß sie aufrecht da und blickte ab und zu bald auf ihren vollen, runden Arm, der von dem Druck auf den Tisch seine Form veränderte, bald auf den noch schöneren Busen, an dem sie den Brillantschmuck zurechtschob; einige Male ordnete sie die Falten ihres Kleides, und sooft die Erzählung eindrucksvoll wurde, schaute sie zu Anna Pawlowna hinüber und nahm sofort denselben Ausdruck an, den das Gesicht des Hoffräuleins aufwies, um gleich darauf wieder zu ihrem ruhigen, strahlenden Lächeln überzugehen. Nach Helene kam auch die kleine Fürstin vom Teetisch herüber.
»Warten Sie noch einen Augenblick, ich möchte meine Handarbeit vornehmen«, sagte sie. »Nun? Wo haben Sie denn Ihre Gedanken?« wandte sie sich an den Fürsten Ippolit. »Bringen Sie mir meinen Ridikül.«
So führte die Fürstin, lächelnd und zu allen redend, auf einmal einen Aufenthalt herbei und ordnete, als sie nun zum Sitzen gekommen war, vergnügt ihren Anzug.
»Jetzt habe ich alles nach Wunsch«, sagte sie, bat, mit der Erzählung zu beginnen, und griff nach ihrer Arbeit. Fürst Ippolit hatte ihr ihren Ridikül geholt, war hinter sie getreten, hatte sich einen Sessel dicht neben sie gerückt und sich zu ihr gesetzt.
Der »charmante« Ippolit überraschte einen jeden durch die auffällige Ähnlichkeit mit seiner schönen Schwester und noch mehr dadurch, daß er trotz dieser Ähnlichkeit in hohem Grad häßlich war. Die Gesichtszüge waren bei ihm die gleichen wie bei seiner Schwester; aber bei dieser glänzte das ganze Gesicht von einem lebensfrohen, glücklichen, jugendlichen, unveränderlichen Lächeln, und die außerordentliche, wahrhaft antike Schönheit des Körpers steigerte diese Wirkung noch; bei dem Bruder dagegen war dasselbe Gesicht von einem trüben Stumpfsinn wie von einem Nebel umschleiert und zeigte unveränderlich einen Ausdruck selbstgefälliger Verdrossenheit, dazu kam ein dürftiger, schwächlicher Körper. Augen, Nase und Mund, alles war gleichsam zu einer einzigen verschwommenen, mürrischen Grimasse zusammengedrückt, und seine Hände und Füße nahmen stets eine absonderliche Haltung ein.
»Es wird doch keine Gespenstergeschichte sein?« sagte er, während er sich neben die Fürstin setzte und eilig seine Lorgnette vor die Augen hielt, als ob er ohne dieses Instrument nicht reden könnte.
»Ganz und gar nicht«, erwiderte erstaunt der Erzähler mit einem Achselzucken.
»Ich frage nämlich deswegen, weil ich Gespenstergeschichten nicht leiden mag«, sagte Fürst Ippolit in einem Ton, aus dem man merken konnte, daß er erst nachträglich, nachdem er jene Worte gesprochen hatte, sich über ihren Sinn klargeworden war.
Aber infolge der Selbstgefälligkeit, mit welcher er sprach, kam es niemandem recht zum Bewußtsein, ob das, was er gesagt hatte, etwas sehr Kluges oder etwas sehr Dummes war. Er trug einen dunkelgrünen Frack, Beinkleider, deren Farbe er selbst als »Lende einer erschreckten Nymphe« bezeichnete, sowie Strümpfe und Schnallenschuhe.
Der Vicomte erzählte in allerliebster Weise eine damals kursierende Anekdote: Der Herzog von Enghien sei heimlich nach Paris gereist, um dort ein Rendezvous mit der Schauspielerin Georges zu haben, und sei dort mit Bonaparte zusammengetroffen, der sich gleichfalls der Gunst der berühmten Schauspielerin erfreut habe. Bei dieser Begegnung mit dem Herzog habe Napoleon einen Ohnmachtsanfall gehabt, ein bei ihm nicht selten auftretendes Leiden, und sich auf diese Art in der Gewalt des Herzogs befunden. Der Herzog habe diesen günstigen Umstand nicht benutzt; Bonaparte aber habe sich später für diese Großmut durch die Ermordung des Herzogs gerächt.
Die Erzählung war sehr hübsch und interessant; besonders bei der Stelle, wo die beiden Rivalen einander plötzlich erkannten, schienen auch die Damen in Aufregung zu sein.
»Reizend!« sagte Anna Pawlowna und blickte dabei die kleine Fürstin fragend an.
»Reizend!« flüsterte die kleine Fürstin und steckte ihre Nadel in ihre Handarbeit hinein, wie um damit anzudeuten, daß ihr lebhaftes Interesse für die reizende Erzählung sie daran hindere weiterzuarbeiten.
Der Vicomte wußte dieses stillschweigende Lob zu schätzen, lächelte dankbar und sprach dann weiter. Aber in diesem Augenblick bemerkte Anna Pawlowna, die die ganze Zeit über ab und zu einen Blick nach dem ihr so unangenehmen jungen Menschen hingeworfen hatte, daß er zu laut und hitzig mit dem Abbé sprach, und eilte, um Hilfe zu bringen, nach dem gefährdeten Punkt. Pierre hatte es wirklich zustande gebracht, mit dem Abbé ein Gespräch über das politische Gleichgewicht anzuknüpfen, und der Abbé, dessen Interesse der junge Mann durch seinen treuherzigen Eifer erregt zu haben schien, entwickelte ihm seine Lieblingsidee. Beide benahmen sich beim Reden und Hören gar zu lebhaft und ungezwungen, und eben dies hatte nicht Anna Pawlownas Beifall.
»Das Mittel dazu ist das europäische Gleichgewicht und das Völkerrecht«, sagte der Abbé. »Es braucht nur ein mächtiges Reich, zum Beispiel das als barbarisch verschriene Rußland, in uneigennütziger Weise an die Spitze eines Staatenbundes zu treten, der sich das Gleichgewicht Europas zum Ziel gesetzt hat, und dieses Reich wird der Retter der Welt sein.«
»Aber wie wollen Sie denn ein solches Gleichgewicht zustande bringen?« begann Pierre; jedoch in diesem Augenblick trat Anna Pawlowna heran, und mit einem strengen Blick auf Pierre fragte sie den Italiener, wie ihm das hiesige Klima bekomme. Das Gesicht des Italieners veränderte sich mit einem Schlag und nahm den geradezu beleidigend heuchlerischen, süßlichen Ausdruck an, der ihm anscheinend im Gespräch mit Frauen zur Gewohnheit geworden war.
»Ich bin von dem glänzenden Verstand und der hohen Bildung der Gesellschaft, in die ich das Glück gehabt habe, aufgenommen zu werden, namentlich auch der weiblichen Gesellschaft, dermaßen bezaubert, daß ich noch keine Zeit gehabt habe, an das Klima zu denken«, erwiderte er. Anna Pawlowna ließ jedoch den Abbé und Pierre nicht mehr los, sondern nahm sie zwecks bequemerer Beaufsichtigung mit in den allgemeinen Kreis.
Kapitel IV
In diesem Augenblick trat eine neue Person in den Salon. Diese neue Person war der junge Fürst Andrei Bolkonski, der Gatte der kleinen Fürstin. Fürst Bolkonski war ein sehr hübscher junger Mann, von kleiner Statur, mit kantigem magerem Gesicht. Alles an seiner Figur, von dem müden, gelangweilten Blick bis zu dem ruhigen, gemessenen Gang, bildete den entschiedensten Gegensatz zu seiner kleinen, lebhaften Frau. Er schien alle im Salon Anwesenden nicht nur zu kennen, sondern ihrer auch so überdrüssig zu sein, daß es ihm höchst widerwärtig war, sie auch nur zu sehen und reden zu hören. Unter allen Gesichtern aber, die ihn so langweilten, war ihm das Gesicht seiner hübschen Frau anscheinend am meisten zuwider. Mit einer Grimasse, die sein hübsches Gesicht entstellte, wandte er sich von ihr ab. Er küßte der Wirtin die Hand und musterte mit halb zugekniffenen Augen die ganze Gesellschaft.
»Sie machen sich fertig, um in den Krieg zu ziehen, Fürst?« fragte Anna Pawlowna.
»General Kutusow hat mich zu seinem Adjutanten bestimmt«, antwortete Bolkonski; er legte, als ob er Franzose wäre, den Ton auf die letzte Silbe »sow«.
»Und Lisa, Ihre Frau?«
»Sie geht aufs Land.«
»Aber machen Sie sich denn gar kein Gewissen daraus, uns Ihrer reizenden Gattin zu berauben?«
»Andrei«, sagte seine Frau, indem sie zu ihrem Mann in demselben koketten Ton sprach, dessen sie sich auch Fremden gegenüber bediente, »was für eine reizende Geschichte uns da eben der Vicomte von Mademoiselle Georges und Bonaparte erzählt hat!«
Fürst Andrei drückte die Augen zu und wandte sich ab. Pierre, der, seit Fürst Andrei in den Salon getreten war, ihn unverwandt mit frohen, freundlichen Blicken angesehen hatte, trat zu ihm heran und ergriff ihn an der Hand. Fürst Andrei verzog, ohne sich umzusehen, sein Gesicht zu einer Grimasse, welche seinen Ärger darüber zum Ausdruck brachte, daß da jemand seine Hand berührte; aber sobald er Pierres lächelndes Gesicht erblickte, breitete sich über sein eigenes Gesicht ein gutmütiges, freundliches Lächeln, wie man es ihm gar nicht zugetraut hätte.
»Nun sieh mal an! Auch du in der vornehmen Welt?« sagte er zu Pierre.
»Ich wußte, daß Sie hier sein würden«, antwortete Pierre. »Ich werde zum Abendessen zu Ihnen kommen«, fügte er leise hinzu, um den Vicomte nicht zu stören, der in seinen Erzählungen fortfuhr. »Ist es gestattet?«
»Nein, es ist nicht gestattet«, antwortete Fürst An drei lachend und gab jenem durch einen Händedruck zu verstehen, daß er danach doch nicht erst zu fragen brauche. Er wollte noch etwas sagen; aber in diesem Augenblick erhob sich Fürst Wasili nebst seiner Tochter, und die Herren standen auf, um ihnen Platz zu machen.
»Entschuldigen Sie mich, mein lieber Vicomte«, sagte Fürst Wasili zu dem Franzosen, den er gleichzeitig freundlich am Ärmel auf den Stuhl niederzog, damit er nicht aufstände. »Dieses unselige Fest bei dem Gesandten beraubt mich eines großen Vergnügens und schafft Ihnen eine unangenehme Unterbrechung. – Es ist mir äußerst schmerzlich, Ihre entzückende Soiree verlassen zu müssen«, sagte er dann zu Anna Pawlowna.
Seine Tochter, Prinzessin Helene, ging, den Rock ihres Kleides ein wenig zusammenraffend, zwischen den Stühlen hindurch, und das Lächeln erstrahlte noch heller auf ihrem schönen Gesicht. Mit ganz entzückten Augen, ja beinahe erschrocken, sah Pierre das schöne Mädchen an, als es an ihm vorbeiging.
»Sehr schön«, sagte Fürst Andrei.
»Ja, sehr schön«, antwortete Pierre.
Als Fürst Wasili an Pierre vorbeikam, ergriff er dessen Hand und wandte sich an Anna Pawlowna:
»Machen Sie mir diesen Bären zu einem gebildeten Menschen«, sagte er. »Da wohnt er nun schon einen Monat lang bei mir, und heute sehe ich ihn zum erstenmal in Gesellschaft. Nichts ist einem jungen Mann so nötig als der Umgang mit klugen Frauen.«
Anna Pawlowna lächelte und versprach, sich mit Pierre alle Mühe geben zu wollen, der, wie sie wußte, väterlicherseits mit dem Fürsten Wasili verwandt war. Die bejahrte Dame, welche bisher bei der Tante gesessen hatte, stand eilig auf und holte den Fürsten Wasili im Vorzimmer ein. Der bisher erheuchelte Schein eines Interesses an den Vorgängen im Salon war vollständig von ihrem Gesicht verschwunden. Dieses gute, vergrämte Gesicht drückte jetzt nur Unruhe und Angst aus.
»Nun, was können Sie mir wegen meines Boris sagen, Fürst?« fragte sie, sobald sie ihn im Vorzimmer eingeholt hatte. (Sie sprach den Namen Boris mit einem besonderen Akzent auf dem o.) »Ich kann nicht länger in Petersburg bleiben. Sagen Sie mir, welchen Bescheid darf ich meinem armen Jungen bringen?«
Obgleich Fürst Wasili die ältliche Dame sichtlich nur ungern und beinahe unhöflich anhörte und sogar seine Ungeduld nicht verbarg, blickte sie ihn mit freundlichem, rührendem Lächeln an und faßte ihn bei der Hand, damit er nicht fortgehe.
»Sie brauchen ja nur dem Kaiser ein Wort zu sagen, und mein Sohn wird ohne weiteres zur Garde versetzt«, bat sie.
»Seien Sie überzeugt, Fürstin, daß ich alles tun werde, was ich kann«, erwiderte Fürst Wasili. »Aber es ist für mich nicht so leicht, dem Kaiser eine solche Bitte vorzulegen. Ich würde Ihnen raten, sich durch Vermittlung des Fürsten Golizyn an Rumjanzew zu wenden; das wäre das klügste.«
Die ältliche Dame war eine Fürstin Drubezkaja und gehörte somit zu einer der besten Familien Rußlands; aber sie war arm, hatte sich schon lange von dem Verkehr mit der vornehmen Welt zurückgezogen und so ihre früheren Konnexionen verloren. Jetzt war sie nach Petersburg gekommen, um für ihren einzigen Sohn die Versetzung zur Garde zu erwirken. Lediglich um den Fürsten Wasili zu treffen, hatte sie sich der Hofdame Anna Pawlowna aufgedrängt und war zu ihrer Soiree gekommen; lediglich zu diesem Zweck hatte sie die Erzählung des Vicomtes mitangehört. Über die Worte des Fürsten erschrak sie heftig, und auf ihrem ehemals schönen Gesicht prägte sich das Gefühl schmerzlicher Kränkung aus; aber das dauerte nur einen Augenblick. Sie lächelte wieder und faßte die Hand des Fürsten Wasili mit festerem Griff.
»Hören Sie mich an, Fürst«, sagte sie. »Ich habe Sie nie um etwas gebeten und werde Sie nie wieder um etwas bitten; ich habe Sie nie an die Freundschaft erinnert, die zwischen meinem Vater und Ihnen bestand. Aber jetzt beschwöre ich Sie bei Gott, tun Sie dies für meinen Sohn, und ich werde Sie für unsern Wohltäter halten«, fügte sie hastig hinzu. »Nein, werden Sie nicht zornig, sondern versprechen Sie es mir. Golizyn habe ich schon gebeten; aber er hat es mir abgeschlagen. Seien Sie der gute, liebe Mensch, der Sie früher waren«, sagte sie mit einem Versuch zu lächeln, obgleich ihr die Tränen in den Augen standen.
»Papa, wir werden zu spät kommen«, sagte die Prinzessin Helene, die an der Tür wartete, und wandte ihren schönen Kopf auf den antiken Schultern zurück.
Aber der Einfluß ist in den vornehmen Kreisen ein Kapital, mit dem man haushälterisch umgehen muß, damit es einem nicht unter den Händen verschwindet. Fürst Wasili wußte das, und da er sich ein für allemal gesagt hatte, daß, wenn er für alle diejenigen bitten wollte, die ihn bäten, es ihm bald unmöglich sein würde, für sich selbst zu bitten, so machte er von seinem Einfluß nur selten Gebrauch. In der Angelegenheit der Fürstin Drubezkaja fühlte er jedoch nach diesem ihrem erneuten Appell etwas wie Gewissensbisse. Woran sie ihn erinnert hatte, das war die Wahrheit: daß ihm die ersten Schritte auf seiner dienstlichen Laufbahn leicht geworden waren, hatte er allerdings ihrem Vater zu verdanken gehabt. Außerdem ersah er aus ihrem ganzen Benehmen, daß sie eine von den Frauen und speziell von den Müttern war, die, wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, nicht ablassen, ehe man ihnen nicht ihren Wunsch erfüllt, und im entgegengesetzten Fall es fertig bringen, einem täglich, ja stündlich zuzusetzen und einem sogar ärgerliche Szenen zu bereiten. Diese letztere Erwägung ließ ihn doch schwankend werden.
»Liebe Anna Michailowna«, sagte er in dem Ton, in welchem er fast immer sprach, einer Mischung von Vertraulichkeit und Mißmut, »es ist mir beinahe unmöglich, das zu tun, was Sie wünschen; aber um Ihnen zu zeigen, wie hoch ich Sie schätze und wie sehr ich das Gedächtnis Ihres seligen Vaters in Ehren halte, werde ich das Unmögliche tun: Ihr Sohn soll zur Garde versetzt werden; hier meine Hand darauf! Sind Sie nun zufrieden?«
»Liebster Freund, Sie sind unser Wohltäter! Ich habe auch nichts anderes von Ihnen erwartet; ich wußte ja doch, was Sie für ein gutes Herz haben.«
Er wollte nun weggehen:
»Warten Sie, nur noch ganz wenige Worte! Wenn er dann aber zur Garde versetzt ist ...« Sie stockte. »Sie sind ja mit Michail Ilarionowitsch Kutusow gut bekannt ... empfehlen Sie ihm doch Boris zum Adjutanten. Dann würde ich beruhigt sein, und dann würde ...«
Fürst Wasili lächelte.
»Nein, das verspreche ich nicht. Sie haben keine Ahnung, wie Kutusow von allen Seiten bestürmt wird, seit er zum Oberkommandierenden ernannt ist. Er hat selbst zu mir gesagt, alle Moskauer Damen hätten sich verabredet, ihm ihre sämtlichen Söhne zu Adjutanten zu geben.«
»Nein, versprechen Sie es mir doch! Ich lasse Sie nicht los, mein teurer Wohltäter!«
»Papa«, sagte die schöne Helene noch einmal in demselben Ton, »wir werden zu spät kommen.«
»Nun, also auf Wiedersehen, leben Sie wohl. Sie sehen, ich muß fort.«
»Also morgen werden Sie mit dem Kaiser darüber reden?«
»Ganz bestimmt; aber mit Kutusow zu reden, das verspreche ich nicht.«
»Aber nein, nein, versprechen Sie es mir, Wasili!« rief Anna Michailowna ihm mit dem Lächeln einer jungen Kokette nach, das ihr einstmals wohl einen eigenen Reiz verliehen haben mochte, jetzt aber zu ihrem ausgemergelten Gesicht schlechterdings nicht paßte. Sie hatte offenbar ihre Jahre ganz vergessen und brachte gewohnheitsmäßig all die althergebrachten weiblichen Hilfsmittel zur Anwendung. Aber sowie Fürst Wasili hinausgegangen war, nahm ihr Gesicht wieder denselben kalten, verstellten Ausdruck an, den es vorher getragen hatte. Sie kehrte zu der Gruppe zurück, in welcher der Vicomte zu erzählen fortfuhr, und gab sich wieder den Anschein, als höre sie zu, während sie doch nur auf die Zeit des Aufbruchs wartete, da ihre Angelegenheit nun erledigt war.
Kapitel V
»Aber wie finden Sie diese ganze letzte Krönungskomödie in Mailand?« fragte Anna Pawlowna. »Und nun ist eine neue Komödie gefolgt: die Bevölkerung von Genua und Lucca trägt Herrn Bonaparte ihre Wünsche vor. Und Herr Bonaparte sitzt auf dem Thron und erfüllt die Wünsche der Völker! Oh, das ist ein entzückendes Schauspiel! Nein, man könnte den Verstand darüber verlieren. Man möchte glauben, daß die ganze Welt den Kopf verloren hat.«
Fürst Andrei blickte der Sprechenden gerade ins Gesicht und lächelte.
»Gott gibt mir diese Krone; wehe dem, der sie antastet!« sagte er (die Worte, welche Bonaparte beim Aufsetzen der Krone gesprochen hatte). »Es heißt, er soll einen schönen Anblick dargeboten haben, als er diese Worte sprach«, fügte er hinzu und wiederholte diese Worte noch einmal auf italienisch: »Dio mi la dona, guai a chi la tocca!«
»Ich hoffe«, fuhr Anna Pawlowna fort, »daß dies endlich der Tropfen ist, der das Gefäß zum Überlaufen bringt. Die Souveräne können diesen Menschen, der alles Bestehende bedroht, nicht länger dulden.«
»Die Souveräne! Ich rede nicht von Rußland«, sagte der Vicomte in artigem, aber hoffnungslosem Ton. »Die Souveräne! Aber was haben sie für Ludwig XVI., für die Königin und für Madame Elisabeth getan? Nichts!« fuhr er, lebhafter werdend, fort. »Und glauben Sie mir, sie werden ihre Strafe dafür erleiden, daß sie die Sache der Bourbonen im Stich gelassen haben. Die Souveräne! Sie schicken Gesandte hin, um den Thronräuber zu beglückwünschen!«
Mit einem Seufzer der Geringschätzung änderte er seine Haltung. Fürst Ippolit, der den Vicomte lange durch seine Lorgnette betrachtet hatte, drehte sich plötzlich bei diesen Worten mit dem ganzen Körper zu der kleinen Fürstin um, erbat sich von ihr eine Nadel und begann, indem er mit der Nadel auf dem Tisch zeichnete, ihr das Wappen der Condés darzustellen. Er erläuterte ihr dieses Wappen mit so wichtiger Miene, als ob die Fürstin ihn darum gebeten hätte.
»Ein Schild mit schmalen, roten und blauen gezähnten Streifen, das ist das Haus Condé«, sagte er. Die Fürstin hörte lächelnd zu.
»Wenn Bonaparte noch ein Jahr auf dem französischen Thron bleibt«, fuhr der Vicomte in seiner begonnenen Darlegung mit der Miene eines Menschen fort, der auf andere nicht hört, sondern bei einem Gegenstand, der ihm besser bekannt ist als allen übrigen, nur seinen eigenen Gedankengang im Auge hat, »so wird ein nie wiedergutzumachendes Unheil angerichtet sein. Durch Intrigen, Gewalttaten, Verbannungen und Hinrichtungen wird die Gesellschaft, ich meine die gute französische Gesellschaft, für immer vernichtet sein, und dann ...«
Er zuckte die Achseln und breitete die Arme auseinander. Pierre setzte gerade an, um etwas zu sagen, da ihn das Gespräch interessierte; aber Anna Pawlowna, die ihn überwachte, ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»Kaiser Alexander«, sagte sie in dem wehmütigen Ton, dessen sie sich stets bediente, wenn sie von der kaiserlichen Familie sprach, »hat erklärt, daß er es den Franzosen selbst anheimstelle, sich die Form ihrer Regierung zu wählen. Und ich meine, es kann gar nicht zweifelhaft sein, daß die ganze Nation sich von dem Usurpator befreien und sich ihrem legitimen König in die Arme werfen wird.« Anna Pawlowna beabsichtigte, mit diesen Worten dem Emigranten und Royalisten eine Liebenswürdigkeit zu erweisen.
»Das dürfte denn doch zweifelhaft sein«, bemerkte Fürst Andrei. »Der Herr Vicomte hat durchaus recht mit seiner Anschauung, daß die Sache sich schon zu weit entwickelt hat. Ich glaube, es wird schwer sein, zu den alten Zuständen zurückzukehren.«
»Soviel ich gehört habe«, mischte sich Pierre, seinen Versuch erneuernd, mit lebhaftem Erröten in das Gespräch, »ist fast der ganze Adel bereits auf Bonapartes Seite getreten.«
»Das sagen die Bonapartisten«, entgegnete der Vicomte, ohne Pierre anzusehen. »Es ist jetzt schwer, über die Ansichten der besseren Kreise Frankreichs ins klare zu kommen.«
»Bonaparte selbst hat das gesagt«, warf Fürst Andrei lächelnd ein. (Es war deutlich, daß ihm der Vicomte nicht gefiel, und daß seine Bemerkung, obwohl er den Vicomte dabei nicht anblickte, gegen diesen gerichtet war.)
»›Ich habe ihnen den Weg des Ruhmes gezeigt‹«, fuhr er nach kurzem Stillschweigen, wieder Worte Napoleons zitierend, fort, »›aber sie haben ihn nicht gehen wollen; ich habe ihnen meine Vorzimmer geöffnet, und sie sind in Scharen herbeigeeilt ...‹ Ich weiß nicht, bis zu welchem Grade er ein Recht hatte, so zu sprechen.«
»Gar kein Recht hatte er dazu«, entgegnete der Vicomte. »Nach der Ermordung des Herzogs haben selbst seine getreuesten Anhänger aufgehört, einen Helden in ihm zu sehen. Und wenn er wirklich für manche Leute ein Held war«, fuhr der Vicomte, zu Anna Pawlowna gewendet, fort, »so kann man doch sagen: nach der Ermordung des Herzogs gibt es im Himmel einen Märtyrer mehr und auf Erden einen Helden weniger.«
Anna Pawlowna und manche ihrer Gäste hatten noch nicht Zeit gefunden, ihre Bewunderung für diese Worte des Vicomtes durch ein Lächeln zu bezeigen, da stürzte sich schon Pierre von neuem in das Gespräch, und obgleich Anna Pawlowna ahnte, daß er etwas Unpassendes vorbringen werde, war sie doch nicht mehr imstande, ihn zurückzuhalten.
»Die Hinrichtung des Herzogs von Enghien«, sagte Pierre, »war eine politische Notwendigkeit, und ich betrachte es geradezu als ein Zeichen von Seelengröße, daß Napoleon sich nicht gescheut hat, die Verantwortung für diese Tat ganz allein auf sich zu nehmen.«
»Mein Gott!« flüsterte Anna Pawlowna ganz entsetzt.
»Sie billigen einen Mord ...? Wie, Monsieur Pierre, Sie sehen in einem Mord ein Zeichen von Seelengröße?« sagte die kleine Fürstin, indem sie ihre Handarbeit lächelnd näher an ihre Brust hielt.
»Ah! Ah!« riefen verschiedene Stimmen.
»Vorzüglich!« sagte Fürst Ippolit auf englisch und schlug sich ein paarmal mit der flachen Hand aufs Knie. Der Vicomte zuckte nur mit den Achseln.
Pierre blickte triumphierend über seine Brille weg die Zuhörer an.
»Ich spreche so«, fuhr er kühnen Mutes fort, »weil die Bourbonen vor der Revolution davongelaufen sind und das Volk der Anarchie preisgegeben haben; Napoleon war der einzige, der es verstand, die Revolution richtig zu beurteilen und sie zu besiegen, und deshalb durfte er, wo es sich um das allgemeine Wohl handelte, nicht vor dem Leben eines einzelnen haltmachen.«
»Mögen Sie nicht an den Tisch dort drüben mit herüberkommen?« sagte Anna Pawlowna. Aber Pierre fuhr, ohne ihr zu antworten, in seiner Meinungsäußerung fort.
»Nein«, sagte er, immer lebhafter werdend, »Napoleon ist ein großer Geist, weil er sich über die Revolution gestellt und ihre Auswüchse vertilgt hat, während er alles Gute, das sie gebracht hatte, beibehielt: die Gleichheit aller Bürger und die Freiheit des Wortes und der Presse; nur durch dieses Verfahren hat er die Macht erlangt.«
»Ja, wenn er die Macht, nachdem er sie erlangt hatte, nicht zum Mord mißbraucht, sondern in die Hände des legitimen Königs gelegt hätte«, entgegnete der Vicomte, »dann würde ich ihn einen großen Mann nennen.«
»Das hätte er gar nicht tun können. Das Volk hatte ihm die Macht nur zu dem Zweck gegeben, damit er es von den Bourbonen befreien möchte, und weil es in ihm einen großen Mann sah. Die Revolution ist eine große Tat gewesen«, fuhr Monsieur Pierre fort und bekundete durch die unnötige Hinzufügung dieser verwegenen, herausfordernden These seine große Jugendlichkeit und seinen Eifer, alles möglichst schnell herauszureden.
»Revolution und Königsmord eine große Tat ...! Wenn jemand so redet ... Aber wollen Sie nicht an den Tisch dort drüben mit herüberkommen?« wiederholte Anna Pawlowna ihre Aufforderung.
»Rousseaus Gesellschaftsvertrag«, sagte der Vicomte mit sanftem Lächeln.
»Ich spreche nicht vom Königsmord; ich spreche von den Ideen.«
»Jawohl, von den Ideen des Raubes, des Mordes und des Königsmordes«, unterbrach ihn wieder eine ironische Stimme.
»Das waren tadelnswerte Ausschreitungen, versteht sich. Aber nicht darin liegt die eigentliche Bedeutung der Revolution; sondern ihre Bedeutung liegt in der Anerkennung der Menschenrechte, in der Ablegung von Vorurteilen, in der Gleichstellung aller Bürger. Und alle diese Ideen hat Napoleon in ihrer ganzen Kraft beibehalten.«
»Freiheit und Gleichheit«, entgegnete der Vicomte geringschätzig, als ob er sich endlich entschlossen hätte, diesem jungen Menschen ernsthaft die ganze Torheit seines Geredes zu beweisen, »das sind hochtönende Worte, die schon längst in Verruf gekommen sind. Wer sollte nicht Freiheit und Gleichheit lieben? Schon unser Heiland hat Freiheit und Gleichheit gepredigt. Sind denn etwa die Menschen nach der Revolution glücklicher geworden? Im Gegenteil. Wir wünschten die Freiheit; aber Bonaparte hat sie vernichtet.«
Fürst Andrei sah lächelnd bald Pierre, bald den Vicomte, bald die Wirtin an. Bei Pierres exzentrischen Reden hatte Anna Pawlowna im ersten Augenblick trotz ihrer gesellschaftlichen Routine einen gewaltigen Schreck bekommen; aber als sie sah, daß bei den von Pierre ausgestoßenen gotteslästerlichen Reden der Vicomte nicht außer sich geriet, und als sie ferner sah, daß ein Vertuschen dieser Reden nicht mehr möglich war, da nahm sie ihren Mut zusammen, ergriff die Partei des Vicomtes und machte einen Angriff auf den dreisten Redner.
»Aber mein lieber Monsieur Pierre«, sagte Anna Pawlowna, »wie können Sie nur jemand für einen großen Mann erklären, der den Herzog – oder sagen wir überhaupt schlechtweg einen Menschen – ohne ordentliches Gericht schuldlos hat hinrichten lassen?«
»Ich möchte fragen«, sagte der Vicomte, »wie man den achtzehnten Brumaire auffassen soll. War das etwa kein Betrug? Das war eine Gaunerei, die mit der Handlungsweise eines großen Mannes ganz und gar keine Ähnlichkeit hat.«
»Und die Gefangenen in Afrika, die er ermorden ließ?« fügte die kleine Fürstin hinzu. »Das ist doch entsetzlich!« Sie zuckte mit den Schultern.
»Er ist ein Emporkömmling; da kann man nun sagen, was man will«, bemerkte Fürst Ippolit.