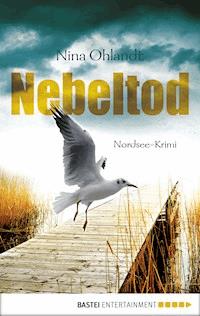11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar John Benthien
- Sprache: Deutsch
Abgründig, raffiniert und norddeutsch - die neue Serie von der Krimiküste
Herbst auf der Nordseeinsel Amrum. In einer stürmischen Nacht stirbt ein alter Mann, kopfüber aufgehängt am Quermarkenfeuer, dem kleinen Inselleuchtturm. Auch seine Frau wird brutal ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen übernimmt Hauptkommissar John Benthien von der Flensburger Kripo. Benthien hat in seiner Dienstzeit schon viele grausame Fälle bearbeitet, doch dieser übertrifft alle. Wer steckt hinter dem Doppelmord? War es ein Racheakt?
Der Kommissar und sein Team tappen im Dunkeln - bis sie auf zwei Ereignisse stoßen, die weit in der Vergangenheit liegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Anmerkung der Autorin
Über die Autorin
Nina Ohlandt wurde in Wuppertal geboren, wuchs in Karlsruhe auf und machte in Paris eine Ausbildung zur Sprachlehrerin, daneben schrieb sie ihr erstes Kinderbuch. Später arbeitete sie als Übersetzerin, Sprachlehrerin und Marktforscherin, bis sie zu ihrer wahren Berufung zurückfand: dem Krimischreiben im Land zwischen den Meeren, dem Land ihrer Vorfahren.
Nina Ohlandt
Küstenmorde
Nordsee-Krimi
John Benthiens erster Fall
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Judith Mandt
Textredaktion: Kai Lückemeier
Titelillustration: © shutterstock: peppi18 | Roberto Cerruti | Stefanie Schoenebein
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-4611-1
Dieses E-Book enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes Möwenschrei von Nina Ohlandt.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Judith Mandt
Textredaktion: Kai Lückemeier
Titelillustration: © shutterstock: Ralf Gosch | Eric Isselee | xpixel
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
ISBN 978-3-8387-5934-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Anke und Monika,in Erinnerung an die Cité des Fleurs
Kapitel 1
Der Mann am Quermarkenfeuer war verzweifelt, am Ende seiner Kräfte; sein nackter Körper ein einziger Schrei. Obwohl er wusste, dass niemand ihn in diesem Sturm, in dieser Leere hören würde – ringsum nur Dünen, eine endlose Strandwüste und davor die tobende See –, konnte er nicht anders als beten, schreien, fluchen, heulen, auch wenn es bedeutete, dass ihm die Luft noch schneller ausgehen würde als geplant. Denn in der Plastiktüte, in der sein Kopf steckte, gab es nur wenige Löcher, und sie ließen kaum Sauerstoff durch.
Er blinzelte, er wimmerte. Er verschluckte sich an seiner Spucke, schnappte nach Luft, spürte sein Herz in der Kehle flattern wie ein sterbender Vogel. Ab und zu sah er durch die milchige Transparenz der Plastiktüte den Mond hinter aufgetürmten Wolken hervorblitzen. Dann lag die Nacht wieder auf ihm wie eine alles erstickende Decke.
Hoffnung? Rettung? Er glaubte längst nicht mehr daran. Hier in dieser gottverlassenen Gegend, auf dieser Insel, in diesem Gewirr von Dünen, inmitten des Sturms und der rasenden See war er so allein, wie ein Mensch es nur sein konnte, kilometerweit entfernt vom nächsten Ort. Auf dem Hinweg durch die unruhige Nacht, im Wald, an der Vogelkoje und auf dem Bohlenweg über die Dünen war ihnen keine Menschenseele begegnet. Wer hatte hier schon etwas verloren, im Sturm, um Mitternacht?
Und dann diese Schmerzen! Überall lauerten sie, an den Fußgelenken, in die das Nylonseil schnitt, im Genick; sie klopften an die Stirn, zerrten an der Kopfhaut, schienen die Augäpfel aus ihren Höhlen zu stoßen. Auch die Möwen waren zugange und fielen über ihn her. Sie hatten sich, zeternd und kreischend, über ihm versammelt, mit hartem Flügelschlag. Oder besser gesagt, sie hatten sich zu seinen Füßen versammelt, denn er hing ja kopfüber an der verdammten Plattform des Quermarkenfeuers wie ein sauber verschnürtes Suppenhuhn, ein Spielball des Windes. Wenn er nicht erstickte in dieser Plastiktüte, wenn sein Kopf nicht in absehbarer Zeit durch den Blutandrang platzte, wenn er nicht an den Schmerzen krepierte, die seinen aufgehängten Körper quälten, wenn er nicht erfror in dieser Nacht … dann starb er wahrscheinlich an den Knochen- und Schädelbrüchen, die der Sturm verursachte, indem er ihn immer wieder gegen den eisernen Korpus des kleinen Leuchtturms schleuderte. Verhindern konnte er es nicht, denn die Hände waren ihm auf den Rücken gebunden. Er musste all seine Muskelkraft aufbringen, um die Arme nicht hängen zu lassen, die Schmerzen wären sonst unerträglich. Egal was er tat, er war am Ende. Aus dieser teuflischen Falle würde selbst sein wendiger Verstand keinen Ausweg mehr finden.
Sein Hals wurde eng, er schnappte nach Sauerstoff. Sein Herz hämmerte in der Kehle. Wie lange hing er bereits an diesem Turm? Zwanzig Minuten? Fünf Stunden? Er wusste es nicht, jedes Zeitgefühl war ihm abhandengekommen.
Eine Möwe hackte nach der Plastiktüte und verletzte ihn an der Augenbraue. Für einen Augenblick schöpfte er eine absurde Hoffnung. Würden die Vögel die Tüte zerreißen? Würde er Luft bekommen? Wieder schrie er, was seine Lungen hergaben, schrie an gegen den Sturm, das Gezeter der Vögel, das brausende Meer in seinem Kopf – vergeblich. Sein Körper fror, doch sein Schädel wurde immer heißer, als steckte er in einem Backofen, der sich langsam erhitzte und seine Gedanken zum Kochen brachte. Wilde, quälende, brennende Gedanken …
Irmi … wie es ihr wohl ergangen war? Ob sie noch lebte? Und wer war der Schatten dort hinten, seine Mutter etwa, das Röslein? Aber wieso trug sie einen schwarzen Mundschutz? Wie lächerlich! Darüber blitzten böse die Augen; rund und am Stiel hängend wie die Hagebutten der Dünenrosen fielen sie ihr fast aus dem Kopf. Hinter ihr lief eine Schar toter Gänse, tapp tapp, tapp tapp, tapp tapp.
»Ich bin sooo müde, Euer Ehren!«
»Klappe halten. Du hängst in der Warteschleife.«
Die See würde ihn holen, die See, die alle Sünder holt. Niemals hätte er auf diese Insel kommen dürfen, niemals. »Die Wandergans mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstesnacht vorbei, am Strande weht das Gras.«
Gänse? Wandergänse? Aber hier ging es nicht um Gänse, hier waren Möwen zugange, mörderische Möwen … Wieder ein Biss, ein Schnabelhieb. Herrgott! Würden sie ihn an diesem gottverdammten Ort bei lebendigem Leibe zerreißen? Würde er hier verrecken, ein Opfer von Seevögeln? Seine Adern pochten, als würden sie platzen. Sie pochten längst vergessene Namen …
»Die Wandergans mit hartem Schrei …«
Ruhe!
»… am Strande weht das Gras.«
In der Wüste weht kein Gras. Und doch ist die Wüste schön, so schön. Aber voller Gräber. Klein. Geradezu winzig. Kaum auszumachen. Kleine Gänse brauchen keine großen Gräber. »Vernehmlich werden die Stimmen …«
Ruhe, verdammt! Auch hier draußen tobt eine Wüste. Sand, so weit man blickt. Unsinn, Sand tobt nicht, er schneidet die Haut wie mit Messerklingen. Was dort draußen tobt, ist das Meer. Es frisst Land, Schiffe und Menschen. Horus, Fenelon, Hermina, das »Totenschiff«, alle gesunken vor Amrums Westküste; die Opfer, eingekerkert in ihrem Schiffsrumpf, erstickt, ertrunken, verdurstet, verfault. Auch das Meer ist, wie die Wüste, ein Grab. Es liebt seine Toten: Zärtlich säubert es ihre Gebeine und füllt die leeren Augen mit Seetang. Doch in Nächten wie dieser gibt es sie frei; sie treiben an Land, setzen auf Stränden und Sandbänken auf, weißbäuchig wie gestrandete Fische. Mit einem Wort: Sie machen Ärger!
Ha!
Wer lacht da? Diese Gestalt dort – doch nicht schon wieder seine Mutter? Aber wieso trägt sie schwarze, hochhackige Stiefel? So ein Quatsch! Seine Mutter hatte nie Stiefel getragen. »Solides Schuhwerk, mein Junge«, hatte sie immer gesagt. Solides Schuhwerk garantierte Wohlstand, Gesundheit, eine gute Ausbildung, Anerkennung, Liebe … Nein, Liebe gab es nicht, nicht in diesem Leben, vielleicht in einem anderen … Keine Widerrede, Junge, Kinder haben den Mund zu halten! Hart konnte sie sein, seine gestrenge Mutter, doch in den Nächten waren ihre Hände so weich … Ach, nun schrumpfte es, das Röslein, der Rumpf fuhr Paternoster nach unten, und der Kopf mit dem Mundschutz schaute alsbald halslos grinsend über den Rand der Stiefel.
Ein Schnabelhieb traf seine Schläfe und riss ein Loch in die Plastiktüte. Er atmete tief und inhalierte eine Ladung Sand. Immerhin, mit dem linken Auge konnte er jetzt ein wenig sehen; den wehenden Strandhafer und den rot-weißen Turm, seinen Feind.
In einem unerwartet klaren Augenblick bemerkte er, dass der Sturm nachließ. Nur heiß war ihm, so heiß, die Stirn brannte, und der Maschinist dahinter schien ein Feuerchen in Gang zu halten, damit der Zunder für den Zug nicht ausging … Und da sah er sie auch schon kommen, die kleine Amrumer Inselbahn, quer über die Dünen ruckelte sie, zwei flackernde Irrlichter, in der Dunkelheit tanzend. Doch die Inselbahn gab es schon lange nicht mehr.
Er verdrängte die Schmerzen, die Übelkeit. Versuchte, so gut es ging, seinen Oberkörper anzuheben. Er schrie, doch es kam nur ein Krächzen. Sein Mund war trocken und voller Blut, die Lippen zerfurcht, zerbissen. Die Zunge hing ihm am Gaumen fest, die Plastiktüte klebte auf seinem Gesicht. Er versuchte, sie einzuatmen und ein Teil des Materials zu zerbeißen. Er hustete und heulte, verschluckte sich, doch dann, endlich, war ein kleiner Riss entstanden. In seine Lungen strömte reine Seeluft. Er räusperte sich, ächzte, schrie. Er musste die Windböen, die Möwen und die See überschreien, er musste gefunden werden, er wusste, dies war die letzte Chance, die er in diesem Leben hatte.
Das Licht kam näher.
»Deine Sessel sind immer noch da, mein Junge«, sagte Benthien senior. Vierzig Kilometer nördlich vom Amrumer Quermarkenfeuer saß er am Schreibtisch seines Sohnes und kroch beinahe in das Notebook hinein. Seine blauen Augen strahlten. »Sie haben sie wieder eingestellt. Aber jetzt kosten sie nur noch 720 Euro pro Stück.« Er drehte sich um. »Willst du es dir nicht doch noch mal überlegen?«
John Benthien, Erster Hauptkommissar bei der Flensburger Kripo, der derzeit auf seinem alten, abgeschabten, aber butterweichen Ledersofa lag und in einen Krimi versunken war, den er noch in dieser Nacht auslesen wollte, seufzte leise. Dass sein Vater, genau wie er, ein Nachtmensch war, dagegen war ja nichts einzuwenden. Auch dass er mit Begeisterung auf den eBay-Seiten surfte und dort vom Schnürsenkel über Bücher und Sushi-Messer bis hin zu Türstoppern, Jugendstil-Fensterriegeln und Angelködern auf fast alles bot, und es meistens auch bekam, war im Prinzip okay. Ungemütlich wurde es nur, wenn er für seinen Sohn einkaufen wollte. John brauchte neue Thermosocken? Einen Kuhfuß, asiatische Gewürze, ein Schweizer Armeemesser gar? Oder ein Ferienhaus in Kanada? Kein Problem, Benthien senior loggte sich trotz seiner achtundsiebzig Jahre mit jugendlichem Elan bei eBay ein und beschaffte das Gewünschte, wobei er vorzugsweise auf exotischen eBay-Seiten surfte. Kürzlich hatte er sich in zwei Art-déco-Sessel verliebt, deren erfolglose eBay-Karriere er seit Wochen verfolgte.
»180 Euro pro Sessel sind sie schon runtergegangen, ein richtiges Schnäppchen«, sagte Benjamin Benthien und scrollte eifrig, »da solltest du zulangen. Denk dran, wie alt die Dinger sind. Dazu in gutem Originalzustand und aus echtem Leder!«
»Vater, 720 Euro für einen Sessel, den ich nicht haben will, ist kein Schnäppchen! Außerdem brauche ich keine Sessel.« Er fügte nicht hinzu, dass rot-schwarze Art-déco-Sessel stilmäßig nicht unbedingt in ein altes, gemütliches Friesenhaus auf einer einsamen Sylter Düne passten und dass er sein knapp bemessenes Gehalt lieber für andere Dinge ausgab, für Bücher, Reisen, für sein Boot und Filmkameras zum Beispiel, vielen Dank!
»Ich beobachte sie jedenfalls weiter. Wenn sie bei 400 Euro angelangt sind, wären wir verrückt, wenn wir die nicht kaufen würden.«
John, genauso hartnäckig wie Benthien senior, hüllte sich in Schweigen. Zerstreut las er den nächsten Absatz in seinem antiquarischen Krimi von Arthur W. Upfield (günstig ersteigert für nur 6,91 Euro!), kam aber seufzend zu dem Schluss, dass er die letzten achtzig Seiten wohl oder übel auf morgen verschieben musste, falls er nicht erst im Morgengrauen zu Bett gehen wollte. Er ließ das Buch sinken. Der Tag war schön gewesen, ein milder Spätsommertag Anfang September, aber gegen Abend hatte sich der Wind gedreht. Nun stürmte er wie ein junger Hund über die Insel, verpasste den Wellen Schaumkämme und jagte sie den Strand hinauf, um am Inselkern zu nagen wie an einem geliebten Knochen. Benthiens Haus, das seit hundert Jahren mit einer hohen Düne verwachsen war, ächzte unter dem Reetdach wie ein rheumatischer Greis. Benthien schloss die Augen. Er kam sich vor wie auf hoher See; das Haus wankte und schwankte auf seiner Düne, die sich unter ihm schüttelte wie ein alter Köter. Noch eine solche Sturmböe, dachte Benthien schläfrig, und das alte Kapitänshaus würde abheben und übers Wattenmeer davonsegeln, geradewegs auf die dänische Küste zu.
Er öffnete die Augen, angelte nach seinem Glas und nahm einen Schluck vom Rotwein, den er aus Italien mitgebracht hatte. Ben am Notebook stieß einen Schrei des Entzückens aus. Er hatte neue Auktionen entdeckt. »Das musst du dir ansehen, Junge! Das ist was für dich. Könnte ich dir zum Geburtstag schenken. Alte Manschettenknöpfe aus Messing mit einem Elchkopf drauf. So was hat bestimmt kein Mensch!«
Das glaubte John auch. Ihn schauderte. Außerdem, wann trug er jemals ein Hemd, zu dem er Manschettenknöpfe brauchte? Am liebsten kleidete er sich lässig, Jeans, Stiefel, Sweatshirt oder Troyer. Anzug, Krawatten, Hemden waren ihm verhasst. Um die Gelegenheiten, bei denen man sich derart in Schale werfen musste, machte er nach Möglichkeit einen großen Bogen. Das war nicht sein Ding. Da unternahm er schon lieber eine lange Strandwanderung, ging segeln oder angeln oder widmete sich seinem neuesten Hobby, den Steinen.
»Sei nicht so stur«, murrte Ben – das sagt genau der Richtige, dachte John im Stillen –, »Frauen mögen gut angezogene Männer. Du solltest mal wieder ausgehen. Oder willst du dich für immer in diesem hinterwäldlerischen Haus verkriechen, mit einem Haufen Sand und Karnickelköttel um dich herum, und ein verschrobener Eigenbrötler werden?«
John nahm sein Buch wieder auf und las demonstrativ weiter. Eine Karriere als Eigenbrötler erschien ihm im Augenblick sehr verlockend. Seit er sich nach sechs Jahren von seiner Freundin Karin getrennt hatte, war sein Vater dahinter her, dass er neue Bekanntschaften machte. Doch John genoss das Alleinsein. Er konnte abends die Haustüre hinter sich schließen und lesen oder Bücher binden oder ein Regal zusammenbauen oder einfach nur übers Meer schauen, ohne dass eine Hektikerin wie Karin auf ihn einredete und Forderungen stellte. Er kam sich vor wie jemand, der nach langer Krankheit genesen war; nun brauchte er Luft, Wind und Regen, einen hohen Himmel, den weiten Horizont und die Gerüche der See. Die Fähigkeit zu träumen musste er wieder neu entdecken und das Recht, auch einmal für sich selbst da zu sein. Das alles hatte Karin ihm genommen. Er begriff erst jetzt, Monate nach der Trennung, was er vorher nicht hatte sehen wollen: dass Karin emotional die Reife eines kleinen Kindes hatte, das ständige Aufmerksamkeit erforderte. Und dazu war er nicht mehr bereit gewesen.
Er nippte an seinem Piemonteser-Wein, ließ den Tropfen über die Zunge rollen und genoss den langen, würzigen Abgang. Ben phantasierte immer noch laut von Johns zukünftigem Eigenbrötlerdasein, das seiner Ansicht nach nicht zu vermeiden wäre, wenn er sich jetzt nicht zusammenreißen und etwas dagegen unternehmen würde. »Meinst du«, schloss er seinen Vortrag mit ernster Stimme, »ich kann ruhig dabei zusehen, wie mein Sohn in dieser Wildnis zum Dünenschrat verkommt?«
Nachdem sein Sohn beinahe den Wein ausgespuckt und sich die Lachtränen aus den Augen gewischt hatte, setzte er sein Glas ganz sanft auf den Tisch.
»Vater, ich kümmere mich nicht um dein Liebesleben, also lass mich in Frieden mit meinem. Okay? Außerdem würde ich Sylt nicht gerade als Wildnis bezeichnen.«
»Ich weiß nicht, wovon du redest, mein Junge!« sagte Benthien senior, um dann inkonsequent hinzuzufügen: »Außerdem hast du gar keins.« Er schob den Stuhl zur Seite und ging in die Küche. Kam kurz darauf mit einer kalten Flasche Bier in der Hand zurück, sichtlich bereit, das Thema weiter zu vertiefen. Doch John, der unter seinen Kollegen als geschickter Verhörspezialist galt, der sofort jeden Vorteil erkannte und ausnutzte, ließ Ben keine Chance. Er ging zu einem überaus unfairen Angriff über.
»Ich rede davon, dass du bei deinen Wattwanderungen den großen Aufreißer spielst und Frauen ohne Ende an Land ziehst. Ich rede von deiner Sammlung von Telefonnummern. Ich wundere mich geradezu, dass du bei deinem ausschweifenden Privatleben auch noch Zeit hast, an meins zu denken!«
Ben lächelte fein. »John, du musst mir zugestehen, dass ich mir Sorgen um dich mache. Du hast …«
»Ich gestehe nur mir selbst zu, mir Sorgen um mich zu machen, Vater, und glaube mir, derzeit mache ich mir keine. Ganz im Gegenteil.«
»Arbeit ist nicht alles im Leben, Junge.« Ben nahm einen Schluck Bier. »Ich wünsche mir nur, dass du ein erfülltes Leben hast. Und dass du dich nicht verbohrt zurückziehst und …«
»Du meinst wohl verbittert. Keine Angst, das bin ich keineswegs!«
»Auf jeden Fall würde es dir nicht schaden, unter Menschen zu gehen, statt dich jedes Wochenende in dieser Einöde zu vergraben, nur in Gesellschaft deines alten Vaters. Was ist denn eigentlich mit deiner Kollegin los, dieser Lilly? Ist sie verheiratet? Sie ist geistreich und witzig. Intelligent. Und liest gern. Die wäre doch was für dich, Junge!«
Über Lilly wollte John nicht sprechen. Er hatte noch ein Ass im Ärmel, von dem er sich nicht wenig versprach.
»Kümmere dich lieber um deine Freundinnen, Vater. Eine davon hat heute hier angerufen. Wollte dich sprechen. Zumindest denke ich, dass sie dich meinte. Sie sprach von einem ›Bikäj‹.«
John beobachtete nicht ohne Schadenfreude, wie sich Benthien senior an seinem Bier verschluckte. Endlich hatte er einen Treffer gelandet! Damit war das Thema »Dünenschrat« wohl endgültig vom Tisch.
Ben räusperte sich. »Das kann nicht für mich gewesen sein«, sagte er mit fester Stimme. Doch seine Hand, die die Flasche Bier zum Mund führte, zitterte leicht.
»Heiße ich von uns beiden etwa Bikäj?,« fragte John.
Ben stärkte sich mit einem Schluck Bier. »Ich doch auch nicht. War wohl eine falsche Verbindung. Was soll Bikäj denn sein, ein Name?«
»Benjamin Karl«, zählte John auf. Er sprach langsam und deutlich. »Soweit ich weiß, sind das deine Vornamen. Jemand, der ein bisschen überspannt ist und sich permanent amerikanische Soaps reinzieht wie beispielsweise deine Freundin Hildegard aus Frankfurt, könnte auf die Idee kommen, deinen Namen zu BK – sprich Bikäj – einzudampfen. Wahrscheinlich findet sie das witzig.«
Interessiert beobachtete er, wie sein Vater blass wurde.
Das Licht war verschwunden.
Schweiß stand auf seiner Stirn, und doch war ihm kalt. Wo war das Licht geblieben? Wo der Lampenträger? Um ihn herum war es finster, nur ab und zu blitzte die karge Mondsichel hinter Wolkenfetzen hervor. Sein Kopf dröhnte, sein Blut rauschte, als beherbergten seine Adern die Dünung eines fremden Meeres. Hatte er sich mit dem Licht getäuscht? Er wusste, lange würde er es nicht mehr aushalten. Der Wind war wieder stärker geworden; er peitschte den Sand und spielte mit den Möwen, die sich jauchzend emportragen ließen bis an den Rand der Wolkenberge. Von dort fielen sie herunter wie Steine, fingen sich wieder, raubten ihm ein Stück Haut oder Fleisch und flogen höhnisch lachend davon, nur um sich erneut auf ihn zu stürzen.
Wo, zum Teufel, war der Mensch mit der Lampe? Sollte er hier ein Opfer der Seevögel werden? Er holte tief Luft und stieß ein Gebrüll aus, dass die Kaninchen vor Schreck davonrannten. In seinen Ohren klang es kraftvoll und wild, doch vielleicht war es nur ein Säuseln im Sturm. Zur Strafe packte ihn der auffrischende Südwest und drehte ihn um und um, und – Hossa! – kollidierte sein Knie mit dem Leuchtturm. Und noch einmal dasselbe, diesmal der Ellbogen, und wieder und wieder … die Hüfte, die Füße, die Schulter, der Kopf.
Eine heiße Flüssigkeit lief ihm ins Auge, Blut mischte sich unter seine Tränen. Ihm fiel auf, dass tatsächlich kein Licht mehr zu sehen war, weder vor ihm noch hinter ihm, nicht in der Ferne, nicht in der Nähe, nirgendwo.
Hossa!
Er wünschte, er könnte ohnmächtig werden. Sich ergeben, vergessen, diese Welt so verlassen, wie er gekommen war – ohne Bewusstsein für das, was geschah, blindlings, mechanisch. Er fühlte bereits seinen Körper nicht mehr, nur die Schmerzen, die waren noch da, umhüllten ihn wie ein Mantel.
Er gab jeden Widerstand auf; er schrie, er wimmerte, weinte wie ein Tier, das dazu ausersehen ist, den Hunger seines Feindes zu stillen. Er war allein in dieser Welt. Erschöpft schloss er die Augen. Lieber Gott, mach, dass es vorüber ist.
Ben holte tief Luft. »Ich kenne keine Hildegard aus Frankfurt.«
»Sei nicht so herzlos, Vater. Wo sie doch extra für dich die weite Reise auf sich genommen hat!«
»Was für eine Reise?«
»Sie ist hier auf Sylt. Aber wenn du sie nicht kennst, muss dich das ja nicht interessieren.«
»Hilde ist hier? Wo?«
John musste lachen. Sein Vater war aufgesprungen und sah so verstört um sich, als würde »Hilde« gleich unter dem Tisch hervorkriechen.
»Ganz in deiner Nähe, vermute ich.«
»Heiliger Brahma! Was will sie hier?«
»Was wird sie wohl wollen?«
»Das geht nicht! Sag ihr, ich bin nicht da. Gestorben. Verreist. Sag ihr irgendwas. Sag, ich habe einen lebensgefährlichen Virus, Ebola oder Dengue. Niemand darf zu mir! Sag ihr das, John. Und grins nicht so blöd!«
»Was«, fragte Benthien junior, »hast du eigentlich angestellt?«
Er betrachtete seinen Vater mit liebevollem Spott. Eines von Bens Sommerhobbys war es, auf Wattwanderungen zwischen Amrum und Föhr Damenbekanntschaften zu machen. Beim gemeinsamen Betrachten der Strandkrabben und Seepocken, der Kotpillenwürmer und Roten Bohnen kam man offenbar leichter als sonst mit Fremden ins Gespräch, und Benthien senior hatte so manche nette Freundschaft geknüpft, die wieder auflebte, sobald die Damen im nächsten Frühjahr oder Sommer wieder an die Nordsee kamen.
John war insgeheim stolz auf seinen Vater. Er war fit wie zu seinen besten Zeiten als Sportlehrer, ruderte oder machte im Winter Langlauf. Mit seiner weißen Mark-Twain-Mähne wirkte er zweifellos auf Frauen jeden Alters. John wusste natürlich, dass seine ganzen Frauengeschichten harmlos waren. Mit der einen besuchte er Theateraufführungen, mit der anderen spielte er Schach, manche waren hingegen ideale Partnerinnen für Tanzkurse oder lange Wanderungen.
John war froh, dass sein Vater in seinem Alter noch so viel Freude am Leben hatte. Aber was war das für eine Geschichte mit dieser Hilde aus Frankfurt?
»Sie will mir an die Wäsche, Junge«, sagte Ben bekümmert und trank sein Bier in einem Zug aus. »Soll ich ihr etwa sagen, dass sie nicht mein Typ ist? Jedenfalls nicht für so was?«
John blinzelte seinem Vater zu. »Vielleicht solltest du dein Liebesleben etwas reduzieren, Vater. Einfach mal kürzertreten. Du verlierst den Überblick.«
»Tu doch nicht so, als ob ich mit jeder gleich ins Bett hüpfen würde!«
»Tust du das denn nicht?«
»Aber Junge!«, Benthien senior sprang vom Stuhl und verschwand in der Küche. John hörte die Kühlschranktür, da war wohl noch ein Bier fällig.
»Vielleicht sollte ich ihr sagen, dass ich inzwischen mit jemandem zusammen bin«, überlegte Ben und goss sich großzügig ein.
»Und wer soll das sein?«
»Helene.«
»Das kannst du Helene nicht antun, Vater! Ich weiß ja nicht, wie diese Hildegard so drauf ist, aber vielleicht rennt sie Helene die Bude ein und wirft ihr Beleidigungen an den Kopf oder …«
»Genau der Typ ist sie! Der Typ Krawalltüte! Was meinst du denn, warum ich ihr aus dem Weg gehe?«
»Und dann willst du ihr Helene zum Fraß vorwerfen? Sie ist schließlich nur deine Nachbarin …«
»Und eine gute Freundin!«
»Eben! Gerade deshalb würde ich sie aus dieser Geschichte heraushalten. Das wäre nicht fair ihr gegenüber.«
»Helene hat Humor.«
»Aber wohl kaum diese Art von Humor.« John dämmerte es langsam, wie sein Vater sich die Geschichte dachte. Er fragte argwöhnisch: »Willst du dich etwa aus dem Staub machen? Einfach abhauen? Und was soll ich mit Hilde anfangen, wenn du nicht da bist?«
»Du segelst doch morgen, oder nicht? Dann bist du ja sowieso nicht zu Hause. Und ich fahre nach Flensburg zurück.«
»Ich fasse es nicht!« John schwankte zwischen Lachen und Empörung. »Ein erwachsener Mann von achtundsiebzig Jahren verdrückt sich von der Insel, um einem Flirt aus dem Wege zu gehen, den er selbst angezettelt hat! Und ich soll es ausbaden. Und was ist mit Sonntag? Soll ich etwa das Fräulein Hilde zum Tanztee führen?«
»Sie will mich kaschen«, sagte Ben und wühlte in seinen Haaren. »Ich finde das nicht zum Lachen, John! Ich habe einfach keine Lust auf lange Diskussionen. Und ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass ich nicht darauf aus bin, eine neue Partnerin zu finden. Aber auf dem Ohr ist sie taub, was soll ich machen? Du weißt genau, dass ich schlecht nein sagen kann, im Gegensatz zu dir. Ich will sie ja nicht verletzen. Vielleicht weiß Helene Rat. Frauen sind immer so viel raffinierter als wir armen Deppen.«
»Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, mein Lieber!« John schüttelte mit gespielter Entrüstung den Kopf. »Versteckt sich hinter einem Weiberrock …« John musste schon wieder gegen das Lachen ankämpfen.
»Fest steht, dass ich morgen den ersten Zug ans Festland nehme, das kann ich dir sagen.«
»Was, den um halb fünf? Flucht in finsterster Nacht? Das wird dir nicht viel nützen«, neckte ihn John, »wenn ich Hilde deine Flensburger Adresse gebe. Und die Nummer deines Handys kennt sie ja sowieso schon.«
»Das schmeiß ich in die Förde! Und untersteh dich!«
Ben rannte davon wie ein gehetztes Reh – vermutlich ins Bett, da er am nächsten Tag ja früh rauswollte. John trank grinsend seinen Rotwein aus und legte zum Abschluss eine Platte von Leonard Cohen auf. Er hoffte nur, dass er morgen schon weit draußen auf dem Meer sein würde, wenn diese Hildegard wieder anrief und nach »Bikäj« verlangte.
Ihm war, als fieberte er. Doch seine Füße waren eisig, die Zehen vermutlich gebrochen, der Sturm hatte seinen Spaß daran, ihn gegen den Leuchtturm zu kegeln. Die Anzahl der Möwen hatte sich verdoppelt, ihr Geschrei verzehnfacht.
Kein Licht mehr da. Kein Trost. Kein Gott.
Er dämmerte vor sich hin, halb verrückt vor Kälte und Schmerzen. Er befahl seinem Körper zu sterben, er gab auf. Er wünschte sich nur noch einen sanften Tod, einen tiefen Fluss, der ihn davontrug wie ein Herbstblatt.
Tapp tapp, da waren sie wieder, die Gänse, die toten, tapp tapp … Oder waren es Schritte, in der Nacht, in den Dünen? Schritte, die leise die Stufen zum Quermarkenfeuer hinaufstiegen? Solide Stufen, aus Bohlen zusammengefügt, dem Meer aus den nassen Fängen geklaut … Alles behält es nicht, das Meer, auch das hatte er schmerzhaft erfahren müssen.
Zweifellos, jemand näherte sich, die hölzerne Plattform knarrte, er sah einen dunklen Schatten. Die Gestalt starrte ihn an, das Gesicht im Schatten der Kapuze verborgen. Vier Schädel, klein wie Affenschrumpfköpfe, sprossen wie Ehrenabzeichen auf der Brust. Ihre Augen bewegten sich wild, rollten wie Murmeln in alle Richtungen, die zischenden Münder drohten.
Wer war diese Gestalt? Seine Mutter, ein Gonger, ein Wiedergänger? Aus den Tiefen der See gestiegen, um ihn zu holen? Der schwarze Vogel Tod beugte sich über ihn, stieß ihn an wie ein Kind auf der Schaukel. Die Köpfe, plötzlich zu riesigen Hagebutten mutiert, fielen herunter; sie platzten auf seinem Gesicht und entließen Ströme von Blut. Wieder und wieder flog er durch die Luft, wieder und wieder klatschte er gegen den Metallkorpus des Turms.
An diesem Strand, an diesem Meer gab es keine Hilfe, kein Erbarmen mehr für ihn.
Kapitel 2
Zwei Wochen vorher
Was er draußen am Horizont sah, erinnerte ihn an ein Aquarell, das Peggy gemalt, dann aber aus unerklärlichen Gründen zerstört, zerfetzt, zerschnitten hatte, mit einem Messer aus ihrer eigenen Küche. So hatte er sie eines Abends gefunden, über das Bild gebeugt, in Tränen aufgelöst, schluchzend.
Eine Erklärung hatte sie ihm nie gegeben.
Das Bild war so schön gewesen, dass es ihm wehtat, es anzusehen. Und nun hatte er Peggys Vorlage gefunden, völlig unerwartet, in diesem Land, an diesem sonderbaren Meer. Das Bild war ganz in Blau getaucht, schimmernd wie Seide, von mattem Glanz, changierend. Das verheißungsvolle Blau eines dunstigen Sommertages. Indigo, Ultramarin, Kobalt, Marine, verschiedene Schichten von Blau, verwoben durch einen genialen Pinselstrich, der ihn vor Sehnsucht taumeln ließ. Das Bild erweckte den Wunsch, sich bis zum Grund in dieses tiefe Blau zu stürzen, sich zu verlieren in den Tiefen der See. Immer, wenn er Peggys Aquarell betrachtete, hatte er wieder das Meer auf den Lippen gespürt und das kühle, lichtdurchflutete Wasser auf seiner Haut. Und dann, eines Tages, hatte sie es zerstört, voller Trauer und Wut. Und ihr Tod hatte ihn ratlos zurückgelassen.
Leif Harding blinzelte in die Sonne.
Nun hatte er Peggys Motiv gefunden. Hier an dieser Mole, auf dem Weg zu den Nordfriesischen Inseln. Meer und Himmel vereinigten sich in perfekter Harmonie; der Dunst eines heißen Sommertags hing über dem blauen Horizont. Fast unmerklich lösten sich zwei weiße Punkte vom Himmel, zart hingetupft ins Blau, luftig wie Watte. Zwei Schiffe, eins hinter dem anderen. Auf Pegs Bild war es ein Segler gewesen, eine Bark mit geblähtem Rahsegel, hier waren es, so sagte ihm sein Verstand, zwei Fähren, die Menschen und Fracht zu den Inseln brachten.
Er beobachtete, wie die weißen Tupfen allmählich näher kamen, an Kontur gewannen und sich zu Schiffen materialisierten. Langsam schwebten sie auf den Anleger zu. Er hörte kaum ein Geräusch, nur die Wellen glucksten gegen die Mole.
Harding schaute sich um. Hinter ihm standen fünf Reihen vollbepackter Autos. Die Reisenden waren ausgestiegen und beobachteten die Anlegemanöver der beiden Fähren. Sie nippten an ihren Kaffeebechern oder Wasserflaschen, rieben sich mit Sonnencreme ein, Hunde bellten erwartungsfroh. Auf einem kleinen Spielplatz direkt am Meer kletterten Kinder auf einem Gerüst herum. Dann fuhr der Zug ein, der mehrmals täglich Urlauber zu den Fähren brachte.
Harding stand mit seinem Gepäck an Tor 3 und beobachtete das Schiff, das gerade anlegte. Es war voller Feriengäste, deren Urlaub zu Ende ging. Zuerst strömten die Fußgänger über die Brücke, danach kamen die Autos. Viele trugen Räder auf dem Dach. An den Fenstern klebten die Gesichter von Kindern, Hunden, Teddybären, die man noch irgendwie zwischen das Restgepäck von Kleidern und schmutziger Wäsche gestopft hatte.
Das Beladen der Fähre ging überraschend schnell. Harding suchte sich auf dem Sonnendeck einen Platz an der Reling. Die Luft roch würzig nach Salz und Algen. Fast unmerklich legte die Fähre ab.
Er versuchte, noch einmal abzutauchen in seinen Traum. Es schien ihm so unwirklich, dass er jetzt hier war – vorgestern noch in Kalifornien, am Strand des Pazifiks, in Hermosa Beach, wo er und Peg gelebt und ihre Praxis geführt hatten – und nun war er hier, ohne Peg, auf einer Reise in die Vergangenheit. Hätte sie sein Unternehmen gebilligt? Er wusste es nicht. Viermal war sie mit ihm nach Deutschland gefahren, aber nie in den Norden, aus dem sie stammte. Er wusste nicht warum. Es gab Themen in Pegs Leben, über die sie nicht gesprochen hatte – so offen, warmherzig und spontan sie sonst auch gewesen war. Er hatte es respektiert, all die Jahre lang. Und nun war es vielleicht zu spät, diesen Teil ihres Lebens kennenzulernen.
Ein roter Ball rollte auf ihn zu, mechanisch kickte er ihn zu dem kleinen Mädchen zurück, das ihn verloren hatte. Ein Hund lief vorbei. Er schloss die Augen, der Sonne zugewandt. Zum ersten Mal seit Wochen war er entspannt; es war, als spülte ihn eine Welle hinaus aufs Meer, fort von den Menschen und diesem weißen Schiff. Nur noch er und Peggy existierten irgendwo im All, allein auf ihrem Stern.
Wie seltsam das Leben spielte. Hätten sie die reiche Mrs. Hurst nicht als Patientin gewonnen, hätte die alte Dame nicht einen Horror vor Krankenhäusern gehabt, hätte Peggy nicht eingewilligt, zwei Tage und Nächte in ihrem Haus zu verbringen, um alle drei Stunden ihren Augendruck zu messen, hätte Mrs. Hurst nicht an der Steilküste in Palos Verdes gelebt, dann …, ja dann wäre seine Frau heute noch am Leben. Und er wäre nicht hier, zusammen mit Pegs Tagebüchern, die er sich bisher nicht getraut hatte zu lesen. Und die er jetzt lesen würde, an einem Ort, wo er sich ihr nahe fühlte – wenn er den Mut dazu aufbrächte. Er wünschte sich so sehr, Peg wäre jetzt mit ihm hier. Er hatte es immer schwer gefunden, Schönheit ganz allein zu ertragen, er hatte sie immer teilen wollen. Zu viel Schönheit bedrückte ihn, ebenso wie zu große Weite, zu viel Freiheit. Hier war all dies vorhanden.
Er öffnete die Augen. Auf der rechten Seite zog sich eine lange, große Insel hin, gesäumt von einem leuchtenden Sandstrand. Links, als bräunlich-graue Silhouette im Dunst, war ebenfalls Land zu sehen, ein schmaler, flacher Streifen, auf dem sich in unregelmäßigen Abständen so etwas wie Hügel erhoben. Diese Inseln erinnerten Harding ganz lebhaft an die Zeichnung in »Der kleine Prinz«, die eine Riesenschlange zeigt, die einen Elefanten verschlungen hat. Natürlich wusste er von Peggy, dass diese Inseln »Halligen« hießen und die Hügel »Warften«, und dass auf den Warften die Häuser standen. Die Halligen, hatte Peggy erzählt, besaßen keine Deiche – oder nur sehr niedrige Sommerdeiche –, so dass sie mehrmals im Jahr von der Nordsee überflutet wurden. Um die Häuser und Viehställe zu schützen, hatte man die Warften errichtet, in der Hoffnung, so hoch würde das Wasser nicht steigen. Und seltsamerweise funktionierte es auch. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hatte es einige Sturmfluten gegeben, das Wasser war von Mal zu Mal höher gestiegen, aber Menschenleben waren nicht zu beklagen. Er hatte ein Foto gesehen, das ihn tief beeindruckt hatte. Auf den Halligen war »Land unter« gewesen, was bedeutete, dass alle Wiesen und Viehweiden überflutet waren. Die Nordsee hatte diese letzten Bastionen im Meer mal wieder zu ihrem ureigensten Territorium gemacht und begonnen, auch die Warften zu erklimmen. Doch die Kühe, an diesen Zustand gewöhnt, hatten seelenruhig ihren Weg durchs Wasser gefunden, im Gänsemarsch, hinauf auf die rettenden Warften. Offenbar, dachte Harding, brauchte man eine ganz besondere Mentalität, eine tiefe Verbundenheit zu der unwirtlichen, manchmal gewalttätigen Natur, um hier leben und überleben zu können. Vielleicht sog man sie bereits mit der Muttermilch ein.
Er öffnete seinen Rucksack und nahm eins von Pegs Tagebüchern – schmucklose, schwarz eingebundene Hefte – in die Hand, öffnete es aber nicht. Er hatte noch nie darin geblättert. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, sie auf die Reise mitzunehmen. Vielleicht würde er hier eine ganz andere Peggy kennenlernen …
Vielleicht, vielleicht …
Ein Gefühl stieg in ihm auf, das er, wenn er es nicht besser gewusst hätte, fast mit Angst verwechselt hätte.
Astrid Faraday war gereizt, ungeduldig, erschöpft, aber dennoch hyperaktiv. Zumindest innerlich. Es schien, als schlage ihr Herz doppelt so schnell und doppelt so intensiv wie sonst, als flösse ihr Blut mit Highspeed durch die Adern, als dribbelten ihre Füße mit der Vehemenz eines jungen Hundes, dem ein langer Spaziergang versprochen worden war, auf und ab. Es fiel ihr schwer, sie ruhig zu halten. Zu lang schon hatte sie sie nicht bewegen können; erst die lange Fahrt im Auto von London durch den Eurotunnel und später die Küste hoch, das manierliche Sitzen am Kaffeetisch ihrer Mutter und dann am Krankenbett ihres Vaters in der Klinik, und jetzt die Überfahrt auf der Fähre. Ihr war danach, am Strand entlangzulaufen, die frische Meeresbrise einzuatmen und ihre heißen Füße dem Meeresschlick anzuvertrauen, dann, hatte sie den Eindruck, könnte sie das Leben vielleicht wieder ertragen. Zumindest wäre es ein Anfang. Und niemand würde sie davon abhalten, dieses Programm heute Nachmittag durchzuziehen!
Mit verhaltener Aggression betrachtete sie ihren Mann Andrew, der ihr auf der Bank gegenübersaß. Er hatte sich mal wieder verstöpselt, hatte abgeschaltet, war unansprechbar, die Augen geschlossen. Vermutlich hörte er die Stones oder die Dire Straits, seine Reminiszenz an die 1970er-Jahre.
Lisi, ihre Tochter, nervte Astrid ebenfalls. Entweder redete sie unentwegt oder sie kickte ihren roten Ball vor die Füße fremder Leute. Außerdem musste sie ständig im Auge behalten werden, damit sie nicht auf die Reling kletterte und acht Meter tief ins Wasser fiel. Jetzt allerdings saß sie neben Astrid auf der Bank und fütterte einen Hund mit kleinen Salzbrezeln. Der Hund, ein schwarzer Labrador, hechelte und schien zu grinsen. Jedenfalls sah man alle seine zweiundvierzig Zähne. Offenbar ein freundlicher Hund. Von seiner Zunge tropfte es auf Astrids Fuß.
»Hör auf, den Hund zu füttern, Lisi«, sagte Astrid. »Hunde vertragen kein Salz.«
»Warum?«
»Weil ihr Stoffwechsel das nicht verträgt.«
»Warum?«
»Himmel, Salz ist nicht gut für ihre Nieren!«
»Warum? Haben Hunde andere Nieren als wir? Ich darf doch auch Salz essen. Mama!«
Astrid atmete tief ein. »Lisi, tu einfach ausnahmsweise mal das, was ich dir sage. Du willst doch nicht, dass dieser nette Hund krank wird, oder?« Sie zog die Sandalen von den Füßen, streckte die Beine aus und schloss die Augen. Neben sich hörte sie Lisi in ihrem Rucksack kramen, dann die Kaugeräusche des Hundes. Astrid riss die Augen auf. Lisi fütterte ihn mit dem Brot, das von gestern noch übrig geblieben war.
»Wolletolle mag Leberwurst!«, sagte Lisi und betrachtete ihren Schützling wohlwollend.
»Die Töle da heißt Wolletolle?«, fragte Andy, der offenbar kurz unter den Lebenden weilte.
Wie erwartet, kochte Lisi vor Empörung. »Er ist keine Töle, Papa, sondern ein ganz lieber Hund! Und ich will auch so einen haben, das wisst ihr ganz genau, schwarz und mit einem roten Tuch um den Hals! Und ihr seid wirklich gemein, wenn ihr mir keinen kauft!«
»Schrei nicht so«, sagte Astrid zu Lisi und gab ihrem Mann einen leichten Fußtritt. »Wolletolle guckt schon ganz erschrocken.«
Da ihre Tochter drauf und dran schien, dieses ewige Streitthema wieder einmal durchzukauen, kramte Astrid hastig in ihrer Tasche nach Geld und beauftragte Lisi, für alle drei ein Eis zu holen.
»Wolletolle isst auch gerne Eis!«
»Meinetwegen«, sagte Astrid erschöpft. Lisi zog ab, den Hund auf den Fersen. Astrid schaute sich um. Wer waren eigentlich die Besitzer dieses Hundes, der ganz sicher nicht Wolletolle hieß, und warum kümmerten sie sich nicht um ihn? Sie fing den Blick eines Mannes auf, der allein auf einer der kurzen Bänke an der Reling saß. In seinen graublauen Augen las sie Verständnis und eine leicht ironische Freundlichkeit. Offenbar hatte er alles mitbekommen und dachte sich seinen Teil. Sie legte ihren Rucksack neben Andy, der wieder abgedriftet war in seine Musik, legte ihre Beine darauf und genoss die Meeresbrise, die ihre Füße kitzelte.
Sie fragte sich, ob es richtig gewesen war, herzukommen. Sie sorgte sich um Andy. Er tat immer so cool, als sei er ein Fels in der Brandung, doch sein Magengeschwür hatte er ihr so lange verheimlicht, bis er Blut spuckte. Sie hatte sich Vorwürfe gemacht, dass sie seinen Zustand nicht erkannt hatte. Inzwischen ging es ihm besser, dennoch hatte sie Angst. Er war so viel verletzlicher, als sie gedacht hatte. Vielleicht sollte man die ganze Sache ruhen lassen. Mehr als dreißig Jahre lang war Gras darüber gewachsen, sollte man es nicht dabei belassen? Warum in alten Wunden rühren? Doch dann dachte sie an ihren Vater, der seit damals ein gebrochener Mann war. Er hatte sich nie erholt. Sicher, er arbeitete hart, zwölf Stunden am Tag, er sorgte für die Familie, er lachte und scherzte, aber ein Teil von ihm blieb unberührt, als säße in seinem Herzen ein Krebsgeschwür, das Jahr für Jahr weiterwucherte.
Kurz bevor sie von London aufgebrochen waren, hatte sie die Nachricht erhalten, dass ihr Vater eine Herzattacke erlitten hätte und in Flensburg auf der Intensivstation läge. Es stellte sich zwar heraus, dass es nur der Kreislauf gewesen war, aber für Astrid war es ein Warnzeichen gewesen. Wenn sie etwas für ihren Vater tun wollte, dann musste es jetzt sein, solange er noch etwas davon hatte. Sie hatte schon vor Monaten alles mit Andy besprochen, und er war auf ihrer Seite gewesen, loyal wie immer. Sie betrachtete ihn liebevoll, immer noch seltsam durchmischt mit einem Anflug milder Aggression, weil er so gut abschalten konnte und imstande war, unangenehme Dinge aus seinem Bewusstsein auszublenden. Ihr war das nicht möglich. Sie musste immer einen Plan haben und für den Fall, dass er nicht funktionierte, einen zweiten Plan und einen dritten, sie musste alles durchsprechen bis ins kleinste Detail, am besten sogar aufschreiben. Sie war groß darin, Listen zu machen; Listen gaben ihr Sicherheit. Ihr Mann war in diesem Punkt das genaue Gegenteil von ihr, unbekümmert, bereit zu improvisieren. Schlagfertig, phantasiebegabt. Sie beneidete ihn darum, fand sein Verhalten aber nicht richtig. Schon gar nicht in diesem Fall. Da musste man sich die Argumente sorgfältig zurechtlegen und Druck ausüben; sie brauchten eine Strategie, denn ihr Gegner, so schien es ihr, war übermächtig. Und immer noch suchte sie nach einer wirksamen Drohung, mit der sie ihn einschüchtern konnte.
Astrid sah sich nach Lisi um, aber von ihrer Tochter war nichts zu sehen. Der einsame Mann auf der Bank an der Reling, der offenbar allein reiste, schien seinen Gedanken nachzuhängen; er betrachtete die vorbeiziehenden Halligen, als träumte er sich dorthin, als sähe er etwas auf den Wiesen und Warften, das nicht da war und das seine Phantasie dort ansiedeln musste. Er hatte ein gutes Gesicht: etwas eckig und kantig, eher hager, ein breites Kinn, eine schmale Nase, ein ausdrucksvoller, sensibler Mund. Die hellen Augen und die kurzen blonden, von Grau durchsetzten Haare passten in diese Landschaft, zu diesem nordfriesischen Menschenschlag, aber sie meinte gehört zu haben, dass er Englisch sprach. Vielleicht gehörte er zu jenen, deren Vorfahren nach Amerika ausgewandert waren. Die Nachfahren dieser Auswanderer besuchten auch heute noch ihre Verwandten auf den Inseln.
Astrid bemerkte, dass sich Andys Füße, die neben ihr auf dem Rucksack lagen, bedrohlich röteten. Sie holte die Sonnenmilch heraus und cremte seine Füße ein, was ihr Mann mit einem kurzen Lächeln quittierte. Dann sah sie sich nach Lisi um.
Weder ihre Tochter noch der Hund waren irgendwo zu sehen.
Leif Harding merkte, dass er eingenickt war, und riss sich zusammen. Er sah, dass sie sich der Insel mit dem Sandstrand näherten. Er konnte viele Häuser erkennen, Ferienwohnungen am Strand, Hotelanlagen, im Hafen Segelschiffe, Jollen, Katamarane, erstaunlich viele Bäume; Menschen, die am Strand Ball spielten oder sich im Wasser gegenseitig untertauchten. Die Zwillingsfähre, die vor ihnen fuhr, schwenkte in die Fahrrinne zur Insel ein, aber sein eigenes Schiff hielt den Kurs und ließ die Insel – die Föhr hieß, wie er auf seiner Karte erkannte – rechts liegen. Es schien eine große, grüne Insel zu sein. Häuser und Dächer lugten zwischen Baumwipfeln hindurch, überragt von zwei Kirchtürmen mit hellem Satteldach. Am schneeweißen Strand, der mehr und mehr in die Ebbe überging, galoppierten Reiter. Hinter diesen Impressionen vom Ferienfrieden an einem schönen Spätsommertag produzierte sein Gehirn jedoch ein ganz anderes Bild: eine graue, steinige Bucht, eine gewundene Holztreppe, die sich steil eine Klippe hinaufwindet, ein Mensch, der kopfüber hinunterstürzt, unten liegen bleibt wie eine zerbrochene Puppe, ein Haufen Lumpen …
Er öffnete die Augen, schüttelte diese Vorstellung von sich ab. Er hatte sie oft, besonders nachts, wenn er nicht schlafen konnte, wenn er weit draußen den Pazifik rauschen hörte und das Bettzeug an seinem Körper klebte. Aber er wusste, so war es nicht gewesen. Nicht ganz so. Peggy war zwar auf der Treppe zum Strand in Palos Verdes einige Stufen hinabgestürzt, aber sie war wieder aufgestanden, nichts war gebrochen; es gab nur ein paar blaue Flecken, Abschürfungen, Schwindel und Kopfschmerzen. Nichts davon hatte sie besonders ernst genommen. Sie hatte sich von Mrs. Hurst verabschiedet, war in den Wagen gestiegen und zu ihm in die Praxis nach Hermosa Beach zurückgekehrt. Sie hatten sich zehn Minuten Zeit genommen, um gemeinsam einen Eiskaffee zu trinken. Über den Abend hatten sie gesprochen, darüber, ob sie essen gehen sollten oder ob Peg einfach zwei Teriyaki-Steaks auf den Grill legen und einen ihrer saftigen Salate dazu machen sollte. Und wie so oft hatten sie sich für den gemütlichen Abend in ihrem kühlen Garten entschieden, inmitten der zahlreichen Hortensien, der Bougainvilleen, der Papageienblumen, mit den Füßen im kleinen Seerosenteich planschend; dazu eisgekühlten Tee unter den fliederfarbenen Blüten des Jacarandabaums, der in diesem Frühjahr besonders schön blühte, mit den heiteren Klängen von Vivaldi im Hintergrund. Am Horizont glitzerte das blaue Band des Pazifiks. Wenn sie Glück hatten, würde sich am Abend die rote Sonne ins Meer stürzen wie der Softball in die Hand des Fängers.
Den Sturz hatte Peggy nicht erwähnt.
Dann kam Mr. Kowalski. Da er starker Diabetiker war, mussten seine Augen alle paar Monate kontrolliert werden. Auch Peggy hatte Patienten zu behandeln. Als er sie das nächste Mal sah, herbeigerufen von einer aufgeregten Patientin, lag sie reglos auf dem Boden ihres Behandlungsraumes. »Sie ist einfach zusammengebrochen, Doktor«, hatte Mrs. Klein fassungslos gesagt, »eben stand sie noch da und hat mit mir gelacht, und im nächsten Augenblick fällt sie einfach um.«
Eine Stunde später war seine Frau im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles an zerebralen Blutungen gestorben. »Völlig unerwartet«, wie die gängige Formel lautete. Sie hatte das Bewusstsein nicht mehr wiedererlangt. Seit diesem Tag vor etwas mehr als zwei Jahren war seine Welt eine andere geworden, eine feindliche Aneinanderreihung von dunklen, befremdlichen, nicht enden wollenden mühseligen Tagen, und er selbst in einem Vakuum schwebend, grau, farblos, ohne jede Erdung.
Wieder knallte der rote Ball gegen seinen Fuß und ließ ihn hochschrecken. In die Menschen an Deck war Unruhe gekommen, sie liefen hin und her. War etwa schon die Insel in Sicht?
»Lisi?«
»Was ist?«
»Bring den Hund zu seinen Leuten zurück, wir müssen gleich zum Auto. Wir sind fast da.«
Lisi seufzte abgrundtief. Dann hockte sie sich auf den Boden und begann, den Hund zu streicheln.
»Bitte, Lisi«, sagte Astrid gequält. »Seine Besitzer vermissen ihn sicher schon. Du kannst nicht einfach einen fremden Hund adoptieren.«
»Aber meinetwegen kannst du sie fragen, ob du mit Wolletolle spazieren gehen darfst«, sagte Lisis Vater.
Astrid und Andrew Faraday standen an der Reling des Zwischendecks. Ihre Sachen hatten sie zusammengepackt, sie waren auf dem Weg zum Auto. In Kürze würde die Fähre am Anleger von Wittdün festmachen. Astrid spürte Andys Arm um ihre Schultern, die Wärme seiner Haut. Die feste Umklammerung tat ihr gut. Ihr Gesicht war starr, fast weiß. Da in dieser Ecke des Schiffs ein starker Wind wehte, kramte sie ein Haargummi aus ihrer Tasche und band ihre langen, dunklen Haare hastig zum Pferdeschwanz. Die Südspitze von Amrum mit den hohen Dünen und den kleinen roten Ferienhäusern, deren Silhouette sie seit einer halben Stunde am Horizont gesehen hatte, war nach einer Drehung der Fähre plötzlich erschreckend nah. Astrid, die diese Insel seit Jahren nicht mehr betreten hatte, fühlte den harten Schlag ihres Herzens. Wieder einmal fragte sie sich, ob sie sich nicht zu viel vorgenommen hatte. Am liebsten wäre sie auf dem Schiff geblieben und gleich wieder zurückgefahren. Auch Andy sah angespannt aus. Bisher hatte sie angenommen, dass er nur ihretwegen zurückgekommen sei. Was aber, wenn er eigene Pläne hatte? Was, wenn die dunkle Wolke der Schwermut noch immer über ihm lag und ihn zum Handeln trieb? War das überhaupt möglich? Waren depressive Menschen nicht eher passiv, ohne Antrieb? Nein, Angst hatte sie nicht, nicht um sich selbst. Aber was wäre, wenn Andy …
»Ich darf Wolletolle besuchen«, sagte Lisi, die plötzlich wieder aufgetaucht war, und packte Andys Hand. »Aber zuerst musst du ihm ein rotes Tuch kaufen. Los!«
Die Insel kam ihr vor wie aus einem Traum gestiegen. Wie oft hatte sie den rot-weißen Leuchtturm gesehen, die bunten Bauerngärten, den Wald, reetgedeckte alte Häuser mit Malven, die bis ans Dach reichten, blühende Heideflächen, Kinder in kurzen Hosen, die sich ins Gras warfen, lachend, lechzend nach Abenteuern. Und doch war sie nachts aus dem Schlaf gefahren, hatte ihren Herzschlag im Hals gespürt und kalten Schweiß auf der Haut. Der Frieden war nur äußerlich gewesen, von innen ausgehöhlt, sabotiert. Ihr war auf einmal klar, dass ihre und vor allem Andys Gelassenheit, die vermeintliche Kontrolle ihrer Gefühle, nur Fassade war, ein fragiles Gebilde, das jederzeit zusammenbrechen konnte.
Verstohlen betrachtete sie vom Beifahrersitz aus das Profil ihres Mannes. Wie ging es ihm jetzt? Er wirkte still, gefasst, als habe er sich ergeben. Astrid musste gegen eine Übelkeit ankämpfen, die nichts mit ihrem Magen zu tun hatte. Es war, als würden durch die geöffneten Fenster die Gase von Fäulnis und Bosheit in den Wagen eindringen und ihr das Atmen erschweren. Dabei war die Insel so schön. Der Tag war mild, ein herrlicher später Augusttag, und Lisis aufgeregte Quirligkeit erinnerte an einen bunten Kolibri, der glücklich an einer Blüte nascht. Doch Astrid war es, als lebte sie in einem ihrer gewohnten Albträume: Ein großes Passagierflugzeug am Himmel nähert sich bedrohlich, kommt ins Trudeln, brennt, sie erkennt offene Münder an den Fenstern, entsetzte Augen, sie läuft und läuft und weiß doch, der Flieger ist schneller. Mit aufheulenden Motoren stürzt er ab, auf Lisi, Andy und sie selbst.
Das kleine Haus, vor dem sie schließlich hielten, war idyllisch: roter Backstein, ein reetgedecktes Dach, innen mit skandinavischen Möbeln gemütlich eingerichtet, dahinter lag ein großer Garten mit Schaukel, Spielturm, Kletter-Kamin. Lisi stürzte sich mit einem Freudenschrei auf die Schaukel. Zusammen mit Andy räumte Astrid den Wagen aus. Sie sprachen nicht viel, wagten kaum, sich anzusehen. Nur einmal, im Vorbeigehen, ließ Andy seine warme Hand für ein paar Sekunden tröstend in ihrem Nacken ruhen.
Nach dem Auspacken und Einräumen gingen Lisi und Andy auf die Suche nach einem roten Tuch, und Astrid konnte endlich ihre Joggingsachen anziehen. Sie lief los, den Smäswai hinunter Richtung Wald und durch die Dünen zum Strand. Ihr Gesicht versteckte sie hinter einer großen Sonnenbrille – obwohl niemand sie erkennen würde, nach so vielen Jahren. Zumindest hoffte sie das.
Um einen Ort, da war sie sich sicher, würde sie einen großen Bogen machen. Nicht aus Angst. Aber noch war die Zeit nicht gekommen.
Schönheit, pure, reine Schönheit, ging es Harding durch den Kopf, als er in seiner Ferienwohnung auf dem Balkon stand und übers Meer blickte. Wieder kam er sich vor, als sei er losgelöst von dieser Welt, von allem, was ihn bedrückte, als schwebe er in Raum und Zeit, sinnlos, ziellos, aber glücklich. Kalifornien? Hermosa Beach? Der lange Flug nach Deutschland? Das war in einer anderen Zeitdimension gewesen. Jetzt war er angekommen, an einem Punkt weit jenseits der Vergangenheit. Die Schönheit dieses silbernen Meeres perlte wie Champagner auf seiner Haut.
Eine bessere Wohnung hätte er gar nicht finden können. Er hatte sie sich im Internet besorgt, nachdem er kurzfristig beschlossen hatte, sich nicht länger vor dieser Reise zu drücken. Das rote Backsteinhaus an der Südspitze der Insel stand auf einer Düne direkt an der See. Von dieser hohen Warte aus hatte er einen Panoramablick auf das Meer und die Halligen. Eine Formation weißer, plastischer Wolken, in schweren Schichten in- und übereinandergeschoben, so dass sie aussahen wie dicke Gebilde aus Sprühsahne, hing über dem Meer und gab dem Raum Ausdruck und Tiefe. Ein winziges Segelboot am Horizont nahm sich in dieser Theaterkulisse aus wie ein Zwerg, der jede Sekunde Gefahr lief, von diesen Wolken in die Tiefe gedrückt zu werden. »Unsere Wolken sind die Kathedralen des Nordens«, hatte Peg einmal gesagt, indem sie irgendjemanden zitierte. Nun konnte er diese Aussage nachvollziehen.
Er war kurz im Ort gewesen, jetzt saß er auf dem Balkon und ließ den weichen Wind durch seine Haare wehen. Ein Kitesurfer segelte auf dem Wasser zwischen dem Inselrand und dem mächtigen, weißen Ausläufer der Sandbank, die vor der Südspitze lag und sich als eine riesige Sandwüste an die Insel schmiegte – ein Strand des grenzenlosen Lichts und der Freiheit, wie ein Dichter es einmal ausgedrückt hatte.
Ein kleiner, zäher, hartnäckiger Gedanke in seinem Hinterkopf flüsterte ihm zu, sich auf die Balkonbrüstung zu stellen und abzuheben und einzutauchen in diese reine, tiefe Schönheit, in diese weite, magische Kulisse von Wolken und See. Fast wollte er glauben, es könnte gelingen; er könnte dort draußen wohnen, in diesem Niemandsland, im Dunst über dem Horizont, und die See würde ihn nicht in die Arme nehmen wollen, die Wolken ihn nicht zärtlich zudecken, ehe sie ihn fallen ließen.
Nein, er wollte sich nicht davonträumen in imaginäre Welten. Er war hier, weil er, neben allem anderen, etwas ganz Prosaisches zu tun hatte: Er wollte Pegs letzten Verwandten aufspüren, ihren Maler-Onkel, von dem sie ihm einige Male erzählt hatte. Fast schien es, als wäre er der einzige Mensch außer ihm selbst gewesen, an dem ihr etwas gelegen hatte. Der Letzte der Familie. Das Dumme war nur, dass Harding keine Ahnung hatte, wie er hieß. Außer seinem Spitznamen wusste er nichts. Es gab keine Adresse. Telefoniert, das wusste Harding, hatte Peggy nie mit ihm, nur mal erwähnt, dass er hier auf einer der Inseln lebte. Aber ob sie ihm je geschrieben, je einen Brief von diesem Onkel erhalten hatte? Er wusste es nicht. Wenn, dann hatte sie die Briefe nicht aufgehoben. Vielleicht hatte dieser Onkel auch nur noch in ihrer Phantasie gelebt, hatte das Märchenland ihrer Kindheit bevölkert, denn die Geschichten, die sie von ihm erzählte, gingen auf lang vergangene Zeiten zurück. Er wusste, dass er jahrelang zur See gefahren und dann Maler geworden war. Ein schweigsamer, eigenbrötlerischer Typ, der vor seiner Staffelei stand und in stummer Raserei flammende Farben auf die Leinwand warf, so hatte Peggy erzählt. Zwischendurch raste er immer wieder zum Klavier, spielte donnernde Akkorde, kehrte zur Staffelei zurück und malte wie besessen das Meer, immer nur das Meer. Ihren Drang zu malen hatte Peg auf ihn zurückgeführt. Sie war zutiefst beeindruckt gewesen von diesem Onkel.
Harding wollte ihn kennenlernen, diesen letzten Verwandten. Nicht nur, weil er ihm die Nachricht überbringen musste, dass Peggy nicht mehr lebte. Er war vielleicht auch der Schlüssel zu Pegs früherem Leben, von dem er so wenig wusste. Ein Leben, das offenbar im Verborgenen stattgefunden und das sie totgeschwiegen hatte – seine sonst so offene, rückhaltlos ehrliche Frau. Immer wieder überfiel ihn die Erinnerung an Peg, wie sie schluchzend vor dem zerstörten Aquarell gesessen hatte, das Messer in der Faust. Warum, fragte er sich, waren sie nie gemeinsam hierher ans Meer gefahren, eine Landschaft, die Peggy doch offensichtlich liebte? Warum hatte sie nie den Wunsch verspürt, ihren Onkel zu besuchen, an den sie doch gute Erinnerungen hatte? Harding fühlte, dass er unter die Vergangenheit keinen Schlussstrich ziehen konnte, ohne diese Fragen geklärt zu haben. Irgendwo musste er anfangen, und so war es eben Amrum, die kleinste der Nordfriesischen Inseln. Hier kannte jeder jeden, vielleicht war hier die Aussicht am größten, jenen Mann zu finden, von dem er nur den Spitznamen »Lobbe« kannte. Mit seinen Deutschkenntnissen, so hoffte Harding, würde er wohl einigermaßen durchkommen. Peggy hatte ihn ihre Sprache gelehrt, aber zur Sicherheit hatte er sich noch einen Sprachführer zugelegt und bereits im Flugzeug neue Vokabeln gelernt. Nur Plattdeutsch würde er nicht verstehen können.
Er stand auf und holte das Telefonbuch.
Kapitel 3
Der Tote am Quermarkenfeuer erinnerte Benthien an ein frühes Erlebnis aus seiner Kindheit. Als er ungefähr vier Jahre alt war, hatten sie an Fasching Verwandte in Rottweil besucht. Sie hatten den Umzug gesehen und waren auf dem Heimweg, als es dämmerte. Plötzlich war aus einem Torbogen eine Gestalt auf sie zugesprungen, um, wie ihm schien, seine Mutter anzugreifen. Eine Gestalt mit einer entsetzlichen Fratze … – die Nase lang und rüsselförmig, auf der Stirn nur ein einziges Auge, das ihn anglotzte, hervorquellend, schielend, mit verdrehter Pupille. Für ihn, den Vierjährigen, war es der Teufel schlechthin. In den folgenden Nächten hatte er Albträume. Später lernte er, dass man diese Gestalten aus der griechischen Mythologie – gottähnliche Wesen, Söhne des Uranos und der Gaia – Zyklopen nennt.
Die traurige Gestalt am Quermarkenfeuer hatte allerdings keinerlei Ähnlichkeit mit welchem Gott auch immer. Irgendjemand hatte den alten Mann kopfüber an die Plattform des kleinen Leuchtturms gehängt wie ein Wäschestück an die Leine. Das Gesicht steckte in einer Plastiktüte, die mit einer Schnur am Hals festgebunden war. Die scharfen Schnäbel der Möwen hatten Löcher in die Tüte gerissen, das größte über dem linken Auge. Und dieses gebrochene Auge glotzte ihn an. Es war klein, dunkel, halb unter das Lid gerutscht, schielend, als habe sich sein Besitzer an einer besonders bösen Fratze versucht. Eine buschige, mit weißen Haaren durchsetzte Augenbraue, ungebärdig wie ein kleines Pelztier, wölbte sich unter dem Auge. Ein schwarzer Streifen getrockneten Bluts zog sich darüber hinweg und war im Haar versickert; falls der Mann noch Haare besaß. Benthien wusste es nicht, denn der Tatort – oder vielmehr der Fundort der Leiche, ob es auch der Tatort war, würde sich erst noch herausstellen – musste natürlich unangetastet bleiben, solange der Fotograf und die Techniker dort noch zugange waren. Nur dem wortkargen kleinen Inselarzt mit dem verkürzten Bein hatte man Zugang zu der Leiche gewährt, damit er offiziell den Tod feststellen konnte.
Benthien hatte ihn gerade noch erwischt. »Der Mann ist eindeutig tot«, hatte ihm der Arzt, reichlich unwirsch, schon von der Plattform aus zugerufen. Er hatte eilig sein Köfferchen gepackt, seine alte Tweedjacke übergezogen und wäre auf der Treppe an ihm vorbeigeeilt, hätte sich ihm Benthien nicht in den Weg gestellt.
»Und was können Sie mir sonst noch sagen?«
Der Arzt musterte ihn. »Sie sehen nicht so aus, als wären Sie erst seit gestern bei der Kripo«, stellte er mürrisch fest. Er nutzte die Verzögerung, die er offenkundig für reine Zeitverschwendung hielt, um seine Tasche auf den Stufen abzustellen und sich eine Zigarette zu drehen. »Also wissen Sie doch ganz genau, dass eine Leiche erst aufgeschnitten werden muss, ehe man sagen kann, wann oder woran der Mensch gestorben ist – und selbst das muss noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Dieser alte Knabe« – er wies mit der Zigarette hinter sich – »hängt vielleicht seit Stunden in dieser Position. Womöglich war er schon tot, als man ihn dort hinhängte. Oder er hat sich selbst aufgeknüpft. Vielleicht ist er vor Angst gestorben. Oder an einem Schlaganfall, Blutgerinnsel, einem Schlag auf den Kopf, was weiß ich. Röntgenaugen habe ich nicht. Er war jedenfalls ein alter Mann, ein bisschen dehydriert, nicht in der besten Verfassung. Er hatte Arthrose, vielleicht Rheuma und vermutlich eine Venenschwäche. So, und nun muss ich weiter – ich habe einen Haufen Patienten, die noch am Leben sind und auf mich warten. Habe die Ehre!«
Verblüfft sah Benthien dem alten Mediziner hinterher. Dann fiel ihm noch eine Frage ein. »Kannten Sie das Opfer?«, rief er dem graukarierten Rücken nach.
»Nie gesehen!« Ein Wedeln in der Luft, das möglicherweise ein Abschiedsgruß sein sollte, dann hinkte der Arzt, ohne sich umzudrehen, eilig den Bohlenweg hinunter.
»Und wann er gestorben ist, weißt du natürlich auch nicht«, murmelte Benthien vor sich hin. Er kannte den Inselarzt nicht, hatte aber von ihm gehört. Er sollte ein Original sein. Brummig, wortkarg, unverblümt in seiner Ausdrucksweise. Doch wenn ihn in der Nacht jemand brauchte, war er zur Stelle, egal wie spät es war. Man sagte, seitdem er auf der Insel praktizierte, starben die Leute nicht mehr. Den Mann am Leuchtturm hatte es dennoch erwischt.
Benthien war kurz nach elf Uhr am Samstagmorgen angerufen worden, gerade als er zu seiner Segeltour aufbrechen wollte. Er hatte es fast nicht glauben wollen. Ein Mord auf der kleinen Nachbarinsel? Er konnte sich nicht erinnern, dass so etwas jemals vorgekommen war. Vandalismus, Diebstahl, Einbrüche, Schlägereien, das ja, aber ein Kapitalverbrechen? Doch an dem Bericht gab es nichts zu deuteln. Ein junges Paar, das den Bohlenweg durch die Dünen gegangen war, der direkt am Amrumer Quermarkenfeuer vorbei zum Strand führte, hatte dieses merkwürdige Etwas, das an der Geländerkonstruktion der Plattform baumelte, schon von weitem entdeckt. Durch zahlreiche Fernsehkrimis geschult, hatten sie sofort die Amrumer Polizei gerufen, nachdem sie einen Blick auf den Mann geworfen und gesehen hatten, dass ihm definitiv nicht mehr zu helfen war.
Benthien hatte telefonisch seine Leute zusammengerufen, Lilly Velasco in Flensburg, Mikke Jessen in Deezbüll, die Techniker, die Oberstaatsanwältin. Dabei hatte sich die Frage gestellt, wie sie alle möglichst schnell zu dieser abgelegenen Insel gelangen sollten. Er selbst hatte es einfacher gehabt. Er wusste, wenn er sich beeilte, würde er noch die »Adler-Express« erreichen, bevor sie in Hörnum ablegte. Knapp fünfzig Minuten später wäre er dann auf Amrum – wahrscheinlich als Erster von der Truppe.
Er war gerade damit beschäftigt gewesen, seine Reisetasche zu packen, als Ben in seinem Schlafzimmer aufgetaucht war.
»Du bist ja immer noch da«, hatte John seinen Vater aufgezogen. »Hat sich die Angst vor Hilde gelegt?«
»Wo willst du hin?«, hatte Benthien senior misstrauisch gefragt und dabei auf die Tasche gestarrt.
»Nach Amrum. Beruflich.«
»Amrum? Jetzt erzähl mir bloß nicht, dass es dort einen Mord gegeben hat!«
»Hat es. Würdest du mir mal aus dem Weg gehen?« John hatte seinen Vater umkurven müssen, um noch einige Socken in die Tasche zu werfen.
»Das heißt, ich soll das ganze Wochenende allein hier im Haus sein? Das geht ja mal gar nicht. Weißt du was? Ich komme mit nach Amrum. Ich war schon lange nicht mehr da. Du fährst doch mit der ›Adler‹, oder nicht? Am Abend nehme ich dann die Fähre nach Dagebüll.«
»Meinetwegen, aber ich fahre in fünf Minuten. Bis dahin musst du fertig sein.«