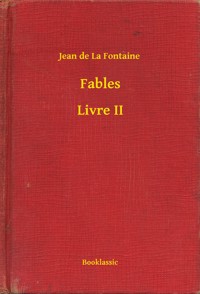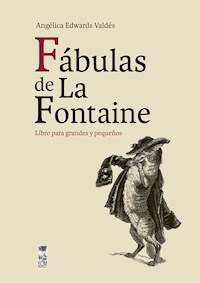Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Taube und Ameise retten sich das Leben. Der aufgeblasene Frosch bezahlt für seinen Übermut. Die Henne legt goldene Eier: Jean de La Fontaines sprechende Tiere begeistern bis heute. Eine fröhliche Art, mit den Kleinen lebenskluge Reime zu genießen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Fontaines Fabeln
Einleitung
Ernst Dohm, geboren am 24. Mai 1819 zu Breslau, hat »Philosophie und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühn« und zwölfmal von der Kanzel herab die Gläubigen in der Umgegend von Halle durch fromme Predigten erbaut. Daß das nicht eigentlich sein Beruf war, muß er schon frühzeitig bemerkt haben. Im Jahre 1848 trat er als Mitbegründer in die Redaktion des »Kladderadatsch« ein, und diesem Blatte hat er den größten Teil seiner schriftstellerischen Tätigkeit gewidmet.
»Dohm hat sich seine geistige und körperliche Frische in seltener Weise bewahrt. Seine Unempfänglichkeit gegen den Witterungswechsel erregt die staunende Bewunderung aller seiner Bekannten. Man sieht ihn im härtesten Winter mit demselben leichten Röckchen fröhlich daherwandeln, wie in den heißesten Tagen des Hochsommers, in der Hand immer dasselbe kleine Stöckchen, das das Jubiläum des ›Kladderadatsch‹ mitgefeiert hat und hoffentlich noch fernere Freudentage mitfeiern wird.
Dohm hat ein volles Anrecht auf einen Ehrenplatz unter den besten zeitgenössischen Dichtern. Mag er von dem einen oder andern in diesem oder jenem überflügelt werden, in bezug auf den Geschmack und die formale Vollendung steht keiner über ihm.«
Mit diesen Worten schloß ich einen Aufsatz über »Ernst Dohm und der Kladderadatsch«, den ich im Januar 1879 in »Nord und Süd« veröffentlichte.
Mein frommer Wunsch, daß dieser prächtige Mensch, der feinsinnige Dichter und bestrickend liebenswürdige Gesellschafter, uns noch lange erhalten bleibe, sollte leider nicht erfüllt werden. Im Winter 1882 auf 83 fühlte er sich zum erstenmal in seinem Leben von Nässe und Frost belästigt und schaffte sich den ersten Überzieher an. Um dieselbe Zeit kam ihm sein Stöckchen abhanden, das ihn dreißig Jahre auf Steg und Weg begleitet hatte, das er auch am Kneiptisch zwischen die Kniee klemmte, und auf dessen lederbesponnenen Bleiknopf er sich stützte und einnickte, wenn ihm die Unterhaltung seiner Nachbarn zu langweilig wurde. Das waren böse Vorboten. Bald darauf starb er, im Sommer 1883.
So geist- und geschmackvoll seine Dichtungen, in denen er die Ereignisse des Tages glossierte, auch waren, so hoch die von ihm als Satiriker geleistete Kulturarbeit auch eingeschätzt werden muß – sein größtes schriftstellerisches Können hat er doch als Nachdichter gezeigt, als virtuoser Meister der Übersetzungskunst. Und unter diesen Kunstwerken steht seine Übertragung der Lafontaineschen Fabeln obenan.
Über diese wahrhaft bewundernswerte Leistung, an der die Kritik, wie ich glaube, zu achtlos vorübergegangen ist, habe ich seiner Zeit – Januar 1877, gleich nach dem Erscheinen des Werkes – in der »Gegenwart« ausführlich gesprochen. Jetzt, da ich von befreundeter Seite aufgefordert werde, zur selben Sache noch einmal das Wort zu ergreifen – und ich folge dieser Einladung mit herzlicher Freude – kann ich heute, nach beinahe 37 Jahren nur wiederholen, was ich damals als Siebenunddreißiger gesagt habe:
Die Lafontaineschen Fabeln, die die kleinen Kinder in Frankreich schon auswendig lernen, wenn es mit dem Sprechen noch nicht recht gehen will, können nach ihrem vollen Werte erst von dem gereiften Mannesalter gewürdigt werden. Den behäbigen und gemütlichen Humor, die reizende Schalkhaftigkeit, den feinen Spott, die kecke Satire, die anständige und ehrliche Gesinnung, die tief poetische Anschauung, die wunderbare Leichtigkeit in der Form, das kühne Spiel mit den sprachlichen Schwierigkeiten, – alles mit einem Worte, was die Größe Lafontaines ausmacht und die Nachwelt dazu bestimmt hat, dem Dichter trotz der Bescheidenheit seiner Aufgabe eine erste Stelle einzuräumen, – alles das kann erst der gereifte Mann recht verstehen und wahrhaft bewundern.
Die Zeitgenossen des Fabeldichters nahmen noch Anstand, den gemütlichen und liebenswürdigen Herrn, – den » bonhomme«, wie sie ihn nannten, und wie er noch jetzt genannt wird – in einem Atem mit Molière, Racine und Boileau zu nennen, mit jenen Dichtern, die sich an die höchste Aufgabe ihrer Kunst gewagt, weil Lafontaine ja nur einem unansehnlichen Genre seine liebevolle Pflege zugewandt habe; die späteren Geschlechter aber haben diese Unterscheidung nicht mehr gelten lassen wollen, und der kühnste und scharfsinnigste der französischen Kritiker unserer Zeit, Sainte Beuve, hat das vermessene Wort ausgesprochen: »Unser wirklicher Homer, der Homer der Franzosen, wer sollte es glauben, ist wahr und wahrhaftig Lafontaine! Causeries du Lundi, 7. Band, III. Aufl., S.519.« Lafontaine ist für ihn der letzte und größte der alten französischen Dichter.
Viele der Lafontaineschen Fabeln, die, wie man weiß, selbst ihrer großen Mehrzahl nach freie Nachdichtungen der Fabeln des Äsop und des Phädrus sind, sind schon seit langen Jahren ins Deutsche übersetzt und im Deutschen nachgeahmt worden; Gellert, Gleim, Lichtwer, Pfeffel, sogar Heinrich von Kleist, und viele andere haben einige der wirksamsten dieser Fabeln herausgegriffen und mehr oder minder frei nachzubilden gesucht. Einige davon, wie »Johann, der muntre Seifensieder«, »Eine kleine Grille sang einen ganzen Sommer lang« haben es auch bei uns zu einer großen Popularität gebracht; aber gerade diese haben durch den Übergang aus dem Französischen ins Deutsche den Charakter des Originals nahezu vollständig eingebüßt; es sind deutsche Gedichte geworden, zu denen Lafontaine nur die Anregung und einige glückliche Wendungen gegeben hat. Ernst Dohm hat den Versuch gemacht, von den sämtlichen Lafontaineschen Fabeln eine gewissenhafte literarische Übersetzung zu geben; und dieses kühne Unternehmen ist trotz der unglaublichen Schwierigkeiten, die es zu bewältigen galt, in geradezu unübertrefflicher Weise gelungen.
Ernst Dohm zeigt sich hier als ein Sprach- und Verskünstler ersten Ranges. Da er von dem sehr richtigen Standpunkt ausgeht, daß bei Lafontaine die Form das Wesentliche ist, so hat er sich bemüht, in seiner Übertragung diese Form in der vollsten Strenge zu erhalten, und zwar so peinlich, daß sogar jede Verszeile der Übersetzung genau so viel Silben zählt wie die korrespondierende Verszeile des Originals; daß die Reime ihrer Stellung und ihrem Charakter nach, als männliche oder weibliche, in der Übertragung den Reimen des Originals durchaus entsprechen; daß alle Eigentümlichkeiten des Rhythmus sich in der Übersetzung da einstellen, wo sie in der Originaldichtung hervortreten; ja, daß sogar gewisse Willkürlichkeiten und Freiheiten in der Sprache des Originals den anklingenden Ausdruck in der Übersetzung gefunden haben. Wenn Lafontaine z. B. sich mit einem schwachen Reim behilft, so hat Dohm ebenfalls sorglos gereimt; ist bei Lafontaine die Form aber gewählt und streng, so weist auch die Übersetzung diesen Charakter auf.
Um die Feinheiten und die außerordentliche Sorgfalt dieser Arbeit ins rechte Licht zu setzen, müssen wir einige Stellen aus dem Originale und aus der Dohmschen Übertragung hier wiedergeben. Wir wollen gerade diejenigen nehmen, welche Laharpe, der in Lafontaine den unübertroffenen Meister der französischen Sprache bewundert, als Muster anführt Cours de littérature, Bd. 8.. Kein französischer Dichter hat in der Tat den Vers mit einer solchen Leichtigkeit behandelt, wie Lafontaine. »Die Eintönigkeit, die man unserer Dichtung vorwirft,« sagt Laharpe, »verschwindet bei ihm ganz und gar. Nur am Wohlklange, nur an der reizvollen Harmonie, die mit dem Empfinden und dem Gedanken stets im Einklange ist, merkt man, daß er Verse schreibt. Er schaltet und waltet mit einer solchen Freiheit in den Reimen, daß die Wiederkehr nur ein Schmuck zu sein scheint, aber keine Notwendigkeit. Niemand hat wie er es verstanden, den Versen einen eigentümlichen Rhythmus zu geben; keiner hat mit der Cäsur eine solche Wirkung erzielt wie er. Die reizvollste Willkür herrscht in seiner ganzen Versifikation. Bei diesem Manne, der die Wahrheit über alles liebte und die Lüge über alles haßte, haben alle Empfindungen, alle Ideen den Akzent, der ihnen gebührt. Man darf sich auch nicht darüber wundern, daß ein Schriftsteller wie er, für den die Dichtung ein so gefügiges Werkzeug war, zu gleicher Zeit ein großer Maler sein mußte. Er versteht es, wahr und wahrhaftig mit dem Worte zu malen.« Hier ein Beispiel: Der Kampf zwischen der Mücke und dem Löwen.
Le quadrupède écume, et son œil étincelle; Il rugit: on se cache, on tremble à l'environ, Et cette alarme universelle Est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en cent lieux le harcelle; Tantôt pique l'échine, et tantôt le museau, Tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son faîte montée. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir, Qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, Fait résonner sa queue à la l'entour de ses flancs, Bat l'air qui n'en peut mais; et sa fureur extrême Le fatigue, l'abat: le voilà sur les dents.
Die Übersetzung von Ernst Dohm lautet:
Er schäumt, und Funken sprüht das Aug' des wilden Recken: Er brüllt, und rings umher erzittert Tal und Berg; Und dieser allgemeine Schrecken Ist einer kleinen Mücke Werk. An hundert Stellen sucht das Mücklein ihn zu necken: Bald sticht's am Rücken ihn, bald macht's am Maul ihm Pein, Bald kriecht's ihm in die Nas' hinein. Nun hat des Löwen Wut erreicht den höchsten Gipfel; Der unsichtbare Feind, wie triumphiert er jetzt, Da Klaue nicht noch Zahn, kurz, nicht der kleinste Zipfel Des schmerzgequälten Tiers mehr heil und unverletzt! Der arme Leu zerfleischt sich selber, an die Weichen Schlägt er den mächt'gen Schweif, er schlägt in kind'schem Sinn Selbst die unschuld'ge Luft. Dies Wüten ohnegleichen Erschöpft ihn, macht ihn matt, und bald ist er ganz hin!
Man vergleiche aufmerksam diese Übersetzung mit dem Original, und man wird schon hier die Bestätigung des vorher Gesagten finden: wie tatsächlich Silbe für Silbe übersetzt ist, ohne daß dadurch der Sprache der Übersetzung irgendwie Gewalt angetan wäre. Ein anderes, ein anmutigeres Bild:
Pérette, sur sa tête ayant un pot au lait, Bien posé sur un coussinet, Prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, Cotillon simple et souliers plats.
Diese Fabel gehört zu denen, die Gleim übersetzt, oder vielmehr, so gut er es vermocht, nachzudichten versucht hat. Bei ihm fängt die Geschichte so an:
Auf leichten Füßen lief ein artig Bauernweib, Geliebt von ihrem Mann, gesund an Seel' und Leib, Frühmorgens nach der Stadt und trug auf ihrem Kopfe Vier Stübchen süße Milch in einem großen Topfe.
So geht's weiter; immer dieselbe biedere Schwatzhaftigkeit, dieselbe hausbackene Reimschmiederei. Bei Dohm heißt es:
Vorsichtig trug Perette 'nen milchgefüllten Topf Auf einem Kissen auf dem Kopf; Sie hofft ohn' Hindernis glücklich zur Stadt zu eilen. Ganz leicht und kurz geschürzt, geht schnellen Schritts sie zu. An Kleidung trug sie heut, um sich nicht zu verweilen, Nur einen Rock und flache Schuh.
Auch hier hat Dohm streng am Original festgehalten und den Charakter des Urtextes mit merkwürdiger Treue in seiner deutschen Nachbildung zu erhalten verstanden. Es ist dieselbe Korrektheit und Knappheit im Ausdruck, die nämliche Bequemlichkeit im Reimen; es ist kein Flickwort da, kein überflüssiges Detail, das lediglich dem Bedürfnis, zu einem vorhandenen Worte ein anklingendes Wort zu finden, sein Dasein verdankt. Aus diesem Reimbedürfnis beschenkt Gleim die Milchfrau mit den schönsten Gaben, mit dem Familienglück und der Gesundheit »an Seele und Leib«, – was sicherlich für die Geschichte vom Milchtopf, der durch einen unvorsichtigen Sprung der jungen Frau vom Kopfe gleitet und zerbricht, von äußerstem Belang ist. Und wie mühsam schleppt sich der langweilige Alexandriner bei Gleim dahin, wie leichtfüßig hüpft er bei Dohm daher!
Wenn Lafontaine in seinen Versen dieses Mühselige und Schwerfällige beabsichtigt, so weiß Dohm dies mit derselben Gewandtheit unserer Sprache wiederzugeben. Da ist z. B. die Fabel von der Kutsche und der Fliege, die in langsamen, trägen Versen im Original also anhebt:
Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, Et de tous les côtés au soleil exposé, Six forts chevaux tiraient un coche.Femme, moine, vieillard, tout était descendu; L'equipage suait, soufflait, était rendu.
Ebenso saumselig und ermattet lauten die Verse in der Dohmschen Übersetzung:
Auf steilem Weg, bergan, zogen durch tiefen Sand Sechs starke Gäule bei der Sonne glüh'ndem Brand 'ne Landkutsche mit viel Beschwerden. Weib, Mönch und Greis stieg aus an diesem schwier'gen Ort. Das schwitzende Gespann kam keuchend kaum noch fort.
Lafontaine hat, wie man bemerkt haben wird, sich in seinen Versen in diskreter Weise der Klangmalerei bedient und mit den Hauptverben » suait, soufflait« die Alliteration angewandt. Der Sorgsamkeit des Übersetzers ist diese Einzelheit nicht entgangen, und wie Lafontaine, so alliteriert auch er in der Übersetzung: »schwier'ge«, »schwitzende«; »kam, keuchend kaum«. Man halte das nicht für einen Zufall, es ist eine wohlbeabsichtigte künstlerische Intention des Übersetzers, der selbst für die geringfügigen Äußerlichkeiten der französischen Dichtung bei seiner deutschen Umdichtung immer nach einem Ersatze gesucht – und ihn auch gefunden hat.
Am bewundernswertesten ist die Kunst, mit der Dohm den steifbeinigen Alexandriner behandelt. Dieser hartmäulige Gaul, der alle sechs Schritt vor der Cäsur stehen bleibt und bockt, galoppiert und trabt hier fröhlich daher, ganz nach dem Gefallen des kundigen Reiters. Gerade wie Lafontaine versteht es der Übersetzer die metrische Cäsur durch das Sinnliche zu verdecken, und in den Vers einen ganz unerwarteten Rhythmus, eine lebhafte Bewegung hineinzubringen. Die Moral der Fabel vom Müller, seinem Sohn und dem Esel heißt bei Lafontaine:
Quant à vous, suivez Mars, ou l'Amour, ou le prince, Allez, venez, courez, demeurez en province:Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement: Les gens en parleront, n'en doutez nullement.
Dohm übersetzt:
Du – geh' zu Hofe, schwör' zu Mars', zu Amors Fahnen, Steh, lauf, bleib hier, zieh' dich zurück ins Schloß der Ahnen, Werd' Geistlicher, Soldat, Rat, nimm ein Weib, nimm keins: Dem Klatsch der Welt verfällst du doch – 's ist alles eins!
Wenn man diese Verse laut liest, wird man kaum gewahr, daß es Alexandriner sind, so geschickt hat Dohm die langweilige Cäsur durch den Sinn zu beseitigen verstanden.
Diese Beispiele – es sind im Verhältnis zu dem großen und umfangreichen Werke nur sehr wenige – müssen uns zur Charakterisierung der Dohmschen Übersetzung genügen. Sie sind aber auch wohl ausreichend, um das Verdienstliche dieser zwar sehr beschwerlichen, aber auch sehr lohnenden Arbeit zu zeigen. Überall, wo wir die Probe gemacht, haben wir den Übersetzer als sprachkundigen, einsichtigen, feinfühligen und mit einer seltenen Formgewandtheit ausgestatteten Dichter bewährt gefunden, der jedesmal mit dem ersten Schlage sicher den Nagel auf den Kopf trifft. Für die ruhige, gemessene Schilderung, wie für die dramatische Lebendigkeit des Dialogs, für den harmlosen Scherz, der bisweilen bis zur Posse sich herabläßt, wie für den ergreifenden Ernst, der sich unter Umständen zur Großartigkeit zu erheben weiß, – für alle Töne, die der französische Dichter anschlägt, hat Dohm die entsprechenden Laute, oder zum mindesten die Anklänge in unserer Muttersprache gefunden. Zu den Meistern der deutschen Übersetzungskunst, zu unseren Schlegel und Tieck, Rückert, Freiligrath, Geibel und Baudissin, Heyse, Gildemeister, Bodenstedt und Wilbrandt ist ein neuer hinzugetreten: Ernst Dohm, der mit dieser schönen Arbeit in die Reihen jener hochverdienten Männer gerückt ist, die den Ruhm beanspruchen dürfen, durch ihre vollgültigen Übersetzungen große Dichter der Fremde bei uns heimisch gemacht zu haben. Lafontaine sollte trotz seines spezifischen Franzosentums uns jetzt kein Fremder mehr sein. Dohm hat ihm das Ehrenbürgerrecht in Deutschland erwirkt.
Das war der Schlußsatz meiner Besprechung in der »Gegenwart«, Januar 1877.
Es mag wundersam berühren, fast unerklärlich erscheinen, daß erst nach nahezu vier Jahrzehnten dem ersten Erscheinen des Werkes diese neue Ausgabe folgt. Und doch läßt es sich erklären. Die erste Ausgabe im Verlage der Möserschen Hofbuchhandlung (vom Jahre 1877) war ein Prachtband in Groß-Folio Die Prachtausgabe ist im Buchhandel noch zu haben. Mit freundlicher Erlaubnis der Firma W. Möser, der auch hier gedankt sei, erscheint jetzt diese Volksausgabe. mit massenhaften riesigen Zeichnungen von Gustave Doré, eines jener Bücher für den Prunktisch im Salon, die manchmal besehen und eigentlich nie gelesen werden. Die Illustrationen von Doré waren eben die Hauptsache und Lafontaines Fabeln zum verbindenden Text herabgedrückt, den man als unvermeidliche Beilage mit in den Kauf nehmen mußte. Schon rein äußerlich – durch die opulente Ausstattung in Druck, Papier und Einband – verriet es seine löbliche Bestimmung: als Festgeschenk.
Danach mußte natürlich auch der Preis bemessen werden, der für die Hausbibliothek, für das größere lesende Publikum viel zu hoch war. Unter diesem Glanz des Äußerlichen vermutete man nicht ein Werk von innerem literarischen Wert, nicht diese entzückend schlichte Dichtung. So darf man denn getrost behaupten, daß die Dohmsche Übersetzung der Fabeln Lafontaines bis zur Stunde eigentlich noch gar nicht erschienen und deshalb in Deutschland so gut wie unbekannt geblieben ist.
Nun erst, ihres prunkhaften Aufputzes entkleidet, bietet sie sich uns dar als das, was sie ist: in ihrer natürlichen Einfachheit und anspruchslosen Anmut. Da können wir zwanglos mit ihr verkehren, sie näher kennen lernen und liebgewinnen.
Sollte es gelingen, dem deutschen Nachdichter – und mit ihm auch dem französischen Dichter – bei uns zu ihrem Rechte zu verhelfen, so käme diese von den Töchtern Ernst Dohms veranstaltete Volksausgabe, wenn auch spät, doch nicht zu spät.
Im Hochsommer 1913
Paul Lindau
Erstes Buch
1. Die Grille und die Ameise
Grillchen, das den Sommer lang Zirpt' und sang, Litt, da nun der Winter droht, Harte Zeit und bittre Not: Nicht das kleinste Würmchen nur, Und von Fliegen keine Spur! Und vor Hunger weinend leise Schlich's zur Nachbarin Ameise; Fleht sie an, in ihrer Not Ihr zu leih'n ein Körnlein Brot, Bis der Sommer wiederkehre. »Glaub' mir« sprach's »auf Grillen-Ehre, Vor dem Erntemond noch zahl' Zins ich dir und Kapital.« Ämschen, die, wie manche lieben Leute, das Verleihen haßt, Fragt die Borgerin: »Was hast Du im Sommer denn getrieben?« »»Tag und Nacht hab' ich ergötzt Durch mein Singen alle Leut'.«« »Durch dein Singen? Sehr erfreut! Weißt du was? Dann – tanze jetzt!«
2. Der Rabe und der Fuchs
Im Schnabel einen Käse haltend, hockt Auf einem Baumast Meister Rabe. Von dieses Käses Duft herbeigelockt, Spricht Meister Fuchs, der schlaue Knabe: »Ah! Herr von Rabe, guten Tag! Wie nett Ihr seid und von wie feinem Schlag! Entspricht dem glänzenden Gefieder Nun auch der Wohlklang Eurer Lieder, Dann seid der Phönix Ihr in diesem Waldrevier.« Dem Raben hüpft das Herz vor Lust. Der Stimme Zier Zu künden, tut mit stolzem Sinn Er weit den Schnabel auf; da – fällt der Käse hin. Der Fuchs nimmt ihn und spricht: »Mein Freundchen, denkt an mich! Ein jeder Schmeichler mästet sich Vom Fette des, der willig auf ihn hört. Die Lehr' ist zweifellos wohl – einen Käse wert!« Der Rabe, scham- und reuevoll, Schwört – etwas spät – daß ihn niemand mehr fangen soll.
3. Der Frosch, der dem Stier an Größe gleichen wollte
Ein Frosch sah einstmals einen Stier, Des Wuchs ihm ungemein gefallen. Kaum größer als ein Ei, war doch voll Neid das Tier; Er reckt und bläht sich auf mit seinen Kräften allen, Dem feisten Rind an Größe gleich zu sein. Drauf spricht er: »Schau, mein Brüderlein, Ist's nun genug? Bin ich so groß wie du?« »»O nein!«« »Jetzt aber?« »›Nein!‹« »Doch nun?« »›Wie du dich auch abmatt'st, Du wirst mir nimmer gleich!‹« Das arme kleine Vieh Bläht sich, und bläht sich, bis es – platzt.
Wie viele gibt's, die nur nach eitler Größe dürsten! Der Bürgersmann tät's gern dem hohen Adel gleich, Das kleinste Fürstentum spielt Königreich, Und jedes Gräflein spielt den Fürsten.
4. Die beiden Esel
Zwei Esel gehn des Wegs; nur Hafer schleppte der, Doch jener trug viel Geld zum Amt der Steuern, Und stolz sich brüstend ob der goldnen Last, der teuern, Gäb' er um keinen Preis die blanke Bürde her. Er trabt gewicht'gen Schritts einher, Hell läßt er tönen sein Geläute. Da plötzlich naht des Feindes Heer Und da nach Gold nur ihr Begehr, Wirft auf das Steuer-Lasttier sich die ganze Meute Und nimmt es mit als gute Beute. Freund Langohr leistet Gegenwehr; Doch schwer verwundet sinkt er hin und seufzt im Sterben: »Das also ist mein Lohn? O gleißnerische Pracht! Der schlechten Hafer trug entrinnt jetzt dem Verderben Und ich, ich sink' in Todes Nacht!« Da spricht zu ihm sein Freund, der gute: »Nicht stets sind Würd' und Amt ein Glück, das glaube mir! Freund, wärest du, wie ich, ein armes Müllertier, Lägst du nicht hier in deinem Blute.«
5. Der Wolf und der Hund
Ein Wolf, der nichts als Knochen war und Haut – Dank guter Wacht der Schäferhunde – Traf eine Dogge einst, die, stark und wohlgebaut, Glänzenden Fells und feist, just jagte in der Runde. »Ha!« dachte Meister Isegrimm » Die so zum Frühstück, wär' nicht schlimm!« Doch stand bevor ein Kampf, ein heißer, Und unser Hofhund hatte Beißer, Gemacht zu harter Gegenwehr. Drum kommt der Wolf ganz freundlich her Und spricht ihn an, so ganz von ungefähr, Bewundernd seines Leibes Fülle. » Die, lieber Herr, ist's Euer Wille« Erwiderte der Hund »blüht Euch so gut wie mir! Verlaßt dies wilde Waldrevier; Seht Eure Vettern, ohne Zweifel Nur dürft'ge Schlucker, arme Teufel, Sie lungern hier umher, verhungert, nackt und bloß! Hier füttert keiner Euch, Ihr lebt nur – mit Verlaub – Vom schlechtesten Geschäft, dem Raub. Drum folgt mir, und Euch winkt – glaubt nur – ein besser Los.« »»Was«« sprach der Wolf »»hab' ich dafür zu leisten?«« »Fast nichts!« so sagt der Hund. »Man überläßt die Jagd Den Menschen, denen sie behagt, Schmeichelt der Dienerschaft, doch seinem Herrn am meisten. Dafür erhält die nicht verspeisten Tischreste man zum Lohn, oft Bissen leckrer Art Hühner- und Taubenknöchlein zart, Manch andrer Wohltat zu geschweigen!« Schon träumt der Wolf gerührt vom Glück der Zukunft, und Ein Tränlein will dem Aug' entsteigen; Da plötzlich sieht er, daß am Halse kahl der Hund. »»Was ist das?«« fragt er. »Nichts!« »»Wie? Nichts?«« »Hat nichts zu sagen!« »»Und doch?«« »Es drückte wohl das Halsband hier mich wund, Woran die Kette hängt, die wir mitunter tragen.« »»Die Kette?«« fragt der Wolf. »»Also bist du nicht frei?«« »Nicht immer; doch was ist daran gelegen?« »»So viel, daß ich dein Glück, all' deine Schwelgerei Verachte! Bötst du meinetwegen Um den Preis mir 'nen Schatz, sieh, ich verschmäht' ihn doch!«« Sprach's, lief zum Wald zurück flugs und – läuft heute noch.
6. Kalb, Ziege, Schaf und Leu, Als Handelscumpanei
Kalb, Zieg' und Schaf im Bund mit einem stolzen Leu'n, Als Gründer bildeten in grauer Vorzeit Tagen Genossenschaftlich sie einen Konsum-Verein, Gewinn sowie Verlust zu gleichem Teil zu tragen. Auf dem Gebiet der Geiß fing einst ein Hirsch sich ein. Zu den Genossen schickt die biedre Zieg' in Eile; Sie kommen, und der Leu, indem er um sich blickt, Spricht: »Wir sind vier, drum geht die Beut' auch in vier Teile.« Zerlegend drauf den Hirsch nach Jägerart geschickt, Nimmt er das erste Stück für sich, und mit Behagen Spricht er: »Das kommt mir zu, weil ich, euch zum Gewinn, Als Leu der Tiere König bin; Dagegen ist wohl nichts zu sagen! Von Rechtes wegen fällt mir zu das zweite Stück; Dies Recht, des Stärkern Recht heißt's in der Politik. Als Tapferstem wird mir das dritte wohl gebühren! Wagt einer jetzt von euch das vierte zu berühren, So würg' ich ihn im Augenblick.«
7. Der Quersack
Einst sprach der Vater Zeus: »An meines Thrones Stufen Erscheine, was da lebt; und wer sich an Gestalt Und Wesen zu Beschwer berechtigt und berufen Vermeint, der red' ohn' Hinterhalt! Wo's geht, bin ich zu helfen willig. Du, Affe, sprich zuerst! Schau dir, wie recht und billig, Die Tiere alle an, vergleich' ihr Angesicht Und ihre Formen mit den deinen. Bist du zufrieden?« »»Ich?«« sprach er »»Warum denn nicht? Ich hab' vier Füße doch wie jene, sollt' ich meinen! Und mit Vergnügen stets hab' ich mein Bild beschaut. Allein mein Bruder Bär ist gar zu plump gebaut, Und keinem Maler sollt' er je zu sitzen wagen!«« Der Bär tritt vor – man glaubt, er wolle sich beklagen; Doch weit gefehlt! Hört nur, wie seinen Wuchs er rühmt! Jedoch der Elefant – so schmäht er unverblümt – Hätt' das am Ohr zu viel, was ihm am Schwanze fehlte; Unförmlich, massenhaft, sei er der Schönheit bar! Der Elefant, der sonst sogar Ein kluges Tier, erschien doch heut als Tor und schmälte, Daß für sein Maul, das nicht gering, Der Walfisch sich zu dick erwiese! Der Ameis' schien die Milb' ein gar zu winzig Ding, Dagegen wär sie selbst ein Riese! Zeus schickt sie alle heim, die sich so mild und lind Selbstlobend kritisiert. Wir Menschen aber sind Der Toren törichtste, da alle wir im Leben, Luxscharf für andre, nur für uns stets maulwurfblind, Uns selber alles, doch dem Nächsten nichts vergeben. Nie gleichen Blicks hast dein du wie des Andern acht. Es schuf des höchsten Schöpfers Macht Als Lumpenvolk uns all', heut wie in frühern Tagen: Quer auf die Schulter legt' er uns den Bettelsack, Drin unsrer Sünden Last wir auf dem Rücken tragen, Doch vorn, uns sichtbar stets, der fremden Fehler Pack.
8. Die Schwalbe und die kleinen Vögel
War einst 'ne Schwalbe, die auf Reisen Gar viel gelernt. Wer viel und mancherlei gesehn, Wird auch so manches wohl verstehn. Sie sah von ferne schon die leichtste Brise kreisen, Und eh' zum Sturmwind die erwuchs, Verkündet sie's den Schiffern flugs. Da nun die Jahreszeit kam, wo der Hanf gesät wird, Sah einen Landmann sie, der ihn in Furchen streut. »Das mißfällt mir!« sprach sie. »Ihr Vöglein, seid gescheut! Ihr dauert mich; denn ich, ich geh', bevor's zu spät wird, Weit fort und berge mich da, wo ich sicher bin. Doch ihr – seht ihr die Hand dort hin und her ihn schwingen? Glaubt mir: 's ist nicht mehr lange hin, Dann wird, was jetzt sie streut, euch, ach! Verderben bringen.
Da wird zu eurem Fang manch Netz gar meisterlich Gelegt und mancher Dohnenstrich; Man stellt euch nach, man legt euch Schlingen. Dann kommt die Zeit der schweren Not, Wo euch Gefängnis oder Tod, Der Käfig oder Bratspieß droht. Drum rat' ich euch, jetzt wegzufressen Den Samen. Folgt mir und seid klug!« Die Vöglein höhnten sie vermessen, Sie hatten Futters ja genug! Man sah das Hanffeld grün sich färben. Da sprach die Schwalbe: »Schnell! Reißt, Halm für Halm, jetzt ab Das Gras, das jener Same gab; Sonst bringt es sicher euch Verderben.« »»Unglücksprophet!«« schrien sie »»Geschwätz'ger Phrasenheld! Ein schöner Rat, um uns zu retten! Da tausend Mann wir nötig hätten, Jetzt kahl zu mäh'n dies ganze Feld!«« Als nun der Hanf in Samen schoß, Da rief die Schwalb': »O weh!« und schüttelte das Haupt. »Das böse Kraut! Wie schnell es sproß! Doch ihr, die ihr bisher noch nimmer mir geglaubt, Merkt jetzt euch dies: Seht ihr die Fluren Voll Stoppeln, hat der Mensch sein Feld Fertig für dieses Jahr bestellt Und folgt als Feind er euren Spuren, Stellt Fallen er und Netze fein Den armen kleinen Vögelein, Dann hütet euch umherzufliegen! Dann bleibt zu Haus, vielmehr verlaßt dann diesen Ort, Wie Kranich, Schnepf' und Storch auf ihren Wanderzügen.
Ach! leider könnt ihr ja nicht fort. Nicht über Land und Meer, wie wir, zum Flug euch rüsten Nach fremden Weltteils fernen Küsten! Drum, glaubt mir, ist für euch die einz'ge Rettung noch, Euch still zu bergen in ein sichres Mauerloch.« Die Vöglein, statt der weisen Kunde Zu lauschen, fingen an zu schwatzen, O und Ach, Wie der Trojaner Volk, als mit Prophetenmunde Kassandra einst zu ihnen sprach. Wie jenen dort, ging's jetzt den Kleinen: Manch Vöglein seufzte, das in Sklaverei geriet.
Wir glauben immer nur an unser eignes Meinen, Und sehn den Schaden erst, wenn er uns selbst geschieht.
9. Stadtratte und Landratte
Stadträttlein lud einst zum Feste Und zu Tisch, auf hoch und fein Fette Ortolanenreste, Landrättlein gar höflich ein.
Auf dem türk'schen fein gewebten Teppich stand das Mahl bereit, Und die beiden Freunde lebten Lustig und in Herrlichkeit.
Man genoß in vollen Zügen, Köstlich mundete der Schmaus; Plötzlich mitten im Vergnügen Wurden sie gestört – O Graus!
Klang es nicht, als ob was krachte? Hei! wie Stadträttlein in Hast Gleich sich aus dem Staube machte! Schleunigst folgt ihm nach der Gast.
Blinder Lärm nur war's. Es wandern Beide wieder in den Saal, Und Stadträttlein spricht zum andern: »Setzen jetzt wir fort das Mahl!«
»»Danke sehr!«« spricht jenes »»Morgen Komm zu mir aufs Land hinaus. Kann dir freilich nicht besorgen Dort so königlichen Schmaus.
Einfach nur, doch unbeneidet, Voller Sicherheit bewußt, Speis' ich dort. Pfui solcher Lust, Die durch Furcht mir wird verleidet!««
10. Der Wolf und das Lamm
Des Stärkern Recht ist stets das beste Recht gewesen – Ihr sollt's in dieser Fabel lesen.
Ein Lamm löscht einst an Baches Rand Den Durst in dessen klarer Welle; Ein Wolf, ganz nüchtern noch, kommt an dieselbe Stelle, Des gier'ger Sinn nach guter Beute stand. »Wie kannst du meinen Trank zu trüben dich erfrechen?« Begann der Wüterich zu sprechen – »Die Unverschämtheit sollst du büßen, und sogleich!«
»»Eu'r Hoheit brauchte«« sagt das Lamm vor Schrecken bleich »»Darum sich so nicht aufzuregen! Wollt doch nur gütigst überlegen, Daß an dem Platz, den ich erwählt, Von Euch gezählt, Ich zwanzig Schritt stromabwärts stehe; Daß folglich Euren Trank – seht Euch den Ort nur an – Ich ganz unmöglich trüben kann.«« »Du trübst ihn dennoch!« spricht der Wilde. »Wie ich sehe, Bist du's auch, der auf mich geschimpft im vor'gen Jahr!« »»Wie? Ich, geschimpft, da ich noch nicht geboren war? Noch säugt die Mutter mich, fragt nach im Stalle.«« »Dein Bruder war's in diesem Falle!« »»Den hab' ich nicht.«« »Dann war's dein Vetter! Und Ihr hetzt mich und verfolgt mich alle, Ihr, euer Hirt und euer Hund. Ja, rächen muß ich mich, wie alle sagen!« Er packt's, zum Walde schleppt er's drauf, Und ohne nach dem Recht zu fragen, Frißt er das arme Lämmlein auf.
11. Der Mensch und sein Ebenbild
Für den Herzog de la Rochefoucauld
Es war einmal ein Mann, der, in sich selbst verliebt, Sich für den schönsten hielt, den alle Lande trügen; Den Spiegel scheltend, daß entstellt sein Bild er gibt, Fand er sein Glück darin, sich selber zu belügen. Um ihn zu heilen, sorgt ein günstiges Geschick, Daß stets er, wo auch weilt sein Blick,
Der Damen stummen und geheimen Rat muß schauen: Spiegel in Stub' und Saal, Spiegel ob nah ob fern, Spiegel in Taschen feiner Herrn, Spiegel im Gürtel schöner Frauen. Was tut unser Narziß? Er tut sich selbst in Bann Und birgt am stillsten Ort sich, den er finden kann, Wohin kein Spiegel wirft sein trügerisch Gebilde. Doch durch der Einsamkeit verlassenstes Gefilde Rieselt ein klarer Silberbach. Er schaut sich selbst darin, und zürnend ruft er: »Ach, Ein eitel Trugbild ist's, das mir den Ort verleidet!« Er gibt sich alle Müh', ihm aus dem Weg zu gehn; Allein der Bach ist gar so schön, Daß er nur ungern von ihm scheidet.
Was die Moral der Fabel sei? Zu allen red' ich; das Sichselbstbetrügen, Ein Übel ist's, von dem kein Sterblicher ganz frei: Dein Herz, es ist der Narr, geneigt sich zu belügen; Der Spiegel, den als falsch zu schelten wir geneigt, Des Nächsten Torheit ist's, die wir an uns vermissen. Der Bach, der unser Bild uns zeigt, Du kennst ihn wohl, man nennt ihn – das Gewissen.
12. Der vielköpfige und der vielschwänzige Drache
Einst pries vor der Höflinge Schar Frankreichs Gesandter, der in Wien beglaubigt war, Des eignen Landes Macht vor der des Deutschen Reiches Ein Deutscher sprach: »Trotz des Vergleiches Wißt: unsres Kaiser Banner trug Schon mancher Mann, selbst stark genug, Tät's not, auf eigne Hand ein Heer zum Kampf zu rüsten.« Drauf Frankreichs Pascha, fein und klug, Erwidert: »Als ob wir nicht wüßten, Was jeder Kurfürst an Soldaten stellen kann! Das mahnt mich unwillkürlich an Etwas, das ich erlebt, mag's wunderbar auch klingen. Ich stand an sichrem Ort, da sah durch einen Hag Die hundert Häupter ich der Hydra plötzlich dringen. Mein Blut erstarrt – so etwas mag Zur Furcht den Tapfersten wohl bringen! Doch blind war meine Furcht; denn ob der Köpfe Zahl Drang durch die Hecke nicht einmal, Geschweige bis zu mir der Leib des Ungeheuers. Noch dacht' ich dieses Abenteuers, Da seh' ein zweites Tier, ein vielgeschweiftes, ich, Das bohrt sein Drachenhaupt, sein einz'ges, durch die Hecken; Zum zweiten Male fühlt' ich mich Von Angst erfaßt und starrem Schrecken. Haupt, Leib und jeder Schweif – Eins brach dem andern Bahn, So ward der Fortschritt leicht dem Tier, dem ungeheuren. Seht, ganz so scheint's mir angetan Mit unsrem Reich und mit dem Euren.«
13. Die Diebe und der Esel
Zwei Diebe prügelten um einen Esel sich, Den sie geraubt; der wollt' behalten ihn, verkaufen Wollt' ihn der andre. Jämmerlich Zerbläut das edle Paar sich drum in blut'gem Raufen. Ein dritter Spitzbub kommt zum Ort, Der führt den Meister Langohr fort.
Manch armes Land ist wohl dem Esel zu vergleichen, Und mancher Fürst aus fernen Reichen, Wie aus der Walachei, Ungarn und der Türkei, Den Dieben. Statt der zwei sind's manchmal drei – Zu häufig nur ist diese Sorte heute! Doch von dem Kleeblatt fällt oft keinem zu die Beute; Ein vierter Räuber kommt, ganz jener wert, und – schnapp! Jagt er das Langohr ihnen ab.
14. Wie Simonides von den Göttern beschützt ward
Drei Dinge gibt's, die nie man hoch genug kann preisen: Gott, die Geliebt' und seinen Herrn. Malherbe sagt's einmal, und ich bekenn' mich gern Zu diesem Ausspruch unsres Weisen. Wohl kitzelt feines Lob und nimmt die Herzen ein, Oft ist der Schönen Gunst der Preis für Schmeichelein. Hört, welch ein Preis dafür von Göttern zu gewinnen. Simonides fiel's einstmals ein, 'nes Fechters Lob im Lied zu singen. Beim Beginnen Fand er zu trocken gleich, zu arm den Gegenstand; Des Ringers Sippe war fast gänzlich unbekannt, Ein dunkler Ehrenmann sein Vater, erein schlichter Und dürft'ger Stoff für einen Dichter. Anfangs sprach der Poet von einem Helden zwar Und lobte, was an ihm nur irgend war zu loben; Bald aber schweift' er ab, und zu dem Zwillingspaar Kastor und Pollux hat er schwungvoll sich erhoben. Er preist die beiden als der Ringer Ruhm und Hort, Zählt ihre Kämpfe auf, bezeichnet jeden Ort, Wo jemals sie gestrahlt im Glanze hellsten Lichtes. Der beiden Lob – mit einem Wort, Zwei Drittel füllt es des Gedichtes. Bedungen hatten ein Talent als Preis die zwei; Jetzt kommt der Biedermann herbei, Zahlt ihm ein Drittel nur und sagt ihm frank und frei, Es würden ihm den Rest Kastor und Pollux zahlen. »Halt' dich nur an die zwei, die hell am Himmel strahlen! Allein, daß du nicht meinst, ich sei Dir gram – besuche mich zu Tisch. Gut sollst du speisen; Auch die Gesellschaft ist nicht schlecht, s' ist meine Sippe – ist dir's recht, So wolle mir die Ehr erweisen.« Simonides sagt zu; vielleicht befürchtet er, Außer dem Geld auch noch die Ehre dranzugeben. Er kommt; man speist, man läßt ihn leben, Und froh und munter geht es her. Da meldet ihm ein Sklav', es hätten an der Pforte Zwei Männer augenblicks zu sprechen ihn begehrt; Er eilt hinaus, doch bleibt am Orte Die Sippe schmausend ungestört. Das Götterzwillingspaar, die er im Lied gepriesen, Sie sind's, sie bringen ihm die Mahnung jetzt als Lohn: Forteilen mög' er schnell aus diesen Unsel'gen Hallen, die mit nahem Einsturz drohn. Bald war erfüllt die Schreckenskunde: Ein Pfeiler wankt, einstürzt das Dach, Das ungestützte, schlägt zugrunde All Eß- und Trinkgerät und mit furchtbarem Krach Die Schenken selbst im Festgemach. Noch mehr: als Rache für die Götter, die geschmähten, Und den betrogenen Poeten Zerschmettert beide Bein' ein Balken dem Athleten. Teils wund, teils arg verstümmelt gar Kehrt heim der Gäste ganze Schar. Fama verbreitete die Mär auf ihren Reisen; Nun doppelt alle Welt, ihm Achtung zu beweisen, Den Sold des Dichters, der der Götter Liebling war, Und jedermann aus höhern Kreisen Ließ jetzt durch ihn für Honorar In Versen seine Ahnen preisen.
Was lehrt die Fabel uns? Zuerst, mein' ich, daß man Das Lob der Himmlischen zu weit nie treiben kann; Ferner, daß mit dem Schmerz und ähnlich ernsten Sachen Melpomene versteht manch gut Geschäft zu machen; Endlich, daß unsre Kunst man schätz' ohn' Unterlaß. Die Großen ehren sich, wenn uns sie Gunst erweisen; Einst hört' als Freund' und Brüder preisen Man den Olymp und den Parnaß.
15. Der Tod und der Unglückliche
Stets rief in seiner Not ein armer Mann Den Tod als Retter an. »Tod!« rief er »wie so schön erscheinst du dem Elenden! Komm, eilig komm herbei, mein grausam Los zu enden!« Der Tod vernimmt's und ist dienstfertig gleich am Ort, Klopft an die Tür, tritt ein, und, kaum läßt er sich schauen »Was seh' ich?« ruft der Mann. »Bringt dieses Scheusal fort! Wie gräßlich ist er! Angst und Grauen Macht mir sein Anblick! Höre mich, Komm näher nicht, o Tod! O Tod, entferne dich!«
Mäcenas war ein Mann von Ehre, Und dieser sagte einst: »Nehmt meine Mannheit ihr, Ja, wenn ein Krüppel ich ohn' Arm' und Beine wäre, Nur leben will ich ja! Laßt nur das Leben mir!« Komm nimmermehr, o Tod! so fleht man stets zu dir.
16. Der Tod und der Holzschläger
Ein armer Arbeitsmann, mit Reisig schwer belastet, Von seines Bündels und der Jahre Last gedrückt, Geht schwanken Schritts fürbaß, tief seufzend und gebückt; Sein Hüttlein hätt' er gern erreicht, bevor er rastet. Jetzt kann er nicht mehr fort, und tränenfeuchten Blicks, Die Bürd' ablegend, denkt er seines Mißgeschicks. Was bot an Freuden ihm bisher sein ganzes Leben? Kann's einen Ärmern wohl als ihn auf Erden geben? Oft keinen Bissen Brot und nimmer Ruh noch Rast, Weib, Kind, der Steuern und der Einquartierung Last, Frondienst und Gläub'ger ohn' Erbarmen – des Jammers vollstes Bild zeigt alles dies dem Armen. Er ruft den Tod herbei; der ist auch gleich zur Stell' Und fragt, womit er dienen sollte.