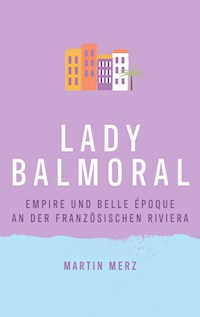
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hinter der namensgebenden Protagonistin der Erzählung mit dem auf den ersten Blick unscheinbaren Titel Lady Balmoral verbirgt sich keine geringere als Queen Victoria (1819–1901). Beschrieben werden die letzten Lebensjahre der Queen und wie sie diese in jedem Frühjahr aufs Neue an der französischen Riviera verbringt, der nicht nur für sie ein Sehnsuchtsort jener Jahre des ausklingenden 19. Jahrhunderts war. Wie in einem bunten, duftenden, sonnenüberfluteten Kaleidoskop lässt sich Victoria auf ihren gedanklichen und tatsächlichen Reisen begleiten. Sie wird in unterschiedlichen Facetten beschrieben, sodass man ihr persönlich und politisch näherkommen kann. Doch auch die Strapazen und Querelen, die ein royales Leben mit seiner Etikette und seinem Protokoll mit sich bringt, werden thematisiert – und dies alles vor der malerischen Kulisse der Riviera. Queen Victoria und der französischen Riviera werden gleichsam ein Denkmal gesetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Der Duft der Macchie
Leiningen und Meiningen
Bataille des Fleurs
Eugénie
Alice de Rothschild
Salisbury
Afrikas Schatten
Aspremont
Lord Melbourne
Der Mahdi
Pflanzen
Der Wettlauf
Peripetie
Der Munshi
Sarah Bernhardt
Gladstone
Griechenland
Winterschwalben
Cemenelum
Amerika
Le soleil c’est tout
China
Auszeichnungen
Transformation
Der Duft der Macchie
Eine alte Frau, in Schwarz gekleidet, reiste im Frühjahr 1895 von England aus nach Südfrankreich. Sie fuhr auf Erholung und zum Vergnügen für einige Wochen.
Auf dem Weg von Windsor nach London hatten ihr die Menschen freundlich und mit einer Vertrautheit zugewunken, als ob sie zur eigenen Familie gehörte. In gewisser Weise war es auch so. Sie freute sich, die dichten Nebelschwaden, die über der Themse waberten, für eine Weile hinter sich zu lassen, wie der alte Lord Brougham, wenn er nach Cannes aufbrach. Sie war entschlossen, die kommenden Wochen zu genießen und sich nur so weit wie nötig mit den Geschäften zu befassen. Die Luft würde leichter und zu dieser Zeit noch nicht so heiß wie in England sein. Sie würde weniger Kopfschmerzen haben.
Die Yacht Victoria & Albert legte wie gewohnt in Portsmouth ab und nahm Kurs Richtung Cherbourg, zum Schutz begleitet von Torpedobooten. Nach sechsstündiger Überfahrt erreichten die Passagiere das französische Festland.
Am Kai erwartete sie der Spezialbeauftragte der Regierung. Victoria begrüßte ihn munter und mit aufrichtiger Freude: »Toujours fidèle au poste, mon bon Paoli?«
Mit diesem unscheinbaren Satz blieben die bodenlangen Röcke, die hochgeschlossenen Kragen, die schamhaft versteckten Knöchel auf der Insel zurück. Paoli genoss schon seit vielen Jahren das Vertrauen und die Sympathie der Königin. Mit ihrer persönlichen Sicherheit betraut, würde er nicht von ihrer Seite weichen, solange sie in Frankreich war. Er hatte seine Leute, die sich diskret um die Monarchin kümmerten, aber er würde auch selbst in ihrer Kutsche Platz nehmen und hinter ihrem Eselskarren herlaufen. Die Mitglieder ihres Gefolges begrüßten Monsieur Paoli herzlich und freuten sich über seine Begleitung. Zwischen ihm und einigen, die schon seit vielen Jahren mit der Königin reisten, Henry Ponsonby, Dr. Reid und Arthur Bigge, hatten sich Freundschaften entwickelt.
Nachdem das Schiff festgemacht war, wurde aus der bis dahin schläfrigen königlichen Entourage geschäftiges Durcheinander. Zelte mussten aufgebaut, das Abendessen vorbereitet und das Gepäck von der Yacht in den bereitstehenden Zug verladen werden. Der Spezialzug der Queen bestand aus zwei Lokomotiven, den persönlichen Waggons in der Mitte des Zuges, in dem sich der Salon und der Schlafwagen der Königin befanden, den Gepäckwagen für Koffer und Taschen, einem Waggon für die indischen Bediensteten und weiteren Waggons für das übrige Dienstpersonal und andere Begleitung. Dieser Zug wurde mit allem Nötigen beladen, um sie am nächsten Morgen Richtung Süden zu fahren.
Defilees, Salutationen, Begrüßungen, eine Kapelle spielte »God Save the Queen«. Victoria war formgerecht auf französischem Boden empfangen worden.
Die Königin nahm sich Zeit für eine Unterhaltung mit Paoli. Man hatte den beiden einen kleinen Tisch mit Stühlen aufgebaut und servierte Tee und Gebäck. Der Gesandte sagte: »Ich hoffe, dass die Überfahrt angenehm und nicht zu unruhig war, Eure Majestät.«
Victoria antwortete: »Ja, das Wetter hatte ein Einsehen mit uns, Gott sei Dank ist niemand seekrank geworden. Wobei, wie Sie ja wissen, ich in dieser Hinsicht nicht so empfindlich bin. Als Oberhaupt einer seefahrenden Nation ist man ja nachgerade verpflichtet, seine Liebe zum Meer zu beweisen.«
Paoli scherzte: »Ja, ich vermute, dass das der Grund ist, warum Ihre Majestät nie den kürzeren Weg von Dover nach Calais nehmen.«
Die Queen genierte sich nicht, ihn direkt und ohne Einleitung das zu fragen, was sie mehr interessierte: »Welche Neuigkeiten gibt es denn aus Paris zu berichten, mein lieber Paoli? Und wichtiger noch, wie stehen wir zurzeit im Kurs?«
Victoria verfügte über ein engmaschiges Netz familiärer Bindungen in allen Königshäusern Europas und war dadurch oft besser informiert als ihre eigene Regierung mit seinem Apparat aus Militär, Diplomatie und Geheimdiensten. Frankreich allerdings hatte sich seiner Monarchie entledigt, und so war sie hier auf andere Kanäle angewiesen. Mit einem liebenswürdigen Lächeln antwortete Paoli: »Oh, selbstverständlich stehen Sie auch weiterhin in allerhöchstem Ansehen in Paris und ganz Frankreich, Eure Majestät.«
Victoria schloss aus dem unbefangenen Tonfall Paolis, dass nichts Beunruhigendes vorgefallen war, und antwortete: »Vielen Dank, mein Lieber, das freut mich natürlich.«
Paoli fuhr fort: »Nun, wie Eure Majestät wahrscheinlich schon wissen, wurde im Januar in der Nationalversammlung ein neuer Präsident gewählt, Monsieur Félix Faure, als Nachfolger von Monsieur Casimir-Periers.«
Darauf erwiderte Victoria: »Ja, man hat mir davon berichtet, ich hatte leider nicht das Vergnügen, Monsieur Casimir-Periers begegnet zu sein. Wie lange war er im Amt?«
Paoli antwortete: »Leider nur etwas mehr als ein halbes Jahr, Eure Majestät.«
Sie konnte sich bei dem französischen Gesandten kleine Scherze erlauben und sagte: »Sie sind ja nicht sehr langlebig, Ihre republikanischen Staatsoberhäupter. Wollen wir hoffen, dass Monsieur Faure sich länger hält und mir irgendwann die Ehre eines Besuchs zuteil werden lässt.«
Paoli beeilte sich, ihr zuzustimmen: »Ja, das hoffen wir alle, Eure Majestät. Oder wollen Sie lieber als Madame Comtesse angeredet werden?« Auf ihren Reisen nach Europa nannte sie sich Gräfin Balmoral, denn obwohl jedes ihrer Gepäckstücke unübersehbar mit dem Schriftzug »Queen of England« gekennzeichnet war, hatte es für sie den Vorzug, vom ermüdenden Zeremoniell des diplomatischen Protokolls befreit zu sein. Ohne auf seine Frage einzugehen, fügte sie an: »Mir ist zugetragen worden, dass es zu einigen kleineren Problemen in Siam gekommen sein soll.«
Sie machte eine Pause, die Paoli, der nichts von den Vorfällen gehört hatte, sogleich nutzte, um abzuwehren: »Aber Eure Majestät, das sind Dinge, die sich leider beinahe jeden Tag ereignen, das sollte jedoch für Eure Majestät nicht der geringste Grund zur Beunruhigung sein. Sie sind doch, glaube ich, zur Erholung hier?«
Die Queen lachte herzlich zurück: »Da haben Sie allerdings vollkommen recht, Paoli.«
Er fragte: »Wie lange ist es her, dass Eure Majestät uns das letzte Mal mit ihrer Gegenwart beehrt haben?«
Victoria antwortete, ohne zu zögern: »Vor drei Jahren war ich in Hyères, aber wie Sie sich vielleicht erinnern, war dieser Besuch von schlimmen Verlusten überschattet. Unser geliebter Eddy hatte uns kurz vorher verlassen und dann, als ob es damit nicht genug gewesen wäre, erreichte uns direkt vor der Abreise nach Hyères die Nachricht vom Tod meines Schwiegersohns, dem Großherzog Ludwig in Darmstadt, woraufhin wir die Abreise wegen der Trauerfeierlichkeiten um zwei Tage verschieben mussten.« Um nicht der düsteren Stimmung noch mehr Raum zu geben, setzte sie hinzu: »Diesmal komme ich, Gottlob, ohne beschwerliche Nachrichten, und ich hoffe inständig, dass es so bleibt.«
Die geänderte Tonlage der Königin erlaubte es Paoli, fortzufahren: »Und nun geht es also zum ersten Mal nach Nizza für Eure Majestät?«
Victoria stellte ihm eine Gegenfrage: »Mein lieber Paoli, glauben Sie denn, dass ich die richtige Wahl getroffen habe?«
Er antwortete: »Nachdem Sie bereits in früheren Jahren in Menton, Grasse und Cannes waren, gibt es, wenn ich das so sagen darf, keinen Grund mehr, Nizza die Ehre Ihres Besuchs vorzuenthalten. Und wenn Sie mich das noch hinzufügen lassen, dann glaube ich, dass es eine gute Wahl ist. Ich bin sicher, Eure Majestät werden den Karneval lieben. Die Blumenschlacht in Nizza ist viel größer als die in Grasse und die Promenade des Anglais vornehmer als alles, was Sie aus Menton oder Hyères kennen und«, fügte er nach einer Kunstpause mit einem bedeutsamen Lächeln hinzu: »Es gibt kein Casino wie in Monte-Carlo.«
Victoria sagte: »Ja, auf all das freue ich mich schon sehr. Allerdings, lieber Paoli, gestatten Sie mir die Bemerkung, die Fête du Citron in Menton ist wirklich ebenfalls ein großartiger Spaß. Aber ich gebe Ihnen recht, dass all die anderen, die man sehen möchte, eher in der Nähe von Nizza sind, während Menton doch etwas abseits liegt. Wissen Sie, mein Freund, dies ist das erste Mal, dass ich keiner Empfehlung oder Einladung gefolgt bin wie sonst immer. Da möchte man sicher sein, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.«
Am nächsten Morgen begrüßte Victoria zunächst persönlich den Lokführer. Hinter der Fassade der Freundlichkeit steckte ihre Sorge um Unfälle, die sich leider schon ereignet hatten. Sie war beruhigt, als sie ihn ausgeschlafen und wohlauf vorfand. Dann bestieg sie, wie gewohnt, als Letzte den Zug. Beim Öffnen der Tür klappte die Treppe mit den vergoldeten Haltegriffen automatisch herunter und Beatrice half ihr in den Wagen, in dem sie, umgeben von allem erdenklichen Komfort, zusammen die nächsten dreißig Stunden verbringen würden.
Schon kurz nachdem sie losgefahren waren, fiel sie immer wieder in einen leichten Schlaf, wie dies bei älteren Menschen häufig der Fall ist, während sich der königliche Spezialzug pfeifend und schnaubend seinen Weg durch das ländliche Frankreich bahnte. Sie sah Alberts Gesicht, vom Rauch halb eingehüllt, er hatte vor Begeisterung seine Hände triumphierend in die Luft geworfen. Wo war das noch gewesen? Sie konnte ihn nicht verstehen, es war ein stummes Bild, obwohl sein Mund ganz offensichtlich Worte formte, aber der Lärm der Dampflok war zu groß. Was für eine ruhige und komfortable Art des Reisens dies doch war und welch ein Fortschritt gegenüber einer Kutschfahrt. Sie liebte Zugfahrten. So wie Albert. Was hatte ihre Mutter gelitten, als sie sich im achten Monat schwanger mit ihr in einer ungefederten Kutsche auf den Weg von Amorbach nach London machen musste. Die arme Victoire hatte gebangt, ob sie es rechtzeitig und gesund über den Kanal schaffen würden, der eigene Mann und Vater des Kindes auf dem Bock der Kutsche, weil für einen Fahrer kein Geld da war, und im Fond Frau von Siebold, die Hebamme.
Louis-Philippe hatte sie vor Jahrzehnten eingeladen, Frankreich zu entdecken. Victorias Vater, der Herzog von Kent, hatte ihm einst irgendwo in den Weiten Kanadas mit einem kleinen Kredit aus einer Notlage geholfen, und Louis-Philippe wollte sich dankbar zeigen, nachdem er zum König gekrönt worden war, das Persönliche und das Staatsmännische nach französischer Art leichthin verbindend. So war der Anfang von Victorias und Alberts Bekanntschaft mit dem Land gemacht. Sie waren beide noch jung, und Victoria war von Beginn an erfreut, entzückt, amüsiert. Die Franzosen schienen ihr so zivilisiert und zuvorkommend. Sie erwiderten ihre Begeisterung und verstärkten sie noch. Auch Albert hatte diese Reisen geliebt. Die Liebe zu Frankreich erlosch auch nicht, nachdem Louis Napoléon ihren ersten Gastgeber ins englische Exil vertrieben hatte. Albert und Victoria gewannen auch ihn und seine Frau lieb. Die französische Geschichte fand aber immer noch keine Ruhe, und so wurden später Napoléon und Eugénie aus dem Land gejagt wie ihr Vorgänger. Auch sie suchten und fanden Zuflucht in England. Ab da hatten sich die Verhältnisse in Frankreich grundlegend geändert, und Victoria konnte sich lange nicht an die neue Französische Republik gewöhnen. Es dauerte seine Zeit, bis sich ihr Misstrauen und ihre Vorbehalte legten.
Für die Mahlzeiten, den Tee und die königliche Morgentoilette hielt der Zug an. Die meiste Zeit unterhielt sie sich mit Beatrice, ihrer jüngsten Tochter und unverzichtbaren Begleiterin auf Reisen, mit der sie sich auch denselben Schlafwagen teilte. Die Prinzessin von Battenberg hatte sich am Ende dem Willen ihrer Mutter beugen müssen. Sie tat, was diese von ihr erwartete, und fügte sich in die Aufgabe der Gesellschafterin und Sekretärin, so wie Prinzessin Helena es aus freien Stücken tat. Victoria hatte diese Rolle von Anfang an für Beatrice vorgesehen und nur ein paar kurze Windungen des Lebens hatten der Prinzessin von Battenberg zeitweise vorgegaukelt, dass das Schicksal etwas anderes mit ihr vorhaben könnte.
Zur Einstimmung auf die bevorstehenden Tage redeten sie über die geplanten und unverhofften Begegnungen, das Wetter und die Natur, die Victoria so liebte. All die wichtigen Banalitäten der nächsten Wochen, auf die sie sich freute. »Und, hast Du vor, ein bisschen zu malen oder zu zeichnen?«, wandte sich Victoria an ihre Tochter.
»Oh ja, das werde ich wohl, wenn du mir denn die Zeit lässt, Mutter«, erwiderte Beatrice leicht ironisch.
»Es wird dich nicht wundern, aber, worauf ich übrigens bestehe, ist, dass du uns gelegentlich am Klavier vorspielst. Du weißt, dass du auch den anderen damit immer viel Freude machst. Und bevor ich es vergesse, habe bitte ein Auge auf die kleine Helena«, fügte Victoria hinzu, obwohl sie wusste, dass sich ihre Tochter bei diesen Reisen immer um ihre Nichte kümmerte.
Beatrice wechselte das Thema: »Wann werden wir Eugénie besuchen?« –
»Oh, bei der ersten Gelegenheit, die sich ergibt. Sie hat sich ja letztes Jahr dort unten am Cap-Martin einen hübschen kleinen Palast bauen lassen. Wie ich hörte, war sie es wohl leid, immer auf die österreichische Kaiserin und ihre Einladungen angewiesen zu sein. Bei ihrem Geschmack glaube ich, dass sie es sich dort schön eingerichtet hat. Wir werden es ja sehen«, erklärte Victoria.
»Wie geht es dem guten Jacquot, alles wohlauf?«, erkundigte sich Beatrice, wohlwissend, dass ihrer Mutter das sehr wichtig war.
»Aber ja, es geht ihm gut, meinem treuen kleinen Eselchen. Er sollte schon zusammen mit den Pferden und den Möbeln in Nizza angekommen sein. Ich müsste Ponsonby mal danach fragen«, antwortete Victoria.
Die Queen verfiel wieder in den angenehmen Zustand eines Dämmerschlafs, weil die immer gleichen grauen Wolkenbilder an ihrem Fenster vorbeizogen. Sie sah sich oberhalb von Grasse auf Jacquot reiten, durch steiniges Gelände hindurch, ein welliges, kleines Plateau. Man konnte von hier aus die gesamte Küste rund um Cannes und Nizza sehen. Die Ebene war nur karg bewachsen, fast wüstenartig, der Sonne so sehr ausgesetzt, dass sie den Impuls verspürte, schnell wieder in schattigere Gefilde zu flüchten. Es gab keine der schönen Blumen hier oben, die weiter unten in den Gärten und an der Küste überall ihren Verführungskünsten nachgingen. Aber es gab diese Büsche, diese unscheinbaren Gewächse, die sie vorher nie wahrgenommen hatte. Hier fielen sie ihr auf, weil es fast nichts anderes gab, nur den Wind, die Sonne und dieses Gewächs, dessen Namen sie erst später erfuhr. Und sie bemerkte den feinen, unaufdringlichen, aber sehr nachhaltigen Duft, den man erst wahrnahm, wenn man sich bewusst machte, dass auch im Unscheinbaren eine Schönheit liegen kann, die sich nur den aufmerksamen Sinnen eröffnet. Sie setzte sich plötzlich auf und seufzte, ohne eine Antwort von Beatrice zu erwarten, mehr zu sich selbst: »Tu te souviens de l’odeur du maquis? Une plante si discret, mais qui sent si bon!«
Die unter strenger römischer Beobachtung sich wähnende keltische Zunge nennt sie zurückhaltend Maquis, die italienische ruft sie nach ihrer Gewohnheit lauthals Macchia, die unentschlossene germanische Macchie. Es war dasselbe Gewächs, vielmehr die Organisation von Gewächsen, die sich gemeinsam gegen die Äxte verteidigten, um in ihrem Inneren die verschiedenen Lebensformen zu bewahren. Wie eine Legion mit ihren Schildern gegen feindliche Heere sich schützte, hatte sich die Macchia, um es mit dem Verursacher zu sagen, Dornen zugelegt, krallte sich flach an den Felsen, beugte sich unter dem Wind, bar menschlichen Nutzens, entsagte nicht ihrer Düfte. Die Macchia, wunderbare, undurchdringliche Macchia, Steineichen, Wacholder, Erdbeerbäume, Mastixsträucher, Alaternen, Heidekraut, Lorbeerbäume, Buchsbäume miteinander verwoben wie Haare. In ihrem stachlig luftigen Atrium von Immergrünen duckten sich die Baumartigen und entledigten sich des Laubes, den Dürren zu trotzen, da der reiche saftige Humus, der hier einst breitete, nun auf dem Boden des Meeres lag. Wenn im Frühjahr das Wasser die Steine netzte, trugen die Bewohner der Macchia ihre Blüten zur Schau, brachten auf dürrem Boden üppige Gärten hervor. Die Aromatischen traten hinaus, und jedem Strauch entströmten Wohlgerüche flüchtiger Essenzen. Rosmarin, Thymian, Lavendel, Cistusrose, Myrte und Pistazie mischten ihre Düfte, das zarte Blau der Rosmarinblüte gesellte sich zum grellen Gelb des Ginsters, die helle Farbe des Ciströschens zum dunklen Violett der Lavandula. Das war der heimatliche Duft Korsikas, nach dem sich Bonaparte auf St. Helena sehnte, um nur das Gefühl des Seefahrers noch einmal zu kosten, der vom Meer kommend, schon von Weitem die Insel riechen konnte.
Nur in der Gegenwart ihrer Tochter gestattete sie sich manchmal diese Art kleiner, selbstvergessener Schwärmerei. Es war, als ob sie den Duft der Blumen, den azurblauen Himmel, die sanfte Brandung des Mittelmeeres durch den Gebrauch der Landessprache vorzeitig herbeisehnen könnte. Beatrice konnte sich in diesem Moment nicht in ihre Mutter hineinversetzen, etwas, wofür sie sonst immer ein Gespür hatte, und sagte: »Entschuldige bitte, aber ich verstehe nicht, wovon Du redest, Mutter.« Victoria war, ohne darüber nachzudenken, ins Französische verfallen, weil dies die Sprache war, in der sie während ihres Halbschlafs gedacht hatte. Diese war für Victoria der Schlüssel, der ihr Begegnungen ermöglichen würde, die in der Steifheit der englischen Öffentlichkeit und des englischen Hofes undenkbar waren. Ein paar Wochen in Sicherheit vor den immerzu hochgezogenen heimischen Augenbrauen wegen des Munshis oder wegen sonst was sein – das war es, was sie suchte. In Frankreich regte sich wegen einer kleinen Liaison keine Braue.
Das alles vollzog sich in einer männerlosen Gegenwart. Nicht, dass der Munshi kein Mann war. Aber er hatte für Victoria nicht dieselbe Bedeutung wie Albert oder John Brown. Das war etwas, das ihre Umgebung verkannte. Sie erfanden schäbige Namen für den Munshi, dichteten ihm eine Stellung an, die er nicht hatte. Sie verstanden nicht, was er ihr bedeutete. Er war für sie jemand, mit dem sie mühelos eine andere Welt betreten konnte, ohne dass sie sich zu etwas verpflichten musste. Ihr ewiges Schwarz half ihr dabei, dass sich ihr niemand mehr in den Weg stellen würde, kein Albert, kein Premierminister und kein Stallbursche. Niemand würde sie mehr Victoria nennen, das allerdings bedauerte sie manchmal.
Über Familienangelegenheiten, die unvermeidlich die Politik berührten, sprachen Victoria und ihre Tochter meist auf Deutsch. Diese Intimitäten waren nicht für fremde Ohren bestimmt und sollten zwischen ihr und der Prinzessin von Battenberg bleiben, und es gab immer Familiäres zu besprechen. »Wenn Du wüsstest, wie froh ich bin, dass Alix jetzt endlich ihren Mann gefunden hat. Das arme Ding hat so viel durchmachen müssen in ihrem kurzen Leben. So früh die Eltern zu verlieren und dann der Tod von Frittie und May …«, sagte Victoria, ohne den Satz zu vollenden.
»Aber ich dachte, du hattest deine Vorbehalte gegen den Zaren, warst gar nicht so begeistert, die kleine Sunny an Russland zu verlieren?«, wandte Beatrice ein.
»Ja, wohl wahr, meine Liebe, ich hatte Bedenken und habe sie immer noch, ich habe einfach Angst, was ihr dort zustoßen könnte. Russland ist groß und weit und grausam. Aber weißt du, am Ende habe ich zugestimmt, weil es schließlich Alix ist, die glücklich werden muss, und ich habe das Gefühl, sie liebt ihren Nikolaus wirklich sehr«, entgegnete Victoria.
»Ich bin auch immer noch erstaunt, wie schnell das alles gegangen ist. Kaum waren sie verheiratet, da starb der alte Zar, und drei Wochen später werden ihr Mann und sie schon zum neuen Zarenpaar gekrönt, jetzt heißt sie offiziell Zarin Alexandra. Hätten sich ruhig etwas mehr Zeit lassen können«, versuchte Beatrice einen unpassenden Scherz.
»Was mich auch jetzt noch irritiert, ist, dass es der Kaiser gewesen sein soll, der sie überredet hat, zur orthodoxen Kirche überzutreten. Das ist ihr wirklich schwergefallen, so, wie sie an ihrem Glauben hängt. Der Kaiser, der Zar, man kann ihnen allen am Ende nicht trauen.«
Beatrice sagte: »Aber nein, Mutter, da kann ich dich beruhigen, es war Elisabeth, die Großherzogin von Russland, ihre ältere Schwester, die sie überzeugt hat, nicht nur zu konvertieren, sondern auch sein zweites Angebot anzunehmen. Alix und Nikolaus hatten sich auf Elisabeths und Sergeis Hochzeit zum ersten Mal getroffen.«
Victoria sagte: »In jedem Fall ist das Schicksal von Alix besiegelt, und wir werden alle versuchen, das Beste daraus zu machen.«
Was hatte sie gerade an die Riviera geführt und nicht nach Biarritz an den Atlantik, der bei Gladstone so hoch im Kurs stand? Wäre er die Vorliebe von Melbourne oder Disraeli gewesen, hätte das etwas geändert? Melbourne hatte sie als blutjunge und unerfahrene Königin, die sich nackt und ohne Verbündete vor eine Meute höfischer Raubtiere geworfen sah, beschützt und dann Schritt für Schritt dafür gesorgt, dass sie das Zepter in die Hand bekam. Seit diesen Tagen hatten die großen Dinge für sie keine Schrecken mehr. Disraeli hatte sie gegen einigen Widerstand zur Kaiserin von Indien gekrönt. Gladstone dagegen hatte Gordon auf dem Gewissen. Er hatte die Niederlage gegen den Mahdi im Sudan zugelassen und der Barbarei zum Triumph verholfen. Alles, wofür sie stand, Ordnung, Zivilisation, Fortschritt, am Boden. Eine Demütigung für die britische Armee und auch, ja, für sie. Warum nicht Cannes oder Monte-Carlo? Bertie hatte ihr vielleicht Angst gemacht, weil er sich den hedonistischen Verlockungen als nicht gewachsen erwiesen hatte. Nicht, dass sie für sich etwas befürchtete, aber wollte sie wirklich an diese Zeiten erinnert werden? Selbst der Munshi zeigte sich in seinem Notizbuch angewidert vom Sodom Monte-Carlo, und so hielt auch sie sich fern.
Es waren die besten und die schlechtesten Zeiten, da hatte Dickens schon Recht. Dank des technischen Fortschritts konnte von der anderen Seite des Atlantiks in der New York Times über jeden ihrer Schritte berichtet werden. War es gut, war es schlecht, war es Weisheit oder Idiotie? War es der Versuch, sie zu kontrollieren? Als sie aus dem Zug stieg, war ihr das herzlich egal. Wichtig waren jetzt andere Dinge, um die sie sich kümmern musste.
Das Empfangskomitee in Nizza ignorierte offenbar die Tatsache, dass hier nur die Gräfin Balmoral anreiste. Bataillone waren aufmarschiert, die Alpenjäger mit Klarinetten, Artillerie zu Pferd und wieder spielte ein Orchester »God Save the Queen«. Die Menge winkte mit Taschentüchern, und die Menschen applaudierten begeistert. General Gebhart wirkte nervös bei seiner Rede. Der kleinen, gebeugten alten Frau gefiel das wohl, auch wenn sie für den einfachen Gruß eines Bahnhofsvorstehers oder den Blumenstrauß eines Bauernmädchens empfänglicher gewesen wäre als für solche offiziellen Ehrungen.
Mit Cimiez, dem nordöstlich vom Zentrum auf einem Berg gelegenen Stadtteil von Nizza, hatte sie sich für den Ort entschieden, an dem schon die römischen Prokonsuln residiert hatten und der den grandiosesten Ausblick über die Stadt und die Baie des Anges bot. Dabei interessierte sie sich mehr für die Naturschönheiten als die Vergangenheit des Ortes. Auch das hatte Albert ihr mit seinem ganzen Ernst vermittelt. Niemand, der über ihnen logieren oder den Blick auf ein Meer verderben konnte, das einen gänzlich anderen Anblick bot als das englische. Die majestätisch schneebedeckten Berge der Seealpen als schmückende Krone im Hintergrund. Sie hatte ein Faible für Juwelen und einen Sinn für Schönheit.
Sie kam mit ihrem Gefolge aus ungefähr fünfzig Personen im Grand Hotel Cimiez an. Dass es wegen der Logis noch harter Budgetverhandlungen bedurfte, kümmerte die Königin nicht. Sie konnte sich darauf verlassen, dass Sir Henry Ponsonby in seiner Rolle als königlicher Finanzsekretär dies diskret und erfolgreich erledigte. So war sie es von ihm seit vielen Jahren gewohnt, und dass seine Tante Lord Melbourne einst ins Unglück gestürzt hatte, war nie zum Thema geworden. Die elektrische Tram hoch auf den Berg, den Pferdegespanne nur mühsam erklommen, war erst zwei Tage vor der Ankunft der Queen von der Stadtverwaltung fertiggestellt worden. Ebenso war noch bis zuletzt hektisch an der Verbesserung der Abwasserkanäle, der Straßenbeleuchtung, dem Hotel und dem dazugehörigen Garten gearbeitet worden. Die normalen Hotelgäste, fast ausschließlich Briten, wurden ausquartiert. Trotzdem mussten ein paar Leute ihres Trosses im Hotel Vitali untergebracht werden, einem Annex des Grand Hotels, der durch einen Park von jenem getrennt war. Darunter waren auch der Munshi und die anderen indischen Bediensteten, denen ein eigener Bereich innerhalb des Vitali zugeteilt wurde. Und das war nun die Angelegenheit, die als eine der ersten zu erledigen war. Es musste alles so arrangiert werden, dass der Munshi keinen Grund zur Klage hatte. Die Reise im Vorjahr nach Florenz hatte einige Fingerzeige gegeben. Der Munshi musste angemessen in der Berichterstattung vorkommen, sowohl in ausländischen als auch in inländischen Zeitungen. Seine Stellung war die eines Sekretärs und Hindulehrers der Queen, nicht die eines ordinären indischen Bediensteten, der ihr in ihre Kutsche half. Vielmehr waren ihm diese untergeordnet.
Das alles besprach die Queen nochmals mit Ponsonby und Dossé, dem Direktor für ihre Kontinentalreisen. Die kleinen, unerledigten Dinge waren es, die sich am Ende zu großem Unbehagen ausweiteten.
Die Riviera war ihre Entdeckung gewesen, jedenfalls war Albert ihr kein Führer mehr dabei. Wie oft hatte sie hier schon um geliebte Menschen getrauert. Ihr Sohn Leopold war in Cannes gestorben, ihre Elizabeth Reynolds in Grasse und Albert Victor hatte sie in Hyères betrauert. Bertie dagegen führte sich zeitweise wie der König der Riviera auf. Ihr Stand und ihre innere Haltung erforderten es bei jeder seiner Eskapaden, ihre Missbilligung zu dokumentieren. Der Prinz von Wales logierte auch nie in derselben Stadt wie seine Mutter, mit der einen Ausnahme vor drei Jahren in Hyères, als er um seinen Sohn trauerte und sie um ihren Enkel.
Sie hatte hier stets auch bei bitteren Anlässen Ablenkung und Trost gefunden, ganz anders als in Balmoral, das untrennbar mit Albert und John Brown verbunden bleiben würde. Allein machte es sie eher depressiv, zumal im harschen, abgeschiedenen schottischen Winter, wo selbst ihr Gefolge vor Langeweile starb. Auch das Gras von Osborne war ihr nicht mehr das Allheilmittel gegen alle Arten von Krankheiten, sie konnte sich nicht mehr darin wälzen, wie sie es als Kind getan hatte. Die Ärzte rieten überwiegend von der Riviera ab und empfahlen stattdessen Davos. Aber deswegen war sie ja gerade nicht hier. Sie war nicht krank und musste von keiner Tuberkulose genesen. Sie war zum Vergnügen hier. Am nächsten Morgen würde sie sich mit ihrem Eselskarren durch den Hanbury Garten fahren lassen, wenn ihr danach war. Sie würde ihre Nase in exotische Blüten versenken und dann tief einatmen. Und später am Nachmittag würde sie in ihrem Landauer eine Spazierfahrt in die Berge machen und den Blick immer wieder über das tiefblaue Meer schweifen lassen. Sie würde dort mit wildfremden Menschen ein paar Gläser roten Bellet trinken, von einem der Anbaugebiete im Norden Nizzas. Keine Fürsten, keine Herzöge. Nur unter einfachen Leuten würde sie die einfachen Dinge so genießen können, wie sie es vorhatte. Vielleicht würde sie ein paar Maler treffen. Sie würde ihnen ein wenig zusehen und fachmännische Bemerkungen austauschen, auch wenn sie selbst das Malen aufgegeben hatte und nur noch selten zeichnete. Sie würde nicht erwähnen, wer sie war oder dass Alberts Weltausstellung dabei geholfen hatte, die Tubenfarben zu verbreiten, und so die Freiluftmalerei erst möglich gemacht hatte. Renoir hatte sogar behauptet, dass es nur mit Schweinsblasen keinen Cézanne, keinen Monet, keinen Pissarro und keinen Impressionismus gegeben hätte. Und wo fanden Maler ein schöneres Betätigungsfeld als hier am Meer und in den Bergen der Riviera, wo sie ihnen nun zusehen konnte. Abends würde sie den Tag noch einmal an sich vorüberziehen lassen und das ein oder andere Geschehnis oder den ein oder anderen Gedanken in ihrem Journal festhalten.
Leiningen und Meiningen
Am Ende war der Weg frei für Prinz Leopold von Sachsen-Coburg. Der Prinz hatte klare Ziele, war tatkräftig und selbstbewusst. Er war fest entschlossen, sich mit der zukünftigen Königin von England zu vermählen. Woher aber kam dieser Prinz, und woher nahm er die Überzeugung, seine wahrlich abenteuerlichen Absichten in die Tat umsetzen zu können? Er verfügte weder über das Netzwerk noch die Herkunft, solch anmaßende Ambitionen zu rechtfertigen. Das Fürstentum, aus dem er stammte, hatte nur ein paar Zehntausend Einwohner und war durch die napoleonischen Kriege gründlich verwüstet worden, der Hunger grassierte jahrelang. Der Optimismus des Prinzen schien vom Korsen inspiriert zu sein.
Wie war es ihm gelungen, den englischen Prinzregenten davon zu überzeugen, ihm seine einzige Tochter zur Frau zu geben, obwohl der Prinz von Wales ihn im Grunde nicht mochte? Der Brite fand den Sachsen-Coburger irritierend einschmeichelnd und verspottete ihn wegen seiner Vorsicht und Unentschlossenheit als Marquis Peu-a-peu. Auch andere Stimmen am englischen Hof konnten ihre Abneigung gegen ihn nicht verbergen, hielten ihn für langweilig, rechthaberisch und zimperlich und deuteten seine Attitüden als die eines rückwärtsgewandten Patriziers. Es waren wohl die unerschütterliche Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit, die Umtriebigkeit vor allem, die es ihm erlaubte, wie bei der Fabel vom Hasen und Igel, immer zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, während die Gegenseite sich noch fragte, welches Stück denn eigentlich gespielt wurde. Seine Manieren waren tadellos, er hatte einen unbestreitbaren Charme und eine schwer zu fassende feminine Seite, die ihm das Entree bei Frauen aller Couleur erleichterte.
Geleitet von seinem politischen Instinkt, umging Leopold den Regenten während der letzten Etappe der Durchführung des Plans, weil er richtigerweise annahm, dass der Prinz von Wales ihm nicht mehr nützen, sondern allenfalls noch schaden könnte. Es gelang ihm trotz seiner jungen Jahre, gestandene englische Minister zu beeindrucken, und er freundete sich mit dem am besten geeigneten Onkel der Prinzessin an, dem Herzog von Kent, den er als geheimen Boten zu ihr nutzen konnte. Sein im Wissen um vorangegangene Enttäuschungen klug eingesetzter Charme war auf eine empfängliche junge Frau getroffen, die sich ohne große Gegenwehr ergab und ihm so einen spektakulären Coup erlaubte. Die Prinzessin erklärte ihrer Umgebung kurzerhand, dass er, Leopold, für ihr Glück vonnöten und somit eine Verbindung unumgänglich sei. Im Januar 1816 reiste Leopold zur Verlobung nach England, die Hochzeit mit Prinzessin Charlotte fand im Mai desselben Jahres statt. Der Charakter der beiden Eheleute stand in merkwürdigem Gegensatz zueinander. Dieser 26-jährige Prinz aus kleinem deutschem Haus hatte sich beim Kampf in Waterloo ausgezeichnet und anschließend auf dem Wiener Kongress bemerkenswertes diplomatisches Geschick bewiesen. Mit diesen Referenzen ging er an die Zähmung einer Widerspenstigen. Förmlich im Auftritt, überlegt im Reden, vorsichtig im Handeln beherrschte er bald das wilde, ungestüme, großzügige Geschöpf an seiner Seite. Er fand vieles an ihr, das er nicht gutheißen konnte. Sie stellte bohrende Nachfragen, sie stampfte mit den Füßen, sie brüllte vor Lachen, sie hatte sehr wenig von jener Selbstbeherrschung, die besonders von Prinzessinnen verlangt wird. Kurz, ihre Manieren waren abscheulich. Er dagegen rühmte sich in dieser Hinsicht, eine hervorragende Schule durchlaufen zu haben, und machte es sich zur Aufgabe, aus dem Wildfang eine echte Prinzessin zu machen. Die Auseinandersetzungen zwischen ihnen liefen oft nach demselben Muster ab. Sie baute sich vor ihm auf, die Hände entschlossen in die Seiten gestemmt, angetan nur mit ihrem reizenden Petticoat, das Gesicht vor Erregung gerötet, die Augen funkelnd, und verkündete, dass sie bereit sei, alles zu tun, was er von ihr verlangte: »Wenn du es willst, werde ich es tun.« Seine ruhige Antwort darauf war stets, dass alles, worum er sie bitte, in ihrem eigenen Interesse und zu ihrem eigenen Guten sei. Baron Stockmar, ein Vertrauter des Paares, notierte in sein Tagebuch, dass Leopold seiner Frau der beste Ehemann der Welt sei und sich die Größe der Liebe Charlottes zu ihrem Mann nur noch mit der Größe der englischen Schulden vergleichen ließe. Das junge Paar erwartete Nachwuchs und richtete sich in froher Hoffnung im Claremont House ein.
*
Der Herzog von Kent setzte sich zu Madame Saint Laurent an den Frühstückstisch. Er überließ ihr, wie es seiner Gewohnheit entsprach, den Morning Chronicle und bearbeitete zunächst seine Korrespondenz. Edward, Herzog von Kent, war der vierte Sohn von Georg. Er war ein großer und kräftiger Mann mit buschigen Augenbrauen. Sein Schädel war oben kahl, aber das verbliebene Haar an den Seiten sorgfältig gekämmt und glänzend schwarz gefärbt. Seine Kleidung war gepflegt und seine ganze Erscheinung war akkurat. Er hatte sein frühes Leben in der Armee in Gibraltar, in Kanada und in Westindien verbracht und war unter dem Einfluss der militärischen Ausbildung zu einem Zuchtmeister geworden. Als er zuletzt nach Gibraltar geschickt wurde, um die Ordnung in einer meuternden Garnison wiederherzustellen, wurde er mit dem Vorwurf unangemessener Strenge abberufen. Abrupt und lange vor der Zeit war seine aktive Karriere schon mit Mitte dreißig beendet. Einen Sadisten hatte man ihn seinerzeit geschimpft. Er aber war überzeugt, nur seine Pflicht getan zu haben. Wie sonst sollte man Aufständische zur Räson bringen als mit harter Hand? Ja, er war wohl mit Strenge vorgegangen, aber ohne das Gefühl, sich schuldig gemacht zu haben oder eine unbotmäßige persönliche Befriedigung dabei empfunden zu haben.
Fast alle Briefe hatten diesmal nur ein Thema: Prinzessin Charlottes plötzlichen Tod, an einem kalten, abweisenden Novembertag des Jahres 1817 aus dem Leben gerissen. Einerseits, wie der Herzog sich schamhaft eingeste





























