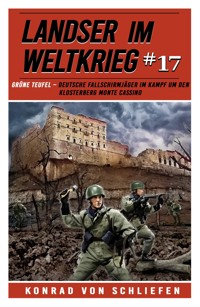
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Fesselnde Landser-Geschichten in Romanheft-Länge
Der vorliegende Band „Grüne Teufel” lässt Sie in die Schlacht um Monte Casino eintauchen.Die deutschen Fallschirmjäger erkämpfen sich in der heroischen Schlacht um den Klosterberg Monte Casino den Respekt der alliierten Gegner und die Ehrenbezeichnung „Grüne Teufel“.
Wird es den Fallschirmjägern unter dem Kommando von Generalleutnant Richard Heidrich gelingen, sich der gegnerischen Übermacht zu erwehren?
Über die Reihe „Landser im Weltkrieg“
„Landser im Weltkrieg“ erzählt fiktionale Geschichten vor historischem Hintergrund realer Schlachten und Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Im Zentrum stehen die Erlebnisse deutscher Landser fernab der großen Strategien am grünen Tisch.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Hermann Weinhauer
Landser im Weltkrieg 17
Grüne Teufel – Deutsche Fallschirmjäger im Kampf um den Klosterberg Monte Cassino
EK-2 Militär
Über die Reihe Landser im Weltkrieg
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Grüne Teufel
Achtung!
Über den nächsten Band
Leseprobe
Lernen Sie den neusten Kracher aus dem Hause EK-2-Militär kennen!
Keine Neuerscheinung mehr verpassen und gratis E-Book sichern!
Über die Reihe Landser im Weltkrieg
Jeder Band dieser Romanreihe erzählt eine fiktionale Geschichte, die vor dem Hintergrund realer Ereignisse und Schlachten im Zweiten Weltkrieg spielt. Im Zentrum der Geschichte steht das Schicksal deutscher Soldaten.
Wir lehnen Krieg und Gewalt ab. Kriege im Allgemeinen und der Zweite Weltkrieg im Besonderen haben unsägliches Leid über Millionen von Menschen gebracht.
Deutsche Soldaten beteiligten sich im Zweiten Weltkrieg an fürchterlichen Verbrechen. Deutsche Soldaten waren aber auch Opfer und Leittragende dieses Konfliktes. Längst nicht jeder ist als glühender Nationalsozialist und Anhänger des Hitler-Regimes in den Kampf gezogen – im Gegenteil hätten Millionen von Deutschen gerne auf die Entbehrungen, den Hunger, die Angst und die seelischen und körperlichen Wunden verzichtet. Sie wünschten sich ein »normales« Leben, einen zivilen Beruf, eine Familie, statt an den Kriegsfronten ums Überleben kämpfen zu müssen. Die Grenzerfahrung des Krieges war für die Erlebnisgeneration epochal und letztlich zog die Mehrheit ihre Motivation aus dem Glauben, durch ihren Einsatz Freunde, Familie und Heimat zu schützen.
Prof. Dr. Sönke Neitzel bescheinigt den deutschen Streitkräften in seinem Buch »Deutsche Krieger« einen bemerkenswerten Zusammenhalt, der bis zum Untergang 1945 weitgehend aufrechterhalten werden konnte. Anhänger des Regimes als auch politisch Indifferente und Gegner der NS-Politik wurden im Kampf zu Schicksalsgemeinschaften zusammengeschweißt. Genau diese Schicksalsgemeinschaften nimmt »Landser im Weltkrieg« in den Blick.
Bei den Romanen aus dieser Reihe handelt es sich um gut recherchierte Werke der Unterhaltungsliteratur, mit denen wir uns der Lebenswirklichkeit des Landsers an der Front annähern. Auf diese Weise gelingt es uns hoffentlich, die Weltkriegsgeneration besser zu verstehen und aus ihren Fehlern, aber auch aus ihrer Erfahrung zu lernen.
Nun wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen mit dem vorliegenden Werk.
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis zu bieten.
Damit uns dies gelingt, sind wir sehr an Ihrer Meinung interessiert. Haben Sie Anregungen für uns? Verbesserungsvorschläge? Kritik?
Schreiben Sie uns gerne: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Heiko und Jill von EK-2 Militär
Grüne Teufel
In diesem dreimal verfluchten Krieg habe ich schon vieles gesehen und erlebt. Aber der blutige Kampf um die Stadt Cassino und den gleichnamigen Berg mit der Benediktinerabtei war wahrlich der Höhepunkt dieser Knochenmühle. Wenn ich zurückdenke an die vielen Wochen des versengenden Kampfes, an die beißende Kälte, die Ströme von Regen und des unaufhörlichen Schneefalls, die Seen von Schlamm, in denen Militärgerät und Soldaten beider Seiten versanken, und an die tiefen Befestigungen, in denen wir uns in den Bergen festgekrallt hatten, wundere ich mich noch heute, dass einige von uns diese Hölle tatsächlich überlebt haben.
Damals konnte ich nicht ahnen, dass ich mit meinen Heereskameraden Teil einer der größten und schwersten Material- und Abwehrschlachten der deutschen Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg werden würde. Und doch stellte das erbitterte Ringen und das massenhafte Sterben um die Stadt und das Kloster Cassino einen Wendepunkt im Kampfraum Italien dar. Die Besten der besten deutschen Soldaten stemmten sich hier in der verlustreichsten, qualvollsten und tragischsten Schlacht gegen den Ansturm eines in allem weit überlegeneren Gegners. Monte Cassino wurde zum »Verdun« des italienischen Kriegsschauplatzes.
Dies ist die Geschichte des Fallschirm-Jägers Gerhard Darmann – also meine Geschichte. Und damit auch jene von hunderten anderen tapferen Elite-Kämpfern, die am verdammten Monte Cassino Seite an Seite gegen eine erdrückende Übermacht der Alliierten kämpfte, verblutete und starb.
Die Schilderungen der nachfolgenden Ereignisse basieren nicht nur auf mein eigenes Erleben, sondern werden ergänzt durch militärische Details, die mir erst später zur Kenntnis gelangten.
Wie lange ich mit den Kameraden meines Zuges auf diesen gottverfluchten Felsen wie eine Bergziege hockte, wusste ich nicht mehr genau zu sagen. Jedenfalls viel zu lange. Dabei wünschte ich mir nichts Sehnlicheres, als dass dieses furchtbare Ringen um den Berg bald ein Ende haben würde.
Wir, das waren die Männer der deutschen 10. und 14. Armee. Ich selbst gehörte dem II. Bataillon des Fallschirmjäger-Regiments 1, der 1. Fallschirmjäger-Division an, die von Generalleutnant Richard Heidrich kommandiert wurde. Mit dem I. Bataillon des FJR 1 und des III. Bataillon des FJR 3 unter Führung von Oberst Karl Lothar Schulz, einem alten Haudegen der deutschen Fallschirmtruppe, der schon bei Rotterdam und auf Kreta mit von der Partie gewesen war, waren wir gemeinsam mit dem Fallschirm-MG-Bataillon 1 unter Major Herbert Werner Schmidt, die ersten, die am und um den Monte Cassino Stellung bezogen. Allerdings verschanzten wir uns nicht, wie von den Tommys und Amis angenommen, im Kloster selbst. Stattdessen hatten an umliegenden Berghängen starke Verteidigungs- und Gefechtsstellungen errichtet. Auch existierten hier keine Waffen- oder Nachschublager der Wehrmacht, wie ebenfalls falsch vermutet.
Wie stets in diesem Kriege galten die Fallschirmjäger, die zumeist buchstäblich in letzter Stunde eingesetzt wurden, als »Feuerwehr«, um ausgebrochene Brände zu löschen, zu denen keine anderen Truppeneinheiten fähig waren.
Zum besseren Verständnis möchte ich an dieser Stelle erläutern, dass die 1. Fallschirmjäger-Division in die Jäger-Regimente 1 bis 3, eine Fallschirm-Artillerie-, eine Fallschirm-Panzerabwehr- und eine Fallschirm-Flak-Abteilung unterteilt war. Hinzu kamen das Fallschirm-MG- und das Fallschirm-Pionierbataillon sowie die Divisionstruppen. Die einzelnen Fallschirm-Regimenter wiederum waren aufgeteilt in einen Regimentsstab mit Stabszug und Nachrichtenzug. Die Bataillone 1 bis 3 bestanden aus drei Infanteriekompanien, einer MG-Kompanie und jeweils einer Infanteriegeschütz-, einer Pak- und einer Pionier-Kompanie.
Monte Cassino ...
Eigentlich würde kein Hahn nach diesem felsigen Hügel, 516 Meter oberhalb des 35.000-Seelenortes Cassino in der italienischen Provinz Frosinone gelegen, krähen, wäre da nicht der Klosterkomplex. Aber nicht etwa, weil dieser als eines der bedeutendsten geistlichen Zentren des Mittelalters galt, sondern weil die Alliierten davon ausgingen, dass wir uns in der Benediktinerabtei festgesetzt hatten und diese uns als Artillerie-Beobachtungsposten diente. Das war natürlich ausgeschlossen, denn eine solche exponierte Lage war viel zu ungeschützt dafür. Vielmehr befanden sich sämtliche unserer Stellungen zunächst außerhalb der Dreihundert-Meter-Zone des Sperrgebiets, das Generalfeldmarschall Albert Kesselring, der Oberbefehlshaber Süd beim italienischen Oberkommando, um die Abtei hatte errichten lassen. Dem Kloster am nächsten standen 300 Meter südwestlich lediglich zwei Kampfwagen der 90. Panzer-Grenadier-Division. 400 Meter südlich des Klosters waren vier Granatwerfer in Stellung gebracht worden. Und 400 Meter südostwärts, auf Höhe 435, hatte sich eine Beobachtungsstelle des Werfer-Regiments 71 eingenistet.
Warum der Monte Cassino überhaupt von großer Relevanz war, ist schnell erzählt: Die gebirgige Gegend rum um die kleine Stadt Cassino war für die Alliierten von wesentlicher Bedeutung für einen Sieg in Italien. Denn um Rom zu erobern, plante US-General Mark W. Clark den Vorstoß seiner 5. Armee durch das Liri-Tal, das wiederum im Süden vom Monte Maio und im Norden vom Monte Cassino beherrscht wurde. Deshalb musste der deutsche Sperrriegel, die sogenannte »Gustav-Stellung«, die im Raum Cassino in Nord-Süd-Richtung verlief, durchstoßen werden.
Zwar gelang es einem französischen Expeditionskorps am 11. und 12. Januar 1944, einige äußere deutsche Verteidigungsstellungen einzunehmen, dennoch konnten wir die Angriffe der Amerikaner auf die Hauptstellungen erfolgreich abwehren. Auch die Tommys mischten kräftig mit. Unterstützt wurden wir noch von der 5. Gebirgsdivision unter dem Kommando von General Ringel sowie von den Gebirgs-Jäger-Regimentern 85 und 100.
In diesen Tagen war das Wetter katastrophal. Einen anderen Ausdruck gab es nicht für diese Verhältnisse. Eisige Temperaturen und heftiger Schneesturm machten dem pausenlos hin und her wogenden jedoch Kampf keinen Abbruch.
US-General Clark und sein britisches Pendant General Harold Alexander, der Oberbefehlshaber der hier operierenden 18. Armeegruppe, warfen immer neue Reserven gegen die Deutschen, die in diesem mörderischen Kessel jedoch ein ums andere Mal zurückgeworfen wurden. Alle feindlichen Angriffe scheiterten, so dass das gesamte 142. US-Regiment regelrecht am Klosterberg verblutete. Und das trotz Artilleriefeuer- und Bomberunterstützung. Zwar gelang es einem Stoßtrupp der 34. US-Infanteriedivision am 6. Februar 1944 den Calvarienberg, also die Höhe 593, zu erobern, die eigentlich den Ausgangspunkt für die endgültige Inbesitznahme von Monte Cassino war. Doch wir hielten tapfer dagegen, so dass während der heftigen Kämpfe die Höhe mehrfach ihren Besitzer wechselte. Vier Tage später gelang es den Kameraden des III. Bataillons des FJR 3 unter Hauptmann Kratzer, den Calvarienberg wieder zurückzugewinnen.
Zunehmend verzettelten sich die Gefechte in den Steinhaufen, Felsenhöhlen und Bergpfade. Die Ami-und Tommy-Panzer konnten die steilen Hänge nicht hinauffahren, deshalb tasteten sie unterhalb davon nach ihren Zielen. Allerdings trafen ihre Panzergranaten lediglich Erde und Fels. Dafür schlug ihnen das gefürchtete Rattern unserer MGs 42, Kaliber 7,92 mm entgegen. Noch dazu krallte sich unsere Fallschirmartillerie, die aus 7,5-cm-Gebirgsgeschützen bestand, beinahe unsichtbar in die zerklüftete Berghänge hinein. Hinzu kamen die zusammenklappbaren 10-cm-Leichtgeschütze, die überall einsetzbar waren – eine Spezialkonstruktion für die Fallschirmjägereinheiten.
Jedenfalls gelang es den Angreifern nicht, uns aus den Bunker-und Grabensystemen am Klosterberg zu vertreiben. Und unten im Liri-Tal zeigten rauchende Trümmer den Weg der Vernichtung an. Auch dort ertönte nach wie vor der Lärm der Schlacht zwischen US-General Clarks Armee und dem deutschen Abwehrriegel.
Doch irgendwann trat schlagartig Stillstand ein. Die Totenstille, die nicht einmal mehr vom Gezwitscher der Vögel unterbrochen wurde, lastete noch schwerer auf unseren Gemütern, als der gewohnte Gefechtslärm.
Auch das Wetter wurde besser. Zumindest für ein paar Stunden. Danach sollte es zwar nicht mehr schneien, dafür aber regnen. Das machte unsere Stabsoffiziere natürlich misstrauisch, rechneten sie doch damit, dass die Alliierten diesen Umstand ausnutzen könnten, um eine größere Offensive gegen Cassino zu starten. Gleich gar, als am Nachmittag des 14. Februar 1944 die 5. US-Armee Flugblätter in italienischer Sprache in den Klostergarten schoss, mit der Ankündigung, dass sich ihre Waffen nun gegen die Abtei selbst richten würden. Die »italienischen Freunde«, wie es dort hieß, sollten sich schnellstens in Sicherheit bringen. Das versetzte natürlich die Zivilisten in Panik, die zuvor vor den Bombardierungen der Alliierten aus der Stadt Cassino geflohen und den Klosterberg hinaufgeströmt waren, um in den unterirdischen Gewölben und Sälen Schutz zu suchen. Doch damit schienen sie letztlich direkt in die offenen Arme des Teufels gelaufen zu sein. Nun stürzten sie ins Freie, um in einer der benachbarten Höhlen einen Unterschlupf zu finden. Andere verkrochen sich tief in die Eingeweide des Gotteshauses. Und wiederum Weitere suchten Zuflucht in der Basilika in dem Glauben, Gott könne es nicht zulassen, dass die Abtei, die das Grab des Heiligen Benedikts barg, der Zerstörung anheimfallen könnte.
Derweil begannen die Heereskameraden damit, den Bischof und Abt des Klosters, einen achtzigjährigen Greis mit strahlenden Augen und einem gütigen Lächeln, zu evakuieren. Ebenso loteten sie aus, ob sie mit Transportkolonnen die italienischen Flüchtlinge mit weißen Fahnen über einen Saumpfad nach Piedimonte schleusen konnten, auf dem die Trägertrupps Tage zuvor mit ihren Mulis mit Verpflegungsvorräten, Medikamenten und Munition hochgekommen waren. Denn die eigentliche Serpentinenstraße zum Kloster würde bei einem Bombardement unverzüglich unpassierbar werden, wäre sie doch wohl das erste geeignete Ziel, um die Verkehrsmobilität der Verteidiger einzuschränken. All das war jedoch hochbrisant, denn neben dem Risiko eines Feindbeschusses konnten in diesem unwegsamen Gelände italienische Partisanen laueren, um die Deutschen ans Kreuz zu nageln.
Jedenfalls tickte die Uhr gegen die Rettung der aus Cassino vertriebenen Flüchtlinge. Deshalb entschlossen sich viele von ihnen, im scheinbar sicheren Kloster zu bleiben, während wiederum andere mit einigen Mönchen die Flucht antraten. Allerdings würde es mindestens zwei Tage dauern, bis sie unter diesen Umständen den Klosterberg verlassen konnten.
Wie dem auch war – es schien etwas Unheilvolles anzustehen! Das glaubten selbst wir einfachen Jäger zu spüren, abseits von irgendwelchen Lageplänen und Karten der Generalität. Es war nur ein Bauchgefühl und die eigene Einschätzung der Situation, in der wir uns befanden. Erst später sollten wir erfahren, dass Generalleutnant Bernard Freyberg, der Kommandant des neuseeländischen II. Korps, das als Teil der 5. US-Armee nach Italien verlegt und ihr unterstellt worden war, längst darauf gedrängt hatte, Monte Cassino mit seiner überwältigend guten Verteidigung und der Unterwühlung durch Bunker, zu bombardieren. Und das, obwohl ein solches Vorhaben zunächst überhaupt nicht im alliierten Bombenzielplan vorgesehen war. Den Alliierten war klar, dass ein Frontalangriff alles andere als sinnvoll und gleich gar nicht militärisch klug wäre.
Deshalb wollte Freyberg mit einem ungeheuren Feuerüberfall die deutschen Stellungen aufsprengen, um sie mit seinen Neuseeländern und Indern zu besetzen. Diese großangelegte Umfassungsoperation sollte das Monte-Cassino-Bollwerk aus der »Gustavstellung« herausbrechen. Nach Ansicht des Generalleutnants, der Ende April 1941 zum alliierten Befehlshaber auf Kreta ernannt worden war, jedoch an den deutschen Fallschirmjägern scheiterte, hatte sich eine solche Strategie nach dem Muster des britischen Brigadegenerals Bernard »Monty« Montgomery bereits im Afrika-Krieg, in Libyen und Tunesien gegen Rommels »Wüstenfüchse« bewährt. Dort war nach dem Prinzip des »colossal crack« vorgegangen worden, bei dem alles ausradiert wurde, was den deutschen Verteidigern hatte Deckung bieten können. Mit einem solchen gewaltigen Feuerüberfall wäre auch das Schicksal Monte Cassinos besiegelt, wie Freyberg annahm und dann der Weg durchs Liri-Tal und insbesondere nach Rom frei. Schließlich gaben die Oberbefehlshaber US-General Mark W. Clark und der britische General Harold Alexander nach. Bei jenem lag es vor allem daran, dass die neuseeländischen Truppen in ihrer Funktion als »Empire-Streitkräfte« nur ihrer eigenen Regierung verantwortlich waren und die Briten deshalb besonders »harmonisch« mit ihnen und gleich gar ohne jeglichen Streit umgehen mussten.
So also wurde die großangelegte Vernichtung der Stadt und des Klosters Cassino ins konkrete Kalkül genommen. Allerdings unterlief den Alliierten ein verheerender Fehler. Zwar informierten sie ihre jeweiligen Stäbe über den bevorstehenden Angriff, vergaßen aber in der Hektik die 7. Brigade des 1. Royal Sussex-Bataillons zu unterrichten. Dabei hatten die Inder bereits am Nachmittag Stellung an den Abhängen der Höhe 593, des Calvarienbergs, bezogen.
Nichtsdestotrotz brach beim besten Flugwetter und ausgezeichneter Erdsicht am 15. Februar 1944 die wahrhaftige Hölle über die deutschen Fallschirmjäger herein. Keiner, der sie überleben sollte, würde sie jemals wieder vergessen.
*
An diesem schicksalhaften Tag strahlte die Sonne von einem azurblauen, fast frühlingshaften Himmel herab, ohne jedoch richtige Wärme zu verbreiten. Dafür war die Luft so klar wie seit Wochen nicht mehr. Das Kloster Monte Cassino, das bei schlechtem Wetter beinahe bis in an die niedrig hängenden Wolken stieß, warf scharfe Schlagschatten auf die kahlen, gezackten Felsen.
Ich war bislang nur zweimal in der Benediktinerabtei auf dem Klosterberg drinnen gewesen, aber ziemlich beeindruckt. Als ich den »Kreuzgang am Eingang«, wie er hieß, betreten hatte, ging ich an der Kapelle vorbei, die dem Heiligen Martin, dem Bischof von Tours, geweiht war. Hier, inmitten von Olivenhainen und in der Schönheit der Architektur, so wurde mir erzählt, starb auch der Heilige Benedikt. Und zwar aufrecht, von Mönchen gestützt, und erst nachdem er die Eucharistie empfangen hatte. Von dort gelangte ich weiter zu einer achteckigen Zisterne, flankiert von korinthischen Säulen, die ein Krönungsgebälk trugen. In den zahlreichen marmornen Nischen standen Statuen und Schreine, die Schutzpatrone, Päpste und Herrscher zeigten. Die Abteikathedrale mit ihrem Marmor und den vertäfelten Wänden war mit reichlichen Gemälden und Fresken ausstaffiert. Auf der Rückseite des Altars befand sich das Grab des Heiligen Benedikt. Unvergessen waren für mich auch die historischen Orgeln in diesem Bereich. Insgesamt bestand der riesige Kloster-Komplex aus Wendelgängen, Innenhöfen und unzähligen, zumeist zweckdienlichen Räumen, wie etwa Werk- und andere Arbeitsstätten für die Mönche. Sogar ein Empfangssalon fand sich hier.
Ich erzähle all das so ausführlich, damit die Nachwelt sich ein Bild des architektonischen Kunstschatzes machen kann, der an diesem schicksalhaften Tag für immer und ewig vernichtet wurde.
Unvermittelt kam mir eine Inschrift in den Sinn, die zu Füßen der Statue des Heiligen Benedikts prangte, die da hieß: »Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.«
Tatsächlich aber war das, was an 15. Februar 1944 kam beileibe alles andere als hochgelobt und gleich gar nicht im Namen des Herrn, sondern vielmehr verderblich und im Auftrag des Alliierten Oberkommandos, um nur eines zu bringen: Tod und Zerstörung!
Ich lag, eingerahmt von zerklüfteten, nassen und schwitzenden Felswänden in einem Unterstand, etwa vierhundert Meter unterhalb der Klostermauern, der eigentlich eine niedrige Höhle war, in die wir uns in den vergangenen Tagen zum Schlafen zurückgezogen hatten. Notdürftig hatten wir darin eine Wasserablaufrinne installiert, so dass selbst bei Sturzregen nicht mit einer Überschwemmung zu rechnen war. In den von unserer Höhle aus umliegenden Unterschlüpfen und Deckungslöchern harrten die übrigen Jäger aus.
Neben mir kauerten meine Kameraden Heiner Rowitz und Gustav Kuschel. Was uns äußerlich einte, waren die immer gleichen hohlwangigen, bartstoppligen, schmutzigen und lehmgrauen Gesichter. Der Erstgenannte war hager und schwarzhaarig wie ich, der andere athletisch gebaut und glatzköpfig.
Allesamt trugen wir als Angehörige der Deutschen Luftwaffe charakteristische, randlose Fallschirmjäger-Stahlhelme, mit ihren verkleinerten Nacken-, Seiten- und Augenschirmen, die den Kopf nicht nur gegen Splitter, sondern auch vor Verletzungen bei der Landung bewahren sollten. Dafür sorgte die stark gepolsterte, mit vier Schrauben an der Helmglocke befestigte Innenausstattung. Ferner diente der Kimmriemen als Ankerpunkt. Eingehüllt waren wir in langärmelige Fliegerkombinationen aus winddichtem, grünmeliertem Baumwollstoff mit Reißverschlüssen und Druckknöpfen versehen, die sich beim Springen nicht öffneten und nicht flatterten. Scherzhaften nannten wir diese Fallschirmblusen, die wie Jacken an- und ausgezogen werden konnten, »Knochensäcke.« Die jeweiligen Kragenspiegel präsentierten den Dienstrang. Gelb stand beispielsweise für den eines Obergefreiten bei der Luftwaffe. Die dunkelgrünen Fallschirmjäger-Hosen wurden um die Knöchel mit einem Zugband zusammengebunden.
Bei Einsätzen in der Kälte trugen wir spezielle Winteranzüge, die aus einer wattierten Hose und Jacke mit Kapuze, Handschuhen und Kopfhaube bestand, beidseitig bedruckt mit einer weißen Winter- und einer grau-blau-grünen Herbst- und Frühlingsseite. Für die wärmeren Gefilde, wie etwa im Mittelmeerraum oder in Nordafrika, bekamen wir luftig geschnittene, über den Knöcheln zusammengebundene »Tropenüberfallhosen« sowie Tropenschnürschuhe aus Segeltuch. Unsere herkömmlichen Springerstiefel mit den dicken, lautlosen Gummisohlen waren seitlich geschnürt. Das war notwendig, denn die üblichen Knobelbecher würden uns sonst beim Himmelsfall von den Füßen gerissen. Zusätzlich trugen wir bei den Sprüngen Springer-Handschuhe, Ellbogen- und Schulterschützer, Knieschoner und elastische Binden zum Schutz der Sprunggelenke. Für den Bodeneinsatz bestand das Koppelzeug aus einer Pistolen-, Munitions- und Handgranatentasche sowie einer Feldflasche, einem Brotbeutel und einer Gasmaskentasche. Ebenso einem Patronengurt.
Als Bewaffnung benutzten die deutschen Fallschirmjäger-Divisionen MGs 42, Maschinenpistolen MP 40, Pistolen P 38 und Flieger-Kappmesser. Außerdem Panzerbüchsen 39, rückstoßfreie 7,5-cm-Leichtgeschütze 1 und 40 sowie 10,5-cm-Leichtgeschütze 40 und 42. Nicht zu vergessen natürlich die Fallschirmjägergewehre FG 42 mit den Dillenbajonetten unter den Läufen. Dabei handelte es sich um Vielzweck-Selbstladegewehre, die speziell für Fallschirmjäger entwickelt wurden. Diese konnten als Scharfschützengewehre mit Zielfernrohren oder als leichte Maschinengewehre mit Zweibein-Vorderstützen ausgerüstet werden. Ebenso war das FG 42 für Einzel- und Dauerfeuer eingerichtet. Die in der Laufverlängerung angebrachte Schulterstütze verhinderte den Hochschlag und ermöglichte zudem eine schnellere Schussabgabe bei Einzelfeuer. Hinzu kam, dass das Visier auf 100 bis 1500 Meter Entfernung eingestellt werden konnte. Allerdings war das Gewehr auch anfällig für Ladehemmungen, die bei all dem Staub und Dreck hier oben, umso wahrscheinlicher waren. Deshalb galt es stets die Waffe gut zu reinigen, sofern Zeit dazu blieb.
Das alles erwähne ich hier, um aufzuzeigen, wie unsere Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung im Einsatz tatsächlich aussah.
Wir waren Elitesoldaten, die keineswegs, selbst wenn wir es gekonnt hätten, vor Bomben und Granaten wegliefen, gehörten wir doch zur Front-, und damit zur Kampftruppe, griffen an und schlugen unbarmherzig zurück. Immer nah am Feind, konnten wir mit Kappmesser und Spaten genauso tödlich umgehen, wie mit Dolch und Bajonett. Ebenso mit unseren Fäusten und Handkanten, mit denen wir unhörbare Schläge gegen die Halsschlagadern und andere neuralgische Nervenpunkte anbringen konnten. Dazu waren wir viele Wochen lang in der Heimat ausgebildet worden. Aber nicht nur im Nahkampf mit Hieb- und Fausttechniken an Sandsäcken und Stoffpuppen, sondern auch beim Schießen, Deckung halten, Hinwerfen, Anschleichen und Marschieren, was für Fallschirmjäger gewiss nicht die erste Disziplin war. Nicht umsonst wurden wir aufgrund der Farbe unserer Uniformen vom Feind die »Grünen Teufel« genannt, der stets Respekt vor der deutschen Eliteeinheit zeigte, die alles andere als herkömmliche »Frontschweine«, sondern eher »Himmelhunde« waren.
In diesem Moment unterbrach das helle Brummen von Flugzeugmotoren meine Gedanken, das unvermittelt die klare Morgenluft erfüllte. Und gleichzeitig schwiegen unten im Tal die Artillerie und die Panzer. Das konnte nur Unheil ankündigen.
Plötzlich war der Himmel über dem Monte Cassino gesprenkelt mit einem großen Geschwader aus 230 alliierten Bombern. Darunter 140 B-17 Flying Fortresses, also »Fliegenden Festungen« von der in Foggia stationierten 15. Strategischen Luftflotte der US Air Force.
Ich kann mich genau daran erinnern, wann das Fegefeuer der ersten Welle aus der Luft begann, weil meine Uhr exakt zu diesem Zeitpunkt stehen blieb. Warum auch immer.
Während unter uns in der Ferne auf einmal wieder die Geschütze hämmerten und die Leuchtspurmunition ein dünn blitzendes Streifennetz fabrizierte, klappten um 9.45 Uhr die Bombenschächte der Feindflugzeuge auf, um ihre tödliche, torkelnde Fracht abzuwerfen. 500 Tonnen Brand- und Sprengbomben regneten auf das Kloster und auf die am Fuße des Berges liegende und von uns besetzte Stadt Cassino.
Dann – von einem Moment zum anderen –ging die Welt unter!
Alles über und um mich herum barst und bebte. Als sich die Wellen durch und über den Boden und Fels pflanzte, erzitterte die Erde, als würde sie von einer Riesenhand geschüttelt. Die Abhänge schwankten wie volltrunkene Gesellen. Ohrenbetäubendes, donnerndes Krachen malträtierte die Trommelfelle wie unter Schlägen eines Schmiedehammers, dessen Echo tosend hinterher rollte. Die vibrierende Luft schien zu zerreißen, und mit ihr sämtliche Nervenspitzen von Mensch und Tier, die sich hier oben aufhielten. Der Monte Cassino riss auf wie ein Vulkan! Doch die glühende Lava sprudelte nicht etwa aus der Tiefe, sondern fiel tausendfach vom Himmel, hinterließ unzählige Krater und Trichter, in dessen Feuerwolken alles verdampfte und pulverisierte: Soldaten und geflüchtete Zivilisten – Kinder, Greise, Frauen und Männer. Von vielen anderen, die sich nicht im unmittelbaren Epizentrum des Feuerorkans befanden, blieben lediglich Haufen verstreuten Fleisches oder stinkende schwarze und ölige Schlacke übrig. Ohne Unterlass zerrissen weitere fürchterliche Explosionen die Luft, reicherten sie mit Staub und beißendem Rauch an, als würden hunderte Drachen ihre Feuerstrahlen speien.
An unserem Unterstand fegten die Höllengluten vorüber. Und dennoch spürten wir den Hitzehauch in den tiefgeduckten Gesichtern und den Händen, die wir zum Schutz über die Stahlhelme gelegt hatten, zusammengerollt wie Embryos. Als ich aufsah, machten dunkle Rauchschwaden das blaue Firmament zur finsteren Himmelshölle.
Wenig später rollte die zweite Angriffswelle heran, bestehend aus zweimotorigen B-25-Mitchells und B-26-Marauders der Mediterranean Allied Air Force,die noch einmal hundert Tonnen Explosivstoffe abluden. Die Apokalypse aus Feuer und Donner wiederholte sich. Das entsetzliche Singen, Pfeifen und Orgeln der Bomben und Granaten war allgegenwärtig. Die Sprengkörper zerhämmerten das bereits dampfende Klostergebäude wie durch unsichtbare Faustschläge eines Riesen noch mehr, blitzten in die eingestürzten brennenden und qualmenden Trümmer, zerstampfen und zerfetzten weitere Zivilisten, Mönche und Soldaten, die den ersten Angriff überlebt hatten. Viele von ihnen waren schreiend vor Todesangst und Wahnsinn herumgerannt, in der Hoffnung, außerhalb ihrer ursprünglichen Schlupfwinkel im todgeweihten Kloster Schutz zu finden und um dort, im Haus Gottes, nicht von den herabstürzenden Trümmern begraben zu werden. Dabei rannten sie jedoch mitten hinein in das feindliche Geschütz- und 24-cm-Kaliber-Artilleriefeuer, von dem sie regelrecht zerpflückt wurden. Andere wiederum wurden von berstenden Granaten und pfeifenden Kugeln zu Boden gestreckt. Die gellenden Schreie, die nichts Menschliches mehr an sich hatten, erstickten und verstummten im anhaltenden Grauen des sinnlosen Gemetzels.
Und dann gab es noch diejenigen, die von der Feuerglut des brutalen Bombardements nur leicht berührt worden waren. Diese Bejammernswerten krochen als große schwarze Klumpen langsam wie Schnecken vorwärts, bis sie letztlich in grausamer Agonie liegenblieben. Sterbende Menschen, Pferde und Vieh.
In diesen grauenhaften Minuten war Gott tot! Denn wie sonst könnte er es zulassen, dass ein Sinnbild des christlichen Glaubens, samt seinen Dienern und Gläubigen einfach so ausgelöscht wurden? Und das auf die entsetzlichste, barbarischste Art und Weise, die sich das perverseste Gehirn überhaupt ausdenken konnte.
Allerdings hatte der Sensenmann noch längst nicht genug!





























