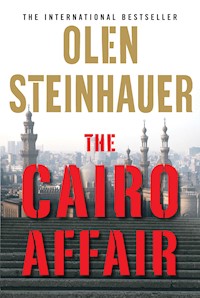2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
James Bond kann einpacken, hier kommt Milo Weaver
Nachdem ihn der letzte Einsatz fast das Leben gekostet hat, spielt Agent Milo Weaver mit dem Gedanken, endgültig auszusteigen, doch der CIA entkommt man nicht. Weaver wird erneut für den aktiven Dienst rekrutiert. Um seine Loyalität zu beweisen, soll er ein 15-jähriges Mädchen töten. Weaver weigert sich und verschafft dem Mädchen heimlich eine neue Identität. Als die Aktion auffliegt, gerät er in tödliche Gefahr.
Milo Weaver ist Tourist, Agent einer geheimen Unterorganisation der CIA. Touristen arbeiten allein, sie haben keine Heimat, keine Identität, keine Moral. Weaver, seit vielen Jahren im Dienst, ist längst nicht mehr hundertprozentig dabei. Er hat das Agentendasein satt, will ein bürgerliches Leben führen, doch den Fängen der CIA entkommt man nicht. Weaver lässt sich erneut für den aktiven Dienst rekrutieren, muss jedoch zunächst seine Loyalität beweisen. Kein Problem, denkt Weaver, bis er den Auftrag erhält, die 15-jährige Adriana Stanescu zu töten. Für Milo Weaver ein Ding der Unmöglichkeit. Er entführt Adriana und gibt sie in Obhut seines Vaters, um ihr ein Leben unter neuer Identität zu ermöglichen. Unterdessen versucht er herauszufinden, warum sie sterben soll. Doch wenig später wird Adriana ermordet aufgefunden, und der Verdacht fällt auf Weaver. Er gerät ins Visier der Company, und keiner weiß besser als Milo Weaver, was das bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Nearest Exit bei St. Martin’s Minotaur
Copyright © 2010 by Third State, Inc. Copyright © 2011 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Tamara Rapp Herstellung: Helga Schörnig Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-08114-0V002
www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
ZaSlavicu i Margo
HENRY GRAYS LETZTER FLUG
MONTAG, 6 . AUGUST BIS DIENSTAG, 11. DEZEMBER 2007
1
Als DJ Jazzy-G das Intro von »Just Like Heaven« auflegte, dieser Cure-Hymne seiner Jugend, genoss Henry Gray einen Augenblick reiner Euphorie. War ihm das im Ausland schon jemals passiert? In den zehn Jahren in Ungarn hatte er bereits Ahnungen davon empfunden, aber erst in diesem Moment – kurz nach zwei Uhr morgens beim Tanzen im Club ChaChaCha auf der Margit-Insel, als er Zsuzsas sanfte Zunge auf seinem schweißnassen Ohrläppchen spürte –, erst jetzt wurden ihm die ganze Wucht und das Glück seiner herrlichen Existenz in Europa bewusst.
Eighties-Abend im ChaChaCha. Jazzy-G las seine Gedanken. Zsuzsa saugte an seiner Zunge.
Trotz der Frustrationen und Enttäuschungen während seines Aufenthalts in dieser mitteleuropäischen Metropole wurde er in Zsuzsanna Papps Armen auf einmal von der Liebe zu dieser Stadt und den kerts gepackt – den Biergärten, die die Ungarn öffneten, sobald der lange, dunkle Winter überstanden war.
Hier im Club legten sie die Kleider ab und tranken, tanzten und arbeiteten sich durch die Stadien des Vorspiels, bis selbst ein Außenseiter wie Henry den Eindruck hatte, dazuzugehören.
Trotzdem hätten all diese Sinnesfreuden nicht ausgereicht, um Henry Gray ein derartiges Hochgefühl zu bescheren. Es war die Story, die ihm der unberechenbare ungarische Postdienst vor zwölf Stunden zugestellt hatte. Die größte Story seiner noch jungen Karriere.
Bisher beruhte sein Erfolg als Journalist allein auf dem Bericht über den Luftwaffenstützpunkt Taszár, wo die US Army in einer abgelegenen ländlichen Gegend Ungarns heimlich die Free Iraqi Forces ausgebildet hatte, als der endlose Golfkrieg noch am Anfang stand. Das war vor vier Jahren gewesen, und in der Zwischenzeit war Henry Grays Karriere ins Stocken geraten. Die geheimen Verhörzentren der CIA in Rumänien und der Slowakei hatte er verschlafen. Sechs Monate hatte er mit den ethnischen Unruhen an der serbisch-ungarischen Grenze vergeudet, nur um festzustellen, dass die amerikanischen Zeitungen desinteressiert abwinkten. Und letztes Jahr, als die Washington Post enthüllte, dass die CIA Taliban-Gefangene zur Ernte von afghanischem Heroin einsetzte, das dann nach Europa verkauft wurde, steckte Henry Gray gerade wieder in einer schwarzen Phase, in der er nach Wodka und Unicum stinkend aufwachte und nicht wusste, was in der vergangenen Woche vorgefallen war.
Doch jetzt hatte ihm die ungarische Post die Rettung gebracht, etwas, das keine Zeitung ignorieren konnte. Das Schreiben war von einer Anwaltskanzlei in Manhattan mit dem merkwürdigen Namen Berg & DeBurgh abgeschickt worden und stammte von einem ihrer Mandanten: Thomas L. Grainger, einem ehemaligen Angestellten der Central Intelligence Agency. Für Henry Gray war das Ganze ein Neuanfang.
Wie um das zu unterstreichen, schien Zsuzsa, die ihn so lang auf Abstand gehalten hatte, endlich seinem Werben nachzugeben, nachdem er ihr den Brief vorgelesen und ihr desssen Bedeutung für seine Karriere erklärt hatte. Sie war selbst Journalistin und hatte ihm ihre Hilfe versprochen. Zwischen Küssen hatte sie ihm vorgeschlagen, dass sie wie Woodward und Bernstein in der Watergateaffäre zusammenarbeiten sollten, und er hatte ihr zugestimmt.
War es die Gier, die Zsuzsa schwach werden ließ? In diesem Augenblick, der mindestens noch einige Stunden dauern würde, spielte es nicht die geringste Rolle.
»Liebst du mich?«, flüsterte sie.
Er nahm ihr warmes Gesicht in die Hände. »Was glaubst du?«
Sie lachte. »Ich glaube, du liebst mich.«
»Und du?«
»Ich hab dich immer gemocht, Henry. Eines Tages könnte ich dich sogar lieben.«
Zuerst hatte sich Henry nicht an den Namen Thomas Grainger erinnert, doch beim zweiten Lesen dämmerte es ihm allmählich: Sie waren sich nur einmal begegnet, als Gray Hinweisen zu seiner Story über Taszár nachging. Auf der Andrássy út hatte plötzlich ein Wagen neben ihm gehalten, das hintere Fenster fuhr nach unten, und ein alter Mann bat ihn um ein Gespräch. In einem Café versuchte Thomas Grainger dann mit einer Mischung aus patriotischen Floskeln und nackten Drohungen, Gray dazu zu bewegen, seinen Bericht erst in einer Woche abzugeben. Gray weigerte sich und fand bei seiner Rückkehr eine demolierte Wohnung vor.
11. Juli 2007
Sehr geehrter Mr. Gray,
es überrascht Sie wahrscheinlich, einen Brief von jemandem zu erhalten, mit dem Sie in der Vergangenheit wegen Ihrer journalistischen Arbeit aneinandergeraten sind. Ich darf Ihnen versichern, dass ich nicht die Absicht habe, mich für mein Verhalten zu entschuldigen. Im Gegenteil, ich bin noch immer der Auffassung, dass Ihre Artikel über Taszár äußerst unverantwortlich waren und den ohnehin eher bescheidenen Kriegsanstrengungen hätten schaden können. Dass dies nicht der Fall war, spricht für meine Fähigkeit, ihr Erscheinen hinauszuzögern, oder für die Bedeutungslosigkeit Ihrer Zeitung – das können Sie selbst entscheiden.
Trotz allem bewundere ich Ihre Hartnäckigkeit. Sie haben sich nicht beirren lassen in einer Situation, in der viele Journalisten klein beigegeben hätten, und genau aus diesem Grund wende ich mich jetzt an Sie. Sie sind ein Journalist, wie ich ihn brauche.
Dass Sie diesen Brief in Händen halten, ist der Beleg für ein entscheidendes Faktum: Ich bin inzwischen tot. Ich schreibe diesen Brief, damit mein Tod – den Auftrag dazu wird vermutlich mein eigener Arbeitgeber erteilt haben – nicht unbeachtet bleibt.
Eitelkeit? Gewiss. Aber wenn Sie mein Alter erreichen, werden Sie diesen Umstand wohl mit mehr Nachsicht betrachten. Vielleicht können Sie darin sogar die gleiche idealistische Motivation erblicken wie ich.
Nach offiziellen Quellen hatte Grainger vor seinem tödlichen Herzinfarkt im Juli eine Finanzaufsichtsabteilung der CIA in New York geleitet. Doch solche Daten sind nicht umsonst so mühelos einzusehen: Sie enthalten die vom Staat gewünschte Darstellung.
Gegen drei schoben sie sich von der Tanzfläche, sammelten ihre Sachen auf – der siebenseitige Brief steckte noch immer in seiner Umhängetasche – und überquerten die Margit-Brücke zurück nach Pest. Sie nahmen ein Taxi zu Zsuzsas kleiner Wohnung im achten Bezirk, und nach einer Stunde hatte er das Gefühl, kein Bedauern empfinden zu müssen, sollte sein Leben noch an diesem Morgen enden.
»Gefällt dir das?« Zsuzsas Stimme drang durch die schwüle, nach ihren Vogue-Zigaretten riechende Dunkelheit.
Er hielt die Luft an und brachte kein Wort hervor. Sie machte etwas mit der Hand, irgendwo zwischen seinen Schenkeln.
»Das ist Tantra.«
»Ach?« Ächzend klammerte er sich am Laken fest.
Es war wirklich die beste aller möglichen Welten.
Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte. Sie dreht sich um den Sudan, die von mir geleitete CIA-Abteilung und China. Jemanden wie Sie wird es nicht erstaunen, dass es auch um Öl geht, wenn auch nicht in der Weise, wie Sie sich das vorstellen.
Außerdem möchte ich nicht verschweigen, dass es gefährlich ist, von dieser Sache zu wissen. Das beweist allein schon mein Tod. Von jetzt an sind Sie auf sich selbst gestellt. Wenn Ihnen dieser Gedanke unerträglich ist, sollten Sie den Brief sofort verbrennen und ihn vergessen.
Hinterher, als auf den Straßen Stille herrschte, lagen sie erschöpft zwischen den Laken und starrten hinauf zur Decke. Zsuzsa rauchte, und das Vertraute an dieser Gewohnheit vermischte sich mit etwas Neuem: ihrer Sexualität. Schließlich sagte sie: »Du lässt mich mitmachen, okay?«
Den ganzen Tag war ihr nicht aufgefallen, dass die Story nicht das Geringste mit Ungarn zu tun hatte, dem einzigen Land, wo ihre Sprachfähigkeiten nützlich waren. Er musste nach New York fliegen, und sie hatte nicht einmal ein Visum. »Natürlich«, log er, »aber vergiss nicht, was in dem Brief steht – es ist gefährlich.«
Sie prustete vor Lachen.
»Was ist?«
»Terry hat recht. Du bist paranoid.«
Gray stützte sich auf den Ellbogen und schaute sie lange an. Terry Parkhall war ein Schreiberling, der schon immer auf sie gestanden hatte. »Terry ist ein Trottel. Er lebt in einer Traumwelt. Wenn man nur die geringste Andeutung macht, dass die CIA bei 9/11 die Finger im Spiel hatte, geht er an die Decke. Was soll daran so unglaublich sein in einer Welt, in der es Guantanamo, Folterzentren und einen von der CIA betriebenen Heroinhandel gibt? Terry hat einfach die grundlegende Wahrheit der Verschwörung nicht kapiert.«
»Und was ist die grundlegende Wahrheit der Verschwörung? «
»Wenn man es sich vorstellen kann, dann hat es auch schon jemand ausprobiert.«
Das hätte er lieber nicht sagen sollen. Warum, wusste er nicht, denn sie war zu keiner Erklärung bereit, doch zwischen ihnen entstand plötzlich eine fühlbare Kälte, und er brauchte lange, bis er endlich einschlief. Es war ein stakkatoartiger Schlaf, unterbrochen von aufblitzenden Unruhen im Sudan unter einer staubigen Sonne, von ölverschmierten Chinesen und Killern aus Graingers geheimer Dienststelle, der Abteilung Tourismus. Um acht war er wieder wach und rieb sich in dem trüben, von der Straße einfallenden Licht die Augen. Zsuzsa atmete tief und gleichmäßig, und er blinzelte Richtung Fenster. In der Leistengegend spürte er ein angenehmes Ziehen. Sollte er es sich nicht noch einmal anders überlegen?
Zsuzsa konnte ihm zwar bei der Suche nach den Beweisen für Graingers Geschichte kaum helfen, trotzdem war er auf einmal entschlossen, sie zu seiner Partnerin zu machen. Hatte ihn ihr Tantragriff zu diesem Sinneswandel bewegt? Oder ein schwer definierbares Schuldgefühl wegen einer falschen Bemerkung? Wie ihre Gründe dafür, dass sie schließlich doch mit ihm geschlafen hatte, spielte es keine Rolle.
Viel wichtiger war, dass eine Menge Arbeit auf ihn wartete; er war ja erst am Anfang. Er zog sich an. Thomas Grainger hatte selbst zugegeben, dass seine Geschichte auf wackeligen Beinen stand. »Bis jetzt habe ich Ihnen noch keine klaren Beweise zu bieten, nur mein Wort. Aber ich hoffe, bald von einem meiner Mitarbeiter Material zu bekommen. « Allerdings endete der Brief ohne ein weiteres Wort über diesen Mitarbeiter und beschränkte sich auf die Wiederholung der entscheidenden Tatsache, dass sein Autor inzwischen tot war, und die Erwähnung realer Namen, bei denen die Recherchen einsetzen konnten: Terence Fitzhugh, Diane Morel, Janet Simmons, Senator Nathan Irwin, Roman Ugrimow, Milo Weaver. Letzterer, so behauptete Grainger, war dabei die einzige Person, von der Gray Unterstützung erwarten konnte. Er sollte den Brief Milo Weaver – und nur Milo Weaver – zeigen, dann hatte er den Schlüssel in der Hand.
Er küsste Zsuzsa und schlich sich mit seiner Umhängetasche hinaus in den gelb erleuchteten Habsburger Vormittag. Er beschloss, zu Fuß nach Hause zu gehen. Es war ein herrlicher Tag, voller Möglichkeiten, auch wenn um ihn herum die mürrischen, zu ihrer banalen Arbeit hastenden Ungarn kaum Notiz davon nahmen.
Sein Apartment lag an der Vadász Utca, einer schmalen, rußigen Gasse mit verfallenen, einst stattlichen Gebäuden. Da der Aufzug permanent kaputt war, stieg er langsam zum vierten Stock hinauf und tippte an der Tür den Code der Alarmanlage ein.
Mit dem Honorar für die Taszár-Story hatte er die Wohnung gekauft und renoviert. Die Küche war ganz in Edelstahl, das Wohnzimmer mit W-LAN und Einbauregalen ausgestattet, und er hatte die instabile Balkonterrasse zur Vadász Utca instand setzen und verstärken lassen. Im Gegensatz zu den Buden von vielen seiner flüchtigen Bekannten spiegelte dieses Zuhause tatsächlich seine Vorstellung von Komfort wider, statt sich mit üblichen Budapester Gegebenheiten abzufinden: riesige Apartments, die in der kommunistischen Ära aufgeteilt worden waren, mit ungünstig geschnittenen Küchen und Bädern und sinnlos langen Korridoren.
Er schaltete den Fernseher ein, wo eine ungarische Popband auf dem heimischen MTV-Sender spielte, ließ die Umhängetasche auf den Boden fallen und überlegte sich beim Pinkeln im Bad, ob er die Arbeit an der Story allein beginnen oder zuerst diesen Milo Weaver ausfindig machen sollte. Allein, beschloss er. Aus zwei Gründen. Erstens wollte er so viel wie möglich in Erfahrung bringen, bevor er sich die unvermeidlichen Lügen Weavers anhörte. Zweitens wollte er die Genugtuung erleben, die Story möglichst selbst zu knacken.
Nachdem er sich die Hände gewaschen hatte, kehrte er ins Wohnzimmer zurück und erstarrte. An seinem Bo-Concept-Sofa, das ihn ein Vermögen gekostet hatte, lehnte ein blonder Mann und fixierte eine tanzende Frau mit schweren Brüsten auf dem Bildschirm. Henry bekam auf einmal keine Luft mehr, und sein Mund arbeitete hilflos, als sich der Typ lässig lächelnd zu ihm umwandte und ihm nach Männerart zunickte.
»Klasse Frau, was?« Amerikanischer Akzent.
»Wer …?« Henry konnte den Satz nicht beenden.
Immer noch lächelnd drehte sich der Mann ganz zu ihm. Er war groß und trug einen Anzug ohne Krawatte. »Mr. Gray?«
»Wie kommen Sie hier rein?«
»Ein bisschen dies, ein bisschen das.« Er klopfte auf das Polster neben sich. »Kommen Sie, wir müssen uns unterhalten. «
Henry bewegte sich nicht. Ob er nicht wollte oder konnte, hätte er selbst nicht sagen können.
»Bitte«, sagte der Mann.
»Wer sind Sie?«
»Oh, Entschuldigung.« Er stand auf. »James Einner.« Er streckte eine große Pranke aus und kam näher. Henry ergriff sie unwillkürlich, und James Einner packte zu. Im gleichen Moment fuhr seine andere Hand steif nach oben und hackte seitlich gegen Henrys Hals. Schmerz spritzte durch Henrys Kopf, ihm wurde schwarz vor Augen, und sein Magen überschlug sich. Ein zweiter Schlag löschte alle Lichter aus.
Eine Sekunde baumelte Henry an James Einners Hand, dann ließ er sie sinken, bis der Journalist auf das renovierte Holzparkett sackte.
Einner trat zurück zum Sofa, um Henrys Umhängetasche zu durchwühlen. Er fand den Brief und zählte die Seiten, dann steckte er auch Henrys Moleskine-Notizbuch ein. Noch einmal durchkämmte er die Wohnung – das hatte er schon den ganzen Abend gemacht, aber er wollte ganz sicher sein – und nahm schließlich Grays Notebook und all seine gebrannten CDs an sich. Er verstaute alles in einer billigen Reisetasche, die er in Prag gekauft hatte, ehe er in den Zug hierher gestiegen war, und stellte sie neben die Wohnungstür. Insgesamt brauchte er dafür ungefähr sieben Minuten, in denen im Fernsehen weiter die ungarische Popparade lief.
Wieder im Wohnzimmer, öffnete er die Tür zur Balkonterrasse. Eine warme Brise wehte herein. Einner beugte sich hinaus und warf schnell einen Blick hinunter: überall auf der Straße parkende Autos, aber keine Fußgänger. Ächzend hob er Henry Gray auf und hielt ihn wie ein Bräutigam, der die Braut über die Schwelle trägt. Ohne Zögern – um jeden Fehler und das Auftauchen von Passanten auszuschließen, die an der prächtigen Fassade hinaufstarren mochten – kippte er den schlaffen Körper über die Brüstung. Das Krachen und das zweitönige Alarmgeheul eines Autos erreichten ihn, als er schon durchs Wohnzimmer schritt. Mit der Reisetasche über der Schulter verließ er still die Wohnung.
2
Vier Monate später, als der Amerikaner im Szent János Kórház – dem St.-Johann-Spital – auf der Budaer Seite der Donau auftauchte, scharten sich die englischsprechenden Schwestern in dem tristen Fünfzigerjahrekorridor um ihn, um seine Fragen zu beantworten. Zsuzsa Papp malte sich aus, dass es für einen unbeteiligten Beobachter so aussehen musste, als wäre plötzlich unerwartet ein berühmter Schauspieler erschienen, denn fast alle Schwestern flirteten mit ihm. Zwei von ihnen berührten ihn sogar am Arm, während sie über seine Witze lachten. Er war, so erzählten sie Zsuzsa später, charmant in der Art mancher Starchirurgen, und selbst die wenigen, die ihn nicht attraktiv fanden, fühlten sich gezwungen, ihm so genau wie möglich Auskunft zu erteilen.
Zunächst korrigierten sie ihn: Nein, Mr. Gray war nicht im August im St. János eingetroffen. Im August war er ins Péterfy Sándor Kórház eingeliefert worden, und zwar mit sechs gebrochenen Rippen, einem Lungenriss, einem gesprungenen Oberschenkelknochen, zwei gebrochenen Armen und einer Schädelfraktur. Dort drüben in Pest war er von einem ausgezeichneten Chirurgen (»in London ausgebildet«, wie sie ihm versicherten) zusammengeflickt worden, danach aber nicht aufgewacht. »Die Fraktur«, erklärte eine von ihnen und berührte ihren Kopf. »Zu viel Blut.«
Das Blut musste abfließen, und obwohl die Ärzte kaum Hoffnung hatten, verlegten sie Gray im September zur Beobachtung und Pflege ins St. János. Er war hauptsächlich von einer klein gewachsenen Schwester mit drahtigem Haar betreut worden, die Bori hieß, und Jana, ihre deutlich größere Freundin, übersetzte alles, was sie dem Amerikaner erzählte. »Wir haben – hatten – Hoffnung, Sie verstehen? Die Verletzung am Kopf ist sehr schlimm, aber sein Herz schlägt von allein weiter. Also kein Problem mit dem Kleinhirn. Aber wir warten, ob das Blut aus seinem Kopf weggeht.«
Es dauerte mehrere Wochen. Erst im Oktober war das Blut ganz verschwunden. Während dieser Zeit wurden die Rechnungen von seinen Eltern bezahlt, die nur einmal aus Amerika zu Besuch kamen, aber dem Krankenhaus regelmäßig Geld überwiesen. »Sie wollen ihn nach Amerika bringen«, erklärte Jana, »aber wir sagen ihnen, das ist unmöglich. Nicht in seinem Zustand.«
»Natürlich«, erwiderte der Amerikaner.
Seine Verfassung stabilisierte sich zwar immer mehr, aber das Koma hielt an. »Diese Dinge sind manchmal ein Rätsel«, bemerkte eine andere Schwester, und der Amerikaner nickte in ernstem Verständnis.
Doch im nächsten Moment platzte es aus Bori heraus, und sie riss freudig erregt die Hände hoch.
Jana übersetzte: »Und dann wacht er plötzlich auf!«
»Das war erst vor einer Woche?« Der Amerikaner lächelte.
»Am fünften Dezember, dem Tag vor Mikulás.«
»Mikulás?«
»Nikolaus. Wenn die Kinder Stiefel voller Süßigkeiten bekommen.«
»Fantastisch.«
Sie riefen seine Eltern an, um ihnen die wunderbare Nachricht zu überbringen, und als er wieder reden konnte, fragten sie ihn, ob er mit jemandem telefonieren wollte – vielleicht mit der hübschen jungen Ungarin, die ihn einmal pro Woche besucht hatte?
»Seine Freundin?«, wollte der Amerikaner wissen.
»Zsuzsa Papp«, ergänzte eine Schwester.
»Ich glaube, Bori ist eifersüchtig«, meinte Jana. »Sie hat sich in ihn verliebt.«
Verlegen runzelte Bori die Stirn und stellte hektische Fragen, die von allen Seiten nur mit Lachen quittiert wurden.
»Und – ist Zsuzsa gekommen?«
»Ja«, antwortete eine Schwester. »Sie war überglücklich. «
»Aber er nicht«, fiel Jana ein. Dann hörte sie kurz Bori zu. »Ich meine, er war froh, sie zu sehen, ja. Aber seine Stimmung … Er war nicht glücklich.«
»Wie?« Der Amerikaner schien verwirrt. »War er traurig? Wütend?«
»Er hatte Angst«, stellte Jana fest.
»Verstehe.«
Erneut wartete Jana Boris Ausführungen ab. »Er sagt seinen Eltern, sie sollen nicht kommen. Es ist nicht sicher, er will allein heimkehren.«
»Er ist also nach Hause geflogen?«
Jana zuckte die Achseln. Genau wie Bori und alle anderen.
Niemand wusste Genaueres. Vier Tage nach dem Erwachen aus dem Koma, nur zwei Tage bevor der charmante Amerikaner eingetroffen war, um sich nach seinem Freund zu erkundigen, war Henry Gray verschwunden. Ohne ein Wort, ohne Abschied von der tief betrübten Bori. Hatte sich einfach am späten Nachmittag heimlich hinausgestohlen, als alle Ärzte nach Hause gegangen waren und Bori zum Abendessen im Pausenraum saß.
Bei der Erinnerung an den Verlust ihres Lieblingspatienten stiegen Bori die Tränen in die Augen, und sie verdeckte sie mit einer Hand. Der Amerikaner legte ihr die Hand auf die Schulter, was mindestens bei zwei Schwestern Neidgefühle weckte. »Bitte«, sagte er. »Wenn sich Henry bei Ihnen meldet, bestellen Sie ihm, dass sein Freund Milo Weaver nach ihm sucht.«
Das war das Bild, das sich für Zsuzsa ergab, als Bori sie in der Redaktion der populären Boulevardzeitung Blikk anrief, um ihr von dem Ereignis zu berichten. Danach fuhr Zsuzsa ins Krankenhaus und fragte Jana und die anderen nach ihrer Version.
Hätte sich Milo Weaver nur im Krankenhaus blicken lassen, hätte sie sich auf die Suche nach ihm gemacht. Aber er kreuzte immer wieder von allein auf, und bei jedem Erscheinen blieben seine Fragen zwar die gleichen, nicht jedoch sein Benehmen und seine Geschichte.
Für die Krankenschwestern war er ein Freund von Henrys Familie, ein Kinderarzt aus Boston. In Henrys Stammkneipe Pótkulcs erzählten die beiden Csillas von dem kettenrauchenden Romancier Milo Weaver aus Prag, der in Henrys Wohnung übernachten wollte. Für Terry, Russell, Johann, Will und Cowall, die er alle mühelos in ihren Lieblingscafés am Ferenc-Liszt-Platz aufgespürt hatte, war er der AP-Korrespondent Milo Weaver und wollte einem Artikel über die wirtschaftlichen Spannungen zwischen Ungarn und Russland nachgehen, den Henry vor einem Jahr eingeschickt hatte. Und von einem Polizisten im sechsten Bezirk erfuhr sie, dass er sogar bei dessen Chef vorgesprochen und diesen in seiner Eigenschaft als Anwalt von Henrys Eltern gefragt hatte, was er über das Verschwinden ihres Sohns in Erfahrung gebracht hatte.
Bevor Henry aus dem Krankenhaus verschwand, hatte er ihr eingeschärft, niemandem zu vertrauen außer Milo Weaver, aber ihm nichts zu verraten. Es war ein Rätsel: Wozu sollte sie sich an ihn wenden, wenn sie ihm nichts sagen durfte? »Du meinst, du traust ihm nicht?«
»Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wenn mich nur wenige Stunden nach dem Eintreffen des Briefs jemand aus dem Fenster wirft, welchen Schutz kann ich da von einem einzigen Mann erwarten? Ich meine einfach, du sollst mit ihm reden, ihm aber nicht erzählen, wo ich bin.«
»Wie sollte ich es ihm denn auch erzählen? Du sagst mir doch nicht, wo du hinwillst.«
Was auch immer sich Henry einbildete, Zsuzsa hatte keine Lust, sich blindlings an seine Anweisungen zu halten. Sie verstand etwas von Journalismus – mehr noch als vom Tanzen – und wusste, dass Henry trotz seiner aktuellen Berühmtheit immer ein mittelmäßiger Reporter bleiben würde. Seine Ängstlichkeit erlaubte ihm keinen objektiven Blick auf die Realität.
Als ihr Chef anrief, um ihr mitzuteilen, dass ein amerikanischer Filmproduzent namens Milo Weaver in der Redaktion nach ihr gefragt hatte, ließ sie sich die Sache noch einmal durch den Kopf gehen. »Hast du ihm gesagt, wo er mich finden kann?«
»Mensch, Zsuzsa. Ich bin doch nicht total korrupt. Er hat eine Nummer hinterlassen.«
Das war eine Option. Das Telefon bot ihr die Distanz, die sie benötigte, um notfalls genauso schnell von der Bildfläche zu verschwinden wie Henry.
Trotzdem rief sie nicht an. Dieser Typ mit Namen Milo Weaver hatte zu viele Berufe, zu viele Geschichten. In Henrys goldenem Brief hatte gestanden, dass man ihm vertrauen konnte, aber es gab einen Riesenunterschied zwischen Milo Weaver und einem Mann, der sich Milo Weaver nannte. Und sie hatte keine Möglichkeit, herauszufinden, ob das eine oder das andere zutraf.
Immerhin hatte sie ein paar Informationen über ihn. Gleich nach dem Mordversuch an Henry vor vier Monaten hatte sie im Internet recherchiert. Ein CIA-Angestellter, Sachbearbeiter in einem Finanzressort der CIA – wahrscheinlich also die Geheimabteilung Tourismus, die Thomas Grainger geleitet hatte. Doch zum Zeitpunkt des Überfalls auf Henry hatte Weaver wegen eines Finanzvergehens in einem Gefängnis im Bundesstaat New York gesessen – »Unterschlagung« war der konkreteste Begriff, den sie dafür fand. Fotos gab es nirgends.
Daher entschied sie sich fürs Schweigen; sie wusste ja ohnehin nichts. Dass Henry aus seinem monatelangen Schlaf erwacht war, mit schwachen Muskeln und ausgetrocknetem Mund und in der festen Überzeugung, dass SIE ihn bald holen würden, natürlich, das konnte sie erzählen. Aber falls jemand nach Henry suchte, war ihm all das längst bekannt. Die Einzelheiten des Überfalls? Henry war seine Erinnerungen viele Male mit ihr durchgegangen, um ganz sicher zu sein, dass sie sich jedes Detail eingeprägt hatte. Sogar seine eigenen Fehler hatte er ihr gestanden und sich weinend dafür entschuldigt, sie belogen zu haben: Er hätte sie für die Story nicht gebrauchen können.
»Glaubst du, das war mir nicht klar?« Ihre Bemerkung hatte seine peinlichen Tränen endlich zum Versiegen gebracht.
Sie wohnte im Haus eines Freunds im siebzehnten Bezirk, nahm sich eine Woche frei und ließ sogar ihren regelmäßigen Wochenendauftritt im 4Play Club ausfallen. Sie vermied alle ihr bekannten Orte, denn wenn Milo Weaver etwas von seinem Fach verstand, waren sie ihm ebenfalls schon bekannt.
Trotz der leichten Paranoia empfand sie dieses Exil als erfrischend, weil sie endlich Zeit zum Lesen hatte, die sie dummerweise Imre Kertész widmete. In dem Bewusstsein, dass ein Geheimagent nach ihr suchte und dass Henry spurlos untergetaucht war, musste sie bei der Lektüre des Nobelpreisträgers nur an Selbstmord denken.
Am vierten Tag dieses Urlaubs vom Leben, wie sie es nannte, trank sie mit ihrem Gastgeber Kaffee und schaute anschließend durchs Fenster zu, wie er zur Arbeit ging. Sie ließ den Roman von Kertész beim Fernseher liegen und duschte, dann schlüpfte sie in eine modische Jogginghose. Sie hatte beschlossen, sich hinauszuwagen und ihren zweiten Kaffee in einem nahe gelegenen Café zu trinken. Sie steckte Telefon und Vogues in ihre Handtasche, schnappte sich eine Jacke und schloss die Wohnungstür auf. Auf der Fußmatte stand stumm ein Mann. Knapp eins fünfundachtzig, blond, blauäugig, lächelnd. »Elnézést.« Das perfekt ausgesprochene Verzeihung lenkte sie kurz von der Tatsache ab, dass sein Aussehen genau der Beschreibung Milo Weavers entsprach.
Als es ihr auffiel, war es schon zu spät. Er drückte ihr die Hand auf den Mund und schob sie zurück an die Wand. Mit einem leichten Tritt nach hinten schloss er die Tür. Er blickte kurz nach beiden Seiten, während sie vergeblich versuchte, ihn in die Finger zu beißen. Dann schlug sie mit der Handtasche nach ihm. Sie schrie in seine Handfläche, aber es war nur ein hilfloses Lallen. Mit der freien Hand entriss er ihr die Tasche und warf sie auf den Boden. Er benötigte nur eine Hand, um sie zum Schweigen zu bringen; er war unglaublich stark.
Schließlich redete er sie auf Englisch an. »Beruhigen Sie sich, ich will Ihnen nichts tun. Ich suche nur nach Henry.«
Als sie blinzelte, spürte sie Tränen auf den Wangen.
»Ich heiße Milo Weaver. Ich bin mit ihm befreundet. Und wahrscheinlich der einzige Freund, der Henry im Augenblick helfen kann. Also hören Sie auf zu schreien. Okay? Nicken Sie bitte.«
Obwohl es sie einiges kostete, nickte sie.
»Also, dann. Bleiben Sie still.«
Langsam ließ er sie los, doch seine zuckenden Finger schwebten vor ihrem Gesicht, bereit zuzufassen. Sie spürte, wie kribbelnd das Blut zurück in ihre brennenden Lippen strömte.
»Tut mir wirklich leid.« Er rieb die Hände aneinander. »Ich wollte nicht, dass Sie bei meinem Anblick in Panik geraten.«
»Und deswegen fallen Sie einfach über mich her?« Ihre Stimme war schwach.
»Gut, Sie sprechen Englisch.«
»Natürlich spreche ich Englisch.«
»Alles in Ordnung?«
Er streckte die Hand nach ihrer Schulter aus, aber bevor er sie erneut berühren konnte, wandte sie sich ab und steuerte auf die Küche zu.
Er blieb knapp hinter ihr, und als sie mit zitternden Händen eine Dose Nescafé und eine Tüte Milch herausholte, lehnte er sich mit verschränkten Armen in die Tür und schaute ihr zu. Seine Kleider wirkten neu. Er sah aus wie ein Geschäftsmann.
»Und, welche Geschichte haben Sie für mich auf Lager? Kinderarzt? Romancier? Anwalt? Ach so, stimmt – Filmproduzent.«
Als er lachte, drehte sie sich zu ihm um. Das Lachen war echt. Er schüttelte den Kopf. »Hängt immer von der Situation ab. Zu Ihnen kann ich ehrlich sein.« Er stockte. »Oder?«
»Ich weiß nicht. Können Sie?«
»Was hat Ihnen Henry erzählt?«
»Worüber?«
»Über den Brief.«
Sie konnte ganze Abschnitte des Briefs auswendig, weil Henry sie in den wenigen Tagen nach dem Erwachen gebeten hatte, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Seine löchrige Erinnerung hatte sich mit ihrer zusammengetan, und gemeinsam hatten sie das meiste rekonstruiert. Aus ölpolitischen Gründen hatte die Abteilung Tourismus, die brutale »Touristen« wie diesen Weaver beschäftigte, letztes Jahr einen Religionsführer – einen Mullah – im Sudan ermordet, und das hatte Unruhen im Land ausgelöst, bei denen sechsundachtzig unschuldige Menschen getötet worden waren.
Ja, sie wusste viel, aber was diesen Milo Weaver anging, war sie sich immer noch nicht sicher.
»Nur, dass es einen Brief gab«, antwortete sie. »Mit einer Story. Was Großes. Wissen Sie, was drinstand?«
»Ich kann’s mir vorstellen.«
Sie schwieg.
»Der Verfasser des Briefs war ein Freund von mir. Ich habe ihm bei der Enthüllung einer illegalen Operation geholfen, aber er wurde getötet. Dann wurde ich aus der Company geschmissen.«
»Welcher Company?«
»Das wissen Sie genau.«
Um seinem forschenden Blick auszuweichen, drehte sie sich um. Sie setzte Wasser auf und griff nach einer Schale mit braunen Zuckerwürfeln.
»In dem Brief stand, dass Henry mir vertrauen soll«, sagte er.
»Ja, das hat er erwähnt.«
»Und was ist mit Ihnen?«
»Der Brief war nicht für mich bestimmt.« Als sie mit einem Teelöffel Nescafé auf zwei Tassen verteilte, verschüttete sie ein paar Körnchen. Da er keine Antwort gab, wandte sie sich kurz darauf wieder zu ihm, und der Löffel fiel ihr aus der Hand. Klirrend prallte er auf die Bodenplatten. Er hielt eine Pistole, eine kleine Waffe, nicht größer als seine Faust, und zielte auf sie.
Er sprach leise und eindringlich. »Ich erkläre Ihnen jetzt, was Sache ist, Zsuzsa. Wenn Sie meine Fragen nicht beantworten, könnte das sehr schlecht für Sie ausgehen. Ich könnte Sie in die Extremitäten schießen. Ich meine Hände und Füße. Wenn Sie dann immer noch nicht reden wollen, könnte ich weiterschießen, immer weiter, bis Sie bewusstlos werden. Das heißt aber nicht, dass Sie sterben würden. Ich bin kein Arzt, doch ich weiß, wie man es machen muss, damit ein Herz nicht zu schlagen aufhört. Sie würden in der Badewanne aufwachen, in kaltem Wasser. Sie hätten Angst und dann noch stärkere Angst vor dem Messer, das ich aus der Schublade hinter Ihnen nehmen würde, um Ihnen noch mehr Schmerzen zuzufügen. Das könnte tagelang so weitergehen, glauben Sie mir. Und am Ende würde ich alle Antworten kriegen, die ich brauche. Die Antworten, die ich sowieso nur brauche, um Henry zu helfen.«
Sein unbefangenes Lächeln kehrte zurück, aber Zsuzsa versagten die Knie – erst das eine, dann das andere. Sie knickten ein, und sie sank zu Boden, die Muskeln völlig erschlafft. Mit einem Schlag wurde ihr übel, und sie wartete nach vorn gebeugt, dass ihr das Frühstück hochkam.
Als sie auf die Bodenplatten starrte, die aus der Nähe betrachtet schmutzig und voller Kaffeeflecken waren, hörte sie ein metallisches Scharren. Die Pistole glitt heran und stoppte neben ihrer Hand.
»Nehmen Sie sie«, forderte er.
Sie legte die rechte Hand darauf und stützte sich auf die linke, um sich hochzurappeln.
Er lehnte noch immer mit einem lässigen Lächeln in der Tür. »Keine falsche Scheu. Ich werde Ihnen nichts tun. Sie sollen nur wissen, dass Sie mir vertrauen können. Wenn Sie irgendwann meinen, dass ich Sie reinlegen will, richten Sie das Ding einfach auf mich und jagen mir eine Kugel in den Kopf. Nicht in die Brust – da könnte ich Sie vielleicht noch erreichen, bevor Sie wieder abdrücken.« Er tippte sich mitten auf die Stirn. »Dann ist die Sache garantiert erledigt.« Er löste sich aus dem Türrahmen. »Ich warte im Wohnzimmer. Lassen Sie sich Zeit.«
Erst nach zwanzig Minuten hatte sie sich so weit gesammelt, dass sie ihm gegenübertreten konnte. Sie überlegte, ob sie Hilfe rufen sollte, aber ihr Freund hatte keinen Festnetzanschluss, und ein flüchtiger Blick in den Gang zeigte ihr, dass Milo Weaver ihre Handtasche an sich genommen hatte. Als sie an der Wohnungstür vorbeischlurfte, sah sie, dass abgeschlossen war und der Schlüssel nicht steckte. Also ging sie mit zwei Tassen Kaffee, Zucker, Milch und der Pistole auf einem Tablett hinüber.
Er saß auf dem Sofa und blätterte in dem Roman von Kertész. »Unglaublich.«
Sie stellte das Tablett auf den Couchtisch neben ihre Handtasche und die Hausschlüssel. Dann griff sie schnell nach der Waffe und steckte sie vorn in die Tasche an ihrem Sweatshirt. »Kertész? Kennen Sie ihn?«
»Nur den Namen. Nein, ich meine die Sprache.« Wieder betrachtete er die Seite und schüttelte den Kopf. »Nicht zu fassen, woher kommt so was?«
»Aus dem Ural vielleicht. So genau weiß das niemand. Es ist ein großes Rätsel.«
Er klappte das Buch zu und legte es auf den Tisch. Dann ließ er ein Stück Zucker in seinen Kaffee fallen und nippte an der Tasse. Er schien alle Zeit der Welt zu haben.
»Sie wollen also was über Henry erfahren.«
»Vor allem, wo er ist.«
»Das weiß ich nicht.«
Er atmete tief durch und nahm wieder einen Schluck. »Ich weiß, dass Sie im Krankenhaus waren, bevor er abgehauen ist. Vier Tage nacheinander, stundenlang jedes Mal. Und da soll er nicht erwähnt haben, dass er verschwinden will? Das können Sie mir nicht weismachen.«
»Er hat es erwähnt. Aber nicht, wohin.«
»Sie haben doch bestimmt eine Vermutung.«
»Er hat jemand angerufen.«
»Das ist doch schon was«, konstatierte Weaver. »Wen?«
»Keine Ahnung.«
»Welches Telefon hat er benutzt? Ihres?«
Sie schüttelte den Kopf. »Eins von den Krankenschwestern. Meins wollte er nicht nehmen.«
»Warum nicht?«
»Aus dem gleichen Grund, warum er mir nicht verraten hat, wo er hinwill. Er wollte mich nicht in Gefahr bringen.«
Weaver überlegte kurz, dann grinste er, als wäre ihm etwas Komisches eingefallen.
»Was ist?« Sie fixierte ihn beunruhigt.
»Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er die Story ganz allein recherchiert. Will er denn keine Hilfe von mir?«
Sie stand noch immer da, und die kleine Waffe lag erstaunlich schwer in ihrem Sweatshirt – aber vielleicht war es nur das Gewicht ihrer Furcht vor dem Ding. Sie mochte diesen Milo Weaver nicht. Er war weder charmant noch sexy, wie alle behaupteten. Möglicherweise waren die Leute von der CIA einfach so. Sie führten einen Auftrag aus, und jeden Menschen, der ihnen in die Quere kam – zum Beispiel eine verängstigte Freundin –, konnten sie nach Belieben herumschubsen.
Allerdings hatte sie die Waffe. Immerhin etwas. Das, was die CIA unter einer vertrauensbildenden Maßnahme verstand. Als sie sich auf einem Sessel niederließ, zog sie die Pistole heraus und legte sie sich aufs Knie. »Natürlich will er Ihre Hilfe. Aber er hat gesagt, dass ihm ein Einzelner jetzt nicht mehr helfen kann. Nicht, wenn die ganze CIA ihn umbringen will. Er erwartet keine Unterstützung mehr von Ihnen.«
Weaver schien verwirrt. »Was soll das denn heißen?«
»Ich dachte, Sie können mir das erklären. Und vielleicht auch, warum Sie geschlagene vier Monate gebraucht haben, um hier aufzukreuzen und Ihre Unterstützung anzubieten. Das würde mich wirklich interessieren.«
Mit leerem Blick ließ er sich die Sache durch den Kopf gehen. Dann stellte er die Tasse zurück aufs Tablett und stand auf. Auch Zsuzsa erhob sich, die Pistole in beiden Händen.
»Danke«, sagte Weaver schließlich. »Sie haben meine Telefonnummer, für den Fall, dass er sich meldet?«
Sie nickte.
»Sie dürfen mich nicht unterschätzen, und er auch nicht. Ich kann ihm helfen, der Sache auf den Grund zu gehen, und ich kann ihn auch beschützen. Das müssen Sie mir glauben.«
Und das tat sie, trotz allem.
»Kann ich jetzt die Waffe wiederhaben?«
Sie war sich nicht sicher.
Erneut setzte er ein Lächeln auf, und nun blitzte auch etwas von seinem berühmten Charme auf. »Sie ist nicht geladen. Los, schießen Sie auf mich.«
Sie starrte auf die Pistole, als könnte sie auf diese Weise herausfinden, ob seine Worte der Wahrheit entsprachen. Dann zielte sie in seine ungefähre Richtung. Aber es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, seiner Aufforderung zu folgen. Schließlich trat Weaver auf sie zu und entwand ihr die Pistole. Er legte den Lauf an seine Schläfe und drückte ab. Und noch einmal. Zsuzsa fuhr zusammen, als es zweimal laut klickte. Erst später wurde ihr klar, was das Erschreckendste an diesem Vormittag gewesen war: Milo Weaver zuckte nicht mit der Wimper. Er wusste natürlich, dass die Waffe nicht geladen war. Trotzdem kam ihr diese Beherrschtheit irgendwie unmenschlich vor.
Er griff nach den Schlüsseln und sperrte die Wohnungstür auf. Durchs Fenster beobachtete sie, wie er das Haus verließ und das tote Gras überquerte. Mit ausdrucksloser Miene sprach er in ein Handy, und nicht das leiseste Zögern lag in seinen harten Schultern und seinem unerbittlichen Gang. Er wirkte wie eine Maschine.
TEIL I
DER NEUNTE AUFTRAG
SONNTAG, 10. FEBRUAR BIS MONTAG, 25. FEBRUAR 2008
1
Er hatte das Gefühl, er müsste es nur benennen können, um es zu beherrschen. Transgressive Assoziation? Das klang einigermaßen richtig, war aber zu klinisch, um die Sache zu fassen zu kriegen. Vielleicht spielte das medizinische Etikett sowieso keine Rolle. Das Einzige, was zählte, war die Wirkung auf ihn und seine Arbeit.
Die schlichtesten Dinge konnten es auslösen – ein Takt Musik, ein Gesicht, ein Schweizer Hündchen, das auf die Straße kackte, oder der Geruch von Auspuffgasen. Nur Kinder nie, was sogar ihm seltsam vorkam. Bloß die indirekten Bruchstücke seines früheren Lebens versetzten ihm diesen Schlag in die Magengrube, und als er in einer eiskalten Züricher Telefonzelle stand und in Brooklyn anrief, hätte er nicht einmal sagen können, was diesmal der Auslöser war. Er wusste nur, dass er Glück hatte: Niemand meldete sich. Vielleicht waren sie in irgendeinem Café beim Frühstück. Dann schaltete sich die Maschine ein: ihre beiden Stimmen, ein Durcheinander weiblicher Töne, die ihn lachend aufforderten, bitte eine Nachricht zu hinterlassen.
Er hängte auf.
Wie er es auch nannte, es war ein riskanter Impuls. Für sich genommen eigentlich harmlos. Was konnte ein spontaner – vielleicht zwanghafter – Anruf in einem Zuhause, das keines mehr war, an einem grauen Sonntagnachmittag schon ausmachen? Doch als er durch die zerkratzte Scheibe auf den weißen Lieferwagen in der Bellerivestraße spähte, wurde er sich der Gefahr bewusst. In diesem Lieferwagen saßen drei Männer und wunderten sich, dass er hier hatte anhalten wollen, wo sie doch gerade auf dem Weg waren, ein Kunstmuseum auszurauben.
Manch einer hätte wohl nicht einmal daran gedacht, sich so eine Frage zu stellen, denn wenn sich das Leben so schnell verändert, wird die Rückschau zu einer verblüffenden Abfolge moralischer Entscheidungen. Und wären diese anders ausgefallen, säße man jetzt eventuell gar nicht hier. Sondern in Brooklyn vielleicht, mit der Sonntagszeitung und den Werbebeilagen, zerstreut zuhörend, wie die eigene Frau das Feuilleton zusammenfasste und die Tochter das Vormittagsprogramm des Fernsehens kritisierte. Doch die Frage kam wieder, wie so oft in den letzten drei Monaten: Wie bin ich hier gelandet?
Die erste Regel im Tourismus lautet, dass man sich nicht von ihm zerstören lassen darf – denn genau das kann passieren. Ohne weiteres. Die rastlose Existenz, die Notwendigkeit, den Überblick über mehrere Aufträge gleichzeitig zu behalten, das Unterdrücken von Empathie, wenn es der Job erfordert, und vor allem die unaufhaltsame Vorwärtsbewegung.
Doch diese tückische Eigenschaft des Tourismus, die Bewegung, ist auch ein Segen. Sie lässt keine Zeit für Fragen, die sich nicht unmittelbar um das eigene Überleben drehen. Auch der Augenblick jetzt war keine Ausnahme. Und so schob er sich aus der Telefonzelle, trabte durch die beißende Kälte und kletterte auf den Beifahrersitz. Giuseppe, der picklige, magere Italiener am Steuer, erfrischte mit seinem Orbit-Kaugummi die Luft im Wagen, während Radovan und Stefan, beides kräftige Kerle, hinten im Laderaum auf einer behelfsmäßigen Holzbank hockten und ihn anstarrten.
Die Lingua franca in diesem Kreis war Deutsch, daher sagte er: »Los.«
Giuseppe fuhr weiter.
Jeder Tourist entwickelt seine eigenen Methoden, um nicht unterzugehen: Rezitieren von Gedichten, Atemübungen, Selbstverletzung, mathematische Rätsel, Musik. Dieser Tourist hatte früher immer einen iPod bei sich gehabt, doch er hatte ihn seiner Frau als Versöhnungsgeschenk gegeben, und jetzt waren ihm nur seine musikalischen Erinnerungen geblieben. Als sie an den kahlen, knorrigen Winterbäumen und den Häusern von Seefeld vorbeirollten, dem südlichen Stadtteil am Zürichsee, summte er eine halb vergessene Melodie aus seiner Jugend in den Achtzigern und fragte sich, wie andere Touristen mit der quälenden Trennung von ihrer Familie fertig wurden. Ein blöder Gedanke: Er war der einzige Tourist mit Familie. Sie bogen um eine Ecke, und Radovan platzte mit einer knappen Aussage heraus: »Meine Mutter hat Krebs.«
Giuseppe lenkte den Wagen weiter in seiner sicheren Art, und Stefan wischte mit einem Lumpen Öl von der Beretta, die er letzte Woche in Hamburg gekauft hatte. Vom Beifahrersitz aus schielte der Mann, den sie als Mr. Winter kannten – er tourte unter dem Namen Sebastian Hall, war seiner Familie aber als Milo Weaver geläufig –, nach hinten zu dem breitschultrigen Serben, der die muskulösen, bleichen Arme über dem Bauch verschränkt hatte und die behandschuhten Fäuste gegen die Rippen drückte. »Das tut mir leid. Den anderen bestimmt auch.«
»Ich will kein Mitleid.« Radovan sprach mit starkem Belgrader Akzent. »Ich wollte es nur erwähnen, bevor wir das machen. Ihr wisst schon, falls ich hinterher keine Gelegenheit mehr dazu habe.«
»Klar, verstanden.«
Giuseppe und Stefan murmelten beifällig.
»Ist die Krankheit behandelbar?«, fragte Milo Weaver.
Radovan, der eingeklemmt zwischen Stefan und einem Haufen leerer Leinensäcke saß, wirkte betroffen. »Es ist im Magen. Schon zu weit fortgeschritten. Ich lasse sie in Wien untersuchen, aber der Arzt kennt sich anscheinend aus.«
»Das weiß man nie.« Giuseppe bog auf eine andere baumgesäumte Straße.
»Klar«, stimmte Stefan zu und wandte sich gleich wieder seiner Waffe zu, um nichts Falsches zu sagen.
»Aber du ziehst die Sache mit uns durch?« Es war Milos Aufgabe, solche Fragen zu stellen.
»Wenn ich wütend bin, kann ich mich besser konzentrieren. «
Milo ging noch einmal die Details durch. Es war ein ziemlich einfacher Plan, dessen Gelingen weniger vom Ablauf abhing als vom Überraschungselement. Jeder kannte seine Aufgabe, aber Radovan – war damit zu rechnen, dass er seinen Frust an einem armen Museumswachmann ausließ? Immerhin hatte er eine Waffe. »Vergesst nicht, wir wollen niemanden verletzen.«
Das war allen klar, da er es im Verlauf der letzten Woche ständig wiederholt hatte. Schon bald hatten sie gespottet, dass Mr. Winter ihre Tante war, die sie aus allen Scherereien heraushalten wollte. In Wirklichkeit hatte er in den letzten knapp drei Monaten ohne fremde Hilfe eine ganze Reihe von Aufträgen erledigt, von denen sie nichts wussten. Er wollte nicht, dass ihm seine Helfer die Glückssträhne verdarben.
Das hier war der achte Auftrag. Er war erst vor kurzem zum Tourismus zurückgekehrt und konnte daher noch Buch führen; andererseits spürte er bereits eine nagende Unruhe, weil all diese Jobs so verdammt einfach gewesen waren.
Nummer vier im Dezember 2007. Die weinerliche Stimme von Owen Mendel, dem geschäfsführenden Leiter der Abteilung Tourismus, erklang aus seinem Nokia: »Fahren Sie nach Istanbul und heben Sie unter dem Namen Charles Little fünfzehntausend Euro bei der Interbank ab. Pass und Kontonummer finden Sie im Hotel. Anschließend fliegen Sie nach London und eröffnen mit dieser Summe bei der Chase Manhattan Bank im 125 London Wall ein Konto. Gleicher Name. Sorgen Sie dafür, dass der Zoll das Geld nicht entdeckt. Meinen Sie, Sie schaffen das?«
Nach dem Warum fragt man als Tourist nicht. Man glaubt einfach, dass alles einer guten Sache dient und dass die weinerliche Stimme am anderen Ende die Stimme Gottes ist.
Zweiter Auftrag im November 2007: »Eine Frau in Stockholm. Sigrid Larsson. Doppel-S. Wohnt im Grand Hotel am Blasieholmshamnen. Sie erwartet Sie. Kaufen Sie Flugtickets nach Moskau und bringen Sie sie bis spätestens achtzehnten zur Trubnaja Uliza 12. Verstanden?«
Sigrid Larsson, eine sechzigjährige Professorin für Internationale Beziehungen, war schockiert, aber auch geschmeichelt wegen des Aufhebens, das um sie gemacht wurde.
Jobs für Kinder, für drittklassige Botschaftsangestellte.
Nummer fünf im Januar 2008: »Vorsicht, wirklich eine heikle Sache. Der Mann heißt Lorenzo Peroni, bedeutender Waffenschieber in Rom. Die Details schicke ich per SMS. Trifft sich in Montenegro mit einem südkoreanischen Käufer namens Park Jin Myung. Sie beschatten ihn ab dem achten, wenn er seine Wohnung verlässt, bis zu seiner Rückkehr am fünfzehnten. Nein, um Mikros müssen Sie sich nicht kümmern, das übernehmen wir. Sie machen die Kameraarbeit, wir brauchen gute Bilder.«
Wie sich herausstellte, war Park Jin Myung kein Waffenkäufer, sondern eine von Peronis zahlreichen Geliebten. Die Fotos hätten besser in eine englische Boulevardzeitung gepasst.
Und so weiter. Noch eine sinnlose Überwachung in Wien, der Befehl, von Berlin aus einen Brief an einen gewissen Theodor Wertmüller in München zu schicken, eine eintägige Beschattung in Paris und zu Beginn des Monats die einzige Liquidierung. Der Befehl dazu kam als SMS:
L: George Whitehead. Gefährlich. Ab Do. eine Woche in Marseille.
George Whitehead, der Patriarch einer Londoner Verbrecherfamilie, sah ungefähr wie siebzig aus und war in Wirklichkeit fast achtzig. Keine Kugel war nötig, nur ein einziger Stoß im Dampfbad des Hotels. Sein Kopf knallte gegen die feuchten Wandbohlen, und die Gehirnerschütterung zog ihn für immer aus dem Verkehr.
Es fühlte sich nicht einmal an wie ein richtiger Mord.
Andere hätten sich vielleicht über diese mühelosen und belanglosen Aufgaben gefreut. Aber Milo Weaver – oder Sebastian Hall oder Mr. Winter – konnte sich nicht entspannen, weil die Mühelosigkeit und Belanglosigkeit nur einen Schluss zuließen: Sie hatten ihn im Visier. Sie wussten oder ahnten, dass er nicht hundertprozentig loyal war.
Und jetzt dieser Job, wieder ein Test. »Treiben Sie Geld auf. Im Idealfall zwanzig Millionen, aber wenn es nur fünf oder zehn werden, verstehen wir das.«
»Dollar?«
»Ja, Dollar. Haben Sie damit ein Problem?«
2
Möglicherweise aus Nervosität erzählte Stefan von einer schönen Frau in Monte Carlo, einer Tänzerin, die ihren komfortablen Lebensstil damit bestritt, dass sie Sex mit Tieren hatte, was Stefan für ein geheimes französisches Laster hielt. Auch das störte Milos inneren Soundtrack, und er forderte den Deutschen auf, den Mund zu halten. »Gib Radovan die Waffe.«
Stefan reichte sie dem Serben.
»Gleich da«, meldete Giuseppe.
Milo schielte auf die Uhr. Kurz vor halb fünf, in einer halben Stunde machten sie zu.
Giuseppe fuhr durch ein offenes Tor auf einen gekiesten Hof, wo drei Schweizer Autos vor dem Museum parkten, einer Villa aus dem neunzehnten Jahrhundert. Sie hatte einmal dem in Deutschland geborenen Industriellen Emil Georg Bührle gehört, der einen Teil seines Vermögens mit dem Verkauf von Waffen an das faschistische Spanien und das Dritte Reich verdient hatte. Der Italiener ließ den Motor laufen. Ein Paar mittleren Alters verließ das Museum, und auch jenseits der Mauer hinter ihrem Wagen waren Paare zu erkennen, die einen Sonntagsspaziergang unternahmen.
»Die vier ganz vorn, wie ausgemacht, okay? Wir können nicht lang rumtrödeln.«
»Ja, Tante«, antwortete Stefan, als sie sich schwarze Skimasken übers Gesicht zogen. Giuseppe blieb hinter dem Steuer, während die anderen ausstiegen. Radovan presste die Beretta an den Schenkel, und die drei Männer liefen mit knirschenden Schritten zum Eingang.
Beim Auskundschaften dieses und vier weiterer Museen in der vergangenen Woche hatte Milo festgestellt, dass es hier keine nennenswerten Sicherheitsvorkehrungen gab, ganz als wären die Verantwortlichen des Bührle-Museums noch nie auf die Idee gekommen, dass vielleicht jemand zu vernarrt in Kunst oder auf schnelles Geld aus sein könnte. Vorn befanden sich zwei Wachleute, pensionierte Polizisten, die nicht einmal Schusswaffen trugen. Radovan war dafür eingeteilt, sie außer Gefecht zu setzen, und er erledigte seine Aufgabe mit Gusto: In seinem starken Akzent brüllte er, dass sie sich auf den Boden legen sollten, während er mit der Pistole herumfuchtelte. Vielleicht in dem Gefühl, dass sie es hier mit einem verzweifelten Mann zu tun hatten, gehorchten sie sofort.
Stefan zog die Kartenverkäuferin hinter ihrem Schalter hervor und schob sie hinunter zu den Uniformierten. Milo hielt inzwischen nach Besuchern Ausschau. Es waren nur noch zwei da: ein älteres Paar im ersten Saal. Verdutzt starrten ihn die beiden an.
Während Radovan auf die Gefangenen aufpasste, zückten Milo und Stefan ihre Drahtschneider. Gleich nach dem ersten Schnitt setzte eine schrille Alarmglocke ein, aber darauf waren sie gefasst. Seinen Berechnungen nach hatten sie mindestens zehn Minuten. Ein Monet, ein van Gogh, ein Cézanne und ein Degas.
Mit den schweren Glasscheiben waren die Gemälde sperrig, daher mussten sie jedes zu zweit zum Lieferwagen tragen. Sieben Minuten später tippte Milo dem bedrohlich hin- und herstapfenden Radovan auf die Schulter. Rasch traten sie den Rückzug an.
Giuseppe stieg aufs Gas.
Das war natürlich der leichte Teil. Vier Bilder im Wert von über einhundertsechzig Millionen Dollar in weniger als zehn Minuten. Keine Leichen, keine Verletzten, keine Fehler. Gesichtsmasken, ein Minumum an Gesprächen und ein weißer Lieferwagen auf dem Weg aus der Stadt.
Giuseppe blieb eisern am Tempolimit. Hinten zogen Radovan und Stefan die Leinensäcke über die Gemälde und plauderten über Einzelheiten des Jobs wie über hübsche Mädchen, die sie im Urlaub kennengelernt hatten. Der Ausdruck auf dem Gesicht der Wachleute, der wohlproportionierte Hintern der Kartenverkäuferin, die merkwürdige Ruhe, mit der das alte Paar den Kunstraub beobachtet hatte. Dann beugte sich Stefan ohne jede Vorwarnung nach vorn und übergab sich.
Er entschuldigte sich, aber sie hatten alle genug Erfahrung in solchen Dingen, um zu wissen, dass oft mindestens einer der Beteiligten seinen Magen nicht unter Kontrolle hatte. So etwas war keine Schande.
In einer verwirrenden Abfolge von Kurven und Abzweigungen, die er sich vorher zurechtgelegt hatte, brachte Giuseppe die Gruppe aus dem Stadtgebiet von Zürich. Erst als sie die östliche Straße nach Tobelhof erreichten, entspannten sie sich ein wenig, und für eine kurze Minute bot sich ihnen der friedliche Ausblick auf den Wald dar, der sich zur Spitze des Zürichbergs hinaufzog. Ein Moment der Unschuld, der nicht von Dauer war. Sie passierten die verstreuten Anwesen von Tobelhof, und als sie die urbane Gegend um Gockhausen erreichten, war das Gefühl bereits wieder verflogen.
Jenseits der Stadt gelangten sie wieder in den Wald und fuhren nach links auf einen verlassenen Feldweg, wo nach einem knappen Kilometer auf einer Lichtung ein VW-Bus und ein Mercedes auf sie warteten. Sie stiegen aus und streckten sich. Radovan stieß einen serbischen Freudenfluch aus – »Jebote!« –, bevor sie die Bilder in den VW luden. Giuseppe verteilte einen Kanister Benzin im Inneren des weißen Lieferwagens.
Milo holte aus dem Kofferraum des Mercedes eine weiche Lederaktentasche. Darin befanden sich kleine, gebrauchte Euroscheine im Wert von sechshunderttausend Dollar, verpackt in drei Plastiktüten. Auf eine Frage hin hätte er erklärt, dass das Geld einem Drogenhändler in Nizza abgenommen worden war, aber niemand fragte. Er dankte ihnen für ihre gute Arbeit, und alle forderten ihn auf, sie anzurufen, wenn er wieder einen Job für sie hatte. Milo wünschte Radovan Glück für seine Mutter.
»Es hat lang gedauert«, antwortete der Serbe, »aber jetzt weiß ich, was für mich Vorrang hat. Mit dem Geld kann ich alles bezahlen, was sie braucht.«
»Ich finde, du bist ein guter Sohn.«
»Ja, das bin ich.« Nicht die geringste Bescheidenheit lag in seinem Ton. »Wenn ein Mann den Kontakt zu seiner Familie verliert, kann er sich gleich eine Kugel in den Kopf jagen.«
Milo lächelte freundlich und schüttelte ihm die Hand, aber Radovan ließ nicht los.
»Weißt du, Tante, ich mag eigentlich keine Amerikaner. Die haben meine Heimatstadt bombardiert. Aber dich – dich mag ich.«
Milo war nicht sicher, wie er damit umgehen sollte. »Wie kommst du darauf, dass ich Amerikaner bin?«
Ein breites Grinsen zog über Radovans Gesicht. Es war das wissende und leicht überhebliche Lächeln, das man bei Männern vom Balkan oft beobachten konnte. »Sagen wir einfach, dein deutscher Akzent ist furchtbar.«
»Vielleicht bin ich Engländer. Oder Kanadier.«
Ein Lachen platzte aus Radovan hervor, und er klopfte Milo auf den Arm. »Nein, du bist schon ein Amerikaner. Aber ich mach dir keinen Vorwurf daraus.« Er griff in die Tasche und reichte Milo mit einem Zwinkern dessen abgenutzten Pass. »Tut mir leid, aber ich möchte wissen, für wen ich arbeite. Also dann, tschüs!«
Als Milo dem Serben nachblickte, der voller Stolz zu den anderen trat, musste er daran denken, dass sie beide Glück gehabt hatten. Wenn er etwas geklaut hätte, was einen Rückschluss auf Milos wahre Identität erlaubt hätte – also nicht bloß den Pass mit dem Namen Sebastian Hall –, wäre Radovan nicht lebend aus diesem Wald herausgekommen. Und Milo war nicht unbedingt scharf darauf, heute noch jemanden zu töten.
Als die drei verschwunden waren, setzte er mit dem VW-Bus noch ein paar Meter nach hinten. Dann ging er zurück und zündete mit seinem Zippo die Sitze des Lieferwagens an, ohne die Türen zu schließen. Sich selbst zündete er eine Davidoff an und wartete, bis sich die roten Flammen ausgebreitet hatten und blau wurden, als das Armaturenbrett schmolz und das Innere mit giftigem Rauch füllte. Er drückte die Zigarette an seinem Absatz aus und warf sie in das wachsende Inferno. Dann setzte er sich in den VW und fuhr weg.
Weiter südlich auf der A2, die ihn nach Mailand führen sollte, vibrierte auf dem Beifahrersitz sein Telefon. Er musste gar nicht die Meldung UNBEKANNTER ANRUFER auf dem Display sehen, um zu wissen, wer das war.
Doch die Stimme gehörte nicht Owen Mendel. Sie war tief, aber lebendig wie die eines gebildeten Mannes, der sich noch an seine progressive Jugend klammert. Aber der Code war unverändert.
»Stattlich und feist.«
»Erschien Buck Mulligan«, antwortete Milo. »Wer sind Sie?«
»Der Neue, wenn Sie so wollen. Alan Drummond. Und Sie sind wohl Sebastian Hall.«
»Was ist mit Mendel passiert?«
»Er war nur eine Übergangslösung, bis sie mich gefunden haben. Gehen Sie davon aus, dass ich bleibe.«
»Okay.« Milo zögerte. »Aber Sie rufen nicht bloß an, um sich vorzustellen, oder?«
»Ich bitte Sie, so was würde ich nie machen. Ich konzentriere mich aufs Wesentliche.«
»Dann kommen wir zur Sache.«
Darauf beorderte ihn Alan Drummond, seine neue Stimme Gottes, ins Hotel Hansablick in Berlin. »Dort warten Instruktionen auf Sie.«
»Sie wissen aber, dass ich hier gerade beschäftigt bin.«
»Das will ich hoffen. Dauert auch nur ein paar Tage.«
»Keine Hinweise?«
»Ich denke, die Sache erklärt sich von selbst.«
Zwei Stunden später verfrachtete er die Gemälde in einem Vorort von Lugano in eine Garage, die er vor einer Woche angemietet und mit einem Kombinationsschloss gesichert hatte. An der Decke brannte eine einzelne Leuchtstoffröhre, in deren surrealem Schein er kurz stehen blieb, um die Bilder zu betrachten. Es war eine Schande: Nach seinem unter starkem Zeitdruck entstandenen Plan sollten nur zwei von ihnen in die Welt zurückkehren. Er zündete sich eine neue Zigarette an und versuchte zu entscheiden, welche überleben sollten und welche nicht, aber er brachte es nicht fertig. Graf Ludovic Lepic und seine zwei Töchter starrten ihn vorwurfsvoll an, als ob sie befürchteten, nie wieder bestaunt zu werden. Degas hatte sie vor fast eineinhalb Jahrhunderten mit Ölfarben unsterblich gemacht, und irgendwann war ein Großindustrieller auf sie gestoßen und hatte sie in seine Villa gehängt. Nächste Woche mussten sie oder zwei andere Bilder mit Hilfe von ein wenig Benzin und dem Feuerzeug verschwinden, als hätten sie nie existiert.
Er sperrte ab und fuhr weiter, bis die südlichen Alpen der Schweiz dem lombardischen Flachland wichen. Die Luft vor seinem Fenster war kalt und sauber, aber in der italienischen Dunkelheit waren die Gipfel hinter ihm nicht zu erkennen. Erst nach Mitternacht erreichte er die neonhellen Straßen Mailands, und auf dem Viale Papiniano wischte er den VW aus und ließ ihn stehen. Nach einer einstündigen Zugfahrt nach Bergamo stieg er in einen Shuttle-Bus zum Flughafen Orio al Serio, wo der erste Flug nach Berlin um halb neun ging. Seine Tragetasche hatte er in einer Züricher Mülltonne entsorgt, bevor er zu seinem Team stieß, daher hatte er jetzt nur dabei, was er in seinen Taschen hatte: Pillen, Davidoffs, Pass, Bargeld und EC-Karten, Handy und einen schlüssellosen Schlüsselring mit einer kleinen Fernbedienung. Er ging mit seinem Sebastian-Hall-Pass an Bord und setzte sich auf einen Platz über dem Flügel, neben einem müden Halbwüchsigen. Rasch schluckte er zwei Dexedrin, um wach zu bleiben. Als sie in der Luft waren, meldete sich der Junge: »Vacation.«
»Pardon?«
Der Italiener mit makellosem Akzent grinste. »Der Song, den Sie summen. ›Vacation‹ von den Go-Go’s.« Er war sichtlich stolz darauf, ein Stück zu kennen, das die meisten Leute zum Zeitpunkt seiner Geburt bereits vergessen hatten.
»Stimmt«, räumte Milo ein. Dann sackte er trotz der in seinen Nervenbahnen ratternden Drogen und der hellen Anrufbeantworterstimmen in seinem Hinterkopf sofort weg.
3
Anfang November hatten sie angerufen und ihn gefragt, ob er an einer Rückkehr in den Außendienst interessiert war. »Ihre Leistungen waren ja immer hervorragend.« Dieses leicht verblüffte Lob hatte Owen Mendel geäußert – verblüfft, weil er nicht wusste, weshalb dieser fähige Tourist, der sogar schon in die Verwaltung aufgestiegen war und dort sechs Jahre gearbeitet hatte, von der Company gefeuert worden war. Offenkundig hatte Mendel nur eine stark zensierte Akte zu Gesicht bekommen. »Natürlich liegt es bei Ihnen, aber Sie wissen ja, welchen Budgetzwängen wir zurzeit unterliegen. Wenn wir erfahrene Kräfte wie Sie gewinnen, haben wir vielleicht eine Chance zur Erholung.«
Nette Ansage. Nicht die Company erwies ihm einen Gefallen, nein, er war der gute Samariter.
Sobald er Owen Mendels Stimme hörte, wusste er genau, was folgen würde. Jewgeni hatte ihn vorbereitet. »Du sagst natürlich Ja, und nach einem Auffrischungskurs stellen sie dich mit einigen Aufträgen auf die Probe. Ein paar Wochen lang. In dieser Zeit musst du dich bewähren, und wir werden keinen Kontakt haben.«
Aus den »paar Wochen« waren drei Monate geworden. Damit hatte nicht einmal der große Jewgeni Primakow gerechnet, das geheime Ohr der Vereinten Nationen. Und er hatte auch nicht damit gerechnet, was für einen Auftrag Mendels Nachfolger Alan Drummond Milo in Berlin erteilen würde: eine letzte, unmögliche Probe.
Der Job in Zürich lag fünf Tage zurück, es war Freitag, kurz vor neun Uhr. Milo stand auf dem kalten, windigen Platz vor dem Berliner Dom. Er fühlte sich wie Matsch, und durch sein umnebeltes Gehirn spukten böse Vorahnungen. Es fiel ihm schwer, nicht wie ein Penner auszusehen. Die ganze Nacht hatte er Trost bei einem Honiglikör namens Bärenfang gesucht, aber das hatte seine Übelkeit nur verstärkt. Donnernd rollte der Stoßverkehr auf ihn zu; ein Reisebus mit Augsburger Kennzeichen bog in die Karl-Liebknecht-Straße und stoppte ein kurzes Stück entfernt mit lautem Ächzen.
Ein weißer Luftpolsterumschlag hatte auf ihn gewartet, und nachdem er ihn im Hansablick gegen ein Trinkgeld in Empfang genommen hatte, hatte er ihn auf einen langen Spaziergang, eine U-Bahn-Fahrt und einen weiteren Fußweg mit zu einer staubigen, unscheinbaren Pension in Friedrichshain genommen, einem Szeneviertel im ehemaligen Ostberlin.
Zwei Fotos zeigten aus verschiedenen Blickwinkeln ein hübsches, blond gefärbtes Mädchen mit olivfarbener Haut. Adriana Stanescu, fünfzehn Jahre alt, das einzige Kind der moldawischen Einwanderer Andrei und Rada Stanescu. Auf der Rückseite eines Bildes stand:
L0 2/15
Das Kind töten und die Leiche verschwinden lassen. Er hatte bis zum Ende der Woche Zeit.
Gleich am Montag hatte er die Instruktionen verbrannt und danach die Stanescus beschattet, um Näheres über ihr Leben herauszufinden. Rada Stanescu arbeitete bei Imperial Tobacco, und ihr Mann Andrei fuhr an den meisten Abenden einen Wagen der Alligator Taxi GmbH. Sie lebten in Kreuzberg zwischen türkischen Familien und neureichen Deutschen, ein wenig südlich von Milos Pension.
Was war mit dem Mädchen Adriana, deren Tod beschlossen worden war? Er hatte sie auf dem Weg zur Lina-Morgenstern-Gesamtschule verfolgt, die von Deutschen und Türken besucht wurde. Er konnte nichts Ungewöhnliches feststellen.
Keine Fragen stellen – eine weitere Regel im Tourismus. Wenn ein Mädchen getötet werden soll, dann ist es eben so. Handeln genügt als Rechtfertigung.
Schlendernd näherte er sich der Kasse, wo die Bayern aus dem Bus vor Kälte in die Hände klatschten und zwischen dampfenden Atemwolken darauf warteten, dass sich der Schalter öffnete.
Jeden Morgen setzte Andrei Stanescu seine Tochter einen Block vor ihrer Schule ab. Warum brachte er sie nicht direkt hin? Weil es (das entnahm er ihrer Haltung und der Scham im Gesicht ihres Vaters) Adriana peinlich war, dass ihr Vater Taxi fuhr. Zwischen der Stelle, wo sie ausstieg, und der Schule an der Gneisenaustraße befanden sich sechs Wohnhäuser und die stets offene Einfahrt zu einem Hof. Am Nachmittag kam sie auf der gleichen Strecke zurück, immer allein. Das hieß also, dass es in diesem Hof passieren musste. Wenn überhaupt.
Jeder Tourist hat eine Vergangenheit, und Alan Drummond wusste alles über die zwei Gründe, die Milo bei einem komfortableren Budget den Zugang zum Tourismus verwehrt hätten: seine Frau und seine Tochter. Drummond war natürlich klar, dass diese scheinbar so einfache Aufgabe für ihn schwerer war als das Erstürmen der iranischen Botschaft in Moskau.