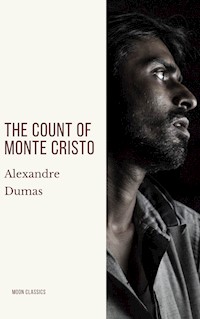Leben und Abenteuer der Fürstin von Monaco, Herzogin von Valentinois, 1. Teil E-Book
Dumas Alexandre
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Catherine Charlotte de Gramont (* 1639; † 4. Juni 1678 im Palais Royal in Paris) war durch Heirat Fürstin von Monaco und Herzogin de Valentinois. Am französischen Hof galt sie als leichtlebige Dame und soll kurzzeitig auch Mätresse des französischen Königs Ludwig XIV. gewesen sein. Sie war Oberhofmeisterin im Palais Royal, der Residenz von Philippe d'Orléans, dem Bruder des Königs. Catherine Charlotte war die Tochter von Antoine de Gramont, Herzog von Gramont (1604–1678) aus dem Haus Gramont, und seiner Nichte und Ehefrau Françoise Marguerite du Plessis (1608–1689), Tochter von Hectors de Chivré, seigneur du Plessis und Nichte von Kardinal Richelieu. Ihr Vater gehörte zu den einflussreichsten Höflingen des französischen Hofs und war seit 1641 Marschall von Frankreich sowie Vizekönig von Navarra und Béarn und Gouverneur von Bayonne. Ihr Bruder war Armand de Gramont, Comte de Guiche. Catherine Charlotte hatte das Gemüt und den Charme ihres Vaters geerbt. 1660 heiratete sie in Paris Louis Grimaldi, 2. Fürst von Monaco. Das Fürstenpaar wurde schließlich wieder an den französischen Hof gerufen….
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Ähnliche
Alexandre Dumas
Leben und Abenteuer der Fürstin von Monaco, Herzogin von Valentinois
Impressum
Texte: © Copyright by Alexandre Dumas
Umschlag: © Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by Dr. August Diezmann
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Inhalt
Impressum
Einführung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Einführung
Wer die Lebensgeschichte eines Fürsten, einer Fürstin, eines vornehmen Herrn oder einer Tänzerin herausgibt, die von der betreffenden Person selbst geschrieben worden ist, muß dein Publikum, welches über die Echtheit solcher Bücher immer Zweifel hegt, Rechenschaft darüber geben, wie er in den Besitz derselben gekommen ist.
Mir wird dies leicht in Bezug auf die Schrift, welche ich hiermit veröffentliche. Ich brauche die Sache nur zu erzählen.
Im Jahre 1838 oder 1839 schrieb ich über meine Reise durch das Fürstenthum Monaco Folgendes:
»Monaco wurde um das zehnte Jahrhundert zu einer erblichen Herrschaft durch die Familie Grimaldi erhoben, ein mächtiges genuesisches Geschlecht, das ansehnliche Besitzungen im Mailändischen und in dem Königreiche Neapel hatte. Um das Jahr 1550, als die großen europäischen Mächte sich bildeten, stellte der Herr von Monaco sich unter spanischen Schutz, weil er fürchtete, in einem Bissen von den Herzogen von Savoyen oder von den Königen von Frankreich verschlungen zu werden. Als aber 1641 dieser Schutz lästiger als vortheilhaft geworden war, beschloß Honoratus II. (Honoré) den Beschützer zu wechseln, und nahm eine französische Besatzung nach Monaco. Spanien, das in Monaco einen fast uneinnehmharen Hafen mit Festung hatte, gerieth in flämischen Zorn, wie es Carl V. und Philipp II. bisweilen geschah, und nahm seinem ehemaligen Schützlinge die mailändischen und neapolitanischen Besitzungen weg. In Folge davon sah sich der arme Herr auf seinen kleinen Staat beschränkt. Um ihn zu entschädigen gab ihm Ludwig XIV. das Herzogthum Valentinois in der Dauphiné, die Grafschaft Carlades in Lyonnais, das Marquisat Baux und die Herrschaft Buis in der Provence, dann vermählte er den Sohn Honoré’s II. mit der Tochter des Marschalls von Gramont, und seit dieser Zeit vertauschten die Grimaldi ihre Herrentitel mit dem Fürstentitel.
»Die Ehe war keine glückliche. Die junge Frau, die schöne und galante Herzogin von Valentinois, welche man aus der Liebeschronik der Zeit Ludwigs XIV. recht wohl kennt, gelangte eines Tages mit einem Schritt aus den Staaten ihres Gemahls, flüchtete nach Paris und führte die seltsamsten Reden über den armen Prinzen. Noch nicht genug: die Herzogin von Valentinois beschränkte ihre eheliche Opposition nicht auf Worte, und der Fürst erfuhr gar bald, daß er so unglücklich sey, als es ein Mann seyn kann.
»In jener Zeit lachte man über solches Unglück, aber der Fürst von Monaco war ein seltsamer Mann und nahm die Sache übel. Er ließ sich die Namen der verschiedenen Liebhaber melden, welche seine Frau nacheinander hatte,und ließ dieselben im Bilde im Hofe seines Schlosses aufhängen. Der Hof war bald angefüllt und man mußte auf die Straße hinausrücken, aber der Fürst wurde nicht müde, und ließ weiter hängen. Das Gerücht von diesen Hinrichtungen drang auch nach Paris. Ludwig XIV. erzürnte sich darüber und ließ den Herrn von Monaco bedeuten, gnädiger zu seyn; der Fürst von Monaco antwortete, er sey Souverain, habe folglich die niedere und hohe Justiz in seinem Staate und man müsse es ihm noch danken, wenn er sich begnüge, Strohmänner hängen zu lassen.
»Die Sache gab so großes Ärgernis, daß man es für gerathen hielt, die Herzogin ihrem Gatten zurückzubringen. Um die Strafe vollständig zu machen, wollte dieser sie vor den Bildern ihrer Geliebten vorbeiführen, aber die verwitwete Fürstin von Monaco bat so lange, bis ihr Sohn diese Rache aufgab und alle gehenkten Strohmänner in einem großen Freudenfeuer verbrannt wurden.
»Das war die Hochzeitsfackel bei dieser Wiedervereinigung«, sagte Frau von Sevigné.
»Bald indeß bedrohte den Fürsten von Monaco ein großes Unglück. Der Fürst Anton hatte nur eine Tochter und gab mehr und mehr die Hoffnung auf, auch einen Sohn zu bekommen. Deshalb verheirathete er die Prinzessin Louise Hippolyte am 20. Oktober 1715 an Jacques Francois Leonor von Goyon - Matignon, der sogleich das Herzogthum Valentinois und nach dem Tode des Fürsten Anton, 26. Februar 1731, auch das Fürstenthum Monaco erhielt Jacques Francois Leonor von Gohons Matignon, Valentinois durch Heirath, Grimaldi durch Erbfolge, ist demnach der Stammvater der jetzt regierenden Familie.
»Honoré IV. regierte friedlich als die französische Revolution 1789 ausbrach. Die Monaconer beobachteten den Gang derselben mit ganz besonderer Aufmerksamkeit und als in Frankreich die Republik ausgerufen wurde, benutzten sie eine Abwesenheit des Fürsten, bewaffneten sich mit dem was sie eben fanden und rückten gegen das Schloß, das sie erstürmten und dessen Keller sie zunächst plünderten, welcher zwar bis fünfzehntausend Flaschen Wein enthalten konnte. Zwei Stunden darauf waren die achttausend Unterthanen des Fürsten von Monaco sämtlich betrunken.
»Gleich dieser erste Versuch zeigte ihnen also, daß die Freiheit etwas gar Schönes sey und sie beschlossen demnach auch eine Republik zu gründen. Da aber Monaco ein zu großer Staat für eine einzige und untheilbare Republik wie die französische war, so beschlossen die großen Geister des Landes, die zu einer Nationalversammlung zusammengetreten waren, die Republik Monaco solle wie die amerikanische eine Bundesrepublik seyn. Die Grundlage der neuen Konstitution wurde demnach berathen und festgesetzt zwischen Monaco und Mentone, die sich beide auf Leben und Tod verbündeten. Nun war noch ein drittes Dorf übrig, Roque-Brune. Dies sollte zur Hälfte zu Monaco, zur Hälfte zu Mentone gehören. Roque-Brune murrte; es wäre gern unabhängig und drittes Bundesglied gewesen, aber Monaco und Mentone lachten über eine solche übertriebene Anmaßung und da Roque-Brune die Gewalt nicht für sich hatte, so mußte es schweigen. Allerdings wurde es den beiden Nationalversamnilungen als ein Herd der Revolution bezeichnet. Die Republik wurde proklamiert als Republik Monaco.«
»Die Monaconer begnügten sich indeß nicht, eine Republik geschaffen zu haben; sie mußten sich auch Bundesgenossen unter den Staaten suchen, welche dieselbe Regierungsform angenommen hatten. Natürlich dachten sie an die Amerikaner und die Franzosen; die Republik San Marino verachtete die Föderativrepublik Monaco so sehr, daß von ihr gar nicht die Rede war.
»Unter den beiden großen Republiken konnte nur eine ihrer Lage nach der Republik Monaco von Vortheil seyn, die französische. Man beschloß also an diese sich zu wenden und schickte drei Abgeordnete an den Nationalconvent, um ihm ein Bündnis anzutragen. Der Convent hatte gerade gute Laune, nahm die Abgeordneten der Republik Monaco sehr gut auf und ersuchte dieselben, den Vertrag am nächsten Tage in Empfang zu nehmen.
»Der Vertrag wurde noch an demselben Tage abgefaßt. Er war freilich nicht lang, denn er bestand nur in zwei Artikeln:
»Art. 1. Es soll Frieden und Bundesgenossenschaft zwischen der französischen und der Republik Monaco bestehen.
»Art. 2. Die französische Republik freut sich die Republik Monaco kennen zu lernen.«
Dieser Vertrag wurde den Abgeordneten übergeben, welche sehr befriedigt mit demselben abreiseten.
Drei Monate später hatte die französische Republik die Republik Monaco in sich ausgenommen.
»Wahrscheinlich ist noch nicht vergessen, wie in Folge der Bemühungen der Frau von D. im Friedensvertrag von Paris 1814 dem Fürsten Honoré V. seine Staaten zurückgegeben wurden, die er seit dem glücklich behalten hat.
»Scherz bei Seite, der Fürst Honoré V. wird von seinen Unterthanen sehr geliebt, die mit Besorgnis dem Tage entgegensehen, an welchem sie ihn verlieren sollen. Sie bewohnen aber auch, wie auch St. Simon spotten mag, [Eigentlich ist es die Souverainität über einen Felsen, von dem aus man, wenn man in der Mitte steht, über die Grenzen des Landes hinausspucken kann. Memoiren des Herzogs von St. Simon.] ein herrliches Land, in welchem nicht rekrutiert wird und in dem es fast gar keine Steuern gibt, da die Civilliste des Fürsten fast gänzlich durch die dritthalb Prozent Zoll von den Waaren und den sechzehn Sous von den Pässen gedeckt wird. Das stehende Heer, welches aus fünfzig Mann besteht, wird nur durch Freiwillige ergänzt.
»Leider konnte ich mich nicht, so wie ich es gewünscht, an dem reizenden Orangengarten erfreuen, den man das Fürstenthum Monaco nennt, da ein grausamer Regen an der Landesgrenze mich überfiel und auf der ganzen Reise durch das Land anhielt, nämlich drei Viertelstunden. In Folge davon sah ich die Hauptstadt und Festung, in welcher die ganze Bevölkerung des Fürstenthums Platz hätte, nur durch einen graulichen feuchten Schleier. Ebenso erging es mir mit dem Hafen, in welchem ich jedoch eine Feluke bemerkte, welche mit einer andern damals abwesenden die Marine des Fürsten ausmacht.
»In Mentone gab mir ein Schild eine Vorstellung von dem Grade der Zivilisation, welche die ehemalige Föderativrepublik im Jahre 1835 erreicht hatte. Ueber einer Thür las man nämlich mit großen Buchstaben: Marianne Casanova verkauft Brot und Modewaaren.
»Ob die Monaconer mit Brot gut versorgt sind, weiß ich nicht; daß die Monaconerinnen die neuesten Modeartikel besitzen sollten, bezweifle ich.
»Eine Viertelstunde von der Stadt trafen wir die zweite Zolllinie und der Paß mußte zum zweiten Male visiert werden. Ich konnte mich überzeugen, daß in dem Staate des Fürsten von Monaco die Ausfuhr so streng verboten ist, als die Einfuhr. Ich wollte das in solchen Fällen gebräuchliche Mittel anwenden, aber ich hatte unbestechliche Zollaufseher vor mir, welche nicht einmal eine Zahnbürste passieren ließen, so daß ich mit meinem Gepäck eine Art Sündflutprobe aushalten mußte, da es wegen der angeblich fortwährenden Schönheit des Klimas Monaco's durchaus kein Obdach an der Grenze gab.
»Leider konnten wir, ich und mein Reisegefährte Jadin, nichts thun, als wo möglich zu begreifen zu suchen, wie es möglich sey, daß in einem so kleinen Lande so viel Regen falle.«
So schrieb ich im Jahre 1888 und ich hatte die Zeilen, welche man eben gelesen, vollständig vergessen, als ich 1842 bei einer zweiten Reise in der Hauptstadt des Fürstenthums Monaco einen Tag und eine Nacht in dem Gasthause »zum großen König von Spanien« blieb.
Ich hatte meinen Paß abgeben müssen, um ein Zimmer und ein Bett zu erhalten.
Mein Paß hatte natürlich dem Wirthe gesagt, wer ich sey.
Mein Wirth hatte es der übrigen Stadt gesagt.
Schon hatten mich unter mancherlei Vorwand ziemlich viele der angesehensten Unterthanen meines vortrefflichen künstlerischen Freundes, des Fürsten Florestan I. besucht, als ich einen geheimnißvollen Besuch erhielt.
Es war der Sohn jener vortrefflichen Marianne Casanova, welche im Jahre 1835 Brot und Modewaaren verkaufte.
Der Sohn hatte das Unglück gehabt, sie vor drei Jahren zu verlieren und das mütterliche Doppelgeschäft verkauft. Mit einem Vermögen von etwa einem Dutzend tausend Franks wollte er in das ehrenwerthe Corps der sardinischen Zollaufseher eintreten, oder hatte dies schon gethan.
Zu mir führte ihn Folgendes.
Sein Großvater, Jacob Casanova, war bei der monaconischen Revolution von 1798 mit den andern Tumultuanten in das Schloß des Fürsten Honoré IV. eingedrungen.
Nur in der Treppe hatte er sich versehen: statt mit den Andern in den Keller hinunterzugehen, war er allein in die Bibliothek hinausgegangen.
Das Versehen war indeß nicht so grob, als es auf den ersten Anblick scheinen könnte, denn Jakob Casanova war kein Weinfreund, sondern ein Bücherfreund.
Mehr als einmal hatte er den Umstand benutzt, daß der Herr Minister des Innern das Brot und die Frau Ministerin des Innern ihre Hüte von seiner Frau bezog, insgeheim die fürstliche Bibliothek besucht und bei diesen Besuchen vier kleine geschriebene Bücher bemerkt, welche den Titel führten: Memoiren der Katharina Charlotte von Gramont von Grimaldi, Herzogin von Valentinois, Fürstin von Monaco, die ihm gewaltig in die Augen stachen.
Von der ganzen Beute im Schlosse reizte ihn nichts so sehr, als diese vier Bände.
Er steckte sie denn auch in die Tasche und kehrte ruhig in seine Wohnung zurück, ohne gegen irgend Jemand von der Entwendung etwas zu erwähnen.
Auch vermißte Niemand die vier kleinen handschriftlichen Bände, welche seit einem Jahrhunderte dagestanden zu haben schienen, ohne daß Jemand außer Jacob Casanova sie beachtet hatte.
Jacob Casanova starb im Jahre 1813 und vermachte seinen Schatz seinem Sohne, welcher seinerseits 1830 aus dem Leben ging und die Bücher seinem Sohne Gaetano Casanova hinterließ, der da vor mir stand.
Eines Tages war ihm die Zeitung von Nizza in die Hände gefallen, in welcher meine vorstehende Schilderung abgedruckt war. Er sah daraus, daß ich das Schild seiner Mutter bemerkt hatte. Diese Aufmerksamkeit brachte ihn auf den Gedanken, daß ich mit dem Manuskript vielleicht etwas anfangen könnte, das seine Familie bisher nicht zu benutzen vermocht hatte.
Er sann drei Jahre darüber nach, wie er mir die vier Bändchen zukommen lasse, hatte aber noch nicht Mittel und Wege gefunden, als er zu Ende des dritten Jahres seines Nachdenkens mit einem male erfuhr, der Mann, mit dem er so lange in Verbindung zu treten gewünscht, sey in Monaco angekommen.
Drei Stunden noch sann er darüber nach, wie er sich bei mir einführen lasse, und da er nach der dritten Stunde nichts ersonnen hatte, nahm er sich vor, sich selbst einzuführen.
Etwa drei Minuten stand er stotternd vor mir, ohne herauszubringen was ihn zu mir führte; endlich aber nahm er die vier Bändchen aus der Tasche und schloß mit dem womit er hätte anfangen sollen, er zeigte mir nämlich den Titel und sagte:
»Lesen Sie.«
Den Titel kennt man.
»Es war ziemlich pikant, namentlich für mich, der ich damals »Ludwig XIV. und seine Zeit« schreiben wollte.
Die Art, wie ich den Mann aufnahm, gab ihm Muth und er erzählte mir die Geschichte der Handschrift, die vom Großvater auf ihn gekommen.
Unter welchen Bedingungen ich in Besitz des Manuskriptes kam, interessiert das große Publikum nicht, die Hauptsache ist, daß ich Alles mittheile, was die Echtheit verbürgen kann.
Eine bessere Bürgschaft dieser Echtheit als alle bibliographischen Details ist der Styl aus dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts, den man nicht verkennen kann, wie man sich leicht überzeugen wird.
Alexander Dumas.
Erstes Kapitel
Alle einigermaßen bedeutenden Personen meiner Zeit haben die Geschichte ihres Lebens geschrieben. Ich besitze nicht den Ehrgeiz, mir einen Namen in der Literatur zu machen oder mir den Ruf eines Schöngeistes zu erwerben; auch will ich die Ereignisse, an welchen ich Theil genommen habe, nicht für Andere erzählen, sondern für mich selbst und besonders für einen Mann, welcher allein mein Herz besessen hat und vor dem ich dasselbe vollständig enthüllen will. Ich werde ihn niemals wiedersehen; er ist jetzt unglücklich; die welche uns trennten, sind Ursache dieses Unglücks, an welchem ich, Gott sey Dank, nicht im Entferntesten Antheil habe. Ohne Zweifel ist ihm oftmals mein Bild erschienen; vielleicht hat er sein Unrecht erkannt, vielleicht hat er eingesehen, daß er mich fast gegen seinen Willen dazu gedrängt, wenn auch auf meiner Seite Unrecht liegt. Hätte man nur einigermaßen gut gehandelt, so wäre ich meiner würdig geblieben, ich sage nicht: seiner würdig, denn er verdient mich nicht so, wie ich bin. Bin ich todt — und ich werde jung sterben, wie man mir prophezeit hat — so wird man ihm diese Papiere übergeben. Ich werde aufrichtig seyn; ich schreibe aus keinem andern Grunde und es lohnt nicht die Mühe, einen Theil der Wahrheit zu verheimlichen, um die übrige auszusprechen. Von den damaligen Angelegenheiten werde ich wenig erwähnen, denn ich habe mich in dieselben nicht gemischt; die Menschen sind mir lieber als die Dinge, und ich scherze lieber, als daß ich über Politik rede. Die Politik gehört nicht in den Kreis der Frauen und ich habe immer diejenigen meines Geschlechts verspottet, welche sie zu ihrer Hauptbeschäftigung machten, statt sich zu bemühen zu gefallen und sich zu unterhalten.
Ich stelle meine Selbstschilderung voran, welche ich eines Abends bei der hochseligen Königin Mutter vor dem ganzen Hofe entwerfen mußte. Das war damals stark Mode und Jeder von uns hat sich derselben unterwerfen müssen. Ich halte dieses Porträt für ähnlich, wenigstens versichern meine Gegner, ich habe mir nicht geschmeichelt. Frau von Montespan, die mich haßt und die ich ebenso wenig liebe, sagt nur, ich habe nur ein Medaillon geliefert, nur den Oberkörper gemalt. Wenn sie diese Memoiren läse, würde sie dies nicht sagen können, denn ich bin fest entschlossen, in diesen mein vollständiges Bild zu geben und keinen meiner Fehler zu vergessen. Ich glaube nachher weniger unglücklich zu seyn.
Ich wurde 1639 im Juni geboren, einundzwanzig Monate nach dem Könige, unserem Herrn; ich bin also sechsunddreißig Jahre alt, als ich das schreibe, 1675. Meine Jugend ist vorüber und die Zeit des Nachdenkens gekommen; auch denke ich nur zu viel nach, denn die Sehnsucht nach der Vergangenheit macht mich krank und ich kann mich nicht daran gewöhnen, mich in der zweiten Reihe der Schönheiten des Tages, nahe der dritten, zu sehen . . .
Ich bin die Tochter Antons III. von Gramont, souveränen Fürsten von Lidacha und Barnacchi, Herzogs und Pairs des Reiches, Marschalls von Frankreich, Ritters der Orden des Königs u. s. w., und Margarethens Duplessis von Chivré, Nichte des Cardinals von Richelieu. Ich hatte zwei Brüder. Der Eine, der durch seine Liebschaften, seine Tapferkeit und seinen eigenthümlichen Charakter allgemein bekannt ist, hieß Graf von Guiche, wie jedesmal der älteste Sohn in unserer Familie; er starb sehr jung, aber ganz gewiß an Langeweile, denn nichts im Leben sprach ihn mehr an. Man hat ihn sehr verschieden beurtheilt und nach dem, was ich später von ihm erzählen werde, beurtheilt man ihn wiederum anders. Mein zweiter Bruder, der Graf von Louvigny, wird nach unserem Vater Herzog von Gramont, und diese Aussicht, die er nicht erwarten konnte, hat ihn sehr bald über den Verlust des armen Grafen von Guiche getröstet. Seiner Frau namentlich wurde es schwer, ihre Freude zu bergen.
Ich bin groß und schön, dies ist unbestreitbar, und Niemand hat es zu leugnen gewagt. Ich habe schönes dunkelblondes Haar, schwarze Augen, die sanft und doch lebhaft sind, einen blendenden Teint, nicht gerade vollkommene aber gute Füße und Hände, einen sehr schönen Arm und vortrefflichen Wuchs. Mein Hals und meine Schultern sind tadellos; man hat in meiner Jugend so viel davon gesprochen, daß es seltsam seyn würde es zu leugnen. Man schreibt mir etwas sehr Vornehmes zu, eine majestätische Haltung, ein geistreiches Gesicht und etwas sehr Einnehmendes in meinem Lächeln, wenn ich die Augenbraunen nicht runzele, denn dann fürchtet man sich vor mir schon von weitem. Meine Zähne sind blendend weiß und meine Lippen roth. Gerade unter der Nase habe ich ein sehr braunes kleines Maal, das fast wie ein Schönpflästerchen aussieht. Der Herr von Monaco hatte immer Lust, dasselbe entfernen zu lassen, ich habe es ihm aber so wenig gestattet, wie manches Andere.
So sehe ich körperlich aus; wie ich geistig bin, ist schwerer zu sagen.
Zuerst weiß ich wenig, denn ich wollte mich nie zum Lernen zwingen. In meiner Kindheit hat man mich sehr verwöhnt und dann kam die Zeit der Freude, in welcher man sich um die Erziehung und Bildung nicht kümmerte. Unsere Väter schlugen sich und unsere Mütter flüchteten, wenn sie nicht genöthigt waren, den Kämpfen beizuwohnen. Ich besitze jedoch angebornen Verstand, und mehr als man geglaubt hat; ich habe mich immer bemüht ihn zu verbergen, um mich seiner besser bedienen zu können, ich bin nur liebenswürdig, wenn ich es seyn will, was mir einen zweifachen Ruf gibt. Einige erheben mich in den Himmel, andere behandeln mich wie eine Wilde, z. B. der Herr von Monaco. Ich lache sie alle aus und bin immer eine einzige Vertraute gewesen.
Mit Recht bin ich stolz auf meine Geburt und meinen Rang; ich mache mich nicht mit Niedrigen gemein, was auch die Verleumdung darüber sagen mag; ich verstehe nicht unter mich hinabzusehen, kaum über mich hinauf, was mir auch nur einmal im Leben widerfahren ist; meine Augen suchen weder in der Höhe noch in der Tiefe, sie bleiben nur um sich. Herz habe ich gerade so viel, um den zu lieben, welcher mich liebt, und ich begreife die weinerlichen Uebertreibungen und Empfindeleien nicht, die mich denn auch niemals zu rühren vermochten. Außer dem, von welchem ich bereits gesprochen habe, der mein Herr war und immer seyn wird.
Für ihn habe ich alles empfunden, alles gefühlt, die tiefste Verzweiflung und die höchste Freude dieser Welt. Die Andern haben mir gefallen, mich unterhalten, weiter nichts; sie befriedigten nur meine Eitelkeit und meine Sinnlichkeit. Ich war Allen überlegen; nach zweistündigem vertraulichen Verkehr mit ihnen kannte ich sie auswendig und Keiner hat mich eine Thräne gekostet.
Sehr fromm, nach der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes, bin ich nicht, aber ich erfülle meine Pflichten gewissenhaft und pünktlich, aus Schicklichkeitsgefühl und um meinen Untergebenen keinen Grund zu gewähren, mich zu tadeln. Ich bin thätig und muthig, laufe umher, sobald ich frei bitt und suche Abenteuer; es ist das ein Bedürfnis für mich. Für gewöhnlich bin ich heiter und lachlustig, auch weiß ich den Spott mit sicherem Blicke zu handhaben, was mich gefürchtet macht. Wehe denen, die mir mißfallen und mich beleidigen! Ich verzeihe selten und vergesse noch weniger; alle meine Sinne haben Gedächtnis.
Gestehen muß ich, daß ich wenige Freunde habe. Der Grund davon liegt mehr in meinem Stolze, als darin, daß ich keinen zu haben verdiente. Im Gegentheil, ich finde, daß Wenige Freunde zu seyn verdienen, und nehme mir nicht die Mühe sie zu suchen. Mein Vater liebt mich nicht sehr; er liebt nur sich selbst und sein Haus; Louvigny und ich sind ihm nichts, und seinen ältesten Sohn hat er eben auch nur beweint, weil derselbe Graf von Guiche war; auch gab er nicht zu, daß Louvigny diesen Namen annehme.