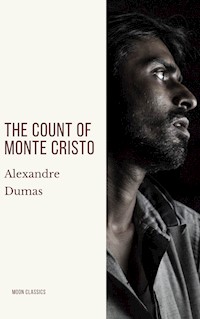Leben und Abenteuer der Fürstin von Monaco, Herzogin von Valentinois, 2. Teil E-Book
Dumas Alexandre
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Catherine Charlotte de Gramont (* 1639; † 4. Juni 1678 im Palais Royal in Paris) war durch Heirat Fürstin von Monaco und Herzogin de Valentinois. Am französischen Hof galt sie als leichtlebige Dame und soll kurzzeitig auch Mätresse des französischen Königs Ludwig XIV. gewesen sein. Sie war Oberhofmeisterin im Palais Royal, der Residenz von Philippe d'Orléans, dem Bruder des Königs. Catherine Charlotte war die Tochter von Antoine de Gramont, Herzog von Gramont (1604–1678) aus dem Haus Gramont, und seiner Nichte und Ehefrau Françoise Marguerite du Plessis (1608–1689), Tochter von Hectors de Chivré, seigneur du Plessis und Nichte von Kardinal Richelieu. Ihr Vater gehörte zu den einflussreichsten Höflingen des französischen Hofs und war seit 1641 Marschall von Frankreich sowie Vizekönig von Navarra und Béarn und Gouverneur von Bayonne. Ihr Bruder war Armand de Gramont, Comte de Guiche. Catherine Charlotte hatte das Gemüt und den Charme ihres Vaters geerbt. 1660 heiratete sie in Paris Louis Grimaldi, 2. Fürst von Monaco. Das Fürstenpaar wurde schließlich wieder an den französischen Hof gerufen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alexandre Dumas
Leben und Abenteuer der Fürstin von Monaco, Herzogin von Valentinois, 2. Teil
Impressum
Texte: © Copyright by Alexandre Dumas
Umschlag: © Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by Dr. August Diezmann
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Inhalt
Impressum
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Man hatte drei Zimmer eingerichtet, davon ein sehr großes, in welchem sonst das Ehrenbett gestanden, für die Marschallin. Die Dienerinnen brachten mich in das mir bestimmte und ich fand da meine beiden Zofen mit Kleidern. Ich trocknete mich, wechselte sehr rasch die Wäsche und die Kleider und entließ sie dann, weil ich die Wohnung Philipps ausfindig machen wollte. Sobald ich allein was-, ging ich hinaus in die Galerie und bis an die Treppe; von da wollte ich mich links wenden, als sich mir ein unerwartetes Hindernis darbot, ein dichtes Gitter wie in einem Kloster, das einzige Neue in dem Hause, mit vortrefflichen Schlössern.
»Philipp sagte wohl, daß er im Gefängnis sey«,dachte ich bei mit.
Wie sehr ich mich bemühte, das Gitter blieb unübersteiglich und der Korridor nach dieser Seite bin verschlossen. Ich mußte umkehren. Peguilhin war fort, ich fürchtete Niemanden mehr und nahm mir vor, meine Nachforschungen später wieder aufzunehmen. Meine Mutter und Frau von Basté, zu denen ich ging, jammerten. Sie fürchteten sich vor Dupont Seine großen Augen und sein raues Äußere kamen ihnen grausam vor; sie glaubten in einer Räuberhöhle zu seyn und die albernen Zofen bestärkten sie darin.
»Ach, warum haben wir Peguilhin fortgelassen!« rief meine Mutter aus. »Nun sind wir ohne alle Vertheidigung.«
»Sind unsere Leute nicht zu rechnen?« fragte ich.
»Die wird man uns nehmen!«
»Das glaube ich nicht. Übrigens wollte der Cousin in die Stadt reiten und er that Recht, sonst müßten wir drei Tage hier bleiben.«
»Der Herr Graf hat recht wohl bemerkt, daß man den schönen jungen Herrn, der uns zuerst begrüßte, hinter Schloß und Riegel eingeschlossen hat«, sagte die Lieblingszofe meiner Mutter. »Als er zu Pferde stieg, sagte er mir: »Wahrscheinlich, um ihn zu strafen, daß er den Galanten spielte!« Ich frage, wenn man einen so hübschen jungen Herrn einsperrt, bloß weil er dem Fräulein die Hand geboten, was man mit uns vornehmen wird?«
So war mir erklärt, warum mich Peguilhin so leichten Herzens verlassen hatte.
Meine Mutter und Gouvernante jammerten weiter. Als sich unerwartet die Thür öffnete, schrieen alte Anwesenden entsetzt auf, aber es trat Niemand ein als der Haushofmeister mit zwei alten Mägden und einem großen silbernen Teller, auf dem sich Wein, Obst und Milch befand, für den Fall, daß die Frau Marschallin etwas zu genießen wünschte, bevor die Mahlzeit bereit sei. Dupont schien sich vorgenommen zu haben, den Wirth so gut als möglich zu " spielen.
»Mein Herr hat mir aufgetragen, die Frau Marschallin zu fragen, wo sie zu speisen wünsche«
»Wo Ihr Herr gewöhnlich speist.«
»So soll mein Herr die Ehre haben mit der Frau Marschallin zu speisen?«
»Nicht nur er, sondern Alle, die er einladen wird, sollen mir willkommen und angenehm seyn.«
Die Leute entfernten sich so zeremoniös als sie gekommen waren.
»Ach, gnädige Frau«, jammerte die Gouvernante, »was haben Sie gesagt! Er wird uns seine ganze Bande bringen.«
»Ach, gnädige Frau«, fiel die Kammerfrau ein, »wie wohl haben Sie getan! Wenn Sie allein gespeiset hätten, wären Sie vielleicht vergiftet worden.«
Ich lachte laut auf und sagte:
»Gnädige Frau Mama, fürchten Sie sich doch nicht so sehr. Der Herr Dupont ist ja ein ganz anständiger Herr und so verfallen auch sein Haus ist, ich werde es von oben bis unten durchsuchen und Ihnen Bericht erstatten. Wenn Fallthüren und dergleichen da sind, wissen wir es wenigstens.«
»Kind!«
»Mademoiselle!«
»Ich verbiete Dir das.«
Ich war schon fort und nahm nur meine jüngste Zofe, Blondeau, mit, die mich nie verlassen hat, die ich später mit Einem aus Monaco verheirathet habe und die nach meinem Tode für meine Denkwürdigkeiten sorgen soll. Sie war heiter und keck gleich mir, und lachte mit mir über die Ängstlichen.
»Zuerst wollen wir mein Zimmer besehen; ich habe ihm kaum einen Blick geschenkt.«
Mein Zimmer war wie die übrigen ohne Möbel; an der einen Seite stand eine Art Bett mit Baldachin und zerrissenen Vorhängen von ursprünglich schönem Stoffe. Im Camine brannte noch Feuer; das Fenster ging auf den erwähnten liebenswürdigen Garten. Ein großer Feigenbaum dessen Zweige bis ans Fenster reichten, gab ihm ein noch traurigeres Aussehen.
»Der häßliche Aufenthalt!« sagte ich. »Was muß Herr Dupont getan haben, daß er dazu verurtheilt wurde? Vielleicht hat er Schätze im Keller. Wir wollen nachsehen.
Wir gingen wirklich dahin und überall hin, bis in den vergitterten Korridor, in die Kapelle, in den Speisesaal und überall war Alles wüst und leer. Nur in der Küche war Leben und dort sah man uns mit großer Verwunderung an.
Nach dem Ausfluge kehrten wir zu meiner Mutter zurück, deren Angst den höchsten Grad erreicht hatte; sie fürchtete schon, mich nicht wieder zu sehen und forderte ihre Frauen auf, mich zu rufen, wenn es vielleicht noch Zeit sey. Zitternd fragte sie mich, ob ich nichts Gräßliches gesehen habe; dann erklärte sie, sie würde nicht schlafen, sondern die Nacht mit uns im Gebet verbringen.
»Frau Mama«, entgegnete ich, »ich kann es beschwören, daß sich außer den Ratten kein lebendiges Wesen in dem Hause befindet. Ich beschwöre es ferner, daß Sie gar keiner Gefahr ausgesetzt sind und daß es Niemand in den Sinn kommt, Ihnen etwas zu Leid zu thun. Unsere Leute essen unten mit gutem Appetit; selbst denen hat man etwas geschickt, die bei dem Wagen wachen. Sie befinden sich um Vieles besser als in einem Wirthshause. Beruhigen Sie sich also, wir werden nicht gestört werden, als etwa durch Spinnen, und so Gott will, gut schlafen.
»Ich lege mich nicht nieder. Du bist ein leichtsinniges, in Allem ungläubiges Mädchen, wie können wir also Vertrauen auf das haben, was Du sagst? Ich zittere schon im Voraus, den schrecklichen Mann bei Tische mir gegenüber zu sehen und ich weiß nicht, wie es gehen soll.
Frau Basté war in einer Ecke mit ihrem Rosenkranze beschäftigt und murmelte vorsorglich Ave’s. Mitten in dieser Angst wurde gemeldet, daß serviert sey, und unser Wirth selbst erschien, um meine Mutter abzuholen. Es gab eine Szene zum Malen. Sie wagte es kaum, sich auf seinen Arm zu stützen, den er ihr bot, als wenn er die Pest habe. Erst nach einiger Zeit fand sie die Kraft ihn zu fragen:
»Werden wir nicht auch Ihren Sohn sehen, den jungen Herrn, der uns so freundlich Ihr Haus anbot?«
»Nein, Madame, er ist so eben in dringenden Geschäften abgereist Ich bedaure es sehr, aber es mußte geschehen.«
»Ach, der arme junge Mann ist verschwunden!« sagte die Basté zu mir.
»Oder abgeschickt worden, um die Bande zusammenzurufen.«
»Mein Gott, Fräulein, was Sie da sagen! Ich glaube, Sie haben Recht.«
»Und in der Nacht werden sie kommen und uns samt- und sonders ermorden.«
Ich flüsterte ihr dies zu, dann lachte ich überlaut, was mir eine Strafpredigt zuzog, aus der ich mir wenig machte. Man aß, zeremoniös, still, aber reichlich. Dupont saß da, aß nicht und sprach auch nicht. Nach dem Essen gingen wir in unsere Zimmer wieder hinauf, geleitet von rauchenden Fackeln. Der Hausherr verbeugte sich bis zur Erde, wünschte uns eine gute Nacht und verschwand.
Meine Mutter begann nun eine in’s Einzelnste gehende Musterung unserer Zimmer, ließ dann noch mehr Holz in die Camine werfen, wie heiß es auch schon war, befahl ihren Zofen bei ihr zu bleiben und bat Frau von Basté, ihr einige Gebete und Kapitel aus dem »Spiegel der christlichen Seele«,ihrem Lieblingsbuche, vorzulesen. Da bat ich sie um die Erlaubnis, die Blondeau mit in mein Zimmer nehmen zu dürfen, um wo möglich zu schlafen.
»Ich bitt sehr müde«, sagte ich, »fürchte mich nicht und denke ganz gut zu schlafen.«
»Geh, mein Kind, wenn ich mich sehr fürchte, werde ich Dich rufen.«
Die Blondeau folgte mir. Wir schlossen unsere Thür so gut, daß sie ohne unsern Willen weder von Freunden noch von Feinden geöffnet werden konnte. Nur beunruhigte mich im höchsten Grade dies Einsperren Philipps. Ich hätte ihn gar zu gerne gesehen. Ich wollte ungestört darüber nachdenken und wies der Blondeau einen großen Sessel an, wo sie bald die Augen zudrückte. Nach einer halben Stunde herrschte die tiefste Stille um uns her. Man hörte nur das regelmäßige Atmen meiner Zofe, die, wie sie sagte, unter meinem Schutze sich weder vor dem Teufel, noch vor Menschen fürchtete. Der Mond hatte die Wolken vertrieben und schien in das Zimmer herein; das Fenster hatte ich ausgemacht, denn es war unerträglich heiß.
Mit einem male war es mir, als höre ich Geräusch im Erdgeschosse, wie leise Tritte. Ich hatte mich angekleidet auf das Bett gelegt, sprang auf und war sogleich am Fenster. Ich hatte mich nicht geirrt; ein Mann ging da unten, tief gebückt, mit äußerster Vorsicht. Anfangs fürchtete ich mich und das Herz klopfte mir gewaltig; bald pochte es aber noch stärker und zwar nicht mehr aus Furcht, denn der Mann war Philipp.
Ich hatte an seine Abreise nicht geglaubt und erwartete ihn fast; nichtsdestoweniger war ich fast eben so sehr erschrocken als erfreut. Ich folgte ihm in Gedanken; er sah mich nicht, aber er hatte sich gut erkundigt; er kam gerade auf das Ziel zu. Sobald er den Baum vor meinem Fenster erreicht hatte, faßte er den Stamm und nach zwei Sekunden war er oben. Sofort erkannte er mich und sprang leicht auf das Fenster.
»Mademoiselle!« sagte er mit bebender Stimme.
»Still!«
Ich zeigte auf die schlafende Blondeau, denn sie konnte erwachen und schreien. So trat ich denn lieber zu ihr und berührte ihren Arm; sie schlug die Augen auf und erkannte mich.
»Fürchte Dich nicht«, sagte ich; »es ist ein Herr da, den ich kenne und mit dem ich sprechen möchte; schlafe nicht, sieh her, aber horche nicht, denn es ist etwas sehr Ernstes.«
Die Blondeau war ein kluges Mädchen und hatte mich lieb. Sie winkte mir und setzte sich so, daß sie uns sehen, aber nicht hören konnte. Dann ging ich wieder zu Philipp, der am Fenster kauerte und ungeduldig auf mich wartete.
»Da bin ich«, sagte ich; »sprechen Sie und erklären Sie mir viele Dinge; denn Ihr Leben ist ein Gewebe von Geheimnissen. Vor allen Dingen, wer sind Sie?«
»Das weiß ich nicht.«
»Was wollten die Königin und der Cardinal bei Ihnen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sie haben Samt-Mars verlassen?«
»Ach nein.«
»Dieser Dupont . . . «
»Er ist es.«
»Aber . . . «
»Fräulein von Gramont! Fräulein von Gramont!« rief Frau von Basté, die, heftig an die Thür pochte; »machen Sie auf; die Frau Mama verlangt nach Ihnen.«
Zweites Kapitel
Die Basté unterbrach mich in dem interessantesten Augenblicke, als ich endlich etwas erfahren sollte. Und wenn man Philipp in meinem Zimmer bemerkte! Was für Geschrei, was für Geschichten hätte das gegeben? Vor den Strafpredigten der guten Frauen fürchte ich mich nicht, aber Peguilhin erfuhr es sicherlich, und wie ihn von der wirklichen Wahrheit überzeugen? Er glaubte gewiß nicht, was ich sagte und beschuldigte mich. Ich wußte nicht was ich thun sollte. Endlich brachte mich mein junger Freund auf dem Feigenbaum aus der Verlegenheit. Er war schon wieder unten am Boden und flüsterte mir zu:
»Ich komme wieder.«
Die Blondeau, die minder verlegen war als ich, rief durch die Thür:
»Fräulein schläft.«
»Wecken Sie sie.«
Ich erwachte selbst und fragte was es gebe.
Die Blondeau machte auf, ich warf mich geschwind auf das Bett und dehnte die Glieder.
»Geschwind«, hieß es draußen vor der Thür. »Man hat im Garten unten gehen hören und einen Mann gesehen.«
»Ach«, dachte ich, »er ist entdeckt. Wir werden einander nicht wieder sehen.«
Unterdessen rief man:
»Er ist von dem Baume am Fenster des Fräuleins heruntergestiegen . . . ich sah ihn. Hilfe! Mörder! Feuer! Diebe!«
Und Alle stimmten in den Ruf ein:
»Hilfe! Hilfe!«
Meine Mutter dagegen hörte ich sagen: »Wir wollen fort . . . fort! Ich mag hier nicht bleiben. Wo sind meine Leute? Man sehe nach meiner Tochter.«
Die Leute hatten sich auf dem Korridor, auf der Treppe, wo sie sonst ein Plätzchen gefunden hatten, niedergelegt; sie mußten bei dem Lärm aufstehen und Einer erschien mit blankem Degen. So aufgebracht ich auch war, hätte ich doch gern lachen mögen, und alles das eines armen Jungens wegen, der mit einem Mädchen reden wollte! Meine Mutter rief unterdeß immer, daß sie keine Minute länger in dem Hause bleibe, daß man uns ermorden wolle, daß sie im Nothfalle zu Fuße gehe. Man brauchte länger als eine halbe Stunde sie zu beruhigen. Sie ließ dann mein Fenster zumachen, verlangte, daß ich bei ihr im Zimmer bleibe und stellte zwei Diener als Wache vor meine Thür. Ich war außer mir vor Zorn.
Der Tag bricht in dieser Jahreszeit früh an; er dämmerte als der Lärm sich beruhigt und Frau von Basté mich zwischen sich und meine Mutter gebracht hatte, wo man vor Hitze und Rauch von den Fackeln kaum mehr athmen konnte. Dann ging es wieder an das Lesen des »Seelenspiegels« und, das Schlimmste, ich mußte zuhören. Meine Mutter schlief halb: die Gouvernante nickte bisweilen mitten in einem Satze.
Dir Blondeau begriff Alles; sie kehrte in mein Zimmer zurück unter dem Vorwande irgend etwas zu holen und stellte sich an das Fenster. Sie fürchtete, der Tollkopf werde wieder kommen, wenn er keinen Lärm mehr höre. Die Schildwachen schliefen.
Das Merkwürdigste war, daß der Lärm den Saint-Mars nicht herbeigebracht hatte. Der gute Mann hatte indeß vielleicht seine Gründe: er entzog sich jeder Erklärung.
Niemals ist mir eine Nacht so lang vorgekommen. Bei der Morgendämmerung endlich erhielt ich die Erlaubnis in mein Zimmer zurückzukehren, wo die Blondeau mich erwartete. Sie kam mir mit einem Finger auf den Lippen entgegen und zeigte mir ein Papier, das sie in der Hand hielt.
»Ein Briefchen!« sagte sie leise.
Ich nahm zitternd den Brief; ich hatte noch keinen erhalten. Ich wagte kaum ihn zu öffnen; ich glühte im Gesicht und wurde dann plötzlich blaß. Ich war alles was man ist, wenn man noch nicht weiß, was Schmerz oder Freude ist und die Jugend die schönen Worte ins Ohr zu stammeln beginnt.
»Blondeau, gib Acht, daß man uns nicht stört, ich will lesen . . . Wie hat er Dir den Brief gegeben?«
»Er kletterte wieder auf den Baum und reichte ihn mir zu. Herr von Bassompierre hätte es nicht besser machen können.«
Ich erbrach das Briefchen; er waren nur einige Zeilen.
»Mademoiselle,
Ich halte mich für ganz und gar unglücklich, da ich von dem Paradiese vertrieben wurde, das ich kaum erreicht hatte, aber ich muß Sie wiedersehen und werde Sie wiedersehen. Ich weiß, daß Sie nach Caderousse reisen, ich weiß, daß dies in der Grafschaft Venaissin ist, und wenn Sie mich binnen einem Monate nicht zu Ihren Füßen sehen, so sagen Sie sich, es sey um den armen Philipp geschehen. Ich bin für das Unglück geboren. Ich habe von der Zukunft weder Liebe noch Ruhm zu erwarten und mein Vormund ist der einzige Mensch, mit dem ich umgeben darf. Ehe ich »länger so fort vegetiere, will ich lieber rasch mein Schicksal »entscheiden und Sie sind dann mein. Auf baldiges oder Nimmer-Wiedersehen.
Jules Philipp.«
Ich las das Billet zweimal und dann trat ich sinnend an das Fenster. Die Luft war himmlisch, das Wetter köstlich; die Vögel hüpften und sangen auf dem Feigenbaume und flogen fort, als ich hinzutrat.
Ich blickte in den unbekannten Garten, unter den Bäumen umher; ich suchte nach meinem Liebhaber und dachte, ich gestehe es, vielmehr an ihn, als an Peguilhin. Das so entschlossene Briefchen gefiel mir. Der Knabe, der Alles wagen wollte, um mir zu folgen, erschien mir wie ein Ritter aus der Ritterzeit.
»Wir werden sehen, ob er nach Caderousse kommt. Ich wünsche es um seinet- und meinetwillen.«
Und wieder las ich die Zeilen. Wie viele ähnliche Briefe habe ich seitdem empfangen! Alle habe ich verbrannt, jenen ersten aber getreulich aufbewahrt. Wenn die Gouvernante von dem Abenteuer etwas geahnt, hätte ich gewiß alle Mittel gegen die bösen Geister zu Hilfe gerufen. Die gute Frau hat mich doch eigentlich nie gekannt. Für sie war ich anfangs nur Fräulein von Gramont und später Fürstin von Monaco. An Geist, Herz, Neigungen und Kopf dachte sie nicht. Ich möchte einem klugen Mädchen nie eine solche Thörin als Führerin geben.
Um acht Uhr kam Peguilhin mit dem wieder hergestellten Wagen. Ich erröthete als ich ihn sah; er bemerkte es und war so fein, daß er sofort einen Fehltritt von meiner Seite ahnte, wenn er auch nicht zu bestimmen vermochte, worin er bestanden. Als man ihm von der Geschichte der Nacht erzählte, sah er mich an und errieth, was er errathen konnte. Auch hatte er auf der weiten Reise die übelste Laune.
Herr von Saint-Mars erschien, um uns ein kostbares Frühstück zu bieten, während unsere Koffer wieder aufgepackt wurden. Er war ungemein artig, in der Weise, welche verräth, wie froh man ist, die Gäste wieder los zu werden. Meine Mutter bewies sich sehr freigebig und ließ den Leuten ein fürstliches Trinkgeld zurück. Von meinem Vetter hätten sie nichts erhalten.
»Auf dem Rückwege werden wir Ihnen einen Besuch machen«, sagte die Dupont, um etwas Artiges hinzu zu setzen.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Marschallin, aber ich werde dann fern von hier seyn und Ihnen also nicht einmal die ärmliche Gastlichkeit bieten können wie jetzt.»
»In diesem Falle nehmen Sie meinen Dank, und wenn Sie am Hofe etwas wünschen, wenden Sie sich getrost an mich. Wir haben einigen Einfluß da, den wir Ihnen gern zur Verfügung stellen.»
Eine Verbeugung war die Antwort des Herrn. Wir stiegen in den Wagen und brachen wieder auf. Als wir wieder das erste Mal anhielten, fragte Peguilhin die Dame über die Ereignisse der Nacht und den geheimnisvollen Mündel, von dem man nichts wieder gehört.
»Er hat eine außerordentliche Ähnlichkeit, die mir sofort aufgefallen ist«, setzte er hinzu; »ich wundere mich, Frau Marschallin, daß sie Ihnen entgangen ist. Der junge Mann ist das wahre Porträt des Königs.«
»Des Königs?» fiel ich ein.
»Ja, zwei Tropfen Milch sind einander nicht ähnlicher; es ist dieselbe Stimme, derselbe Wuchs.»
»Ich kann nichts dazu sagen,» entgegnete meine Mutter. »Wir Alle haben Se. Majestät seit seiner Kindheit nicht gesehen.«
Damit hatte das Gespräch ein Ende. Wir fuhren ohne Aufenthalt und Unfall weiter bis an die Grenze der Grafschaft, wo uns der Cardinal-Legat italienisch becomplimentiren ließ. Man antwortete französisch, dem Herkommen gemäß, welches verlangt einander anzureden, sobald man weiß nicht verstanden zu werden. Man löste die Kanonen und erzeigte uns alle Ehren. Meine Mutter war nicht stolz darauf, denn sie sagte sich, es geschehe alles des Marschalls wegen.
Eine Enttäuschung erwartete uns indeß in Caderousse, das ein sehr hübsches Haus an der Rhone ist. Die Heirath hatte nicht stattgefunden; da aber einmal so viele Gäste eingeladen waren und hundert Boten hätten ausgeschickt werden müssen, um die Einladungen zurück zu nehmen, entschloß sich der Herzog, Feste zu geben. Das Seltsamste dabei ist, daß die Heirath später doch stattfand, als Fräulein Duplessis-Guénégoud heirathsfähig geworden war. Vorher versuchte Caderousse sein Glück an mehren andern Orten; er warb z B. auch um Fräulein von Sévigné.
Ich hate Lust von Caderousse und seinen Körben zu erzählen, obgleich sie erst in eine spätere Zeit fallen. Er ist ein seltsamer Mann und er kam in Verbindung mit noch viel seltsameren. Als er uns zu sich geladen, war er noch jung.
Als wir ankamen und in dem Hofe ausstiegen, wurden wir von ihm selbst und mehren seiner Freunde empfangen. Einer derselben bot mir die Hand und sagte in dem angenehmen Tone einer kreischenden Säge:
»Mademoiselle, ich habe die Ehre der Überbringer eines Briefes des Herrn Marschalls von Gramont für die Frau Marschallin zu seyn. Werde ich ihr denselben übergeben können? Ich bin der Herzog von Valentinois.«
»Es wird eine Ehre für meine Mutter seyn«, antwortete ich sehr trocken, denn er gefiel mir gar nicht.
Er war ein kleiner, kurzer, dicker Mann mit Augen wie ein weißes Kaninchen, einer Rüsselnase, mit Wurstlippen und einer maßlos großen Perücke in Semmelblond ohne Locken, einem wahren Strohdache. Er trug einen Frack von gelblichem Sammet mit Scharlachborten, unermeßlich viele Spitzen und Diamanten an allen Fingern. Seine Hand sah aus wie die eines Accoucheurs oder Zahnausziehers. Er ging wie ein Chaisenträger mit breit ausgespreizten Beinen und sein Gesicht nahm bei allem was ihn unangenehm berührte, sofort die Farbe eines Hahnenkammes an. Die Herren von Rochefoucauld und La Bruyère behaupten, Leute mit solchem Krebsschalengesicht besäßen großen Eigensinn und seltene Bosheit. Auch haben sie Recht, wenigstens bei diesem.