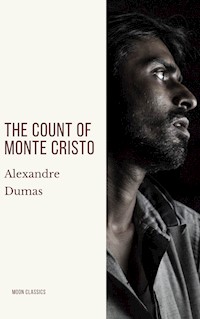Leben und Abenteuer der Fürstin von Monaco, Herzogin von Valentinois, 3. Teil E-Book
Dumas Alexandre
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Catherine Charlotte de Gramont (* 1639; † 4. Juni 1678 im Palais Royal in Paris) war durch Heirat Fürstin von Monaco und Herzogin de Valentinois. Am französischen Hof galt sie als leichtlebige Dame und soll kurzzeitig auch Mätresse des französischen Königs Ludwig XIV. gewesen sein. Sie war Oberhofmeisterin im Palais Royal, der Residenz von Philippe d'Orléans, dem Bruder des Königs. Catherine Charlotte war die Tochter von Antoine de Gramont, Herzog von Gramont (1604–1678) aus dem Haus Gramont, und seiner Nichte und Ehefrau Françoise Marguerite du Plessis (1608–1689), Tochter von Hectors de Chivré, seigneur du Plessis und Nichte von Kardinal Richelieu. Ihr Vater gehörte zu den einflussreichsten Höflingen des französischen Hofs und war seit 1641 Marschall von Frankreich sowie Vizekönig von Navarra und Béarn und Gouverneur von Bayonne. Ihr Bruder war Armand de Gramont, Comte de Guiche. Catherine Charlotte hatte das Gemüt und den Charme ihres Vaters geerbt. 1660 heiratete sie in Paris Louis Grimaldi, 2. Fürst von Monaco. Das Fürstenpaar wurde schließlich wieder an den französischen Hof gerufen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alexandre Dumas
Leben und Abenteuer der Fürstin von Monaco, Herzogin von Valentinois, 3. Teil
Impressum
Texte: © Copyright by Alexandre Dumas
Umschlag: © Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by Dr. August Diezmann
Verlag: Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag Gunter Pirntke Mühlsdorfer Weg 25 01257 Dresden [email protected]
Inhalt
Impressum
Dritter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Dritter Teil
Erstes Kapitel
Nach Bordeaux brachte meine Tante, die Gräfin von Lauzun, ihre Tochter, welche bei der Königin bleiben sollte. Ich beschäftigte mich viel mit der liebenswürdigen Cousine, um ihrem Bruder zu gefallen, der sie sehr lieb hatte und sie mir dringend empfahl. Ein Jahr später verheirathete sie sich mit dem Grafen von Nugent. Auf dieser Reise sahen wir uns kaum und waren nie allein. Herr von Valentinois verließ mich nicht. Meine Liebhaber, mein »Erster Bruder« wie man damals sagte, vergingen fast; ich konnte ihnen aber so wenig helfen, wie mir selbst.
Der Cardinal wollte zu Ehren der jungen Königin in Paris ein Ballet geben lassen, aber der Saal, in welchem die Vorbereitungen stattfanden, fing Feuer und der Cardinal erschrak so sehr darüber, daß er sich nach Vincennes bringen ließ, wo er zwei Monate darauf starb. Er hinterließ meinem Vater hunderttausend Livres und dies tröstete ihn schnell über den Verlust seines großen Freundes.
Herr von Monaco fing um diese Zeit an mich zu drängen mit ihm nach Italien zu gehen; ich schlug es ihm so bestimmt und in so derber Weise ab, daß er sich bei meinem Vater beklagte. Dieser lachte wie gewöhnlich und billigte es, daß ich am Hofe bleiben wollte.
»Sie werden Zeit genug haben in Monaco zu seyn, wenn Sie regieren; da Ihr Vater den Platz noch einnimmt und ausfüllt, so lassen Sie ihn doch.«
Das gefiel meinem Herrn Gemahle nicht und ich fürchtete eines Tages von ihm ohne Weiteres nach Italien entführt zu werden. Ich sprach mit Peguilhin davon, sobald ich mit ihm allein war.
Da eben von einer Verbindung Monsieurs mit Henriette von England die Rede war, so sagte Peguilhin eines Tages zu mir:
»Ich kenne ein Mitei, das Sie hier halten wird. Nehmen Sie meine Stellung beider Prinzessin.«
Das war ein Lichtstrahl für mich. Ich ließ einspannen, fuhr sofort zu der Königin von England und trug ihr mein Anliegen vor. Sie versprach mir alles Mögliche zu thun und setzte hinzu:
»Ich glaube, es wird keine Mühe machen; die ganze königliche Familie spricht mit Achtung von Ihnen, meine Tochter selbst liebt Sie, und wir alle fühlen uns durch Ihren Wunsch geschmeichelt. Eine Herzogin und eine solche Stellung annehmen! Freilich werden Sie auch von Manchen getadelt werden. Haben Sie dies bedacht?«
Was lag mir an dem Tadel. Ich wollte um jeden Preis bleiben.
Unten am Louvre, in welchem die Königin von England wohnte, traf ich den Wagen der Frau von Boisse, die als Frau von Langley unter der Regentschaft Aufsehen machte.
Ich erzähle ihre Geschichte; honny soit qui mai y pense.
Herr von Langley konnte die Verwandten seiner Frau nicht ausstehen. Sie war sehr reich. Er verfolgte sie mit der größten Eifersucht und ging ihr selbst in die Kirche nach. Er machte ihr sogar den Antrag, sich mit ihr für immer einzuschließen.
Die Familie der Frau ängstigte sich wegen dieser Eifersucht und kam auf den Verdacht, daß es mit der Ehe nicht recht richtig seyn möge. Man sprach deshalb einst mit der jungen Frau und sie gestand, daß er untüchtig sey; das gab denn gewaltigen Lärm, es kam zum Prozeß, der zwei Jahre dauerte und man sprach in ganz Paris von weiter nichts. Da Langley Hugenotte war und er verlor, so fiel auf seine sämtlichen Glaubensgenossen auch Schande.
Später verheirathete er sich wieder und seine zweite Frau gebar ihm zwei Kinder. Die Geschiedene wurde das Lächerliche, weiches der Prozeß auf sie gehäuft hatte, nicht wieder los, gebar ihrem zweiten Manne eine Unzahl Kinder und wurde vor ihrem Tode außerordentlich fromm.
Es ist nun auch die beste Gelegenheit von der Prinzessin Henriette zu sprechen, die ich besser gekannt habe als irgend Jemand. Sie hinterließ einen seltsamen Ruf, der ganz verschieden von dem war, welchen Sie sich früher erworben hatte. Sie verdiente aber weder den einen noch den andern.
In ihrer Kindheit und ersten Jugend, als sie an dem Hofe geduldet wurde, litt ihre Gesundheit und ihre Stimmung darunter. Die Entbehrungen und Demüthigungen, welche sie erfuhr und ertrug, verletzten mit Recht ihren Stolz. Sie sprach mit Niemanden, antwortete nicht und sah eher aus als wolle sie beißen, nicht aber lächeln. Der König haßte sie, die Königin Mutter behandelte sie hochmüthig, Monsieur verspottete sie und Mademoiselle zankte mit ihr; sie wurde dadurch verbittert und galt für boshaft. Da sie übertrieben hager, farblos, deshalb anmuthlos, haltlos und überhaupt reizlos war, machte man ihr selbst ihr Auge und ihr Haar streitig, die beide außerordentlich schön waren. Man schilderte sie als eine Art Mißgeburt und erlaubte ihr nicht zu tanzen; Alle stoben vor ihr, um nicht von ihr aufgefordert zu werden, der König selbst zuerst, dem die Königin Mutter es geradezu befehlen mußte.
Als Monsieur sich mit ihr verheirathen wollte, sagte der König zu ihm: »Hast Du denn so große Eile Knochen zu heirathen?«
Als er so sprach, war gleichwohl für die Prinzessin alles anders geworden.
Nach der Restauration Carls II. wollte die Königin von England diesen glücklichen Umschwung benutzen; sie nahm die Prinzessin Henriette mit sich und diese befand sich kaum an dem englischen Hofe, als sie sich völlig umwandelte. Binnen einem halben Jahr wurde sie so reizend, als sie vorher reizlos gewesen. Das linkische, verlegene, ungeschickte Kind erschien ungemein graziös; ihre Gestalt streckte sich zwar nicht kerzengerade, aber sie erhielt eine ganz eigenthümliche Anmuth Ihre langen hagern Arme rundeten sich, ihr Gesicht wurde lächelnd, frisch und offen; die Augen blitzten und die ganze Person, die sonst von Niemanden beachtet oder abstoßend gefunden wurde, verdunkelte die größten Schönheiten.
Die englischen Herren zeigten alle leidenschaftlichen Eifer für sie, unter andern der Herzog von Buckingham, der Sohn jenes, welcher in seiner Jugend in die Königin Mutter so verliebt gewesen war. Er machte öffentlich der königlichen Prinzessin den Hof, der älteren Schwester Carls II. die mit Wilhelm von Nassau, dem Prinzen von Oranien, vermählt war. Sie wies ihn nicht ab, als er aber die Prinzessin Henriette sah, verlor er den Kopf. Diese war kokett und zwar kokett in der Art, welche junge Herren bis zur Verzweiflung aufreizt. Sie erlaubte dem Herzog allerlei Unternehmungen und gestattete sie, indem sie dieselben nicht untersagte. Man sprach davon in England und ganz Europa, und Monsieur, dessen Charakter dem keines andern Menschen gleicht, fühlte sich dadurch geschmeichelt.
»Meine Knochen,« sagte er zu dem Könige, »scheinen jetzt recht appetitlich zu seyn, denn Jedermann will anbeißen.«
Trotzdem gehörte er später zu den lächerlichsten Eifersüchtigen.
Man schrieb von Paris aus, um die Verbindung zu beschleunigen. Man mußte sich in London zur Abreise entschließen. Die Prinzessin hat mir oft gesagt, daß sie kein Verlangen darnach hatte, und der schöne Buckingham ihr Herz nicht ungerührt gelassen. Man könnte von seiner Liebe ein Buch schreiben, so viele Seltsamkeiten beging er.
Der König Carl II. begleitete die Königin, seine Mutter, eine Tagesreise von London. Buckingham folgte ihr wie der ganze Hof, aber er konnte sich nicht entschließen die Prinzessin zu verlassen und bat um die Erlaubnis, mit nach Frankreich zu gehen. Ohne alles Gepäck schiffte er sich in Portsmouth mit der Königin ein.
Am ersten Tage ging alles gut, am zweiten Tage aber hatte man Gegenwind und kam in große Gefahr. Der Herzog von Buckingham wurde fast wahnsinnig in den Gedanken, seinen Abgott vielleicht sterben sehen zu müssen, ohne etwas zur Rettung thun zu können. Er sprach von nichts Geringerem, als die Prinzessin in die Arme zu nehmen und mit ihr über das Meer zu schwimmen. Zum Glück legte sich der Sturm, die Gefahr verzog sich und man konnte den Hafen erreichen, in dem man Zuflucht suchen wollte.
Die Prinzessin hatte Fieber, wollte aber trotzdem die Seereise fortsetzen. Man brachte sie wieder auf das Schiff und kaum war sie da, als die Masern ausbrachen. So war sie von neuem in Gefahr und der Herzog von neuem in Verzweiflung. Er hätte sich gewiß das Leben genommen, wenn sie gestorben wäre.
Endlich kam man in Havre an. Der Herzog eilte nach Paris voraus, die Prinzessin blieb, um sich von der Krankheit zu erholen.
Wir sahen in Paris den Herzog, der seine Herzensleiden allen Echos klagte und dadurch Monsieur in Zorn brachte, namentlich seit Guiche, sein Günstling, gesagt hatte, es sey unverschämt von dem Engländer, daß er die Augen zu der Gemahlin eines unserer Prinzen zu erheben wage, wenn sie auch die Schwester seines Souveräns sey. Wenn sie zusammen kamen, geberdeten sie sich wie zwei junge Hähne; man mußte jeden Augenblick erwarten, daß sie übereinander herfallen würden.
Endlich kam die Reizende selbst an und brachte den ganzen Hof in Aufruhr. Man hatte sich kaum von der Hochzeit der Mancini mit dem Connetable Kolonne erholt, aber hier erwartete man stets irgend eine Festlichkeit; Gunst und Ungunst, Glück und Unglück, Alles ist willkommen, wenn es nur etwas Neues ist und etwas zu sehen gibt.
Mein Bruder Guiche war damals in Frau von Chalais, die Tochter des Herzogs von Marmontiers verliebt, die sehr liebenswürdig war ohne sehr schön zu seyn. Eines Abends zeigte die Prinzessin von England jene Dame dem Herzog von Buckingham und sagte ihm, sie sey die Geliebte des Grafen von Guiche. (Sie sprachen immer Englisch mit einander.) Er äußerte sich darüber und mein Bruder stachelte nun die Eifersucht Monsieurs so sehr an, daß derselbe sich bei der Königin Mutter beklagte und die Ausweisung des Herzogs verlangte. Die Königin war indeß dem Herzog von Buckingham sehr geneigt, in Erinnerung an den Vater desselben, der sie so sehr geliebt und den sie auch geliebt haben soll. Sie vertheidigte ihn mit aller Macht, aber er sah sich etwas später doch genöthigt abzureisen.
Die neue Madame (Gemahlin Monsieurs, eben die Prinzessin Henriette) überraschte durch ihren Geist, wie sie durch ihre Schönheit überrascht hatte. Alle Herren machten ihr den Hof und die Damen bemühten sich ihre Freundschaft zu erhalten.
Keiner gelang es in dem Maße wie mir, erstlich weil wir einander schon längst kannten, und dann auch weil sie meinen Bruder liebte; so weit sie wenigstens bei ihr Koketterie und Eroberungssucht Einen besonders lieben konnte, und endlich weil Monsieur, von Guiche dazu angereizt, mich zu lieben anfing, so weit er eine Frau zu lieben vermochte. Es war eine seltsame Ehe und Wirthschaft diese prinzliche, und ich kann unmöglich Alles sagen was ich gesehen habe.
Mein Bruder konnte seines vertrauten Verhältnisses zu dem Prinzen wegen zu allen Stunden zu demselben gehen und er that es; er sah die Prinzessin sonach auch in allen Verhältnissen; der Prinz selbst machte ihn auf die Reize derselben aufmerksam. Eines Tages führte er ihn zu ihrer Toilette und zeigte ihm ihr schönes Haar, das ihr wie ein Mantel über die Schultern fiel.
Peguilhin sah fortwährend unglücklich aus. So sehr ich ihn auch liebte, konnten miteinander doch nur selten und verstohlen sehen. Es waren immer so viele um mich herum, Monaco abgerechnet. Eines Tages war Madame Cornel bei mir, die witzige Frau, welche einmal sagte: »Es ist mit den Hörnern (der Ehemänner) wie mit den Zähnen; nur der Durchbruch schmerzt; nachher fühlt man sie gar nicht und befindet sich wohl dabei. Auch die Scudery kam und die beiden haßten und verfolgten einander fortwährend, so daß es ein wahres Fest war, sie beisammen zu haben. Sie waren nicht lange bei mir, als Peguilhin auch erschien.
»Ich muß sogleich mit Ihnen sprechen,« sagte er zu mir, »und allein. Schicken Sie die Beiden alten Närrinnen fort.«
Kaum hatte er mir dies gesagt, so ließ mir auch Guiche melden, daß er unter vier Augen mit mir zu reden habe.
Zweites Kapitel
Die beiden alten Damen fortzubringen, war gerade nicht schwer, aber wie ich mit jedem der beiden Männer allein und sogleich sprechen sollte, wußte ich nicht. Ich dachte darüber nach und entschloß mich, meinen Bruder fortzuschicken, als Monaco eintrat und zum ersten und einzigen Male in seinem Leben etwas Passendes that. Sein geheimnißvolles Aussehen verscheuchte die beiden Damen und endlich nahm er sogar Guiche mit sich, um, ich weiß nicht von welchem Prozesse mit ihm zu reden. So blieb ich mit Peguilhin allein, obgleich mein Bruder beim Fortgehen mir zurief:
»Ich komme wieder.«
Sobald sich die Thür geschlossen hatte, trat mein Cousin zu mir, ergrif meine Hand, drückte sie, daß ich vor Schmerz hätte ausschreien mögen, und sagte:
»Sie müssen mir antworten und aufrichtig.«
»Worauf? Sie thun mir entsetzlich weh.«
»Für wen entscheiden Sie sich, für den König oder Monsieur?«
»Warum?«
Er sah mich mit großen Augen an und mein Staunen, das er für erheuchelt hielt, steigerte seinen Zorn noch höher.
»Warum, fragen Sie? Warum kann eine junge schöne Dame wie Sie einen jungen schönen Prinzen wählen?«
»Ich habe bis zu diesem Augenblicke an eine solche, Wahl nicht gedacht.«
»Sie-verspotten mich . . . sie zwingen mich, die Achtung aus den Augen zu setzen. Ich kenne mich nicht mehr.«
»Das sehe ich und es scheint auch als kenneten Sie mich nicht mehr. Wenn es Ihnen belieben sollte, sich deutlicher auszudrücken und mir ruhig zu sagen, um was es sich handelt, so verständigen wir uns vielleicht.«
»Ach,« entgegnete er, »Sie lieben mich nicht mehr.«
Das war sehr unrecht und ich hatte große Lust böse zu werden; ich hielt indeß an mich, denn seine Eifersucht schmeichelte mir doch.
»Ich weiß nicht« was Sie sagen wollen,« antwortete ich, »denn ich habe Sie vielleicht nie so sehr geliebt.«
»Und Ihre Anbeter?«
»Was liegt an diesen? Sie finden mich hübsch, und weiter zu gehen, habe ich ihnen nie erlaubt.«
»Aber jene Beiden?«
»Welche?«
»Der König und dessen Bruder.«
»Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen.«
»Ich beschwöre Sie, lügen Sie nicht. Ich werde mich bemühen, ruhig zu sprechen. Monsieur — der Bruder des Königs — liebt Sie.«
»Sie kennen ihn nicht; er liebt keinen Menschen, namentlich wird er nie eine Dame lieben. Er steht in uns Wesen, die hübscher sind als er, die eine weichere, feinere, weißere Haut haben, die mit ihm in Putz und Allem wetteifern, was ihn ausschließlich beschäftigt. Er spricht mit mir, weil ich mich besser als Andere aus Juwelen und Schmuck verstehe, weil ich seine Klagen über die Prinzessin, seine Gemahlin, mit anhöre, ohne ihn zu unterbrechen, weil ich lache, wenn er mich zum Lachen zu bringen wünscht, und weil ich endlich über Nichtigkeiten und Kleinigkeiten ernsthaft mit ihm reden kann. Aber Liebe! Liebe zu Philipp von Orleans! Ich stehe dafür, daß er nie andere als gemalte Geliebte haben wird.«
»Dann ist es der König.«
»Der König, der mich nicht ansieht und der mich nur grüßt, weil er muß, weil er es meinem Namen schuldig zu seyn glaubt! Der König, der nicht weiß, ob ich blond oder brünett bin! Gehen Sie, lieber Peguilhin, Sie haben Ihren Verstand nicht beisammen.«
»Ich weiß recht gut, was ich vorgestern in Fontainebleau selbst gehört habe. Se. Majestät fragte Madame Colbert über mehre Damen mit ganz besonderem Interesse und über Sie zuerst: »Wie alt ist sie? Hat sie Geist? Sie kann den Valentinois unmöglich lieben. Wie ist ihre Stimmung? Sie ist sehr schön. Sie tanzt gut. Was sagen Sie dazu?«
»Se. Majestät wußte wahrscheinlich Madame Colbert nichts zu sagen und da ihm gerade nichts Besseres einfiel, sprach er von mir.«
Ich erröthete dabei unwillkürlich und meine Eitelkeit fühlte sich angenehm berührt. Die Eifersucht ist doch recht ungeschickt. Mußte er das erzählen? Wenn man auch aus einen gewöhnlichen Mann nicht hört, — einen König dagegen? . . . Peguilhin bemerkte wohl, welchen Eindruck seine Worte auf mich gemacht hatten, und er konnte seinen Zorn nicht beherrschen. Er behandelte mich hart, so daß ich wirklich in Verlegenheit kam; zuletzt verbot er mir nach Fontainebleau zu gehen. Er war überhaupt der herrschsüchtigste und despotischeste Mensch, er war es gegen Jedermann, sogar gegen den König; deshalb ist er nun auch im Gefängnis und da wird er bleiben, wie er selbst beim Eintritte sagte, bis in alle Ewigkeit.
Ich bin nun auch nichts weniger als geduldig; ich sträubte mich gegen sein Verbot und so kam es zu einem starken Wortwechsel. Ich hielt ihm meine Stellung, Herrn von Monaco, die Prinzessin und Alles entgegen, er aber antwortete, um diese brauche ich mich nicht zu kümmern, gar nicht zu kümmern. Trotz meiner üblen Laune mußte ich über diese Äußerung lachen. Ich wollte es mit Gründen versuchen, seine Ansicht zu bekämpfen, als wir meinen Bruder Guiche zurück kommen hörten.
»Richten Sie es ein wie Sie wollen«, sagte mein Cousin rasch zu mir, »aber wenn Sie nach Fontainebleau gehen, platze ich heraus und dann gilt es die Bastille und das Kloster. Es hängt ganz von Ihnen ab.«
Mein Bruder trat so geschäftig ein wie Peguilhin. Er bemerkte, daß wir einen Wortwechsel gehabt hatten, sah aber nur was er sehen wollte und sprach nie von dem was er sah. Er scherzte bitter und spitzig, nach seiner Art, dann setzte er plötzlich lauter hinzu:
»Peguilhin, machen Sie dem Fräulein von Tonnay-Charente ein wenig den Hof, ich habe mit meiner Schwester zu reden.«
»Warum gerade dieser?«
»Weil sie hübsch ist, weil sie ihm sehr gefällt und weil sie ihn, glaube ich, auch freundlich behandelt.«
»Wirklich? Er hat vielleicht die Absicht sie zu heirathen?«
»Ich werde nie heirathen!« fiel Peguilhin ein. »Ein Astrolog oder vielmehr eine Wahrsagerin in unsern Bergen hat mir verkündigt, daß ich durch eine Heirath glücklich oder sehr unglücklich werden würde. Herr von Mortemart ist sehr reich und sehr vornehm, steht aber für mich noch nicht hoch genug. Uebringens macht der Marquis von Montespan, unser Nachbar, gewissermaßen dem Fräulein den Hof und ich möchte ihm nicht in das Gehege gehen.«
»Nun,« sagte Guiche, »ich maße mir nicht an Ihnen irgendwie Vorschriften zu machen, ich wünschte nur Sie aus mindestens eine Stunde anderswo zu beschäftigen.«
Peguilhin ließ sich das nicht wiederholen, aber bei dem Fortgehen warf er mir noch die Worte zu:
»Sie werden in der That zu sehr belästigt, Frau Herzogin; Sie können morgen unmöglich die Reise nach Fontainebleau machen.«
Sobald er fort war, rief Guiche aus:
»Wie? Du wolltest morgen nicht nach Fontainebleau? Hoffentlich irrt er sich; Du wirst da Triumphe feiernd.«
»Ich weiß wirklich nicht,« antwortete ich albern und muthlos, »ich fühle mich in der That nicht ganz wohl.«
»Nicht nach Fontainebleau! Das ist ja unmöglich, Schwester, in jeder Weise unmöglich. Die Prinzessin (Madame) bedarf Deiner und ich beschwöre Dich, nicht auszubleiben, wenn Du mich nur ein wenig liebst.«
»Warum aber?«
»Willst Du mir einen Gefallen, einen sehr großen Gefallen thun?«
»Von Herzen gern.«
»So höre mich an. Du mußt nicht bloß nach Fontainebleau reisen, sondern auch in einer gewissen Weise Dich da benehmen.«
»In welcher Weise?«
»Der Prinz (Monsieur) liebt Dich.«
»Ach geh!«
»Der Prinz liebt Dich, sage ich Dir. Er liebt Dich, weil ich es will. Er wird Dich noch mehr lieben, wenn es in meinem Interesse nöthig ist.«
»Ich habe aber kein Interesse, von dem Prinzen geliebt zu seyn.«
»Du vielleicht nicht, aber ich . . . «
»Du?«
»Ja, ich, und eben wegen dieses Interesses mußt Du, wenn Du eine gute Schwester bist . . . «
»Willst . . . «
»Mußt Du selbst den Prinzen lieben oder Dich wenigstens so stellen.«
»Er langweilt Dich wohl, da Du ihn mir zuschieben willst?»
»Schwester, brauche ich Dir denn wirklich mehr zu sagen? Ich habe Dich für klüger gehalten. Uebrigens verlange ich ja auch nichts Unangenehmes und Beschwerliches. Der Prinz hat Geist, er ist gut gewachsen, eitel und gefallsüchtig, wie es nur eine Dame in Frankreich seyn kann; er ist auch nicht boshaft; er lacht gern; ziehe ihn an Dich, suche es dahin zu bringen, daß er sich nur mit Dir beschäftigt und Du wirst mich zum glücklichsten Sterblichen machen.»
»Du bist wohl in die Prinzessin sehr verliebt?«
»Und Du bist sehr neugierig.«
»Lieber Bruder, Du kennst die Prinzessin nicht.«
»Liebe Schwester, das ist meine Sache, nicht die deinige. Sey nur gut und die Sache wird sich leicht machen.«
»Es thut mir leid, daß ich Dir deine Bitte abschlagen muß.«
»Warum abschlagen?«
»Weil ich nicht anders kann, denn Valentinois würde . . . «
»Er soll kein Hindernis seyn.«
»Auch dann könnte ich nicht einwilligen.«
»Schwesterchen, hindert ein anderer Liebhaber?«
»Und wenn dies der Fall wäre?«
»Liebe Herzogin, ich kümmere mich um deine Angelegenheiten nicht, das würde schon Valentinois nicht zugeben, der seinen Schatz selber hütet . . . Aber reife nach Fontainebleau, und mache Dich so schön, daß Du bemerkt wirst, mehr verlange ich gar nicht.«
Monaco öffnete die Thür und steckte den Kopf herein, um zu sehen wer da sey. Mit seinem Elephantentritte tappte er dann ganz herein.
»Madame,« sagte er, »Peguilhin hat mir eben gesagt, Sie wollten nicht nach Fontainebleau fahren?«
»Ich fühle mich nicht ganz wohl.«
»Das thut mir leid; Sie müssen sich besser zu finden suchen; ich wünsche, daß Sie an den Hof gehen, wenigstens eine Woche lang und Sie scheinen ganz zu Hause zu bleiben.«
»Kann ich nicht ein wenig ausruhen?«
»Ausruhen! Ausruhen können Sie in Ihrem Wagen. Leider haben Sie sich herabgelassen, eine Stellung im Hause der Prinzessin anzunehmen, statt unumschränkte Gebieterin in Ihrem eigenen Hause zu seyn . . . Ich weiß auch, daß der König sich nach Ihnen erkundigt hat, ich weiß daß er Sie auszeichnet und er wird Ihnen nichts abschlagen, wenn Sie ihn um etwas bitten. Und ich möchte, daß Sie wegen etwas für uns sehr Wichtigen mit ihm sprechen.«
»Was meinen Sie?«
»Die Besitzung Cressé, weiche der König Heinrich IV. der Diana von Poitiers gegeben hat, und die wir uns seit vielen Jahren wünschen.«
»Wenn ich nun die Stelle der Diana einnähme?« fragte ich.
»Welche Stelle, Madame?«
»Die einer Geliebten des Königs.«