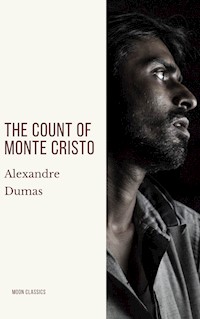Leben und Abenteuer der Fürstin von Monaco, Herzogin von Valentinois, 4. Teil E-Book
Dumas Alexandre
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Catherine Charlotte de Gramont (* 1639; † 4. Juni 1678 im Palais Royal in Paris) war durch Heirat Fürstin von Monaco und Herzogin de Valentinois. Am französischen Hof galt sie als leichtlebige Dame und soll kurzzeitig auch Mätresse des französischen Königs Ludwig XIV. gewesen sein. Sie war Oberhofmeisterin im Palais Royal, der Residenz von Philippe d'Orléans, dem Bruder des Königs. Catherine Charlotte war die Tochter von Antoine de Gramont, Herzog von Gramont (1604–1678) aus dem Haus Gramont, und seiner Nichte und Ehefrau Françoise Marguerite du Plessis (1608–1689), Tochter von Hectors de Chivré, seigneur du Plessis und Nichte von Kardinal Richelieu. Ihr Vater gehörte zu den einflussreichsten Höflingen des französischen Hofs und war seit 1641 Marschall von Frankreich sowie Vizekönig von Navarra und Béarn und Gouverneur von Bayonne. Ihr Bruder war Armand de Gramont, Comte de Guiche. Catherine Charlotte hatte das Gemüt und den Charme ihres Vaters geerbt. 1660 heiratete sie in Paris Louis Grimaldi, 2. Fürst von Monaco. Das Fürstenpaar wurde schließlich wieder an den französischen Hof gerufen. Der vierteilige Roman wirft einen Blick in die Welt des Adels und des französischen Königshofes. Ein echter Dumas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alexandre Dumas
Leben und Abenteuer der Fürstin von Monaco, Herzogin von Valentinois, 3. Teil
Impressum
Texte: © Copyright by Alexandre Dumas
Umschlag: © Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by Dr. August Diezmann
Verlag: Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag Gunter Pirntke Mühlsdorfer Weg 25 01257 Dresden [email protected]
Inhalt
Impressum
Vierter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Letztes Kapitel
Vierter Teil
Erstes Kapitel
Man soupierte und dann wollten die Herren vom Hofe dem Fremden den Palast bei Fackellicht zeigen. Es ist ein recht hübsches Gebäude, nicht zu alt und vor hundertfünfzig Jahren neu gebaut. Man sieht indes noch viele Spuren des Alten. Die vier Flügel sehen nach den vier Himmelsgegenden, der nach Mittag zu ist seltsam gebaut: er hat an den Seiten zwei Thürmchen und in der Mitte bewundert man ein Thor, die Arbeit der Heidin, wie die alten Weiber in Monaco sagen. Der große Grimaldi-Saal mit seinen Fresken von einem berühmten Maler und sein kostbarer Camin sind in ganz Italien berühmt. Es ist in der That ein Meisterwerk und der Stolz der Herren von Monaco.
Bewunderungswürdig, wie schon gesagt, ist die Gegend; die Felsen und die grünen Rasen, die sich bis an das blaue Mittelmeer hinunterziehen, gewähren den reizendsten Anblick, der fast mehr als irgend ein anderer geeignet ist, den Geist und die Sinne zu entflammen. Ich begreife wohl, daß Biaritz hier den Schauplatz seiner Thaten suchte. Saint-Mars aber sah Alles kaltblütig an und ohne ein Wort zu sagen. Mein Zwerg versicherte sogar, er habe nichts angesehen und ich traue es ihm wohl zu.
Am andern Tag reiste er ab. Ich ließ ihm folgen, aber er hatte es geahnt, begab sich nach Mentone und bestieg da einen Küstenfahrer, den er für sich und seine Leute miethete und auf den er kein fremdes Gesicht ließ. Wir erfuhren also nicht, wohin er sich wendete.
Als ich an demselben Abend mit Lasky im Garten an der Meeresküste umherging, erblickte ich Biaritz in einer Mönchskutte. Mönche des Ordens, den er gewählt hatte, haben überall Zutritt, selbst bei dem Fürsten, fast ohne um Erlaubnis zu fragen. Ich ward bei seinem Anblick bewegt. Als er auf mich zukam, lief mein Zwerg, der in einiger Entfernung mit meinem Hündchen spielte, auf mich zu und rief:
»Durchlaucht, der Herr Fürst!«
Ich habe ihn oft peitschen lassen, um es ihm abzugewöhnen, so mit mir zu sprechen, es war aber nicht möglich. Die Ankunft meines Gemahls befreite mich aus der Verlegenheit und ich empfing ihn so freundlich, daß er sich höchlich verwunderte und die Contenance verlor.
»Schon von Rom zurück?« fragte ich.
»Ich habe Briefe erhalten, wir müssen nach Frankreich zurückkehren, wenn es Ihnen nicht unangenehm ist.«
»Briefe aus Frankreich nach Rom. Welche Hexenmeister konnten das errathen, daß Sie dort wären? Darauf aber, daß es mir unangenehm seyn könnte, in mein Vaterland zurückzukehren, weiß ich nicht zu antworten. Wann reisen wir?«
»Nun . . . bald . . . morgen.«
»Morgen! vortrefflich, aber etwas schnell ist es doch . . . Haben Sie nicht Vielerlei hier zu ordnen? All Ihre Minister sind nicht vorbereitet, Ihr Volk hoffte Sie noch lange zu behalten . . . womit wollen Sie es trösten?«
Er liebte den Spott über seine kleine Krone gar nicht; gewöhnlich wurde er heftig darüber und verließ mich; diesmal lächelte er. Ich wußte damals noch nicht, wie sehr er sich durch die Mazarin und die Connetable hatte fesseln lassen, aber ich errieth es gar bald. Trotzdem wunderte ich mich über die plötzliche Abreise, da ich nicht sogleich darauf kam, daß der Fürst von Monaco als außerordentlicher Gesandter der Frau Connetable Colonne und der Herzogin von Mazarin zu den Liebhabern dieser Damen nach Paris gehen könne. Er war gewiß der beschäftigtste Diplomat in Europa.
Er verwickelte sich in tausend Albernheiten, um eine einzige große zu verdecken, und erzählte mir die seltsamsten Märchen, die ich natürlich zu glauben schien. Ich merkte, daß er mir untreu war und sah das gar nicht ungern; warum brauche ich nicht ausführlich auseinander zu setzen.
Drei Tage nach dieser Unterredung setzten wir uns in den Wagen, um nach Paris zurück zu kehren. Ich hatte Biaritz nicht wieder gesehen, weil ich unter dem Vorgehen, ich befinde mich unwohl, in meinem Zimmer blieb. Lasky wurde nicht müde von Erscheinungen und seltsamen Tönen in der Nacht mir zu erzählen. Das Gespenst Lucians zog durch die Galerien; die Pagen und Mädchen konnten vor Angst nicht schlafen. Ich konnte mir die Sache recht gut erklären und doch zitterte ich in der Erinnerung an das, was ich gesehen hatte. Die drohende Erscheinung deutete, meiner Meinung nach, auf einen Unfall im Hause Monaco. Auch irrte ich mich nicht. Mein Mann beging unter der Herrschaft zweier Leidenschaften, seine Liebe zu der Mancini und seiner Eifersucht gegen mich, allerlei thörichte Streiche und meinem Sohne traue ich nichts Besseres zu.
Ich freute mich Italien zu verlassen und Frankreich, den Hof, meine Freunde, namentlich Lauzun, wieder zu sehen. An Philipp dachte ich nur mit Angst, an Biaritz mit großer Furcht, denn ich stellte mir ihn wüthend vor. Am Tage meiner Abreise, Früh, übergab mir die Blondeau einen Brief, den sie unter ihrer Adresse erhalten hatte.
»Sie reisen ab, Sie verlassen mich und schenken mir nicht einmal einen Abschiedsblick; Sie sind nicht mehr da, ichkann Sie nicht finden, Sie werden also leben. Freuen Sie sich aber dessen nicht, denn dieses Leben wird schlimmer seyn als der Tod; ich werde mich an allem rächen was Sie lieben, wenn Sie irgend etwas lieben. Sie werden sich an mich erinnern müssen, ich aber werde Sie vergessen, außer in den Augenblicken, wo dies Herz von Rache schlägt, das Sie so grausam mit Füßen getreten haben; ich werde da seyn, wenn Sie es am wenigsten erwarten, aber auch nur, um Ihnen zu fluchen und Ihnen das Böse zu vergelten, das Sie mir thun. Lügnerin! Treu- lose! Verrätherin! Nicht einmal mir die Illusion und das Bedauern zu lassen! Ich begreife gar nicht mehr, wie ich Sie so sehr lieben konnte.«
Diese Drohungen erschreckten mich nicht sehr. Ich hielt Biaritz wie die alte Königin für etwas übergeschnappt. Wir schlugen den direkten Weg diesmal ein, so daß wir nicht über Pignerol kamen und reisten schneller, weil ich nicht mehr schwanger war. Man hielt viele Reden an uns, und man empfing uns überall als souveräne Fürsten, selbst der Herr von Savoyen, den wir begrüßten. Ich hätte wohl vierzehn Tage da zu bleiben gewünscht; aber Herr von Monaco wollte es nicht, denn er brannte vor Verlangen, die Aufträge der beiden Mancinis auszurichten und sich den Dank zu verdienen. Atti fünfzehnten Tage nach unserer Abreise aus Monaco erreichten wir Paris.
In Lyon trafen wir Herrn von Villeroi, der wegen einer Liebesthorheit dahin in das Gouvernement seines Vaters verwiesen war; es war dies seine erste Verbannung. Er war damals einer der elegantesten und schönsten Herren vom Hofes auch hatte man ihn den Chatmantar genannt. Dagegen versicherte Frau von Solanges, die wir bei ihrem Vater in Lyon fanden, er sey noch mehr bezaubert als bezaubernd.
Zweites Kapitel
Mit wahrem Entzücken kam ich in Paris an; ich fand aber Peguilhin, der nun Graf von Lauzun war, minder zärtlich als bei meiner Abreise und Guiche theilte mir bald mit, daß er um Athenaïs von Tournay-Charente schmachte, die jetzt Marquise von Goudrin und Montespan ist. Sie nannte ihn auch ihren Verschmachtenden und er ließ sich den Namen gefallen. Sie stellte sich grausam, aber sie sah es gern, daß man sie verehrte und daß dies bekannt werde, namentlich auch, daß ich für aufgegeben gelte. Sie beehrte mich schon damals mit ihrem Hasse und ich erwiderte ihn mit aller meiner Macht, die darin nicht klein ist.
Die Prinzessin sank mir weinend in die Arme und der Prinz nannte mich sein Glück; auch setzte er hinzu, er habe mich mit Ungeduld erwartet.
»Seit Sie nicht mehr da sind, schöne Fürstin«, sagte er, »verliere ich jedes Spiel.«
Ich weiß nicht woher diese Zärtlichkeit kam; sie erschien mir gar seltsam, denn der Prinz hatte mir nie so viel gesagt, seit wir kälter gegen einander geworden. Ich werde bald von beiden sprechen, Jetzt aber sofort mein Abenteuer mit dem Könige erzählen, damit die Sache zu Ende komme. Man hat in jeder Weise davon gesprochen; ich meines Theils werde den Muth haben Alles zu sagen wie es wirklich war. Es ist nicht schmeichelhaft für meine Eitelkeit, mein Aufgegebenseyn zu gestehen. Indessen ich bin nicht die Einzige, denn gar Viele theilen mit mir dies Schicksal. Ich erlag einer Cabale, vielleicht auch wegen meines Charakters, vielleicht . . . nun man wird ja hören.
Alles dieses geschah im nächsten Jahre, zur Zeit als der König der Valière überdrüssig war und, wenn er könnte, sie zu vergessen suchte, wenn auch gerade nicht um — sich von ihr zu trennen. Er sah sich um, Allen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, und ich muß gestehen, daß Alle seine Gunst suchten, und sich so viel als möglich herausputzten. Ich war nach meiner Niederkunft und seit meiner Wiederkehr von Monaco viel schöner geworden und der König hatte mich mit Auszeichnung empfangen. Er sprach wenig mit mir, sah mich aber um so mehr an. Die Prinzessin, deren Augen Alles beobachteten, trotz ihrem Liebesverhältnis mit meinem Bruder, sagte es mir mit einiger Bitterkeit. Lauzun, der erklärte Günstling, ging mit dem Herrn auf Umwegen in das Zimmer des Hoffräuleins, um die Lamothe-Haudancourt zu sehen, welche ihn gar aufmerksam anhörte. Lauzun dagegen, der vor allem ehrgeizig war, suchte die Frau von Montespan zu fördern, denn er hoffte durch dieselbe den König zu beherrschen und von den Andern zu isolieren. Gedacht war es gut, Gott lenkte es aber anders.
Eines Tages waren wir in Saint-Germain sehr heiter und in guter Gesellschaft. Selbst der Prinz schmollte nicht, ganz gegen seine Gewohnheit. Er hatte seinen lieben Cavalier von Lothringen und die Frau von Granzie, die er sich allmälig zur Geliebten geben ließ, obgleich sie in der That die Geliebte Lothringens war, den wir später noch kennen lernen werden. Die Prinzessin tändelte mit Guiche und Vardes, die Valière war unwohl und blieb in ihrem Zimmer; Frau von Montespan entschleierte sich noch nicht; Frau von Haudancourt, Frau von Soubise und zwei oder drei Andere waren noch da, die nach der Gunst des Königs strebten, aber er kümmerte sich eben nicht um sie.
Lauzun und ich sprachen seit drei Wochen nicht mit einander. Ich war höchst unwillig und aufgebracht, ließ es mir aber nicht merken.
Der König sprach von einer Spazierfahrt im Walde. Er liebte solche Partien, namentlich in Abwesenheit der Königin. Es war eine herrliche, warme klare Mondscheinnacht, wir Alle waren jung, mehr oder minder verliebt und freuten uns also über den Plan. Der König begann damals die kleinen Caleschen zu versuchen, die er später bevorzugte und die für ein beginnendes Verhältnis sehr bequem sind, weil sie nur zwei Personen aufnehmen können. Später fuhr er selbst, damals hatte er einen vertrauten Kutscher, dem er unter den strengsten Strafen verboten hatte, sich umzusehen. Der Kutscher hieß Simon, ich habe ihn nicht vergessen. Er starb endlich in Folge eines Sturzes vom Pferde.
Se. Majestät hatte sich den ganzen Abend mit mir beschäftigt und ich triumphierte. Er glich Philipp zum Verwechseln, ich hütete mich aber davon zu sprechen. Ich hatte Saint-Mars und seine Drohungen nicht vergessen. Als man sich zur Fahrt bereit machte, trat er zu mir und fragte, ohne daß es Jemand hörte:
»Madame, ist Ihnen gefällig, in meinem Wagen zu fahren?«
Ich errötete vor Stolz und Freude, antwortete sehr fest: »ja« und warf dabei Lauzun, der mich beobachtete, einen Blick zu. Der König bot mir die Hand und führte mich nach seiner Gewohnheit mit Galanterie gegen die Damen, der Niemand gleich gekommen ist, und die namentlich ausfallend denen gegenüber war, welche ihm gefielen. Ehe wir einstiegen, sagte er zu Simon halblaut:
»Fahre immer zu auf den Wegen hin, ohne Dich um die Andern zu kümmern und sorge dafür, daß Du Dich verirrst.«
Der Kutscher und die Hofleute kannten das Signal. Wenn er bei dem Einsteigen nicht sagte: »Meine Herren, Sie folgen mir«, so hatten sich Alle fern zu halten.
Ich errieth was geschehen sollte und der erste Eindruck war ein betrübender. Ich liebte Lauzun, ich würde stolz gewesen sein ihm ein solches Opfer zu bringen, war es aber in diesem Augenblicke möglich? Ließ er mich nicht im Stiche und durfte ich aussehen, als wäre ich verlassen worden? Konnte ich den größten König, den galantesten Mann um des Liebhabers der Montespan willen abweisen? Ich würde mich jetzt für erniedrigt gehalten haben.
»Madame«, fragte der König, nachdem wir eine kleine Strecke gefahren waren, »ist es wahr, daß Sie Herrn von Lauzun liebten?«
Die Frage brachte mich in Verlegenheit. Er liebte weder gegenwärtige noch frühere Nebenbuhler. Leugnen konnte ich nicht wohl; ich wußte aber auch nicht was ich antworten sollte und stotterte.
»Ich bin Ihres Vertrauens würdig«, fuhr er fort; »fürchten Sie nichts; ich bin immer sehr verschwiegen gewesen und werde es auch jetzt seyn. Also antworten Sie mir.«
Ich konnte nicht ausweichen.
»Sire, wir sollten einander heirathen, waren verwandt, wuchsen mit einander auf und Sie können sich denken . . . «
»Ja wohl, eine Kinderei, ich verstehehe.«
»Ich sah im Mondscheine, wie sich seine Stirne in Falten zog und es war mir nicht wohl zu Muthe. Er ist immer aus Stolz eifersüchtig gewesen.
»Und jetzt?« fuhr er fort.
»Ach jetzt, Sire, liebe ich ihn nicht mehr.«
Ich sagte dies in der allernatürlichsten Weise und glaubte es auch. Der König lächelte.
»Wissen Sie es gewiß?«
»Ganz gewiß.«
»Sollten Sie zufällig Herrn von Monaco lieben?«
Dieses zufällig gefiel mir sehr und nun lächelte ich.
»Er steht mit der Mazarin gut?«
Mein Mann war damals mit ihr in Italien, von wo er sie nach England begleitete, bis sie ihn fortschickte wie einen Lakeien, um St. Evremont zu befriedigen, ihren ehemaligen Liebhaber, und ein halbes Dutzend junger Männer.
»Da sie weder Lauzun noch Monaco lieben, wen lieben Sie, Madame?« fuhr er fort. »Jemanden müssen Sie doch lieben.«
Ich konnte nicht so direkt antworten, als ich gefragt worden worden war, schlug also die Augen nieder. Er ergriff meine Hand und küßte sie. Der König war gegen Damen, wie gesagt, äußerst achtungsvoll und demüthig. Er behandelte sie mit der größten Rücksicht bis . . . Doch dies soll das letzte Kapitel meiner Denkwürdigkeiten sein; ich habe versprochen, die Wahrheit über ihn zu sagen und werde es halten.
»Wollen Sie mir nicht sagen, wen Sie lieben? Was würden Sie antworten, wenn man Ihnen sagte, daß man Sie liebte?«
»Es käme darauf an, wem ich zu antworten hätte.«
»Würden Sie der Wahrheit gemäß antworten?«
»Allerdings, Sire.«
»Und wie?«
»Ew. Majestät hatte mich noch nicht mit einer Antwort beehrt.«
»Sie weichen meiner Frage aus.«
»Ich weiche ihr nicht aus, ich erwarte sie.«
»Bin ich gewöhnlich der Vertraute Anderer? Es kann nur von mir die Rede seyn.
»Ew. Majestät erzeigen mir große Ehre, aber . . . «
»Aber meine Werbung gefällt Ihnen nicht?«
»Das sage ich nicht.«
»Was sagen Sie denn?«
»Ich wage nicht zu sagen was ich denke und wage auch nicht zu denken, was ich sagen möchte.«
»Ah!«
Ich muß gestehen, daß der König reizend war.
Drittes Kapitel
Wir fuhren lange so. Der König war zärtlich, eifrig, verschwenderisch, und wenn auch nicht so leidenschaftlich wie Biaritz, so zeigte er doch ein so lebhaftes Gefühl, daß ich berauscht wurde, ich gestehe es. Zum ersten Mal in meinem Leben vergaß ich Lauzun ganz und gar; in den himmlischen Augenblicken, die alle meine Leidenschaften befriedigten, fiel mir es gar nicht ein, daß er in der Welt sey. Außer mir vor Freude kam ich nach Hause; ich sah bereits die Welt zu meinen Füßen, mich als die Gebieterin des Hofes und ganz Frankreichs und träumte den glänzendsten Ruhm für den König und mich . . . Er liebte mich! Er hatte es mir geschworen, hatte mir versprochen, die Valière zu verlassen und mir die erste Stelle einzuräumen; er hatte mir versprochen, ich soll von nun an sein einziger Gedanke, seine einzige Liebe sein.
Meiner Familie war ich sicher; mein Vater hatte mich in der Wohnung der schönen Corisandra, einer der »Freundinnen« Heinrichs IV., meiner Vorfahrin, erzogen. Mein Bruder konnte mit der Prinzessin philosophieren und meinen Mann würde die Mazarin, die ihn über Alles tröstete, auch über eine kleine Verweisung in seine Staaten trösten. Alles stand also vortrefflich. Am nächsten Tage sollte die Valière gestürzt und ich erklärt werden; ich konnte die Nacht nicht schlafen.
Früh am Morgen begann ich meine Toilette und wohl nie war ich schöner. Ich legte meine prachtvollen Perlen an, die mir vortrefflich standen. Ich besaß für sechzigtausend Thaler. Ich zog einen Rock und ein Leibchen von blaßgelben und himmelblauem Brokat mit Chenillenstickerei an, welche später so außerordentlich gefiel und die ich zuerst trug. Die Blondeau hatte einen Sticker ausfindig gemacht, der durch mich wohlhabend wurde und allerdings sehr schöne Sachen erfand. Es war Pfingstmontag und der Tag der Procession der Heiligen-Geist-Ritter, wobei der König so schön aussah. Die Damen verdoppelten ihren Putz, sonst würden sie von den Herren in den Schatten gestellt worden seyn.
Als ich erschien, entstand ein Gemurmel. Einige lobten, Andere tadelten mich, Alle waren gespannt aus das, was geschehen werde. Meine Spazierfahrt am vorigen Tage mit dem Könige war bekannt. Alle sprachen davon je nach ihren Hoffnungen oder Befürchtungen. Die Valière war sehr blaß, aber allerdings auch sehr schön; die Prinzessin biß sich auf die Lippen, Frau von Montespan lachte gezwungen und Lauzun endlich stellte sich gleichgültig, aber seine Augen funkelten vor Zorn.
Ich verbeugte mich vor der Königin, die nichts ahnte. Die Königin Mutter war damals todt; sie würde sofort Alles errathen haben. Ich begrüßte die Prinzessin und ging zu ihr, wie es mein Amt verschrieb. Anfangs sprach sie nicht mit mir, dann musterte sie mich von oben bis unten und warf mir laut das Kompliment zu:
»Sie sind sehr schön, Madame, und sehen aus wie eine Braut oder Neuverheirathete.«
Ich wollte antworten, aber der König trat ein und ich dachte nun nur an ihn. Alle Prinzen und Hofleute folgten ihm. Mein Vater blinzelte mir von weitem zu, woraus ich erkannte, daß er Alles wußte. Der König war wie gewöhnlich, er zeichnete mich nicht aus und das überraschte mich.
Man begab sich in die Capelle und ich folgte der Prinzessin, trostlos über meine zerfallenen Hoffnungen. Ein Blick der Montespan brachte mich wieder zu mir selber; sie triumphierte über meine Niedergeschlagenheit. Da richtete ich den Kopf stolz empor; ich wollte schön seyn und ich war es; ich hatte das Vergnügen, es oft um mich her zu hören. Die Zeremonie ging vor sich, man kehrte in die Gemächer zurück und Jeder ging wohin es ihm beliebte. Der König hatte sich in seine Zimmer begeben.
Ich hatte viel Komplimente über meine beginnende Gunst empfangen und diese meine Nichtbeachtung durch den König überraschte den Hof fast noch mehr, als mich selbst. Ich ging vergnügt plaudernd umher, obwohl ich den Tod im Herzen trug, als Herr von Marcillac zu mir trat und mich leise aufforderte ihm zu folgen. Er war der wohlbekannte Vertraute der Liebesverhältnisse Sr. Majestät, der Nebenbuhler Lauzun’s, der einzige Günstling Ludwigs XIV., welcher bis jetzt nur flüchtig von Ungnade berührt worden ist. Er scheint sich auch noch lange zu erhalten, denn er ist ein mittelmäßiger Mensch.
Alle Gesichter wechselten die Farbe, nur das meinige nicht, denn ich verstand es mich zu beherrschen. Ich blieb noch einige Augenblicke, theils um mich an der allgemeinen Verlegenheit zu weiden, theils um nicht zu schnell abzubrechen. Dann entschuldigte ich mich und ging nach meinem Zimmer, um dann einen andern Weg zu nehmen. Herr von Marcillac ging voraus. Er kannte die geheimen Gänge im Schlosse so gut wie Bontems, zu dem wir uns begaben. Der Kammerdiener des Königs wartete auf mich und verbeugte sich sehr tief vor mir. Herr von Marcillac blieb, aber keiner von Beiden sprach ein Wort. Ich fragte was das bedeute.
»Se. Majestät wünschen Sie zu sehen, Madame.«
»Wohin habe ich da zu gehen?«
»Bontems wird Sie geleiten; er kennt das Wort, nach dem geöffnet wird.«
»Ich verstehe Sie nicht.«
»Der König wird Ihnen das Weitere sagen.«
»Warum riefen Sie mich denn, Herr Herzog?«
»Auf Befehl des Königs, Madame.«
Das Alles glich den Versprechungen vom vorigen Tage gar nicht. Gern hätte ich meinem Herzen Luft gemacht, aber ich hielt an mich und nahm mir vor das Ende abzuwarten.
»Nun, Herr Bontems, geleiten Sie mich, da ich Ihnen zu folgen habe«, sagte ich.
Er ließ es sich nicht wiederholen und führte mich durch ein Labyrinth von dunkeln, übelriechenden Gängen, für die sich ein Anzug wie der meinige gar nicht eignete, an eine kleine Thür in einem dunkeln Korridor und einem Theile des Schlosses, den ich noch nie betreten hatte und der nur für die Dienerschaft bestimmt war. Ich erstickte fast vor Zorn und war zehnmal daran nicht weiter zu folgen. An jener Thür blieb Bontems stehen, öffnete sie mit einem kleinen Schlüssel, den er bei sich hatte, verbeugte sich dann noch einmal, winkte mir einzutreten und sagte leise:
»Der König ist hier.«
Ich trat ein und sah ihn in der That in einem sehr reichen, aber auch dunkeln Kabinett sitzen, das sein Licht von oben erhielt durch Gitter und Glas. Er kam auf mich zu und reichte mir die Hand. Ich gab ihm die meinige nicht, sondern begnügte mich mit einer zeremoniösen Verbeugung.
»Ah, Madame, Sie sind schöner als alle Schönen und ich freue mich sehr, Sie wieder zu sehen.«
Ich verbeugte mich nochmals.
»Wie? Finde ich Sie so wieder? So ganz anders als gestern! Sind Sie schon verändert? Haben Sie vergessen . . . «
»Ich habe nichts vergessen, Sire, ja ich allein scheine ein gutes Gedächtnis zu haben.«
Der König errötete und versuchte zu lächeln.
»Ah, ja gestern! Sie haben Eile, Madame, und ich sehe, daß man mich nicht getäuscht hat, und daß in Ihnen der Ehrgeiz größer ist als die Liebe.«
Eine solche Erklärung mir in das Gesicht und in ganz anderer Weise als ich sie am vorigen Tage erwartet hatte, brachte mich in große Verlegenheit. Meine Feinde mußten sehr rührig seyn, da sie schon Mittel gefunden hatten, in einigen Stunden Alles zu ändern. Ich wußte damals nicht, daß die Valière Abends den königlichen Liebhaber besuchte, und daß sie lange nach mir beisammen blieben. Ihre Thränen, ihre Verzweiflung, ihre Bitten, seine noch nicht erloschene Glut für sie, die Furcht vor einem Skandal und vor Allem die Gewohnheit hatten zusammen gewirkt gegen mich. Der König, ich muß es sagen, wünschte meinen Besitz, aber er liebte mich nicht. Seine Jugend, seine Leidenschaft zogen ihn zu mir; sein Herz, sein Verstand hielten ihn zurück. Meine Familie war zu mächtig, — eine Favorite aus dem Hause Gramont, ein Favorite von meinem Charakter wäre eine Macht gewesen. Das fühlte er; er ahnte besonders auch den Widerstand, den er finden werde, und diesen fürchtete und haßte er über Alles.
Frau von Montespan mußte eine Willensausdauer, die ich nicht besaß, aufbieten, nur dahin zu gelangen, wo sie sich noch befindet, wenn auch fast nur noch im Bilde. Die Montemarts sind wohl so vornehm wie wir, aber sie haben nie den Intriguengeist und die Kühnheit wie mein Vater und mein Oheim. Der dicke Vivonne hat sich durch den Einfluß seiner schönen Schwester zum Marschall von Frankreich und Gouverneur der Champagne machen lassen, aber nie über Jemanden zu befehlen gesucht, nie einen Rath ertheilt und an nichts gedacht, als wie er sich vergnüge und der Frau von Luders den Hof mache. Mein Vater hätte sicherlich an ganz andere Dinge gedacht.
Ich sah mich von einer schwindelnden Höhe herabgestürzt. Ich bin stolz, wie man weiß, ich dulde keinen Zwang, nicht den Schatten von Geringachtung und machte eine Bewegung, um nach der Thür hin zu gehen.
»Wohin?« fragte der König sehr erstaunt.
»Mein Platz ist nicht hier, da Ew. Majestät mich verkennen. Geruhen Sie zu gestatten, daß ich mich entferne.«
»Im Gegentheil, Fürstin; kommen Sie, setzen Sie sich und lassen Sie uns plaudern.«
Das war ein Befehl und ich gehorchte.
Viertes Kapitel
Der König verstand nicht zu scherzen und konnte sich auch nicht verstellen im Scherz. Er wollte sehr klug seyn, ich durchschaute ihn aber auf der Stelle und war auf meiner Hut.
»Sie halten mich für recht schuldig, nicht wahr?« fragte er und dann fuhr er fort: »Ich hätte nach dem Ordensfeste die Frau von Monaco an der Hand nehmen und, wie es unter Philipp August geschehen, für die Königin der Schönheit und der Liebe erklären sollte; das verlangten Sie, nicht wahr?«
»Sie spotten, Sire, aber damit entschuldigen Sie sich nicht und erwerben sich noch weniger Verzeihung, wenn Sie mir dies Wort gestatten wollen.«
»Ich entschuldige mich nicht, weil ich keine Schuld trage, Madame. Ich habe Zartgefühl, vielleicht übertrieben, in der Liebe; aber ich würde Alles gethan haben, was ich gestern versprochen, wenn mich nicht ein Wort, ein einziges Wort davon abgehalten hätte.«
»Darf ich fragen welches?«
»Ich habe Ihnen bereits gesagt, Madame, ich fürchte, nicht geliebt zu werden, wenigstens nicht so sehr und in der Art wie ich es wünsche.«
»Ich verstehe Sie nicht, Sire.«
»Mit einem Worte, ich fürchte in Ihnen mehr die ehrgeizige Frau als die hingebende Geliebte zu finden. Ich irre mich vielleicht und Sie mögen mich von meinem Irrthume befreien.«
»Wie?«
»Begnügen Sie sich mit meinem Herzen, lassen Sie sich das Geheimnis gefallen; verlangen Sie nicht mehr; bleiben Sie im Stillen meine Geliebte, bringen Sie mir an diesen unbekannten Ort das Glück, das ich von Ihnen erwarte, und lassen Sie uns vor den Augen der Welt einander fremd seyn. Wenn Sie darauf eingehen, erkenne ich, daß Sie verleumdet wurden, und glaube an Sie wie an mich selbst.«
Damit war die Sache auf einen gefährlichen Boden gebracht; es blieb mir keine Wahl und ich antwortete deshalb fest:
»Ich gehe darauf ein, Sire.«
»Wie? Auf das Geheimnis, auf seltenes, Niemanden bekanntes Beisammenseyn, auf die Verleugnung Ihrer Neigungen und das Opfer alles dessen, was Ihnen gefällt?«
»Ja, Sire.«
»So lieben Sie mich wirklich?«
Ich liebte ihn in der That, oder ich machte mich selbst vielmehr blind darüber und so wurde es mir auch nicht schwer ihn selbst zu blenden. Ich sprach mit solcher Beredsamkeit, daß er nichts entgegnen konnte, und nach einer halben Stunde war er so zärtlich, so vertrauensvoll wie am vorigen Tage, ja er kam aus die früheren Anträge und Versprechungen zurück und drang in mich, sie anzunehmen. Ich konnte mich selbst mehr beherrschen als er, und schlug es aus.