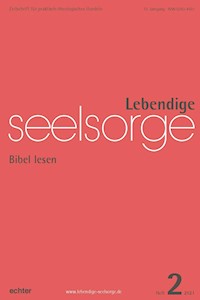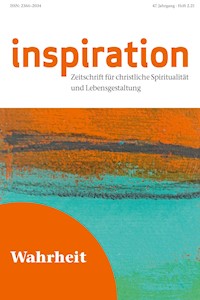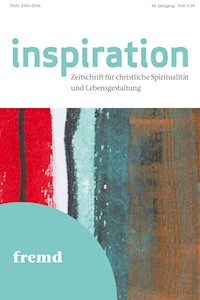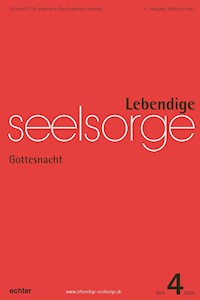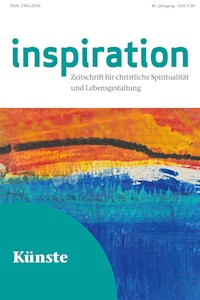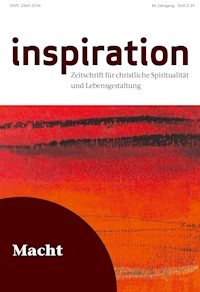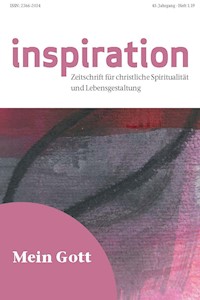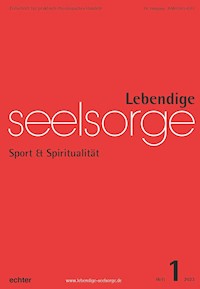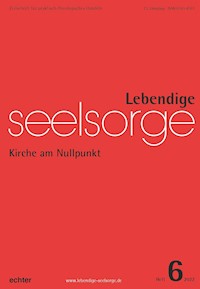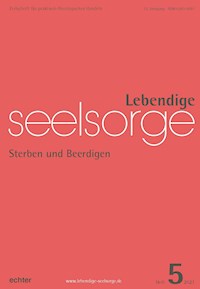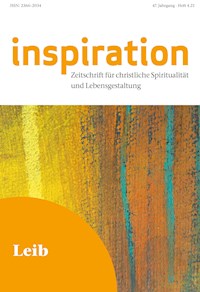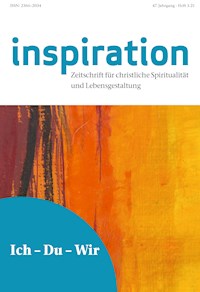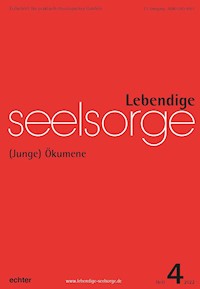
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Lebendige Seelsorge
- Sprache: Deutsch
Es ist alle acht Jahre ein besonderes Ereignis: Im Herbst 2022 findet die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) statt, zum ersten Mal in seiner Geschichte in Deutschland. Beinahe 5.000 Menschen aus 350 Mitgliedskirchen reisen nach Karlsruhe – ein weithin sichtbares Zeichen der globalen ökumenischen Bewegung. Korrespondierend möchte auch die Lebendige Seelsorge das Thema Ökumene aufgreifen. Wir haben gezielt junge Christ*innen und Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Konfessionen gefragt, ob Ökumene überhaupt noch ein Thema in ihrem Leben ist, und wenn ja, wie sie Ökumene leben, reflektieren, diskutieren und erforschen. Für alle, die in diesem Heft schreiben, ist Ökumene ein Thema, verbunden mit eigenen Positionierungen, Ärgernissen und Hoffnungen. Gleichzeitig war und ist Ökumene – im Hinblick auf den Ukrainekrieg besonders virulent – ein Thema politischer Verwerfungen. Auch diese Spannungen prägen das Heft. Christine Schliesser und Verena Hammes geben aus protestantischer und katholischer Sicht theologische Einführungen in die Herausforderungen einer zeitgemäßen Ökumene. Andrea Riedl nimmt die Rolle von Ökumene und Orthodoxie im Ukrainekrieg in den Blick. Ein Beispiel konkret gelebter Ökumene ist die Arche-Gemeinde in Neckargemünd, vorgestellt von Tobias Bartole. Die Präses der Synode der EKD, Anna-Nicole Heinrich, diskutiert im Interview ökumenische Anstrengungen und konfessionelle Profilierungen. Junge Menschen können (und sollen) Ökumene im Religionsunterricht erfahren, im Blick auf die Orthodoxie erläutert von Yauheniya Danilovich. Das Heft gibt jungen Stimmen Raum, um ganz bewusst in der Ich-Perspektive ausgewählte ökumenische Orte und Initiativen zu reflektieren: Fionula Herbst, Blanca Zacher, Matilda Franz und Elisabeth Schilli (Quickborn-Arbeitskreis), Finja Miriam Weber (Friedenslicht aus Betlehem), Kathinka Hertlein (Ökumenischer Kreuzweg der Jugend), für das Bonifatiuswerk Sabine Joy Ihben-Bahl, Anna-Maria Klassen, Marie-Gabrielle Ortenburg, Ricardo Wickert und Simon Hartung (Work-Life-Spirit). Das Heft zeigt: Ökumene ist individuell religiös identitätsprägend und bleibt ein entscheidendes Thema auf gesellschaftlicher und globaler Ebene, inmitten von vielfachen Krisen und Gefährdungen. Die Vollversammlung des ÖRK richtet einen Aufruf an die Kirchen, miteinander, mit Menschen anderen Glaubens und mit allen Menschen guten Willens unermüdlich für gerechten Frieden und Versöhnung zu arbeiten. Mit Dorothea Sattler hoffen auch wir, dass "alle Konfessionen, gerade im Blick auf die jüngeren Generationen, mit Sehnsucht auf der Suche bleiben nach sichtbarer Einheit".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
THEMA
Zusammen ist man weniger allein
Fünf Thesen für eine junge Öffentliche ÖkumeneVon Christine Schliesser
Herausforderungen für die multilaterale Ökumene heute
Von Verena Hammes
Nicht Sahnehäubchen auf dem Theologiekuchen, sondern Brot und Butter
Die Replik von Christine Schliesser aufVerena Hammes
Neue Perspektiven
Die Replik von Verena Hammes aufChristine Schliesser
Die Orthodoxie – Die Ökumene
Schlagworte in der KriseVon Andrea Riedl
PROJEKT
Alles gemeinsam tun, was gemeinsam möglich ist – ohne Angst
Von Tobias Bartole
INTERVIEW
„Ehrlichkeit im Umgang ist Hindernis und wichtigste Herausforderung zugleich.“
Ein Gespräch mit Anna-Nicole Heinrich
PRAXIS
Welche Rolle spielt Ökumene (noch) im Leben junger Christ*innen?
Vier junge Christinnen reflektieren ihre Erfahrungen mit Ökumene
Von Fionula Herbst, Blanca Zacher, Matilda Franz und Elisabeth Schilli
Die Reise des Friedenslichts aus Betlehem
Von Finja Miriam Weber
Die Bedeutung der Ökumene in der Arbeit des Ökumenischen Kreuzwegs der Jugend
Von Kathinka Hertlein
Wo beginnt die Ökumene im Religionsunterricht?
Einige Beobachtungen aus orthodoxer PerspektiveVon Yauheniya Danilovich
SEELSORGE UND DIASPORA: BONIFATIUSWERK
Der Geist weht: im Berufsalltag, nach Feierabend – im Leben
Work-Life-Spirit als ökumenisches Projekt für junge Berufstätige
Von Sabine Joy Ihben-Bahl, Anna-Maria Klassen, Marie-Gabrielle Ortenburg, Ricardo Wickert und Simon Hartung
FORUM
Wenn sich der Wind dreht, müssen wir die Segel neu setzen
Plädoyer für einen theologischen Paradigmenwechsel
Von Julia Enxing
POPKULTURBEUTEL
Kürzeste Definition von Religion: Alles wird gut.
Von Matthias Sellmann
NACHLESE
Re:Lecture
Von Barbara Janz-Spaeth
Buchbesprechungen
Impressum
Die Lebendige Seelsorge ist eine Kooperation zwischen Echter Verlag und Bonifatiuswerk.
EDITORIAL
Ute Leimgruber Herausgeberin
Es ist alle acht Jahre ein besonderes Ereignis: Im Herbst 2022 findet die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) statt, zum ersten Mal in seiner Geschichte in Deutschland. Beinahe 5.000 Menschen aus 350 Mitgliedskirchen reisen nach Karlsruhe – ein weithin sichtbares Zeichen der globalen ökumenischen Bewegung. Korrespondierend möchte auch die Lebendige Seelsorge das Thema Ökumene aufgreifen. Wir haben gezielt junge Christ*innen und Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Konfessionen gefragt, ob Ökumene überhaupt noch ein Thema in ihrem Leben ist, und wenn ja, wie sie Ökumene leben, reflektieren, diskutieren und erforschen. Für alle, die in diesem Heft schreiben, ist Ökumene ein Thema, verbunden mit eigenen Positionierungen, Ärgernissen und Hoffnungen. Gleichzeitig war und ist Ökumene – im Hinblick auf den Ukrainekrieg besonders virulent – ein Thema politischer Verwerfungen. Auch diese Spannungen prägen das Heft.
Christine Schliesser und Verena Hammes geben aus protestantischer und katholischer Sicht theologische Einführungen in die Herausforderungen einer zeitgemäßen Ökumene. Andrea Riedl nimmt die Rolle von Ökumene und Orthodoxie im Ukrainekrieg in den Blick. Ein Beispiel konkret gelebter Ökumene ist die Arche-Gemeinde in Neckargemünd, vorgestellt von Tobias Bartole. Die Präses der Synode der EKD, Anna-Nicole Heinrich, diskutiert im Interview ökumenische Anstrengungen und konfessionelle Profilierungen. Junge Menschen können (und sollen) Ökumene im Religionsunterricht erfahren, im Blick auf die Orthodoxie erläutert von Yauheniya Danilovich. Das Heft gibt jungen Stimmen Raum, um ganz bewusst in der Ich-Perspektive ausgewählte ökumenische Orte und Initiativen zu reflektieren: Fionula Herbst, Blanca Zacher, Matilda Franz und Elisabeth Schilli (Quickborn-Arbeitskreis), Finja Miriam Weber (Friedenslicht aus Betlehem), Kathinka Hertlein (Ökumenischer Kreuzweg der Jugend), für das Bonifatiuswerk Sabine Joy Ihben-Bahl, Anna-Maria Klassen, Marie-Gabrielle Ortenburg, Ricardo Wickert und Simon Hartung (Work-Life-Spirit).
Das Heft zeigt: Ökumene ist individuell religiös identitätsprägend und bleibt ein entscheidendes Thema auf gesellschaftlicher und globaler Ebene, inmitten von vielfachen Krisen und Gefährdungen. Die Vollversammlung des ÖRK richtet einen Aufruf an die Kirchen, miteinander, mit Menschen anderen Glaubens und mit allen Menschen guten Willens unermüdlich für gerechten Frieden und Versöhnung zu arbeiten. Mit Dorothea Sattler hoffen auch wir, dass „alle Konfessionen, gerade im Blick auf die jüngeren Generationen, mit Sehnsucht auf der Suche bleiben nach sichtbarer Einheit“.
Eine interessante und bewegende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre
Prof.in Dr. Ute Leimgruber
THEMA
Zusammen ist man weniger allein
Fünf Thesen für eine junge Öffentliche Ökumene
„Ich denke, dass der Wandel, den wir um uns herum erleben, eines Tages auf der gleichen Ebene gesehen werden wird wie das, was mit der Kirche nach der konstantinischen Wende oder nach der Erfindung des Buchdrucks geschah. Wie auch immer der Wandel aussehen wird, wenn er vollzogen ist – er wird als eine seismische Verschiebung gegenüber dem, was wir bisher kannten, registriert werden“ (Nieuwhof; Übersetzung C.S.), so der kanadische Theologe Carey Nieuwhof angesichts der immensen Herausforderungen auf nahezu allen Ebenen kirchlichen Lebens. Wie gelingt eine junge Ökumene vor dem Hintergrund dieser gewaltigen Transformationsprozesse? Christine Schliesser
Wir kennen sie alle, die Zahlen und die Statistiken, die offenbar keine andere Richtung kennen als nach unten. Die Mitgliederzahlen der großen, etablierten Kirchen im deutschsprachigen Bereich wie auch in anderen westlichen Industrienationen sind im freien Fall, ohne dass die Talsohle bereits in Sicht ist (global gesehen sind diese Entwicklungen in Westeuropa bzw. Nordamerika freilich die Ausnahme, vgl. Pew Research Center). 50 Prozent der sogenannten Millennials, also derer, die zwischen 1984 und 2002 geboren wurden, sind post-christlich. Für den eingangs zitierten Theologen Carey Nieuwhof gleichen die Umwälzungen, in denen wir uns aktuell befinden, einem Erdbeben – bzw. präziser: einem Kirchenbeben. Ohne in den Chor derer, die den Abgesang auf die Kirche bereits angestimmt haben, einstimmen zu wollen, werden hier drei Aspekte deutlich, die auch die junge Ökumene und eine ökumenische Theologie massiv betreffen: Erstens befinden sich unsere pluralistischen, säkularen Gesellschaften inmitten gewaltiger Transformationsprozesse, die die kirchliche Landschaft nachhaltig verändern werden. Zweitens gehen diese Transformationsprozesse über den nationalen und auch über den deutschsprachigen Raum hinaus. Und drittens betreffen sie alle etablierten Kirchen, unabhängig von ihrer partikularen Konfession. In fast allen Bereichen des kirchlichen Lebens stehen die Kirchen – sei es die römisch-katholische Kirche in Deutschland, die evangelisch-reformierte Kirche in der Schweiz oder die anglikanische Kirche in England – vor ähnlichen Herausforderungen. Vor dem Hintergrund dieses Dreiklangs – gesellschaftliche und kirchliche Transformationsprozesse, Internationalität und Überkonfessionalität – können fünf Thesen für eine junge Ökumene entfaltet werden. Als Leitperspektive bietet sich hierfür das internationale und überkonfessionelle Paradigma der Öffentlichen Theologie an.
Christine Schliesser
Dr. theol., Privatdozentin für Systematische Theologie an der Universität Zürich; Studienleiterin am ökumenischen Zentrum Glaube & Gesellschaft an der Universität Fribourg; Research Fellow in Studies in Historical Trauma and Transformation an der Universität Stellenbosch; mit Ayse S. Kadayifci-Orellana und Pauline Kollontai Mitherausgeberin der interreligiösen und interdisziplinären Buchreihe Religion Matters. On the Significance of Religion in Global Issues (Routledge).
WAS IST ÖFFENTLICHE THEOLOGIE UND WARUM IST SIE FÜR DIE JUNGE ÖFFENTLICHE ÖKUMENE WICHTIG?
Theologie im Modus Öffentlicher Theologie zu betreiben, heißt, sowohl an der Relevanz der Theologie für die verschiedenen Öffentlichkeiten als auch an der Relevanz öffentlicher Herausforderungen für die Theologie festzuhalten (vgl. auch Vögele, 421f.). Darüber hinaus lassen sich folgende Merkmale Öffentlicher Theologie anführen (vgl. Bedford-Strohm, 53): Sie ist engagiert in Fragen öffentlicher Relevanz; zweisprachig, d.h. sie spricht bleibend parallel ihre eigene Glaubenssprache und eine säkular verständliche Sprache; interdisziplinär; glocal, d.h. sie verbindet ihren partikularen Kontext mit einer globalen Perspektive; und sie nimmt öffentliche Fragestellungen mit hinein in die theologische Reflexion. Das Markenzeichen Öffentlicher Theologie ist jedoch, zumindest in der christlichen Ausprägung, ihre Christozentrik (vgl. Schliesser, 355–371).
Akteurinnen und Akteure Öffentlicher Theologie sind nicht nur die akademische Theologie und die institutionalisierten Kirchen, sondern auch jede einzelne Christin und jeder einzelne Christ. Während Öffentliche Theologie in Deutschland zur Zeit eher evangelisch konnotiert ist – nicht zuletzt durch prominente evangelische Theologen wie Wolfgang Huber, Heinrich Bedford-Strohm oder Torsten Meireis (vgl. Höhne) –, präsentiert sie sich auf internationaler Ebene als durch und durch überkonfessionell (vgl. Gruchy 2004, 45–62). Mit ihrer globalen Orientierung, ihrer je partikularen Gestalt, ihrem Engagement in öffentlichen Fragestellungen sowie ihrer konfessionsverbindenden Ausrichtung bietet die Öffentliche Theologie ein produktives Paradigma für die junge Ökumene und eine ökumenische Theologie.
Keine der bestehenden Differenzen zwischen den christlichen Konfessionen vermag den gemeinsamen Herzschlag der Christozentrik zu übertönen.
THESE 1: EIN HERZSCHLAG. CHRISTOZENTRIK VERBINDET DIE JUNGE ÖFFENTLICHE ÖKUMENE
Keine der bestehenden Differenzen zwischen den christlichen Konfessionen vermag den gemeinsamen Herzschlag der Christozentrik zu übertönen. Für die Entfaltung dieser These eignet sich die traditionelle dogmatische Denkfigur des munus triplex besonders gut, also der Lehre von den drei Ämtern Christi als König, Prophet und Priester – nicht zuletzt, weil sie in nahezu allen Konfessionen beheimatet ist und damit ein einzigartiges ökumenisches Phänomen darstellt (vgl. Schlink, 414). Mit dem reformierten Theologen Michael Welker lassen sich die drei Ämter Christi dem irdischen Leben Jesus, dem Kreuzesgeschehen und der Auferstehung zuordnen (vgl. Welker, 281–290). Indem das Königtum Christi mit Jesu irdischen Leben verknüpft wird, zeigt sich ein König, der sich in Liebe und Erbarmen den Armen und Ausgestoßenen widmet. Im Kreuzesgeschehen hingegen kommt besonders die prophetische Dimension in den Blick. Hier werden menschliches Versagen, Schuld und Sünde ernst genommen und zugleich konstruktive Wege zu ihrer Überwindung durch Vergebung und Versöhnung aufgezeigt. Auch verbindet sich mit der Tradition der alttestamentlichen Propheten der Aufschrei gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Die Auferstehung aus der Perspektive des Priestertums Christi verweist nicht nur auf die besondere Bedeutung der Kirche als Zeugin Christi, sondern spannt zugleich eine radikale Hoffnungsperspektive auf, die das Hier und Heute transzendiert. Liebe für die Ausgestoßenen, Aufschrei gegen Ungerechtigkeit, Zeugin der Hoffnungsperspektive Christi – welch großartige Verheißung und Herausforderung für die junge Öffentliche Ökumene!
THESE 2: EINE WIRKLICHKEIT. DIE JUNGE ÖFFENTLICHE ÖKUMENE STEHT GEGEN DEN DUALISMUS VON RELIGIÖSPRIVAT VS. SÄKULAR-ÖFFENTLICH
Die letzten Jahrzehnte, eigentlich sogar das gesamte letzte Jahrhundert, standen unter dem Einfluss der Diagnose von Max Weber, der eine „Entzauberung der Welt“ postulierte. Damit verband sich u. a. die sogenannte Säkularisierungsthese und der Gedanke, dass die Säkularisierung in den funktional ausdifferenzierten Gesellschaften immer weiter voranschreitet und der Einfluss der Religion stetig abnimmt. Im Zuge der Aufklärung war Religion zudem überwiegend in die Sphäre des Privaten relegiert worden. In der Philosophie des politischen Liberalismus verband sich dann vor allem der Name John Rawls mit der Idee einer „öffentlichen Vernunft“, in der religiöse Argumente keinen Platz haben, sondern lediglich „freistehende Argumente“ zugelassen sind (Rawls, 349f.). Diese Schlaglichter verdeutlichen den geistig-kulturellen Hintergrund, der Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft vieler westlicher Industrienationen bis heute prägt. Öffentliche Theologie stellt sich diesem Dualismus zwischen religiösprivat und säkular-öffentlich entgegen. Christinnen und Christen bezeugen gemeinsam, dass die gesamte Realität von Christus umfasst ist. Dietrich Bonhoeffer, ein Öffentlicher Theologe avant la lettre, fasst dies wie folgt: „Wie in Christus die Gotteswirklichkeit in die Weltwirklichkeit einging, so gibt es das Christliche nicht anders als im Weltlichen“ (Bonhoeffer, 44). Dies ist der Rahmen, in dem die junge Öffentliche Ökumene denkt und handelt.
THESE 3: EIN AUFTRAG. ALS „CULTURAL WITNESS“ FÖRDERT DIE JUNGE ÖFFENTLICHE ÖKUMENE RELIGIÖSE SPRACHFÄHIGKEIT UND MEHRSPRACHIGKEIT
„Der christliche Glaube beinhaltet eine bemerkenswerte Geschichte, die die Kulturen über Jahrhunderte hinweg auf tiefgreifende Weise geprägt hat. Doch wir müssen bessere Wege finden, diesen Glauben zu vermitteln, damit andere ihn heute verstehen und glauben können“ (Tomlin; Übersetzung C. S.), so Graham Tomlin, Direktor des 2022 gegründeten Centre for Cultural Witness. Verankert in der anglikanischen Kirche, ist dieses Zentrum ökumenisch und international ausgerichtet, um „Cultural Witness“, also Zeugin in den Kulturen unserer pluralistischen Gesellschaften zu sein. Leitfrage ist dabei, wie die Kommunikation des Evangeliums auf verständliche und attraktive Weise geschehen kann und welche Kompetenzen dafür benötigt werden. Dabei wird der allgemeine Rückgang religiöser Sprachfähigkeit inzwischen auch in Politik und Zivilgesellschaft als Verlust wahrgenommen, so dass z. B. der irische Diplomat Philip McDonagh im Blick auf den OSZE-Kontext die „Förderung von religiöser Sprachfähigkeit im öffentlichen Dienst, in der Wirtschaft, in den Medien und im Hochschulwesen“ (McDonagh, 26; Übersetzung C. S.) fordert. Bevor jedoch religiöse Sprachfähigkeit in die verschiedenen Öffentlichkeiten hinein vermittelt werden kann, muss diese Kompetenz zunächst einmal selbst erworben werden. Dies geschieht zunächst nach innen und dann nach außen. So gilt es auch für die junge Ökumene zuvorderst, sich die Grundlagen des christlichen Glaubens selbst (neu) zu vergegenwärtigen. Für eine spezifisch ökumenische Theologie beinhalten neutestamentliche Bezugspunkte nicht zuletzt das Hohepriesterliche Gebet Jesu sowie die zahlreichen Ermahnungen zur Einigkeit. Für die Kommunikation des christlichen Glaubens nach außen wird Zweisprachigkeit – oder präziser noch: Mehrsprachigkeit – benötigt. Das heißt, dass Christinnen und Christen in der Lage sind, sowohl in der eigenen Glaubenssprache als auch in säkular anschlussfähigen Sprachspielen zu kommunizieren, ohne dass das spezifisch christliche Profil unsichtbar wird. Um der jungen Öffentlichen Ökumene diesen Kompetenzerwerb zu erleichtern, sind hier in besonderer Weise die christlichen Bildungsstätten in Universität und Kirche gefordert.
Bevor jedoch religiöse Sprachfähigkeit in die verschiedenen Öffentlichkeiten hinein vermittelt werden kann, muss diese Kompetenz zunächst einmal selbst erworben werden.
THESE 4: EINE WURZEL. DIE JUNGE ÖFFENTLICHE ÖKUMENE IST IN IHRER VIELFÄLTIG GELEBTEN SPIRITUALITÄT VERBUNDEN
Die international bekannte Gemeinschaft von Taizé zeigt beispielhaft, wie eine junge Ökumene in gemeinsam erlebter Spiritualität die Quellen des Glaubens feiert – vor Ort in Taizé und darüber hinaus. Auf die Bedeutung von Spiritualität und gelebter Gotteserfahrung im Kontext einer globalen, ökumenischen Öffentlichen Theologie verweist auch John de Gruchy: „Eine gute öffentliche theologische Praxis erfordert eine Spiritualität, die eine gelebte Erfahrung mit Gott, mit den Menschen und mit der Schöpfung ermöglicht” (Gruchy 2007, 40; Übersetzung C.S.). Junge Öffentliche Ökumene ist einander mit Kopf, Hand und Herz verbunden. Das bedeutet: Neben den ökumenischen Dialog und das gemeinsame theologische Ringen und neben die ökumenische Diapraxis im gemeinsamen Engagement für eine gerechtere Welt tritt die erlebte Spiritualität als gemeinsame Verbindung der Herzen in Gott. Damit einher geht ein Geist der Demut, der bereit ist, auch eigene Verfehlungen im Blick auf die christliche Gemeinschaft anzuerkennen und um Vergebung zu bitten. Der orthodoxe Theologe Peter Bouteneff nennt dies eine „Ökumene der Buße“. Aus dieser spirituellen Haltung erwächst dann ein weites Herz und ein weiter Blick für die Nächsten: „Diese ‚Ökumene der Buße‘ ist zugleich immer auch eine Ökumene der Großzügigkeit, denn je mehr ich meinen eigenen Anteil an der Schuld an den Trennungen erkenne, umso großzügiger muss und wird mein Herz werden. Und diese Ökumene muss auch eine Ökumene der Neugier sein – Neugier im Sinne der Bereitschaft, einander wirklich zuzuhören und voneinander zu lernen“ (Bouteneff, 172).
Im Ringen um Antworten etwa auf den Klimawandel oder auf eine ungerechte Wirtschaftsordnung verlieren konfessionelle Differenzen zunehmend an Bedeutung.
THESE 5: EINE WELT. VON EINER „ÖKUMENE DER PROFILE“ ZU EINER ‚ÖKUMENE DER PRAXIS‘
Es ist an der Zeit, den Stellenwert theologischer Differenzen zwischen den einzelnen Konfessionen für den ökumenischen Dialog und mehr noch für die ökumenische Diapraxis zu überdenken. Dabei werden die akademischen Auseinandersetzungen um theologische Streitpunkte und eine „Ökumene der Profile“ (Wolfgang Huber) ergänzt durch eine ‚Ökumene der Praxis‘. Gerade die junge Öffentliche Ökumene engagiert sich in einem auf die Lösung spezifischer Herausforderungen gerichteten Miteinander, nicht zuletzt im globalen Kontext. Im Ringen um Antworten etwa auf den Klimawandel oder auf eine ungerechte Wirtschaftsordnung verlieren konfessionelle Differenzen zunehmend an Bedeutung. Ein Beispiel dieses gemeinsamen Arbeitens für eine nachhaltigere, gerechtere Wirtschaftsordnung stellt die 2019 in Anlehnung an Franz von Assisi ins Leben gerufene Initiative Economia di Francesco dar. Die Bewegung richtet sich an junge Wirtschaftswissenschaftler*innen und Entrepreneure, die Wirtschaft und Globalisierung neu denken möchten. Von der katholischen Tradition inspiriert, verbindet diese Initiative mehrere tausend junge Leute aus unterschiedlichen christlichen und nicht-christlichen Glaubensrichtungen. In diesem Sinne fordert etwa der römisch-katholische Ökonom und Theologe Luigino Bruni von Papst Franziskus die Einberufung eines Dritten Vatikanischen Konzils, das sich den globalen Herausforderungen an eine nachhaltige Wirtschaft und Ökologie widmet. „Ein neues ökumenisches Konzil dürfte nicht nur eine Angelegenheit der Bischöfe sein, sondern müsste auch die Laien ernsthaft einbeziehen; es dürfte nicht nur eine Angelegenheit der Männer, sondern auch der Frauen sein; nicht nur eine Angelegenheit der Erwachsenen, sondern auch der jungen Menschen; nicht nur eine Angelegenheit der Katholiken, sondern auch der anderen Kirchen, der anderen Religionen und der Atheisten guten Willens“ (Bruni; Übersetzung C. S.). Verbunden durch den einen Herzschlag der Christozentrik, Teil der einen Wirklichkeit, als „Cultural Witness“ unterwegs in dem einen