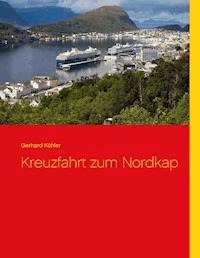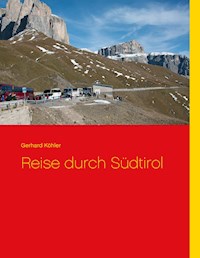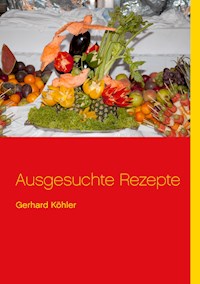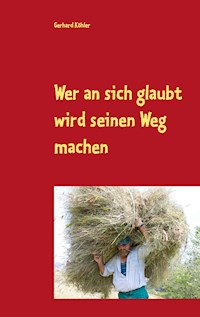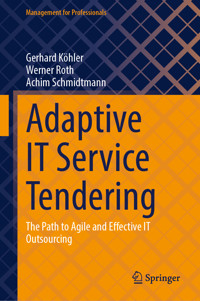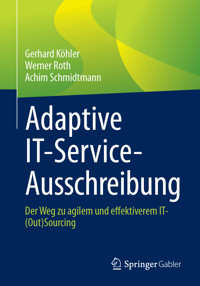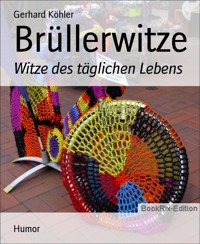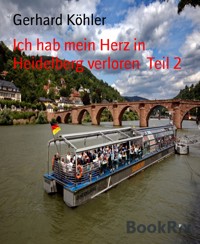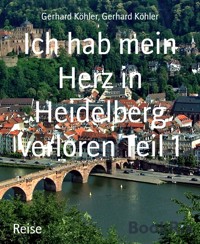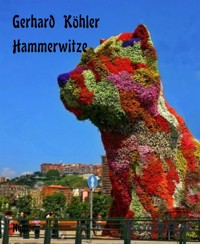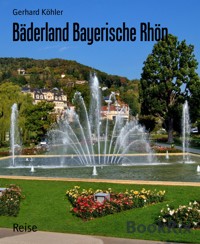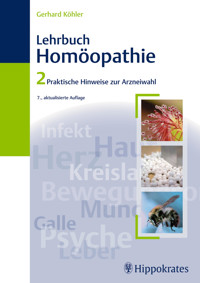
109,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hippokrates
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Homöopathie - ein Buch mit sieben Siegeln? Das muss nicht sein! Dieses bewährte Lehrbuch der Homöopathie bezieht seine besondere Qualität aus der klaren Sprache und Didaktik von Gerhard Köhler. Es stellt übersichtlich und prägnant das komplette Grundlagenwissen der Homöopathie dar. Die didaktische Aufbereitung bietet Ihnen einen pragmatischen Zugang zu diesem Thema und konzentriert sich auf die für die Praxis wesentlichen Lerninhalte. Einsteigern eröffnet dieses Buch einen sehr guten Zugang zur Homöopathie. Aber auch erfahrene Therapeuten finden hier nützliche Hinweise und Anregungen. Das modern aufgebaute Werk verschafft Ihnen einen schnellen Überblick und erleichtert das Lernen. Bewährtes Grundlagenwissen didaktisch aufbereitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
In dankbarer Erinnerung an meine Eltern
Dr. med. Gerhard Köhler (1916 – 2002)
Medizinstudium in Freiburg, München, Danzig. 1941 Staatsexamen und Promotion an der Universität Leipzig.
Klinische Ausbildung in Aachen und Krefeld (Chirurgie, Frauenheilkunde). Nach dem Krieg Niederlassung und Arbeit im Belegkrankenhaus – Schwerpunkt Chirurgie, Geburtshilfe, Innere Medizin sowie begleitende Anwendung der Homöopathie im klinischen Betrieb.
1962 Niederlassung als Homöopathischer Arzt in eigener Kassenpraxis in Freiburg/Breisgau. In dieser Zeit 24 Semester lang Vorlesungen und Seminare über Homöopathische Medizin für Studenten und Assistenten der Universität Freiburg. 12 Jahre Kursleiter und Dozent bei der Ausbildung für Ärzte im Weiterbildungszentrum Bad Brückenau, später auch in Bergisch Gladbach und an der Niedersächsischen Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren in Celle.
Lehrbuch Homöopathie
Band 2 Praktische Hinweise zur Arzneiwahl
Gerhard Köhler
7., aktualisierte Auflage
5 Abbildungen 9 Tabellen
Vorwort zur 4. Auflage
In den neun Auflagen des zweibändigen Lehrbuches der Homöopathie, die seit 1982 im Hippokrates Verlag erschienen sind, wurde von Jahr zu Jahr deutlicher, dass der Verlag und der Autor bemüht sind, die homöopathische Wissenschaft gut erlernbar und reif zur praktischen Anwendung zu machen. Dazu gehörte es auch, die Botschaft in anderssprachige Länder zu tragen. So sind einige fremdsprachige Lizenzausgaben entstanden, das freut mich besonders. Band 1 mit Grundlagen und Anwendung und Band 2 mit Hinweisen zur Arzneiwahl ergänzen und verbinden sich durch eine Vielzahl von Querverweisen in Sachverzeichnissen, Literaturinformationen und sehr reichhaltige Arzneimittelverzeichnisse mit Repertorium. Diese vielfachen Vernetzungen von Arzneisymptomen geben inhaltsreiche Hilfen für die Arzneimittelwahl und sichern die endgültige Entscheidung für die leibseelische Ganzheit des behandelten Kranken.
Freiburg im Breisgau, September 1997
Gerhard Köhler
Vorwort zur 2. und 3. Auflage
Die jüngste Auflage orientiert sich an der Überarbeitung des bisherigen Textes und Erweiterung um einige Kapitel und ist gründlich durchgesehen worden.
Dabei wurde versucht, noch deutlicher zu zeigen, „dass bei homöopathischer Wahl eines Heilmittels der Gemütszustand des Kranken oft am meisten den Ausschlag gibt“ (S. Hahnemann).
Dem Verlag und allen Helfern danke ich für die weitere gute Zusammenarbeit. Dadurch wurde es möglich, dass inzwischen englische, russische, holländische und italienische Übersetzungen erscheinen konnten.
Freiburg im Breisgau, Sommer 1991/Winter 1993
Gerhard Köhler
Vorwort zur 1. Auflage
Der zweite Band enthält die weiterentwickelten Skripten und Begleittexte, die den Hörern meiner Vorträge, Vorlesungen und Kurse schon bekannt sind und die sich in vielen Praxen bereits bewährt haben.
Durch anregende Mitarbeit, kritische Diskussion und schriftliche Hinweise haben die Teilnehmer dieser Lehrveranstaltungen und auch viele Leser des ersten Bandes erheblichen Anteil am fertigen Werk.
Mein Dank gebührt den Damen und Herren des Verlages, dem Verleger Herrn Albrecht Hauff und der Cheflektorin Frau Dorothee Seiz; ebenso Frau Ilse Lässig, Freiburg, die in bewundernswürdiger Genauigkeit und Aktivität die gesamten Schreibarbeiten – wie im ersten Band – erledigt hat und Inhalt mit Form in Einklang brachte. Die Zeichnungen und Tabellen wurden von Herrn Udo Hoffmann, Freiburg, angefertigt.
Freiburg im Breisgau, Juli 1986
Gerhard Köhler
Inhalt
Vorwort zur 4. Auflage
Vorwort zur 1., 2. und 3. Auflage
1 Einführung
1.1 Hinweise zur Arbeit mit dem Buch
1.2 Anwendung der Arznei
2 Infekte
2.1 Fieberhafter Infekt, grippaler Infekt, Erkältungsinfekte
Übersicht
2.2 Epidemische Krankheiten; exanthematische „Kinderkrankheiten“
2.2.1 Diphtherie
Übersicht
2.2.2 Morbilli (Masern)
Übersicht
2.2.3 Parotitis epidemica (Mumps)
Übersicht
2.2.4 Pertussis (Keuchhusten)
Übersicht
2.2.5 Rubeolae (Röteln)
Übersicht
2.2.6 Scarlatina (Scharlach)
Übersicht
2.2.7 Varicellae (Windpocken)
3 Schwindel
Übersicht
4 Kinetose
Übersicht
5 Haut
5.1 Entzündliche Hauterkrankungen
5.1.1 Grundformen der Entzündungsphasen und ihre Hauptmittel
5.1.2 Aktive Hyperämie
5.1.3 Exsudation
5.1.4 Eiterung
Übersicht
5.2 Klinische Indikationen
5.2.1 Lokale Hyperämie
5.2.2 Erysipel (Wundrose)
Übersicht
5.3 Exsudation – Quaddeln Urtikaria (Nesselsucht)
Übersicht
5.4 Blasen Verschiedene Herpes-Formen
Übersicht
5.4.1 Herpes simplex
5.4.2 Herpes circinatus (Ringelflechte)
5.4.3 Herpes labialis
5.4.4 Herpes genitalis
5.5 Zoster (Herpes zoster, Gürtelrose)
Übersicht
5.6 Eiterung
5.6.1 Furunkel
Übersicht
5.6.2 Furunkulose
5.6.3 Karbunkel
5.7 Impetigo contagiosa
Übersicht
5.8 Acne vulgaris (Acne juvenilis)
Übersicht
5.8.1 Seborrhoea oleosa (fettige Haut)
5.8.2 Seborrhoea sicca (trockene Haut)
5.9 Rosazea (Acne rosacea)
Übersicht
5.10 Ekzemgruppe, atopische Dermatitis, Neurodermitis
Übersicht
5.11 Psoriasis (Schuppenflechte)
Übersicht
5.12 Übermäßige Verhornung (Hyperkeratose, Parakeratose)
Übersicht
5.12.1 Ichthyosis (Fischschuppenkrankheit)
5.12.2 Klavus (Hühnerauge)
5.13 Hautausschläge mit deutlicher Ätiologie
Übersicht
5.13.1 Kontaktekzem
5.13.2 Arzneimittelexanthem
5.13.3 Sonnenbestrahlung
5.13.4 Schweiß
5.13.5 Sudamina (Miliaria, Schweißfriesel)
5.13.6 Dyshidrotisches Ekzem
5.13.7 Intertrigo
5.13.8 Windeldermatitis
5.14 Proliferative und wuchernde Hauterkrankungen
5.14.1 Verrucae (Warzen)
5.14.2 Verrucae planae juveniles
Übersicht
5.14.3 Verrucae vulgares
5.14.4 Verrucae seborrhoicae (seborrhoische Warzen, Alterswarzen)
5.15 Kondylome (Feigwarzen)
5.15.1 Condylomata acuminata (spitze Feigwarzen)
Übersicht
5.15.2 Condylomata lata (breite Feigwarzen)
5.16 Gutartige Geschwülste
Übersicht
5.16.1 Hämangiom (Blutschwamm)
5.16.2 Fibrome
5.16.3 Atherome
5.16.4 Keratoma senile, aktinische Keratose (Alterskruste)
5.16.5 Keloid (Wulstnarbe)
5.17 Zerstörende (destruktive) Hautprozesse
5.17.1 Ulzerationen (Geschwüre)
Übersicht
5.17.2 Traumatische Ulzera
5.17.3 Dekubitus (Folge von Aufliegen)
5.17.4 Periphere Durchblutungsstörungen
5.17.5 Diabetische Ulzera, Gangrän
5.17.6 Maligne Ulzera
6 Haare
6.1 Haarausfall
Übersicht
6.1.1 Alopecia diffusa (diffuser Haarausfall am Kopf)
6.1.2 Alopecia areata (kreisrunder Haarausfall am Kopf)
6.1.3 Haarausfall an sonstigen Stellen
7 Nägel
7.1 Konstitutionelle und diagnostische Zeichen; Therapie
Übersicht
7.2 Klinische Syndrome
Übersicht
7.2.1 Eingewachsener Nagel (Unguis incarnatus)
7.2.2 Entzündungen am Nagel (Onychie, Paronychie, Panaritium parunguale)
7.2.3 Entzündung durch Verletzungen
7.2.4 Mykosen (Pilzerkrankungen)
7.2.5 Nägel kauen, abbeißen
7.2.6 Niednägel
8 Variköser Symptomenkomplex
Übersicht
8.1 Erweiterung der Venen, Varikose
8.2 Entzündung
8.2.1 Phlebitis
8.2.2 Thrombophlebitis
8.3 Stauung
8.3.1 Eczema varicosum
8.3.2 Ulcus cruris varicosum
8.4 Hämorrhoiden und Analfissuren
Übersicht
8.4.1 Hämorrhoiden
8.4.2 Analfissuren
9 Atemorgane
9.1 Husten
Übersicht
9.1.1 Trockener Husten
9.1.2 Feuchter Husten (mit Auswurf)
9.2 Asthma
Übersicht
9.2.1 Behandlung im Anfall
9.2.2 Behandlung in der anfallsfreien Zeit
9.2.3 Wodurch entsteht der Anfall?
9.2.4 Wie verläuft der Anfall?
9.2.5 Konstitutionsbehandlung
9.2.6 Zusatzbehandlung
9.3 Pleuritis
9.3.1 Akuter Beginn
Übersicht
9.3.2 Pleuritis sicca
9.3.3 Pleuritis exsudativa
9.3.4 Restzustand
9.4 Sarkoidose (Manifestation in der Lunge, Morbus Boeck)
10 Herz und Kreislauf
10.1 Hypertonie
10.1.1 Primäre (essenzielle) Hypertonie
Übersicht
10.1.2 Sekundäre Hypertonie
10.1.3 Hochdruckkrisen
10.2 Hypotonie
Übersicht
10.2.1 Andauernde Hypotonie
10.2.2 Gelegentliche Hypotonie
10.3 Arteriosklerose
Übersicht
10.3.1 Zerebralsklerose
10.3.2 Allgemeine Sklerose
10.4 Zerebraler Insult
Übersicht
10.5 Dringliche Herz- und Kreislaufstörungen
Übersicht
10.5.1 Kollaps
10.5.2 Stenokardie
10.5.3 Herzklopfen
10.5.4 Herzjagen
11 Bewegungsorgane
11.1 Rheumatischer Formenkreis
11.1.1 Akute Arthritis
Übersicht
11.1.2 Progredient-chronische Polyarthritis
11.2 Arthrosen
Übersicht
11.2.1 Koxarthrose
11.2.2 Gonarthrose
11.2.3 Begleittherapie
11.3 Ischialgie
Übersicht
11.3.1 Rheumatische Entzündung, Neuralgie
11.3.2 Fokale Fernwirkung (Herdinfekte)
11.3.3 Nachbarschaftliche Einflüsse
11.3.4 Wirbelsäulenveränderungen
12 Kopf
12.1 Kopfschmerzen
Übersicht
12.1.1 Psychosomatische Wechselwirkungen
12.1.2 Ätiologische Beziehungen
12.1.3 Kopfschmerzen in einzelnen Lebensphasen der Frau
12.2 Migräne
12.3 Anfall
Übersicht
12.4 Neuralgischer Gesichtsschmerz (Trigeminusneuralgie, Fazialisneuralgie, Prosopalgie)
Übersicht
13 Hals – Nase – Ohr
13.1 Otitis media
Übersicht
13.1.1 Otalgie
13.1.2 Lokalisation der Entzündung
13.1.3 Absonderung
13.1.4 Drohende Mastoiditis
13.1.5 Rezidivierende Otitis
13.1.6 Chronische Otitis
13.1.7 Hydro- oder Mukotympanon
13.2 Schnupfen
Übersicht
13.3 Allergischer Schnupfen, Pollinose (Heuschnupfen), Rhinitis vasomotorica, neurogene Rhinitis
Übersicht
13.4 Entzündung der Nasennebenhöhlen
Übersicht
13.5 Erkrankungen der Tonsillen
Übersicht
14 Mund
14.1 Entzündungen an der Mundschleimhaut und am Zahnfleisch
Übersicht
14.2 Oberflächenentzündung
14.2.1 Stomatitis, Gingivitis
14.3 Gewebedefekt
14.3.1 Aphthen
14.3.2 Ulzera
14.3.3 Ulzera mit Pseudomembranen
14.4 Eiterung
14.4.1 Abszessbildung, Fistelung
15 Erkrankungen der Schilddrüse
15.1 Struma
Übersicht
15.2 Weiche Struma
15.2.1 Parenchymstruma
15.2.2 Kolloidstruma
15.2.3 Gefäßstruma
15.2.4 Hyperthyreose, Morbus Basedow, Jodismus
15.3 Harte Struma
15.3.1 Hypo- oder Euthyreose
15.3.2 Hyperfunktion
15.4 Knotenkröpfe
15.4.1 Euthyreote Knoten
15.4.2 Zysten
16 Magen – Darm
16.1 Akute Magen- und Darmstörungen im Kindesalter
16.1.1 Speikinder
Übersicht
16.1.2 Azetonämisches Erbrechen
16.1.3 Blähungskoliken
16.1.4 Nabelkoliken
16.1.5 Akute Gastroenteritis, Brechdurchfall, Ernährungsstörungen
16.2 Erkrankungen des Magens und des Zwölffingerdarms
Übersicht
16.2.1 Akute Magen- und Darmstörungen
16.2.2 Gastritis, Gastroduodenitis
16.2.3 Chronische Magenstörungen
16.2.4 Ätiologische Faktoren
16.2.5 „Nervöser Magen“
16.2.6 Die Ulkuskrankheit
16.3 Sodbrennen
Übersicht
16.4 Colon irritabile (Reizkolon)
Übersicht
16.5 Colitis ulcerosa
Übersicht
17 Leber – Galle
17.1 Krankheiten der Gallenwege
Übersicht
17.1.1 Gallenkolik, Dyskinesie
17.1.2 Cholelithiasis (Steingallenblase)
17.1.3 Postcholektomiesyndrom
17.1.4 Cholezystitis
17.2 Krankheiten der Leber
Übersicht
17.2.1 Hepatitis
17.2.2 Leberinsuffizienz
17.2.3 Leberzirrhose
18 Harnorgane
18.1 Entzündliche Erkrankungen der Harnwege
Übersicht
18.2 Blasen- und Nierensteine
Übersicht
18.2.1 Behandlung während der Kolik
18.2.2 Behandlung nach der Kolik
18.3 Enuresis nocturna
Übersicht
18.3.1 Psychisches Trauma
19 Geschlechtsorgane
19.1 Prostata
Übersicht
19.1.1 Entzündung, Prostatitis
19.1.2 Kongestive Vergrößerungen
19.1.3 Tumorbildung, Prostataadenom
19.2 Dysmenorrhö
Übersicht
19.3 Schwangerschaft und Nachgeburtsperiode
19.3.1 Psychische Veränderungen
Übersicht
19.3.2 Hyperemesis gravidarum
19.3.3 Beschwerden beim Stillen
19.3.4 Mastitis
20 Physisches Trauma – Folgen von körperlichen Verletzungen
20.1 Gehirntrauma (Commotio, Contusio, Geburtstrauma)
Übersicht
20.2 Operationstrauma
Übersicht
20.3 Sonnenstich
20.4 Überanstrengung
Übersicht
20.5 Verbrennungen
20.6 Verheben, Hexenschuss, Lumbago, Diskopathie
Übersicht
20.7 Verletzungen
Übersicht
20.8 Wundbehandlung
Übersicht
21 Psychisches Trauma – Folgen von seelischen Verletzungen
Übersicht
21.1 Liebesentzug
Übersicht
21.2 Übersteigerte Triebhaftigkeit
Literatur
Arzneimittelverzeichnis
Sachverzeichnis
1 Einführung
Ohne Kenntnis der Grundlagen und Regeln des homöopathischen Heilverfahrens sollte man diesen zweiten Band des Lehrbuchs Homöopathie nicht beurteilen oder einzelne Teile daraus für die Behandlung kranker Menschen verwenden. Hinweise zur Arzneiwahl können nicht wie der Tipp eines Kochbuchs verstanden werden, der auf leichte Weise das beste Menü zaubert.
Denn Homöopathie ist eine individuelle und ganzheitliche Therapiemethode. Sie legt besonderen Wert auf die leiblich-seelische Besonderheit des Kranken, auf seine Biografie, Konstitution und sein Verhalten zur Umwelt.
Ich kann Ihnen also keine pauschalen Therapieempfehlungen zu kollektiven Krankheitsdiagnosen geben, sondern möchte Sie sensibilisieren, bei der Anamnese darauf zu achten, dass viele Kranke bei ähnlicher Krankheit unterschiedlich reagieren. Daraus folgt, dass Sie diese unterschiedlichen Reaktionsweisen doch nicht einfach „unterschlagen“ können und eine nivellierende Pauschaltherapie durchführen. Dieses Buch möchte Ihnen helfen, diese auffallenden, sonderlichen und charakteristischen Reaktionsweisen bei anscheinend gleichem Krankheitssyndrom zu nutzen für die sichere und rasche Entscheidung bei der Arzneiwahl (vgl. Organon 6, § 153).
Im ersten Band wurde darauf hingewiesen, dass vollständige Symptome (▶Abb. 1) zur sicheren Arzneiwahl führen. Zu einem vollständigen Symptom gehören die Angaben, weshalb und wo eine krankhafte Störung, ein Schmerz, eine Sensation aufgetreten ist, wodurch und wann diese besser oder stärker wird (vgl. Bd. 1, S. 31 – 48). Eine zielsichere Anamnese und Untersuchung muss sich darum bemühen, vollständige Symptome zu erhalten – damit haben Sie das Basismaterial für die Stellung der klinischen Diagnose und für die differenzialtherapeutische Arzneiwahl. Art und Ort der Störung repräsentieren ausgeprägter die klinische Diagnose, Auslösung und Modalitäten differenzieren die Arzneiwahl. Das funktionelle Zusammenspiel dieser vier Faktoren möge die folgende Abbildung bildhaft darstellen.
Ein vollständiges Symptom kann so charakteristisch und deutlich sein, dass es als „Kern des Ganzen“ (Dostojewski) das gesamte Krankheitsbild verkörpert. Damit wird es bei der Suche nach dem ähnlichen Arzneimittelbild zum „Erkennungszeichen der heilenden Arznei“ (Georg von Keller).
Abb. 1 Vollständiges Symptom.
Und damit sind wir bei den beiden Aufgaben, die sich dieses Buch stellt: Hilfe bei der Arzneiwahl und beim Erlernen der Arzneimittelbilder.
Bei der Suche nach der passenden Arznei gehen Sie von der Übersicht des entsprechenden Kapitels eines Krankheitssyndromes aus. Dort können Sie sich rasch orientieren, an welche Arzneimittel bei einer bestimmen Phase der Krankheit besonders zu denken ist. Die Mittel sind meist alphabetisch geordnet, gelegentlich sind einige wegen ihrer besonderen Wertigkeit vorangestellt. Mit der differenzierten Beschreibung der Arzneisymptome werden Sie eine passende Arzneiwahl treffen können. Diese Wahl sollten Sie mit einer größeren Arzneimittellehre nachprüfen, bestätigen oder ablehnen. Reichen diese Informationen im Einzelfall einmal nicht aus, so erhalten Sie mit den Querverweisen die Möglichkeit, den gesamten Krankheitsfall mithilfe Ihres Repertoriums doch noch zu lösen. Damit möchte ich erreichen, dass Sie offen bleiben für die verschiedenen Methoden der Arzneifindung, für kurze oder lange Wege (vgl. Bd. 1, S. 69).
Die zweite Aufgabe dieses Buches hat fast noch größeres Gewicht: Es möchte Ihnen helfen, die vielfältigen und umfangreichen Symptome der homöopathischen Arzneimittellehre zu lernen oder Ihr vorhandenes Wissen aufzufrischen und zu erweitern.
Um die „richtige“ Lern- oder Lehrmethode wird oft diskutiert und gestritten. Ich beteilige mich nicht an diesem Streit. Aus der Erfahrung im Umgang mit Lernenden und aus Lehrveranstaltungen weiß ich, dass jeder Lernende und Lehrende seine eigene Methode entwickelt. Die moderne Didaktik hat die alte Erfahrung bestätigt, dass wir besser lernen beim Umgang mit Patienten. Die Arzneisymptome, die man während der Anamnese von einem Patienten hört und durch den Behandlungserfolg bestätigt bekommt, bleiben lebendig.
In Anlehnung an diese auf den Patienten ausgerichtete Methode können Sie mit dem Buch die Materia medica schrittweise erlernen, so wie es Ihnen in der Praxis bei der Anamneseerhebung ja auch entgegenkommt: vom Einzelnen zum Ganzen, von der Symptomatik einer Arznei im überschaubaren Bereich eines Krankheitssyndromes bis hin zur Fülle des ganzen Arzneimittelbilds.
Diese Methode hat den Vorteil, dass die bisher nur schulmedizinisch ausgebildeten Kollegen sich das individuelle Krankheitsbild, eingeordnet im Bereich eines klinischen Syndromes, vorstellen können, sich vielleicht sogar an einen Patienten erinnern, bei dem sie Ähnliches festgestellt hatten. Auf diesem Wege bildet sich das für die homöopathische Arzneiwahl notwendige Denken in phänomenologischen Entsprechungen zwischen individuellem Krankheitsbild und Arzneimittelbild. Die trockene Arzneimittellehre wird lebendig, wenn man z. B. bei einem plötzlich beginnenden Infekt, der Belladonna benötigt, die Entsprechung zwischen dem individuellen Krankheitsbild und der Arzneisymptomatik erkennen lernt. Je genauer und umfangreicher im Sinne eines vollständigen Symptoms wir diese Ähnlichkeit erkennen, umso selbstverständlicher sprechen wir dann bei anderen Patienten von einem Belladonna-Kopfschmerz, einem Rumex-Husten, von einer Ferrum-Otitis, einer Phytolacca-Tonsillitis, einem Lachesis-Erysipel. Diese Ausdrücke entstammen keiner wichtigtuerischen „Insider“ sprache – sie stehen ein für die Gewissenhaftigkeit und Individualisierung unserer Arzneiwahl, sie verbürgen sich für die spiegelbildliche Entsprechung zwischen Arznei und Krankheit:
Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden!
1.1 Hinweise zur Arbeit mit dem Buch
Querverweise auf die Repertorien beziehen sich auf die beiden deutschen Übersetzungen des Kent'schen Originalwerks: Für den Erbe-Kent (Hippokrates-Verlag) steht das Kürzel EK, die von Georg v. Keller und Künzli von Fimmelsberg besorgte Übersetzung ist mit KK unter Bandangabe I – III gekennzeichnet (bis zur 13. Auflage), also z. B. KK II/179. Die Angaben für die einbändige Repertoriums-Ausgabe (also der 14. Auflage) wurden ohne die Bandangabe zitiert (z. B. KK 1409). Zusätzlich sind einige Hinweise auf das Synthetische Repertorium von Barthel und Klunker vermerkt; Kürzel SR.
Quellenangaben sind meist direkt im Text vermerkt mit folgenden Kürzeln:
Organon §, steht für Hahnemann, Samuel: Organon der Heilkunst, 6. Auflage, § 1 – 291; CK, Bd., Symp., für Hahnemann, Samuel: Chronische Krankheiten, Band 1 – 5, Symptom; RAL, Bd., Symp., für Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre, Band 1 – 6, Symptom; Hering, GS, Bd., für Hering, Constantin: The Guiding Symptoms, Band 1 – 10.
1.2 Anwendung der Arznei
Die homöopathische Arznei sollte möglichst nüchtern am Morgen, wenigstens 15 Minuten vor oder sonst 1 Stunde nach der Mahlzeit eingenommen werden. Nicht direkt schlucken, sondern im Munde zergehen lassen! Dies kann man einige Tage bei niedrigen Potenzen (bis C6/D12) 2 – 3-mal täglich wiederholen. Je nach Alter und Sensitivität des Patienten kann man bei jeder einzelnen Gabe 1 – 8 Tropfen oder 1 – 8 Globuli oder ½ – 1 Tablette einnehmen.
Für bestimmte Krankheitsfälle werden andere Anwendungsmethoden empfohlen (vgl. Band 1, S. 169). Diese Hinweise finden Sie am Ende der jeweiligen Arzneibeschreibung bei der Anwendung:
Methode 1: Bei akuten und dringlichen Krankheitsfällen beginnt man mit einer Gabe der jeweiligen Arznei, wie oben beschrieben. Dann löst man nach dieser ersten Gabe 5 Tropfen oder 5 Globuli oder 1 Tablette in einer Vierteltasse Wasser auf und „verkleppert“ diese Lösung mit einem Eierlöffel (keinen Metalllöffel verwenden!), als wolle man Sahne schlagen. Von dieser hergestellten Lösung gibt man wiederholt 1 Eierlöffel voll, je nach Aktualität der Krankheit zunächst alle 5 Minuten, dann viertelstündlich und verlängert die Pause Schritt für Schritt, wie die Besserung fortschreitet, ½ – 2-stündlich, dann Schluss.
Methode 2: Kumulative Anwendung von Hochpotenzen nach folgendem Schema: Je eine Gabe morgens C100/abends C200/am anderen Morgen C1000. Damit ist die Kur beendet. Diese Anwendung ist eine sehr seltene Ausnahme bei robusten Patienten mit akuter Krankheit, z. B. bei eben beginnender Eiterung, mit Hepar sulfuris behandelt.
Reihe: Die gleiche Arznei wird steigend von der Tiefpotenz (z. B. C6) bis zur Hochpotenz (z. B. C200) als Kur bei chronischen Krankheiten in immer längeren Zeitabständen, aber unter laufender Kontrolle des Arztes gegeben.
Beispiel: Beginn mit C6 Tabl., 6 Tage jeden Morgen 1 Tabl.; dann nach 2 Tagen Pause einmalig 1 Tabl. C7; dann nach 3 Tagen Pause einmalig 1 Tabl. C9; nach 5 Tagen Pause 1 Tabl. C12; nach 8 Tagen 1 Tabl. C30; nach 14 Tagen 1 Tabl. C100; nach einem Monat 1 Tabl. C200. Dieses Schema soll nur ungefähren Anhalt bieten, in welchen Abständen die Arznei wiederholt werden kann, wenn es nötig ist!
2 Infekte
2.1 Fieberhafter Infekt, grippaler Infekt, Erkältungsinfekte
Im Anfang eines fieberhaften Infekts ist es oft noch nicht möglich, eine exakte Diagnose zu stellen. Mit einer guten Anamnese und Allgemeinuntersuchung lassen sich die wesentlichen Krankheitsphänomene erfassen, die für die homöopathische Arzneiwahl erforderlich sind. Wir können schon zielgerichtet behandeln, bevor die Lokalisation eines Infekts deutlich wird und dadurch ein objektivierbarer Befund vorliegt. Diese Möglichkeit zur sinnvollen Therapie der Anfänge ist ein wesentlicher Vorteil der homöopathischen Methode, denn es ist nicht günstig, jeden Infekt im Beginn mit Antibiotika zu unterdrücken, bevor Immunisierungsmechanismen anlaufen und der Organismus seine Infektabwehr aufbaut und trainiert.
Homöopathische Behandlung stärkt und fördert die körpereigene Regulation, sie ist „Hilfe zur Selbsthilfe“, verhütet fast immer Komplikationen und schützt vor Rezidiven.
Übersicht
Vgl. in den Repertorien: KK II/31 ff.; KK 437
Plötzlicher Beginn
Aconitum napellus Belladonna
Allmählicher Beginn
Ferrum phosphoricum Gelsemium sempervirens Eupatorium perfoliatum oder purpureum Echinacea angustifolia oder purpurea
Plötzlicher Beginn
Bei plötzlichem und heftigem Beginn eines Infekts bewähren sich als erste Mittel:
Aconitum napellus
Stürmischer Beginn nach Einwirkung von scharfem, kaltem Wind (Ostwind), auch Folge von Schreck und Ärger. Beginn oft um Mitternacht mit ängstlicher Unruhe, gesteigert bis zur Todesangst. Am Anfang Frostschauer, trockene, heiße Haut. Gesicht im Liegen rot, beim Aufsitzen blass. Der Puls ist schnell, voll und hart. Erkrankung meist noch nicht lokalisiert – evtl. kurzer, trockener Husten, manchmal pfeifende Inspiration (Pseudokrupp).
Anwendung: C6 (C12) Dil. nach Methode 1. Bei starker Angst C30 (D30) Dil. oder Glob.
Belladonna
Plötzlicher Beginn eines allgemeinen Infekts mit roter, schweißiger Haut. Charakteristische Symptomen-Trias: heiß, rot, klopfende Empfindungen. Gesicht hochrot, glänzend, weite Pupillen (Atropin!). Klopfender, harter, voller, schnellender Puls. Klopfende Karotiden und Temporalarterien. Dampfender Schweiß im Bett, beim Aufdecken frostig, will zugedeckt bleiben. Starker Durst auf kaltes Wasser (Atropin macht trockene Schleimhäute). Hämmernder Kopfschmerz, verstärkt durch geringste Erschütterungen und beim Bücken. Schleimhäute kräftig rot. Laryngealer Reizhusten, trocken, krampfig. Folgt oft gut nach Aconitum, wenn der Schweiß beginnt.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Allmählicher Beginn
Bei allmählichem Beginn eines Infekts finden wir oft die Symptomatik von Ferrum phosphoricum, Gelsemium sempervirens oder Eupatorium perfoliatum oder purpureum. Wenn der Patient keine differenzierenden Phänomene bietet, verordnen wir Echinacea angustifolia oder purpurea.
Ferrum phosphoricum
Fiebermittel bei rasch erschöpften Menschen mit geringer Abwehrkraft und Neigung zu Nasenbluten und Mittelohrentzündung. Der Beginn des Infekts ist nicht so dramatisch wie bei Aconitum napellus oder Belladonna – es fehlt die Angst und Unruhe von Aconitum und die aktive Hyperämie von Belladonna.
Bei Ferrum phosphoricum herrscht vasomotorische Labilität, die sich darin zeigt, dass der Patient im Gesicht wechselnd blass oder rot ist. Der Puls ist schnell, sehr klein, weich und unterdrückbar. Oft Nasenbluten. Neigung zur Lokalisation des Infekts am Mittelohr mit klopfendem, pulsierendem Schmerz. Meist schlimmer nachts, dabei sind oft die Ohrmuschel und Wange der erkrankten Seite stärker gerötet als auf der gesunden Seite (wie Chamomilla bei Zahnungsbeschwerden des Kleinkinds). Bei Husten klagt der Patient über trockenes, kitzelndes Gefühl im Halsgebiet mit krampfigem Husten, der kaum Auswurf fördert. Evtl. Schmerzen im Thoraxgebiet.
Anwendung: C6 (D12) Tabl. nach Methode 1.
Gelsemium sempervirens
Fieberhafter Infekt mit Frösteln, zittriger Schwäche und Benommenheit. Im Anfang des Infekts laufen Kälteschauer den Rücken auf und ab, dabei oft Zittern und Zähneklappern, das so stark sein kann, dass der Patient gehalten werden will. Der Infekt entwickelt sich allmählich, meist 1 – 2 Tage nach Abkühlung. Der Puls ist mäßig beschleunigt und weich, das Gesicht oft dunkelrot. Meist Durst. Lokalisiert sich der Infekt, so tritt ein wässriger, brennender, scharfer Fließschnupfen auf mit Reizung des Pharynx und Schluckbeschwerden oder Bronchitis mit geringem Auswurf.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Eupatorium perfoliatum
Der ganze Körper tut weh: Im Rücken wie zerschlagen, tief sitzende Schmerzen in Knochen und Gelenken, wie verrenkt. Klopfende oder berstende Kopfschmerzen, schmerzhafter Husten, muss den Brustkorb festhalten.
Auffallende zeitliche Umkehrung des Temperaturverlaufs: Das Fieber erreicht am Morgen (7 – 9 Uhr) seinen Höhepunkt; starker Frost in der Nacht und am Morgen; im Laufe des Tages heiß, kaum Schweiß. Besserung des Allgemeinbefindens, wenn Schweißausbruch eintritt. Vor dem Frost großer Durst nach kaltem Wasser; nach dem Frost oft Erbrechen; Galleerbrechen und druckempfindliche Leber. Gesicht heiß und rot.
Eupatorium purpureum
Bei Mitbeteiligung des Harnsystems, z. B. Zystitis, aber sonst gleicher Symptomatik wie Eupatorium perfoliatum bewährt sich Eupatorium purpureum.
Anwendung: D6/C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Echinacea angustifolia oder purpurea
Diese beiden Formen der Kegelblume (Rudbeckia) sind gleichwertig. Die Arzneimittelprüfung an Gesunden hat wenig unterscheidende Modalitäten gebracht. Nach vielfältiger Erfahrung erhöht dieser Pflanzenextrakt die körpereigene Abwehr. Auffallend ist der unangenehme Geruch aller Ausscheidungen.
Anwendung: Ø-D3 Dil.
Alle 1-2-3 Stunden 5 – 15 Tropfen.
MEMO
PulsGesichtCharakteristikaAconitum napellusschnell, voll, hartheiß, rot, trocken, beim Aufsitzen blassstürmischer Beginn, Angst, Folge von kaltem WindBelladonnaschnell, voll, schnellendheiß, rot, schweißig, Extremitäten kalt; deckt sich nicht aufplötzlicher Beginn, klopfende Empfindungen; Körper heiß – Extremitäten kaltFerrum phosph.klein, weich, leicht unterdrückbarblass und rot im Wechsel, besonders bei LagewechselKreislauf labil; Nasenbluten, OhrenschmerzenGelsemium sempervirensetwas beschleunigt, weichdunkelrot, gedunsen, benommenzittrige Schwäche, benommen, FrostschauerEupatorium perfoliatummäßig beschleunigt, weichheiß, rotzerschlagenes Gefühl, Fieber am Morgen, Erbrechen2.2 Epidemische Krankheiten; exanthematische „Kinderkrankheiten“
Hahnemann bezeichnet als „festständige Krankheiten“ solche Krankheitsverläufe, „welche viele Menschen aus ähnlicher Ursache unter sehr ähnlichen Beschwerden epidemisch ergreifen, die dann gewöhnlich ansteckend (kontagiös) zu werden pflegen … Es sind auf gleiche Art wiederkehrende … eigenartige akute Miasmen, die den Menschen entweder nur einmal im Leben befallen, wie die Menschenpocken, die Masern, der Keuchhusten, das glatte hellrote Scharlachfieber, Mumps usw.“ (Organon, § 73).
Weit vor der bakteriologischen Ära von Robert Koch hat Hahnemann erkannt, dass ein übertragbares Agens – im Sprachgebrauch seiner Zeit als „Miasma“ bezeichnet – die Infektionskrankheiten bedingt.
Wegen der „ähnlichen Ursachen“ sind die Krankheitsabläufe weniger individuell geprägt, die Symptomatik ist nicht sehr vielfältig. Die homöopathische Therapie kann sich hier auf eine Gruppe von bewährten Mitteln stützen. Die Arzneidifferenzierung richtet sich nach dem Stadium der Krankheit und den persönlichen Begleitsymptomen. Unterscheidende Modalitäten und sonderliche Symptome treten bei diesen festständigen Krankheiten seltener auf. Trotzdem gilt auch hier, dass individuelle Symptome unbedingten Vorrang haben vor krankheitsspezifischen Merkmalen.
2.2.1 Diphtherie
Bei sicherer Diagnose oder von Anfang an schwerem Verlauf wird auch aus juristischen Gründen die heute übliche Serumtherapie zur Ergänzung der gezielten homöopathischen Behandlung empfohlen.
Übersicht
Vgl. in den Repertorien:
Hals:
KK III/269 ff. (Belag, Exsudat); KK 1403
Kehlkopf:
KK III/315 (Kehlkopf, Diphtherie); KK 1449
Nase:
KK III/179 (Schnupfen, bei Diphtherie); KK 1313
Prophylaxe
Diphtherinum
Hauptmittel
Mercuriussolubilis Mercurius cyanatus Kalium bichromicum
Komplikationen
Hohes Fieber
Paresen
Ailanthus glandulosa Gelsemium sempervirens Causticum Hahnemanni
vgl. KK I/425 (Lähmung, nach Diphtherie); KK 1959
Prophylaxe
In der ansteckungsgefährdeten Umgebung von Kranken kann man vorsorglich die spezifische Nosode anwenden:
Diphtherinum
Wirkt auch bei Komplikationen, bei Paresen und sonstigen Folgezuständen nach Diphtherie.
Anwendung: D30 Dil. oder Glob.; 1 Gabe, evtl. nach 1 Woche wiederholen.
Hauptmittel
Mercurius solubilis
Bei allen Quecksilberverbindungen ist auffallend: Es besteht starker Foetor ex ore, nächtliche Unruhe mit Schweißneigung, Mitbeteiligung der regionalen Lymphknoten, schmierig belegte Zunge mit Zahneindrücken.
Der Belag auf den Tonsillen unterscheidet sich von den anderen Quecksilberverbindungen: bei Mercurius solubilis beobachten wir einen weißlich-gelblichen Belag.
Anwendung: C6 (D12) Tabl., bei akutem Verlauf in kurzen Zeitabständen nach Methode 1.
Mercurius cyanatus
Die wesentliche Symptomatik ist entsprechend, wie sie bei Mercurius solubilis beschrieben wurde. Unterschiede: Der Allgemeinzustand ist von Anfang an stärker beeinträchtigt durch Erschöpfung und Kreislauflabilität; weiß-grauer Belag auf den Tonsillen, auch membranöse Beläge in der Umgebung der Tonsillen.
Anwendung: C6 (D12) Tabl. nach Methode 1.
Kalium bichromicum
Brennende Schmerzen. Ulzerationen auf den Tonsillen, evtl. Übergang auf die Nasenschleimhaut mit fadenziehendem Schleim und Blutbeimengungen. Geschwüre am Nasenseptum.
Anwendung: C6 (D12) Tabl. nach Methode 1.
Komplikationen
Hohes Fieber und Verschlechterung des Allgemeinzustands
Ailanthus glandulosa (vgl. auch bei Scarlatina, ▶S. 16)
Zuerst erregt und unruhig, dann stumpf, benommen, kraftlos. Missverhältnis zwischen Puls- und Temperaturkurve (wie Pyrogenium).
Gesicht gedunsen, evtl. livid oder mahagonifarben. Trockene, bräunlich-rote Zunge, starker Fötor. Durst mit Verlangen nach kaltem Wasser, obschon warmes Getränk den Halsschmerz günstig beeinflusst. Starke Schwellung um die Tonsillen; Lymphknoten geschwollen.
Anwendung: C6 (D12)/C30 Dil. nach Methode 1.
Paresen
Gelsemium sempervirens
Besonders bei Lähmung der Augenmuskeln und des Stimmbands, Zittern der Zunge beim Herausstrecken. Benommen, erschöpft.
Anwendung: C6 (D12)/C30 Dil.
Causticum Hahnemanni
Unsicherheit und Schwäche der Muskeln, besonders Unterarm und Hand mit Taubheit. Langsam zunehmende Schwäche bis zur schlaffen Lähmung.
Anwendung: C30 – C1000, Methode 2.
2.2.2 Morbilli (Masern)
Übersicht
Vgl. in den Repertorien: KK II/184; KK 590 KK I/426; KK 1960
Prophylaxe
Morbillinum
Stadium catarrhale
Euphrasia officinalis Allium cepa Sticta pulmonaria
Stadium exanthematicum
Normaler Verlauf
Pulsatilla pratensis Ferrum phosphoricum Belladonna Bryonia alba aut dioica
Komplikationen
Exanthem entwickelt sich nicht
Sulfur Ammonium carbonicum
Ernster Verlauf
Lachesis muta Ailanthus glandulosa Rhus toxicodendron
Otitis
Ferrum phosphoricum
Bronc
Antimonium tartaricum Sulfur jodatum
Kreislauflabilität
Ammonium carbonicum
Nachbehandlung
Verzögerte Rekonvaleszenz, Folgezustände, Schwäche der Infektabwehr
Morbillinum Tuberculinum bovinum
Prophylaxe
Morbillinum
Nur bei sehr schwachen Kleinkindern, die Kontakt zu Kranken haben, kann vorsorglich 1 Gabe Morbillinum D30 Dil. verordnet werden, 2 – 5 Tropfen. Diese Masern-Nosode ist auch angezeigt nach schwerem Verlauf, bei verzögerter Rekonvaleszenz, bei Folgekrankheiten (chronischer Schnupfen, Bronchitis, Asthma), nach Unterdrückung des normalen Masern-Exanthems, z. B. durch kalte Anwendungen.
Stadium catarrhale
Im Stadium catarrhale wird die Diagnose Masern meist nur bei einer Epidemie gestellt. Die uncharakteristischen Anfangssymptome werden mit Arzneien behandelt, die nach Ähnlichkeit entsprechen. Damit erreicht man einen komplikationsfreien und milden Verlauf, ohne die Immunreaktionen zu unterbrechen. (Vgl. auch Kapitel „Fieberhafter Infekt“, ▶S.4, „Schnupfen“, ▶S. 234, „Husten“, ▶S. 102).
Besonders häufig indiziert sind:
Euphrasia officinalis
Starke Konjunktivitis mit scharfem Sekret und brennenden Tränen.
Anwendung: D4/D6 Dil. nach Methode 1.
Allium cepa
Fließschnupfen mit scharfer Absonderung und viel Niesen.
Anwendung: D6/C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Sticta pulmonaria
Nase eher verstopft oder Verstopfungsgefühl, muss dauernd schnäuzen. Entzündung beginnt in der Nase und steigt die Atemwege abwärts bis in die Bronchien.
Anwendung: D6/C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Stadium exanthematicum
Bei normalem Verlauf sind die Hauptmittel Pulsatilla pratensis und Ferrum phosphoricum, seltener Belladonna und Bryonia alba aut dioica.
Pulsatilla pratensis
Dicke, gelbe, milde Sekrete im Auge, in der Nase und im Rachen. Verlangen nach frischer Luft und kühlem Raum. Oft wenig Durst, weinerlich.
Anwendung: D6/C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Ferrum phosphoricum
Nasenbluten, Kreislauflabilität, rotes Gesicht im Liegen und bei Erregung, blass beim Aufrichten, Puls weich und voll.
Otalgie oder Otitis media.
Anwendung: C6 (D12)/C30 Tabl. nach Methode 1.
Belladonna
Sehr starkes, tomatenrotes Exanthem bei kräftigen Kindern.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Bryonia alba aut dioica
Starker, schmerzhafter Husten, muss sich die Brust dabei festhalten, stechender Schmerz. Husten wird bei Eintritt in einen warmen Raum schlimmer. Trockene Schleimhäute, viel Durst.
Anwendung: D4/D6/C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Komplikationen
Nach vielfältiger Erfahrung kann man sich fast sicher darauf verlassen, dass mit Herauskommen des typischen Masern-Exanthems die Krise überwunden ist. Deshalb ist jede Unterdrückung gefährlich! Warum fiebersenkende Arzneien und kalte Wadenwickel, wenn Fieber heilt? Fieberkrämpfe treten (fast) nur bei extremer Temperatursteigerung auf.
Wenn das Exanthem sich nicht entwickelt
Sulfur
Wirkt bei Folgen von Unterdrückungen. Oft unreine raue Haut. Neigung zu Ekzemen oder Furunkeln.
Anwendung: D30/C30 ▶Tabl., 1 Gabe.
Ammonium carbonicum
Besonders bei kreislauflabilen, dicklichen Kindern mit Kurzatmigkeit und unverstärkten Rasselgeräuschen über der Lunge.
Anwendung: C6 (D12) Tabl.
Ernster Verlauf und schweres Krankheitsgefühl
Beides ist meist verbunden mit missfarbenem oder unterdrücktem Exanthem. Diskrepanz zwischen Fieber und Pulskurve.
Lachesis muta
Livides, bläulich-rotes Exanthem, hämorrhagisch.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Ailanthus glandulosa (vgl. Kapitel „Diphtherie“, ▶S.6)
Bräunliches, mahagonifarbenes Exanthem. Starke Erschöpfung.
Anwendung: C6 (D12)/D30/C30 Dil. nach Methode 1.
Rhus toxicodendron
Durchfall, starke motorische Unruhe.
Anwendung: D30/C30 Dil. nach Methode 1.
Otitis media (vgl. Kapitel „Ohr“, ▶S. 227)
Ferrum phosphoricum
Pulsierender, klopfender Schmerz. Trommelfell rot und vorgewölbt. Blasse, anämische Kinder mit lokalen Kongestionen. Neigung zu Nasenbluten.
Anwendung: C6 (D12) Tabl. nach Methode 1.
Bronchitis, Bronchioloitis, Pneumonie (vgl. Kapitel „Husten“, ▶S. 102)
Antimonium tartaricum
Allgemeine Schwäche; zu erschöpft, um den Schleim abhusten zu können. Reichliche Rasselgeräusche, aber wenig Auswurf.
Anwendung: D6/C6 (D12) Tabl. nach Methode 1.
Sulfur jodatum
Hustet noch lange Zeit nach der Krankheit.
Anwendung: D6/C6 (D12) Tabl.; 2-mal tägl. 1 Tabl.
Kreislauflabilität
Ammonium carbonicum (vgl. ▶S. 9)
Müde, matt, erschöpft; Kollapsneigung. Verträgt keine Kälte und Nässe; evtl. Nasenbluten beim Waschen; mag aber auch keine warmen Räume. Hustet mehr im warmen Zimmer und nachts (2–3 Uhr).
Anwendung: C6 (D12) Tabl.
Nachbehandlung
Verzögerte Rekonvaleszenz
Manche Kinder erholen sich nur langsam nach Masern. Hier hilft meist rasch 1 Gabe Morbillinum D oder C30 (vgl. dort).
Folgezustände
Die Masern-Nosode ist auch dienlich bei Folgezuständen nach dieser Krankheit.
Schwäche der Infektabwehr
Nach Masern tritt bei ungenügender Behandlung oder Unterdrückung eine Schwäche der Infektabwehr ein (anergische Nachphase) oder es entwickeln sich andere Krankheiten. Die Homöopathie nimmt diese zeitlichen Zusammenhänge auch als Hinweis auf eine möglich ätiologische Verbindung. Wenn Mütter bei der Erhebung der biografischen Anamnese ihres Kindes berichten: „Seitdem unser Kind die Masern hatte, erholt es sich nicht; dauernd hat es Husten und Schnupfen; es leidet an Durchfall; seitdem bekommt es Asthmaanfälle“, so können wir die Kur beginnen mit 1 Gabe von
Morbillinum
Anwendung: D30/C30
oder auf die Erfahrung der alten Ärzte zurückgreifen und als Zwischenmittel verabreichen 1 Gabe von
Tuberculinum bovinum
Anwendung: D30.
Begründung für diese Behandlung:
Tuberkulinische Kinder (vgl. Bd. 1, S. 151, Tab. 12) bekommen die Masern, sobald sich eine Infektion in der Umgebung anbietet. Diese Kinder sind nach ungestörtem Ablauf der akuten Krankheit in ihrem Gesamtzustand besser, d. h. sie haben eine günstigere Abwehrlage. Wenn aber die akute Krankheit unterdrückt wurde und das Exanthem nicht vollständig herauskam, so kümmern die tuberkulinischen Kinder besonders deutlich und benötigen die entsprechende Nosode.
2.2.3 Parotitis epidemica (Mumps)
Übersicht
Vgl. in den Repertorien:
Ohrspeicheldrüse
Entzündung:
KK II/81; KK 487
Vergrößerung:
KK II/78; KK 484
Verhärtung:
KK II/78; KK 484
Schwellung:
KK II/115; KK 521
Schmerz:
KK II/130; KK 536
Prophylaxe
Parotitis-Nosode
Hauptmittel
Barium carbonicum Mercurius solubilis (Mercurius solubilis Hahnemanni)
Komplikationen
Orchitis, Mastitis
Pulsatilla pratensis
KK II/81 (Entzündung, Parotis, metastasierend zum Hoden, Mamma), KK 487
Prophylaxe
Wird mit der Parotitis-Nosode durchgeführt.
Anwendung: 1 Gabe D30/C30 Dil.
Hauptmittel
Barium carbonicum
Besonders im Kleinkindalter und bei Neigung zu Erkältungen und Vergrößerung der Tonsillen indiziert. Starke Mundtrockenheit.
Anwendung: C6 (D12)/C30 Tabl.
Mercurius solubilis
Hier dagegen reichliche übel riechende Salivation. Nächtliche Schweiße und Unruhe.
Anwendung: C6 (D12) – C30 Tabl.
Komplikationen
Am häufigsten ist die Ausbreitung mit Entzündung der Hoden und der Brustdrüse (Orchitis, Mastitis), seltener tritt eine Pankreatitis oder Meningitis auf.
Orchitis und Mastitis
Pulsatilla pratensis
Spannende, ziehende Schmerzen, die sich vom Bauch über den Samenstrang zu den Hoden ausdehnen. Schwellung und brennende Schmerzen der Hoden.
Knoten in der Mamma mit ausstrahlendem Schmerz zum gleichseitigen Arm. Bei Fieber ausgeprägtes Frösteln, auch im warmen Raum; aber kein Durst.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Bei allen anderen Komplikationen erreicht man oft eine schnelle Besserung durch Eigenblut-Nosode C5 Dil. (Imhäuser 1995).
Herstellung: Wegen der technisch einfachen Methode stelle ich Einglaspotenzen nach Korsakoff her (vgl. Bd. 1, S. 25).
Man nehme 0,1 ml Patientenblut (Vene oder Fingerbeere), fülle mit 30 %igem Alkohol bis 10 ml auf, verschüttele und potenziere von diesem Ausgangsmaterial weiter bis zur C5. Davon 3-mal täglich 3 – 5 Tropfen, etwa 3 Tage lang.
2.2.4 Pertussis (Keuchhusten)
Für die Arzneiwahl sind folgende Zeichen und Symptome besonders wichtig:
zeitlicher Ablauf der Anfälle
Modalitäten der Auslösung oder Verschlimmerung
Gesichtsfarbe im Anfall
Beschaffenheit des Schleimes
Begleitsymptome (Konkomitanzien)
Übersicht
Vgl. in den Repertorien: KK III/390; KK 1524
Prophylaxe
Pertussinum
Stadium catarrhale
Echinacea angustifolia
Stadium convulsivum
Rotes Gesicht – wenig Schleim
Belladonna Arnica montana Drosera rotundifolia Mephitis putorius
Rotes Gesicht – mit Schleim
Coccus cacti Corallium rubrum
Blasses oder blaues Gesicht
Ipecacuanha Cuprum metallicum oder arsenicosum
Folgekrankheiten
Pertussinum
Prophylaxe
In der Umgebung eines Kranken kann man mit der Keuchhusten-Nosode (Pertussinum) vorsorglich behandeln und manchen Krankheitsfall kupieren oder einen milden Verlauf erreichen. Bei Verdacht oder bei ähnlich verlaufenden Anfällen von Krampfhusten sollte man rechtzeitig diese Arznei verordnen.
Anwendung: 1 Gabe D oder C30 Dil.
Stadium catarrhale
Außerhalb einer Epidemie ist die Diagnose im ersten uncharakteristischen Stadium nur selten zu stellen; hinweisend ist Leukozytose über 15000. Die Arzneiwahl richtet sich in dieser Phase nach den charakteristischen Symptomen und Zeichen des Kranken (vgl. Kapitel „Husten“, ▶S. 102).
Stadium convulsivum
Durch Beobachtung des Kranken oder Befragung der Angehörigen lässt sich die Gesichtsfarbe im Anfall, die Schleimmenge und Beschaffenheit meist sicher ermitteln. Mit diesen auffallenden Zeichen lassen sich drei Gruppen von Kranken mit ihren dazugehörigen Arzneien bilden.
Rotes Gesicht, trockener Husten, wenig oder kein Schleim
Bei der ersten Gruppe ist im Anfall das Gesicht rot, aber es handelt sich um einen trockenen Krampfhusten mit wenig oder fast keinem Schleim.
Belladonna
Tomatenrotes Gesicht, trockener, bellender Husten. Erregte, kräftige Kinder mit weiten Pupillen. Weint vor dem Anfall, hält Brustkorb fest – dies entspricht der typischen Modalität von Belladonna: Schmerzen schlimmer durch Erschütterung.
Anfälle schlimmer nach erstem Schlaf, vor Mitternacht, beim Erwachen, durch Bewegung. Weinen beim Berühren des Kehlkopfs.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Arnica montana
Tiefrotes Gesicht; heißer Kopf, kalte Extremitäten. Blutungs neigung: blutiger Auswurf und Nasensekret, subkonjunktivales Hämatom. Weint vor dem Anfall, fühlt den Anfall kommen, hält Hand aufs Herz; weint nach dem Anfall.
Anfälle schlimmer vor Mitternacht, durch Ärger und Bewegung.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Drosera rotundifolia
Purpur rotes bis zyanotisches Gesicht. Blutungsneigung; oft Nasenbluten, manchmal blutiger Schleim. Erbrechen von Speise. Erstickungsgefühl, aber keine Erschöpfung nach Anfall. Kinder spielen bald weiter.
Typische Verschlimmerungszeit: 10 – 1 Uhr.
Anwendung: C6 (D12) Tabl. 3-mal tägl. und 1 Tabl. nach dem Anfall.
Mephitis putorius
Blau rotes Gesicht, zyanotisch. Heftige, erstickende Anfälle. Nach dem Anfall schreit das Kind auf. Evtl. Schmerz im Genitalbereich bei Husten, fasst nach Geschlechtsteilen. Erbrechen.
Anfälle schlimmer vor und bis Mitternacht, im Liegen, 2 Stunden nach Schlaf; besser im kalten Zimmer und durch kalte Waschungen.
Anwendung: D6/C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Rotes Gesicht, reichlich Auswurf
Bei der zweiten Gruppe ist im Anfall das Gesicht rot mit reichlich Schleim auswurf.
Coccus cacti
Purpur rotes Gesicht, viel Rasselgeräusche. Erstickende Anfälle enden mit Erbrechen oder Aushusten von zähem, fädigem Schleim. Schleim kann aus dem Munde hängen.
Anfälle schlimmer durch Wärme, warme Getränke; besser durch Kälte, kaltes Getränk.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Corallium rubrum
Purpur rotes Gesicht. Schnappt schon vor dem Anfall nach Luft. Hustenanfälle folgen rasch aufeinander. Aushusten von zähem, fadenziehendem Schleim. Oft Nasenbluten mit großer Erschöpfung. Anfälle schlimmer durch kalte Luft.
Anwendung: C6 (D12) Tabl. nach Methode 1.
Blasses Gesicht wird blau
Bei der dritten Gruppe passt die alte volkstümliche Bezeichnung: blauer Stickhusten. Im Anfall ist das Gesicht zuerst blass und wird bald blau; die Patienten sind bei ihren Anfällen sehr erschöpft.
Ipecacuanha
Blasses Gesicht, kalter Schweiß, Zyanose im Anfall oder nur kurze Röte. Brechwürgen bei sauberer Zunge. Hörbares Rasseln, aber meist kein oder wenig Schleimauswurf.
Nasenbluten, evtl. blutig gestreifter Auswurf. Nach dem Anfall erschöpft, erholt sich aber rasch.
Anwendung: D6/C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Cuprum metallicum oder arsenicosum
Sehr erschöpft, blass, im Anfall blaues Gesicht. Hände und Füße kalt, evtl. blau. Schwere, lang dauernde Anfälle und lange Pausen. Anfall endet mit Erbrechen, nach dem Anfall sehr erschöpft. Oft Krampfanfälle, krampfige Zuckungen, tonischklonische Krämpfe; Anfälle schlimmer nachts und besser durch kalte Getränke.
Anwendung: D oder C30 Tabl. nach Methode 1.
Folgekrankheiten
Bei Folgekrankheiten, die im zeitlichen Zusammenhang mit einem Keuchhusten aufgetreten sind, erreichen Sie oft einen entscheidenden Erfolg mit einer Zwischengabe von
Pertussinum
Anwendung: C30 (D30) und nach 10 Tagen einmal C200 (D200) Tabl.
Fragen Sie in der biografischen Anamnese bei Asthmakranken regelmäßig nach früheren Infektionskrankheiten! Öfter wird berichtet, dass das Asthma nach einem Keuchhusten aufgetreten sei.
2.2.5 Rubeolae (Röteln)
Wegen des kurz dauernden und milden Verlaufs kommen die meisten Erkrankten gar nicht zur Behandlung. Die manchmal schmerzhaften Schwellungen der Lymphknoten, besonders im Nackenbereich und hinter den Ohren, reagieren meist rasch auf Apis mellifica, Belladonna oder Barium carbonicum.
Übersicht
Vgl. in den Repertorien: KK II/301 (Schwellung Nackendrüsen); KK 707 KK III/94 (Schwellung hinter dem Ohr, Lymphdrüsen); KK 1228
Apis mellifica
ist indiziert bei stechenden Schmerzen im Bereich der Schwellung mit großer Empfindlichkeit gegen Berührung; verlangt kühlen Umschlag, denn Wärme ist nicht angenehm. Trotz trockenen Halses meist wenig Durst.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Belladonna
Heftiger, rascher Beginn des Infekts mit rotem Gesicht. In dieser Weise reagieren meist vollblütige, lebhafte Kinder mit weiten Pupillen. Klopfende Schmerzen im Bereich der geschwollenen Drüsen. Im Gegensatz zu Apis mellifica möchten diese Patienten lieber warme Packungen oder einen warmen Schal.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Barium carbonicum
Charakteristisch ist die auffallende Härte der Lymphknoten. Meist lymphatische Kinder mit Frostigkeit und Abneigung gegen Zugluft, gleichzeitig ausgeprägte Erkältungsneigung.
Anwendung: C6 (D12)/C30 (D30) Tabl.
Die höhere Potenz bei personaler Übereinstimmung: zu kleine oder körperlich und geistig retardierte Kinder mit schüchternem, ängstlichem Charakter.
Der milde Verlauf der akuten Krankheit im Kindesalter steht im krassen Gegensatz zur Gefahr bei einer Infektion in den ersten Schwangerschaftswochen. Diese Embryopathien sollten Anlass zur intensiven Beobachtung und Forschung sein – vielleicht kennen wir andere Folgekrankheiten dieser Virusinfektion noch nicht, da sie eine lange Latenzzeit haben können. (Vgl. Slow Virus Infections)
Der immer noch so moderne Hahnemann hat durch die Miasmalehre seine Schüler und Nachfolger sensibilisiert, auf diese pathogenetischen oder ätiologischen Zusammenhänge zwischen Infektion und Nachkrankheit zu achten. Aus diesem Grunde hat er uns auch geraten, die Behandlung eines Infekts mit 1 Gabe Sulfur C30 abzuschließen. Wegen möglicher Folgekrankheiten sollten wir es erst recht nach den Röteln tun.
2.2.6 Scarlatina (Scharlach)
Die Besprechung der homöopathischen Scharlachbehandlung hat nicht nur historisches Interesse – die Erfolge sind und bleiben auch in unserer Zeit gut. Trotzdem rate ich – auch aus juristischen Gründen – die Vor- und Nachteile der Antibiotikabehandlung im Einzelfall recht genau abzuwägen. Bei Komplikationen oder Folgekrankheiten, die auch trotz Antibiotikatherapie auftreten können, sollten Sie aber mit allem Nachdruck die homöopathische Therapie einsetzen.
Übersicht
Vgl. in den Repertorien: KK II/189; KK 595
Prophylaxe
Belladonna
Normaler Verlauf
Belladonna
Komplikationen
Exanthem kommt nicht
Sulfur
Exanthem geht zurück
Zincum metallicum
vgl. KK II/189; KK 595 (zurückgehend)
Ernster Verlauf
Lachesis muta Ailanthus glandulosa Baptisia tinctoria Phosphorus
Rheumatische Schmerzen
Phytolacca decandra
Nierenbeteiligung
Apis mellifica
KK III/718; KK 1852 (Urin, Eiweiß, nach Scharlach)
Natrium sulfuricum Phosphorus Berberis vulgaris
Folgekrankheiten
Scarlatinum
vgl. KK I/438; KK1972
Anhaltende Erschöpfung
Ammonium muriaticum
Chronische Otitis
Aurum metallicum
vgl. KK III/80; KK 1214 (Absonderung nach Sch.) KK III/134; KK 1268 (schwerhörig, nach Scharlach)
Tellurium metallicum
Prophylaxe
In der Umgebung von scharlachkranken Kindern hat sie sich bewährt. Entsprechend der Empfehlung von Hahnemann wenden wir Belladonna C30 (D30) Dil. oder Glob. an, 3 Tage nacheinander jeweils 3 – 5 Tropfen oder 3 Globuli. Leider kam seine Methode in Misskredit, da seine Zeitgenossen die Beschränkung der Belladonna-Wirkung auf das „glatte Sydenham'sche Scharlachfieber“ übersahen und die Indikation auch auf andere Infekte mit einem roten Exanthem ausdehnten.
Normaler Verlauf
Sehr oft stimmt die Symptomenähnlichkeit bei den meisten Kranken überein mit dem Arzneimittelbild von
Belladonna
Glattes, tomatenrotes Exanthem und Enanthem; typische grellrote Zunge. Tonsillitis mit Schwellungsgefühl, evtl. klopfender Schmerz mit Verschlimmerung durch kaltes Getränk, obschon oft Verlangen nach etwas Kaltem besteht. Heißes, rotes Gesicht, hochfieberhaft mit vollem hartem Puls, klopfende Karotiden.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Komplikationen
Exanthem kommt nicht oder geht zurück
Wenn das Exanthem nicht richtig herauskommt oder unterdrückt wird, kann man mit einer Gabe
Sulfur
etwas provozieren.
Anwendung: C30 (D30) Tabl. oder Glob.
Bei schwachen, erschöpften, besonders anämischen Patienten geht manchmal schon nach wenigen Stunden der Ausschlag zurück. Geben Sie in dieser Situation
Zincum metallicum
Anwendung: C30 (D30) 1 Tabl. oder 3 Glob.
Ernster Verlauf
Ein kritischer Verlauf der Krankheit zeigt sich durch Unruhe, Erregung, Schwäche, durch Diskrepanz zwischen Fieber und Pulskurve oder durch ein missfarbiges Exanthem. In solchen ernsten Fällen kommen folgende Mittel in Frage:
Lachesis muta
Livide Haut und Schleimhaut, evtl. hämorrhagisches Exanthem. Nächtliche Angst. Angina stärker links oder beginnt links und breitet sich nach rechts aus. Wärme verschlechtert das Allgemeinbefinden.
Anwendung: C6 (D12)/C30 (D30) Dil. nach Methode 1.
Ailanthus glandulosa
Bräunlich-rotes, mahagonifarbenes Exanthem. Starke Erschöpfung. Hals sehr geschwollen. Zunge wird trocken und bräunlich-rot.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Baptisia tinctoria
Benommen und unruhig. Übler Mundgeruch. Kann nur trinken, schluckt keine feste Nahrung. Verlangen nach frischer Luft.
Anwendung: C6 (D12)/C30 (D30) Dil. nach Methode 1.
Phosphorus
Hämorrhagisches Exanthem, sehr rasche Entwicklung des kritischen Zustands. Furcht beim Alleinsein, unruhig oder apathisch.
Anwendung: C6 (D12) – C30 (D30) Dil. nach Methode 1.
Rheumatische Schmerzen
Phytolacca decandra
Schießende, wandernde Schmerzen in den Gelenken. Fieber mit Frostschauer und Erschöpfung. Schmerzen verstärkt bei feuchtkaltem Wetter, durch Abkühlung, bei Bewegung; besser durch Wärme, bei trockenem Wetter, in der Ruhe. Tonsillen rot, geschwollen, evtl. brennende Schmerzen, Schluckschmerzen, Schmerzen strahlen in die Ohren aus. Zunge an der Spitze rot.
Anwendung: D6/C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Nierenbeteiligung
Apis mellifica
Ödeme, allgemein und um die Augen. Urin spärlich, dunkel, evtl. brennender Schmerz am Ende der Miktion. Wenig Durst. Tonsillen feurig-rot, gedunsen, Uvula-Ödem, stechende Schmerzen.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Natrium sulfuricum
Ödeme, allgemein und um die Augen. Urin reichlich, viel Urobilinogen, Ziegelmehlsediment.
Sykotisches Mittel: alles schlechter bei feuchtem Wetter und Feuchtigkeit.
Anwendung: C6 (D12) – C30 Tabl. nach Methode 1.
Phosphorus
Hämaturie, Albuminurie; Urin trüb, dunkel, Ziegelmehlsediment. Plötzlicher Beginn der Komplikation; sehr erschöpft bis zur Ohnmacht. Überempfindlich gegen meteorologische Einflüsse, gegen Licht, gegen Musik und starke, auch angenehme Gerüche.
Das Exanthem zeigt meist strichförmige Hämorrhagien, evtl. Nasenbluten.
Anwendung: C30 (D30) Dil. oder Glob. nach Methode 1.
Berberis vulgaris
Im Urin viel Schleim, Brennen beim Urinieren. Ausstrahlende Schmerzen vom Nierenlager und von der Blase in Lenden und Oberschenkel.
Besonders indiziert, wenn gleichzeitig oder im Wechsel Nieren-, Leber- und rheumatische Beschwerden auftreten.
Anwendung: D3 Dil., 4-mal tägl. 5 Tropfen.
Folgekrankheiten
Auch bei Folgekrankheiten nach Scharlach können viele der schon besprochenen akuten Mittel angezeigt sein. Einen speziellen Hinweis finden Sie in den Repertorien. Diese Reihe (KK I/438; KK 1972) müsste noch ergänzt werden durch die Scharlach-Nosode:
Scarlatinum
Verordnung nach der Ätiologie – keine unterscheidenden Merkmale bekannt.
Anwendung: C30/C200 Dil. in einzelnen Gaben.
Lange anhaltende Erschöpfung nach überstandenem Scharlach
Ammonium muriaticum
Kleiner, schwacher, aber beschleunigter Puls mit der Empfindung, als koche es in den Adern (wie Aurum metallicum), Pulsationsgefühl. Passt besonders bei Patienten mit weichem, schwammigem Gewebe, Neigung zu Adipositas; Frostigkeit, Kälteschauer, beim Erwachen um 18 Uhr; besonders Kältegefühl zwischen den Schulterblättern. Abneigung gegen feuchtkaltes Wetter. Katarrhalische Zustände im Nasen-Rachen-Raum; Leberbeschwerden mit trockenem, bröckeligem Stuhl.
Anwendung: C6 (D12) Dil.
Chronische Otitis
Die chronische Otitis nach Scharlach mit randständigem Trommelfelldefekt und lang dauernder Sekretion lässt sich mit homöopathisch indizierten Arzneien öfter doch noch trocken bekommen, sodass später eine Plastik möglich ist.
Aurum metallicum
Hartnäckiger, stinkender, reichlicher Ohrenfluss. Brennende, stechende Schmerzen, bohrende Schmerzen im Mastoid, Jucken im Gehörgang.
Anwendung: Reihe von C30 – C200 Tabl.
Tellurium metallicum
Übel riechende, scharfe Sekretion, riecht wie Fischlake, pulsierender Schmerz.
Anwendung: Reihe von C30 – C200 Tabl.
2.2.7 Varicellae (Windpocken)
Vgl. KK II/192; KK 598 (Windpocken)
Für die Beurteilung dieser Virusinfektion gelten ähnliche Überlegungen, wie ich sie im Kapitel „Rubeolae“ (vgl. ▶S. 14) angedeutet habe. Diese Gedanken gewinnen mehr Aktualität, seitdem neuere Forschungen die Identität zwischen Zosterund Varizellenviren belegen.
Hauptmittel
Eigenblut-Nosode (nach Imhäuser)
Anwendung: C6 (D12) Dil., 3 Tage nacheinander morgens 3 Tr.
Herstellung: siehe Kapitel „Parotitis“, ▶S. 11.
Variolinum (Pocken-Nosode)
Besonders indiziert bei stark gestörtem Allgemeinbefinden und Nacken-, Kopfschmerzen.
Anwendung: C30 Dil. nach Methode 1.
Rhus toxicodendron
Besonders indiziert bei Bläschenbildung mit brennendem Jucken, Bläschen werden nach Kratzen rasch eitrig.
Anwendung: C30 (D30) Dil. oder LM VI Dil.
Verzögerte Abheilung besonders bei hautempfindlichen Patienten und zur Schlussbehandlung
Sulfur C30
1 Gabe C30, evtl. nach einer Woche 1 Gabe C100.
3 Schwindel
Hinter dem Symptom „Schwindel“ stehen bekanntermaßen verschiedene Grundkrankheiten, deren Behandlung hier nicht erörtert werden soll.
Die fast nicht überschaubare Zahl von Arzneimitteln, die bei der Arzneiprüfung Schwindel auslösen, macht es nötig, dass wir chronische Fälle repertorisieren.
Übersicht
Vgl. KK I/153 – 171; KK 153 – 171
Argentum nitricum Arnica montana Cocculus indicus Conium maculatum Tabacum Theridion curassavicum Veratrum album
Argentum nitricum
Lebt in ständiger Unruhe und Angst; Angst vor kommenden Ereignissen. Schwindel mit zittriger Schwäche der Beine, Unsicherheit beim Gehen, besonders im Dunkeln; schlimmer beim Schließen der Augen.
Schwindel in der Höhe; bei phobischen Ängsten; beim Anblick hoher Häuser; in engen Straßen, mit Angst, dass die Häuser auf ihn fallen; beim Blick in die Tiefe (Hochhaus-Syndrom); beim Überqueren eines Flusses, dabei gelegentlich Impuls, sich in den Abgrund zu stürzen.
Anwendung: C30 – C200 Tabl.; LM VI – XXX Dil.
Arnica montana
Nach Kopftraumen (Commotio, Contusio) kommt es zu Schwindelanfällen, die durch Bewegung des Kopfes schlimmer werden. Schwindel schlimmer bei Lagewechsel, beim Aufstehen, bei Kopfbewegungen, beim Gehen. Drehschwindel (wie im Kreis herum) mit Fallneigung.
Allgemeines Zerschlagenheitsgefühl. Bett erscheint zu hart. Oft uneinsichtige Patienten, die sich über die Schwere ihres Krankheitszustands nicht klar sind; schicken den Arzt oder Pfleger oder Hilfspersonen weg, da sie nicht krank seien.
Anwendung: C30, C200 Dil.
Cocculus indicus
Schwindel tritt meist zusammen mit großer Erschöpfung, Schwäche und Übelkeit auf.
Schwindel wird schlimmer durch Bewegungen, beim Fahren; durch Mangel an Schlaf (Nachtwachen; Schwestern-Mittel!); durch Lärm, durch Erschütterung; beim Aufrichten aus der Waagerechten, durch Sonne.
Schwindel bei Hinterkopfschmerzen mit Empfindung, als ob der Hinterkopf sich öffne und schließe, als ob die Augen nach vorn gezogen würden. Sehr wichtiges Mittel auch bei der Kinetose.
Anwendung: C30/C200 Dil.; LM VI – XVIII Dil.
Conium maculatum
Lähmungsartige Schwäche der Beine. Toxische Dosen machen eine von den Beinen bis zum Herzen fortschreitende Lähmung. Beispiel: Vergiftungstod des Sokrates.
Drehschwindel, als ob sich das ganze Bett herumdrehen würde. Schwindel schlimmer bei Lageveränderungen, beim Umdrehen, besonders beim Seitwärtsdrehen des Kopfes, beim Seitwärtsschauen. Muss sich mit den Augen ganz gerade halten, im Raum festhalten; deshalb wird der Schwindel schlimmer bei geschlossenen Augen. Schwindel bei alten, geschwächten Menschen.
Anwendung: C6 (D12) – C30 Dil.; LM VI – XVIII Dil.
Tabacum
Zum Sterben übel bei Schwindel. Schwindel mit Kollapsgefühl; eingefallenes Gesicht, blass, grüngelb, kalter Schweiß. Brechreiz bis zum Erbrechen. Schwindel wird schlimmer durch jede Bewegung, durch Fahren, durch Wärme – paradox: will sich aufdecken und entblößen, obwohl er selber sehr kalt ist. Schlimmer durch Öffnen der Augen. Oft wichtiges Mittel bei Kinetose, bei Morbus Ménière, bei Intoxikationen durch Tabakabusus.
Anwendung: C30/C200 Dil.; LM VI-XVIII Dil.
Theridion curassavicum
Schwindel mit Übelkeit. Nervöse, ängstliche Unruhe. Plötzliche Schwäche mit Kälte des Körpers, Zittern. Sehr geräuschempfindliche Patienten. Lärm schmerzt im Körper und Lärm löst Schwindel aus. Schwindel schlimmer bei geringster Bewegung, beim Schließen der Augen. Schwindel bei Kinetose, bei Morbus Ménière.
Anwendung: C30/C200 Dil.; LM VI – XVIII Dil.
Veratrum album
Schwindel mit Kreislaufkollaps und Kälte. Bei Menschen mit niedrigem Blutdruck kommt es zu taumeligem Schwindel mit Unsicherheit beim Gehen. Schwindel schlimmer beim Gehen und besser beim Hinlegen, besonders bei Kopftieflage, besser durch Wärme und warme Getränke.
Anwendung: D4 – C30 Dil.
MEMO
Augenschließen verschlimmert den Schwindel bei Conium maculatum, Argentum metallicum, Theridion curassavicum. Augenöffnen verschlimmert bei Tabacum.
4 Kinetose
Vgl. auch Kapitel „Schwindel“, ▶S. 18.
Unsere Patienten, die an Kinetose leiden, lassen sich in zwei Gruppen einteilen, denen man entsprechende Arzneien zuordnen kann.
Bei der ersten Gruppe fällt auf, dass die krankhafte Sensibilität gegen Fahrbewegungen zu einer Mitreaktion im Kreislaufsystem führt. Diese Reaktion zeigt Erscheinungen, die an einen hypotonen Kollaps erinnern: die Kranken sind kalt, blass, haben kalten Schweiß; sie sind im Allgemeinen geschwächt, hinfällig und fühlen sich sehr elend. Die voll entwickelte Seekrankheit verläuft in dieser Form. Die Patienten berichten, dass es ihnen bei jeder Seefahrt oder Autotour sterbenselend sei, dass sie kalt, schwach, hinfällig und sehr blass werden.
Die zweite Gruppe reagiert „gelassener“ auf die Fahrbewegungen. Es tritt kein Kollaps auf und die Patienten erholen sich rascher nach Stillstand des Fahrzeugs.
Übersicht
Vgl. in den Repertorien Fahren verschlechtert: KK I/499; KK 203 Angst (Furcht) beim Fahren: KK I/5; KK 5 – beim Abwärtsfahren: KK I/5; KK 5 Übelkeit beim Fahren: KK III/476; KK 1610 Erbrechen beim Wagenfahren: KK III/455 (Fahren im Wagen); KK 1589 Seekrankheit: KK I/520; KK 2054
Mit Kreislaufreaktionen
Cocculus indicus Colchicum autumnale Tabacum Theridion curassavicum
Ohne Kreislaufreaktionen
Borax veneta Cinnamomum ceylanicum Petroleum Symphoricarpus racemosus
Mit Kreislaufreaktionen
Cocculus indicus (vgl. auch ▶S. 18)
Auffallend starker Schwindel mit Schwäche, Erschöpfung fast bis zum Kollaps und Übelkeit. Muss sich legen, da das Aufrichten aus der Waagerechten den Schwindel verstärkt. Hält sich ganz still und will nicht sprechen – verträgt Fahren besonders schlecht nach Schlafmangel (wie Colchicum).
Anwendung: C30 Glob.
(Alkoholische Tropfen verstärken manchmal schon die Übelkeit.)
Colchicum autumnale
Auffallende starke Überempfindlichkeit gegen Gerüche. Rauch, Benzin, Parfüm, Essensgerüche, ja schon der Anblick von Essen verstärken die Übelkeit. Im Auto besser bei offenem Fenster, mit Schiebedach; während einer Schiffsreise sind sie lieber auf Deck. Innere Kälte, Kollapsneigung, Erschöpfung. Verträgt Fahren besonders schlecht nach ungenügendem Schlaf, nach Nachtwachen, nach intensivem Studium (wie Cocculus indicus).
Anwendung: C30 Glob.
Tabacum (vgl. ▶S. 18)
Blass bis grüngelb vor Elendigkeit; kalt mit kaltem Schweiß. Paradox zu dieser Kälteempfindung: will keine Wärme, öffnet die Kleidung, deckt sich auf, verlangt frische, kühle Luft. Muss beim Fahren die Augen geschlossen halten, sonst wird die Übelkeit noch stärker.
Anwendung: C30 Glob.
Theridion curassavicum
Starkes Erbrechen, extrem lärmempfindlich. Muss die Augen offen lassen, besser, wenn er sich „mit den Augen festhält“. Plötzliche Schwäche mit Kälte des Körpers.
Anwendung: C30 Glob.
Ohne Kreislaufreaktionen
Bei der zweiten Gruppe finden wir keine Kollapserscheinungen, obschon Übelkeit und Erbrechen ebenso vorhanden sind.
Borax veneta
Übelkeit bei Abwärtsbewegungen. Übelkeit verstärkt sich im sehr weich gefederten Auto, bei welliger Straße, bei Fahrten ins Tal hinab; im Flugzeug verschlechtern Luftlöcher mit Absacken nach unten; im Schiff sind tiefe Wellentäler ein Gräuel. – Sehr empfindlich gegen plötzliche Geräusche (vgl. Theridion curassavicum: empfindlich gegen Lärm), gegen Rauch und warmes Wetter.
Anwendung: D6 – C30 Glob.
Cinnamomum ceylanicum
Übelkeit bessert sich rasch, sobald das Fahrzeug hält (Voisin). Übelkeit und Aufstoßen von Luft.
Anwendung: C6 (D12) Dil.
Petroleum
Verlangt trotz Übelkeit zu essen. Dieses paradoxe Symptom gewinnt noch mehr an Bedeutung durch die meist sehr ausgeprägte und beständige Übelkeit, solange sich das Fahrzeug bewegt. Im Mund Zusammenlaufen von Wasser bei erhaltenem Appetit; Essen bessert.
Anwendung: C30 Glob.
Symphoricarpus racemosus
Starker Widerwille gegen Speisen. Dieses Symptom ist gerade entgegengesetzt zu Petroleum. Auffallend ist die Zunahme der Übelkeit durch Gerüche und Besserung bei ruhiger Rückenlage.
Anwendung: C6 (D12) Glob.
5 Haut
Nach den Gesetzen der Heilung (Hahnemann, Hering) geht die Gesundung von innen nach außen. Erst soll das Innere und das Allgemeine bei unseren Patienten besser werden und zuletzt die Hauterkrankung ausheilen. Deshalb ist eine primär auf die Haut gerichtete lokale Therapie sowohl unsinnig wie unnatürlich.
Die folgenden Hinweise sollen die Arzneifindung mithilfe der Gesamtheit der Symptome unter Einschluss der so wichtigen Hautphänomene erleichtern. Die Morphe der Hauterkrankung ist das sichtbare Spiegelbild der inneren krankhaften Veränderungen. Die Hautsymptome haben für die Arzneiwahl eine höhere Rangordnung, als sonst lokalen oder pathognomonischen Symptomen zugestanden wird (vgl. Bd. 1, S. 170 ff.).
Die Morphe der Hauterkrankung weist auf die besondere Form der chronischen Krankheit, wie Hahnemann beobachtet hat:
Entzündliche Hautreaktionen gehören zum psorischen Formenkreis.
Proliferative, wuchernde Prozesse sind typisch für den sykotischen Formenkreis.
Destruktive, zerstörende Entwicklungen kennzeichnen den luesinischen Formenkreis.
Die folgende Übersicht der einzelnen Krankheitsformen mit ihren zugehörigen und oft bewährten Arzneimitteln entspricht diesem Hahnemann'schen Ordnungsprinzip der chronischen Krankheiten.
Dieses Grundprinzip sollte aber nicht als starres Schema betrachtet werden. Eine Phase geht oft in die andere über, außerdem gibt es Mischformen. Krankheit ist stets ein Entwicklungsprozess. Diese Entwicklung erkennen wir am pathophysiologischen Ablauf von Entzündungsprozessen an der Haut: Die akute Entzündung verläuft oft vom Stadium des Erythems über Ödem und Blasenbildung zur Exsudation und Eiterung. Chronische Entzündungen produzieren Wucherungen und im Endzustand tiefe Geschwüre.
5.1 Entzündliche Hauterkrankungen
5.1.1 Grundformen der Entzündungsphasen und ihre Hauptmittel
Entzündungen einer Hautpartie laufen in drei Phasen ab:
Rötung,
Quaddeln oder Blasen,
Eiterungen.
In diesen drei Grundformen erkennen wir den pathophysiologischen und zeitlichen Ablauf von Entzündungen, denen entsprechende Arzneimittel zugeordnet werden. Aufgrund der phänomenologischen Ähnlichkeit können wir diese Arzneien auch bei Hautkrankheiten mit unterschiedlicher diagnostischer Benennung anwenden.
Wer sich an dieser phänomenologischen Zuordnung stört, möge daran denken, dass die Dermatologie schon immer, bis zum heutigen Tag, aufgrund von Erfahrungen die gleiche Therapie bei oft sehr unterschiedlichen Hautkrankheiten anwendet: Zink, Schwefel, Teer, Cortison.
Übersicht
Aktive Hyperämie
Erythem
Aconitum napellus Belladonna
Exsudation
Ödem, Quaddel
Apis mellifica
Blase
Rhus toxicodendron Cantharis vesicatoria
Eiterung
Hepar sulfuris Sulfur Silicea terra
5.1.2 Aktive Hyperämie
Erythem
Die aktive Hyperämie ist die erste Phase der Entzündung. Die Haut ist heiß, rot, schmerzhaft. Entsprechende Arzneien sind:
Aconitum napellus
Erstes Mittel bei plötzlichem Beginn einer Entzündung. Haut ist heiß, trocken, rotfleckig, evtl. Brennschmerz.
Anwendung: C6 (D12) Dil., C30 Glob.
Belladonna
Folgt oft gut nach Aconitum napellus, sobald die Haut schweißig wird und klopfender Schmerz auftritt. Die Haut ist glatt, kräftig rot (tomatenrot) oder auch Scharlachröte.
Anwendung: C6 (D12) Dil.
5.1.3 Exsudation
In der zweiten Phase der Entzündung kommt es zum Austritt von Serum zwischen die Hautzellen – erkennbar an Ödem, Quaddel oder Blase. Die Hauptmittel für diese Phasen sind:
Ödem, Quaddel
Apis mellifica
Verstärkte Schwellung durch Lymphansammlung, dadurch hellrot.
Stechender Schmerz, brennende Hitze (wie bei Bienenstich), sehr berührungsempfindliche Haut, besser durch Kühle.
Anwendung: C6 (D12) Dil.
Blase
Rhus toxicodendron
Bei Berührung der Blätter dieser Pflanze (Gift-Efeu) zuerst Brennen und Jucken der Haut, dann erysipelartige Rötung, Schwellung und besonders Bildung von Bläschen und Blasen. Umgebung der Bläschen ist rot, Bläschen gehen oft an der Spitze in Eiterung über. Schmerzen und Jucken schlimmer durch Kälte und Nässe.
Anwendung: C30 (D30) Dil.
Cantharis vesicatoria
Vor allem angezeigt bei größeren Blasen mit wenig geröteter Umgebung. Starker Brennschmerz, besser durch kalte Anwendungen.
5.1.4 Eiterung
In dieser Phase wirken die typischen Eiterungsmittel.
Hepar sulfuris
Neigung zu eitriger Entzündung bei geringfügigen Verletzungen. Stechender, splitterartiger Schmerz an entzündeten Stellen. Frostiger Patient mit Neigung zu übel riechenden Schweißen.
Anwendung: C30 – C200 Tabl.
Sulfur
Raue, ungesunde, schuppige Haut mit Eiterungsneigung. Haut juckt und brennt, schlimmer durch Waschen. Beim Kratzen geht das Jucken in vermehrtes Brennen über. Sulfur bringt früher unterdrückte Hautleiden wieder an die Oberfläche.
Anwendung: C6 (D12) – C30 (D30) Tabl.
Silicea terra
Kalter, frierender Patient mit Eiterungsneigung bei kleinen Verletzungen. Träge, lang dauernde, übel riechende Eiterung. Fisteln.
Anwendung: C6 (D12) – C30 Tabl.
5.2 Klinische Indikationen
5.2.1 Lokale Hyperämie
Die Kenntnis der Grundformen mit ihren zugeordneten Mitteln ist die Grundlage zur Verordnung bei bestimmten klinischen Krankheitsbildern.
Die vielfachen Formen von Erythemen – von der Scharlachhaut über Sonnenbrand bis zum Erysipel – verlangen oft die gleichen Mittel: Aconitum napellus und Belladonna.
5.2.2 Erysipel (Wundrose)
Übersicht
Vgl. in den Repertorien: KK II/177; KK 583
Glatte und rote Haut
Aconitum napellus Belladonna
Livide Farbe
Lachesis muta
Hellrote und ödematöse Haut
Apis mellifica
Mit Blasenbildung
Euphorbium officinarum Rhus toxicodendron
Mit Schrunden
Graphites naturalis
Rezidive
Streptococcinum
Glatte und rote Haut
Aconitum napellus
Plötzlicher Beginn mit hohem Fieber und Schüttelfrost.
Folge von kaltem Wind, Ärger, Schreck. Haut glatt, rotfleckig, Brennschmerz.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Belladonna
Plötzlicher Beginn, hochfieberhaft – der ganze Patient glüht, heiß, schweißig; will aber zugedeckt bleiben, friert beim Aufdecken.
Entzündete Hautpartie tomatenrot, oft klopfender Schmerz.
Anwendung: C6 (D12) Dil. nach Methode 1.
Livide Farbe
Sie kündet immer eine kritische Situation an. Hier ist besonders wirkungsvoll
Lachesis muta
Septische Temperatur, heißer Schweiß. Entzündete Hautpartie livid, purpurfarben, manchmal auch gangränös.
(Bei solchen Fällen auch an Crotalus horridus denken!)
Erysipel bei alten Menschen, nach erschöpfenden Krankheiten. Breitet sich eventuell von links nach rechts aus.
Anwendung: C6 (D12) – C30 Dil., auch als Injektion.
Bei hellroter und ödematöser Haut
Apis mellifica
Fieber beginnt mit Frost, dann Hitze und Schweiß ohne Durst. Stechender, brennender Schmerz, sehr berührungsempfindlich, verlangt Kühles.
Anwendung: C6 (D12) – C30 Dil.
Mit Blasenbildung
Euphorbium officinarum
Im Fieber Frost und Schweiß. Kalter Körper und innere brennende Hitze (Hering).
Entzündete Hautpartie rot und geschwollen mit erbsengroßen Blasen, die mit gelbem Exsudat gefüllt sind; evtl. auch blutige Blasen, die rasch nekrotisch werden.
Anwendung: D6 – C6 (D12) Dil.
Rhus toxicodendron
Hier sind die Blasen kleiner und zahlreicher als bei Euphorbium officinarum.
Anwendung: C6 (D12) – C30 Dil.
Derbe, verdickte und schrundige Haut
Bei schon lange bestehendem Erysipel wird bei manchen Patienten die Haut derb, verdickt und schrundig. Diese Situation verlangt
Graphites naturalis
Erysipelstellen brennen und jucken mit Neigung zur Verhärtung der Haut und Schrunden; evtl. nässend mit honigartiger Absonderung.
Anwendung: C30 – C200 Tabl.
Rezidive
Hier sollte man durch gute Hautpflege – evtl. mit Calendula-Salbe – kleine Verletzungen, Risse und Schrunden rasch zur Abheilung bringen. Die Abwehrschwäche gegen Streptokokken lässt sich verbessern mit der entsprechenden Nosode:
Streptococcinum
Anwendung: C7 Dil., jeden dritten Tag.
5.3 Exsudation – Quaddeln Urtikaria (Nesselsucht)
Übersicht
Vgl. in den Repertorien: KK II/191; KK 597
Akut
Schlimmer durch Wärme
Apis mellifica
Schlimmer durch Kälte
Urtica urens Acidum formicicum Dulcamara Rhus toxicodendron
Nahrungsmittelallergie
Antimonium crudum Arsenicum album
Chronisch-rezidivierend
Ätiologie
Fisch, Meeresfrüchte
Natrium muriaticum
Fisch, Penicillin
Phosphorus
Fisch, Menses unterdrückt, Kälte, Winter
Sepia succus
Kontaktallergene, Arzneimittel
Sulfur
Milch
Calcium carbonicum
Kaltes Bad
Calcium phosphoricum
Akute Phase
Schmerzen und Jucken schlimmer in der Wärme
Apis mellifica
Brennender, stechender Schmerz und Jucken werden besser durch Kühle, schlechter durch Wärme, Schwitzen und bei Wetterwechsel. Sehr berührungsempfindliche Haut, Quaddeln sind hellrot oder manchmal livid.
Anwendung: C6 (D12) – C30 Dil.
Schmerzen schlimmer durch Kälte und Beschwerden des gichtigrheumatischen Formenkreises
Urtica urens
Typisch ist brennender Schmerz (Merke: Brennnessel). Starkes Jucken und Brennen schlechter durch feuchte Kälte und körperliche Anstrengungen. Folgen nach Unterdrückung von Nesselsucht.
Anwendung: Ø–C6 (D12) Dil.
Acidum formicicum und Formica rufa
Besonders indiziert bei gichtig-rheumatischer Diathese in Verbindung mit großer Empfindlichkeit gegen Kälte und Nässe. Folge von Kaltbaden.
Anwendung: C30 Dil.; Injektion i. c. oder i. v. D12 – D30.
Dulcamara
hat ebenfalls starke Empfindlichkeit gegen Kälte und Nässe.
Folgen von Erkältung, Durchnässung, bei nasskalter Witterung. Kälte-Urtikaria (vgl. unten Antimonium crudum).
Die oft begleitenden rheumaartigen Gelenkschmerzen werden besser durch Wärme und Bewegung.
Paradox bei allgemeiner Kälteempfindlichkeit ist die Beobachtung, dass der Hautausschlag und das Jucken durch Wärme und Anstrengungen sich verschlechtern, Juckreiz in kalter Luft besser!
Sonderlich: Urtikaria vor Menses.
Anwendung: C6 (D12) – C30 Dil.
Rhus toxicodendron
Kalte Luft und Schwitzen verschlechtern. Folge von Nasswerden; rezidiviert oft im Frühjahr. Besonders indiziert, wenn die Quaddeln klein und knötchenförmig sind.
Anwendung: C30 Dil.
Nahrungsmittelallergie
Sie löst oft eine akute Urtikaria aus.
Antimonium crudum
Akute Urtikaria im Verlauf einer Magen-Darm-Leber-Störung, oft ausgelöst durch verdorbenes Fleisch (vgl. Arsen). Dabei Übelkeit und Erbrechen; Erbrechen erleichtert nicht. Zunge mit dickem, weißem Belag.
Verträgt an der Haut keine Temperaturextreme: Urtikaria sowohl nach Überwärmung, besonders nach Sonnenbad, als auch durch kaltes Baden.
Anwendung: D6 – C6 (D12) Tabl. – bei mürrischer Stimmungslage C30 – C200 Tabl.
Arsenicum album
Ausgeprägter Brennschmerz mit nächtlicher Unruhe, besonders nach Kratzen. Jucken und Brennen oft besser durch heiße Anwendungen, Jucken seltener besser durch Kaltwasser-Umschläge (Mezger).
Auslöser: nicht einwandfreies Fleisch führt öfter zu allergischer Reaktion.
Anwendung: C30 – C200; LM XIV – XXX Dil.
Chronisch-rezidivierender Nesselausschlag
Die Gesamtheit der Symptome muss ermittelt werden. Die Anamnese sollte sich bemühen, den ätiologischen Hintergrund der Rezidive zu finden.
Natrium muriaticum
Frostige Patienten, herb, verschlossen, introvertiert; reizbar bei Zuspruch oder Trost. Allgemeine Verschlimmerungszeit 11 Uhr. Haut oft fettig, besonders an Stirn und Stirn-Haar-Grenze.
Auslöser: oft feuchte Kälte oder auch Sonnenbestrahlung, am Meer, nach Fisch, Muscheln, Krabben. Bedeutungsvoll sind psychosomatische Konflikte als Auslöser.
Anwendung: Reihe von C30 – C1000 Tabl.; LM XIV – XXX Dil.
Phosphorus
Manchmal ist die Ätiologie hinweisend: Nach Verzehr von Fisch (oft besteht auch Abneigung gegen Fisch). Folge von Baden, Sonnenbädern (oft hellhäutige, rötlich blonde Menschen).
Allergische Reaktion nach Penicillin.
Anwendung: C30 – C200 Tabl.; LM VI – XVIII Dil.
Sepia succus
Besonders bei knötchenförmiger Urtikaria (wie Rhus toxicodendron und Calcium carbonicum) mit Verschlechterung durch kalte Luft, im Winter.
Oft mit Störungen der Menstruation: nach unterdrückten Menses, bei schwacher Periode, in der Klimax. – Ätiologie: Verzehr von Fisch.
Anwendung: C30 – C200 Tabl.; LM VI – XVIII Dil.