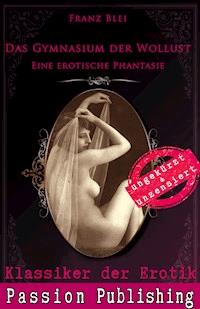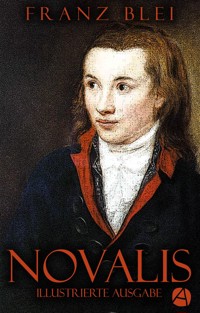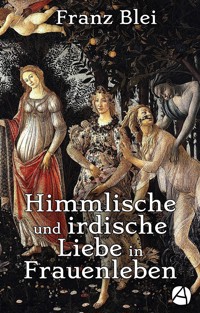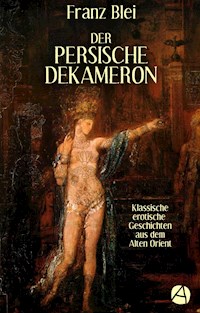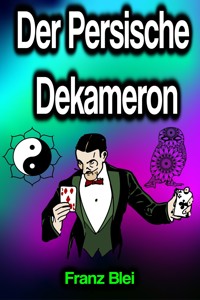Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist nicht als erotischer Leitfaden oder Sex-Handbuch gedacht. Nach AnsichtBleis muß im Vertraulichen und Gewöhnlichen des Alltags die Liebe auf die Probe gestellt werden, die sich nicht in den Flitterwochen nach der ersten Nacht beweist, sondern in den Jahren nach dem ersten Ehejahr. Diese Regulierung des verheerenden Feuers und dessen Leitung, daß sie das Ganze einer Gemeinsamkeit durchwärme und nicht nur das nächtliche Lager erhitze: das ist die zivilisierte Form, welche die zerstörerische Leidenschaft der Liebe annehmen muß, um als Liebe bestehen zu bleiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lehrbuch der Liebe und Ehe
Franz Blei
Inhalt:
Lehrbuch der Liebe und Ehe
Vorwort
Erstes Kapitel
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
Zweites Kapitel
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
Drittes Kapitel
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
Viertes Kapitel
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
Fünftes Kapitel
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
Sechstes Kapitel
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
Letztes Kapitel
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
Lehrbuch der Liebe und Ehe, F. Blei
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849623104
www.jazzybee-verlag.de
Lehrbuch der Liebe und Ehe
Jenen Frauen, die mich im Guten oder im Bösen nicht vergessen haben, ist dieser Tractatus Erotico-Politicus gewidmet mit dem Geleitspruch: Di' che 'n domandi Amor, che sa lo vero.
Vorwort
In einem verbreiteten Buche über das Leben des sexuellen Mittelstandes und dessen heutige Leiden verschenkt der ärztliche Verfasser die Erfahrungen einer wie er sagt fast fünfzigjährigen Praxis so gut wie für nichts. Er weiß und lehrt, wie annehmlich es sei und das von ihm in Betracht gezogene Liebesleben fördernd, wenn sich die daran Beteiligten des öfteren an den sekretierenden Körperteilen etwas waschen. Oder er setzt auseinander, wie es für das Glück und vor allem auch für die Dauer einer Ehe von großer Wichtigkeit sei, die Positionen der Kopulation zu variieren, und er gibt da gleich ausführlich ein Dutzend verschiedener Positiones amoris an, alle wie er sagt höchst geeignet, das Vergnügen nicht reizlos werden zu lassen, – nicht immer ganz einfache Stellungen, aber alle doch mit einigem Fleiß und gutem Willen zu erlernen. Sagt also nach dem Abendbrot der vollbärtige Gatte zu seiner Frau Gemahlin: »Heute, Luise, wollmermal an Stellung fünf rangehn«, –
Und voll Eifer studiert die gerne willige Gattin Was ihr der schlicht behaarte Finger zu lesen gebietet, wie man im idyllischen Versmaß es nur sagen kann.
Nun, für solche in diesem Punkte Unglückliche und Verzweifelte ist das hier vorgelegte Buch nicht geschrieben. Es enthält weder Einschärfungen was das Waschen betrifft, noch Anweisungen über die mannigfachen Exekutionen des Beischlafes. Der Verfasser verläßt sich hier auf die gute Kinderstube seiner Leser und Leserinnen und auf ihr Ahnen, daß dem immanenten tragischen Geist der Liebe mit so komischen Einfällen der funktionellen Praxis nicht beizukommen ist. Der praktische Arzt schreibt für die Millionen, die nichts als funktionieren, aber nicht lieben. Und die ihren Untergang und ihre blöde Qual eben daraus haben, daß sie nichts als funktionierend sündigen: der Mann damit, daß er ohne Liebe eine Frau beschläft, die Frau damit, daß sie es ohne Liebe geschehen läßt, gleichgültig, ob sich das in einer Ehe vollzieht oder in dem, was man ein Verhältnis nennt, der Stunde oder einer längeren Dauer. Beziehungen, die sich nur so von Schoß zu Schoß herstellen, muß wohl das Waschen gelehrt werden. Und in der gelernten Variante ihres sogenannten Vergnügens erleben diese Paare nur rascher noch als sonst den Ekel und Widerwillen voreinander. Denn in den Sekreten und Eingeweiden können sie nie finden, was sie da suchen: Liebe. Denn diese ist nur aus dem eigenen Gefühle zu erschaffen. Sie finden höchstens Lust, die sich mindert, woran alle Variationen des körperlichen Mittels nichts ändern. Nicht an einer mangelhaft ausgebildeten Physik der geschlechtlichen Funktionen gehen diese ehelichen und anderen Paarungen zugrunde, nicht unter dem Mangel der Delikatesse und des Taktes in der Kopulation leiden sie und wäre ihnen durch Weckung solcher Delikatesse zu helfen und durch akrobatische Ausbildung, sondern sie leiden, weil sie etwas tun und tun lassen, das ohne die Adelung durch das Gefühl der Liebe nichts als gemein ist. Kein menschlicher Liebesakt kommt ohne die Phantasie zustande, und wo die Liebe dieser Phantasie nicht Bahn und Richtung weist, führt sie in die Irre des Irrsinns und der Verzweiflung. Die zunehmende Häßlichkeit der Menschen, äußere wie innere, hat darin ihren Grund, daß die Menschen sich ohne die Adelung ihres Triebes durch die Liebe paaren und ohne Liebe empfangene Kinder gebären, diese oft so unerwünschten weil nicht ausgespülten Effekte des sich Vergessens im gleichgültigen Zufall eines Schoßes oder einer Umarmung.
Es wäre falsch und sinnlos, jener absoluten ganz anarchischen Liebe das Wort zu reden, hinter welcher nichts als der Tod steht, den wir oft jene jungen Paare freiwillig sich geben sehen, weil sie »sich nicht heiraten können«. Oder weil »die Eltern dagegen« sind. Die Liebe gibt sich, um sozial möglich zu sein und sich nicht in der ihr eigentümlichen Anarchie zum Tode zu bringen, das Amalgam mit allerlei verankernden Strebungen, Gedanken, Interessen, Gefühlen. Die Liebe begibt sich, um sich zu erhalten, ihrer prädominanten exklusiven Stellung. Auch die Ehe oder jede andere Form des dauernden Zusammenseins hat hier ihren Ursprung, indem das Zusammensein das Wilde, Eigengesetzliche der Liebe lähmt, ihm den scharfen Stachel nimmt, denn man will ja leben und nicht in der Leidenschaft verbrennen. So muß also das Nest gebaut werden. So muß im Vertraulichen und Gewöhnlichen des Alltags die Liebe auf die Probe gestellt werden, die sich nicht in den Flitterwochen nach der ersten Nacht beweist, sondern in den Jahren nach dem ersten Ehejahr. Diese Regulierung des verheerenden Feuers und dessen Leitung, daß sie das Ganze einer Gemeinsamkeit durchwärme und nicht nur das nächtliche Lager erhitze: das ist die zivilisierte Form, welche die zerstörerische Leidenschaft der Liebe annehmen muß, um als Liebe bestehen zu bleiben.
Nichts ist leichter als dem sinnlichen Appetit nachzugeben: nur ein bißchen Angst ist zu überwinden; nur ein bißchen Scheu ist zu verdrängen. Das alles schafft der Körper selber zusamt der Illusion, daß es sich dabei um Liebe handle – um nach der umnachtenden Ohnmacht den aus ihr Erwachten auf die harten Klippen seines Fragens zu werfen: ist das die Liebe?
Sie ist eine Begabung wie eine andere. Und hat ihre Nachahmer und Dilettierer wie jede andere. Die Unzähligen zählen hier nicht, die sich der Liebe für fähig halten aus keinem andern Grunde, als daß sie imstande sind, zu beschlafen und sich beschlafen zu lassen. Wär es bloß das, dann hinderte uns nichts, auch von der Liebe der Schweine, der Hunde und der Schweinehunde zu reden, was nur denen einfällt, welche das Um und Auf, Wunsch und Ziel, Anfang und Ende dieser menschlichen Beziehung als die tierische Beziehung sehen, die in der Kopulation besteht. Das aber ist zu wenig und ist auch zu viel. Zu wenig, weil es diesem Vorgang nichts als das Triebhafte gibt und ihm das mystische Siegel nimmt, das er für den Menschen bedeutet. Zuviel, weil es diesem Akt mehr zu tragen aufbürdet, als er tragen kann und aus ihm ableitet, was aus ihm gar nicht ableitbar ist. Erst die Widerstände gegen den nichts als anreizenden Eros machen aus ihm den aufbauenden Eros. Was nur und gleich dem Triebe nachgibt, funktioniert wohl, aber lebt nicht in jenem Sinn, den wir Menschen dem Leben geben. Es ist aber nicht jede Menschenseele unsterblich. Nur die lebendige ist es. Nicht die im Triebleben erstorbene.
Ich habe darauf verzichtet, die Mannigfaltigkeit der Phänomene, die der Titel umschreibt, in den starren Rahmen eines Systems zu pressen. Auch die Vorliebe für einen bestimmten Gedanken in einem Theorem sich ausleben zu lassen, liegt mir fern. Ich will den Leser, den geneigten, nicht überreden. Nur zu seinen eigenen Gedanken über diese Gegenstände veranlassen. Ihn also nachdenklich machen. Auch dort, wo es anders aussieht und Urteile gefällt werden, wird der Leser deren Einschränkung auch ohne besondern Hinweis zwischen den Zeilen bemerken. Er wird auch den Ton nicht mißverstehen, in dem zuweilen Musik gemacht wird. Der Ernst eines Gegenstandes wird nicht immer nur dadurch bewiesen, daß ich mit größerem Ernst von ihm spreche und mit einer angemaßten Würdigkeit den Leser übertölpele. Ich spreche au pair zu ihm, nicht von einem Katheder oder Podium zu ihm hinunter. Ich habe nichts zu lehren, wovon ich nicht wüßte, daß ein Leser mehr und Besseres davon verstünde. Dieses Lehrbuch soll eine Konversation sein, und es sieht nur materiell so aus, als ob ich allein spräche und unwidersprochen. Man wird merken, daß ich mir selber widerspreche, nicht mit Absicht, aber aus Höflichkeit, die es aus sich nicht verträgt, in Dingen »recht zu haben«, wo es ein solches Rechthaben gar nicht geben kann. Es stehen ja nicht so einfache Gegenstände zur Entscheidung oder überhaupt zur Entscheidung wie ein Würfel oder eine Kugel, deren unterschiedliche Merkmale so deutlich sind für jedermann, daß da kein Streit von Meinungen aufkommen kann.
All das heißt aber nicht, daß ich hier den Zufall und die Willkür walten lasse. Der Kreis des zu Betrachtenden ist so weit gezogen, daß er alles Auffallende enthält, und die Ordnung ist so getroffen, daß vom Zentrum aus gegen die Peripherie hin die verkleinernde Perspektive deutlich wird. So war wenigstens die Absicht. Ob sie immer erreicht ist, hat der Leser zu entscheiden, der vom Leben verwundete Leser, der weiß, daß ein Buch keine Kur ist dafür. Und der weiß, daß wir alle an dieser Wunde sterben müssen.
Erstes Kapitel
§ 1
Eltern und Erzieher sprechen von der sexuellen Not als einem charakteristischen Novum dieser Zeit, das früheren Zeiten fremd gewesen wäre. Etwa jenen vor dreißig Jahren, als es unter den bürgerlichen jungen Mädchen weder Freigelassene noch Emanzipierte, sondern streng bewachte und sich selbst bewachende Jungfrauen gab, unter denen hie und da einmal eine zu einer Halb-Jungfrau entartete. Diese jungen Mädchen von damals waren vom jungen Mann von damals so gut wie unverführbar. Das Risiko war zu groß. Das Abtreiben unerwünschter Folgen war nicht in Mode, und die Verführung führte zu einer erzwungenen Heirat. Die Jungfräulichkeit der Braut war eine höchst wichtige Voraussetzung für die Eheschließung. Als ich Student in Zürich war, verführte ein reichsdeutscher Student eine junge Schweizerin. Das Mädchen wurde schwanger und dessen Verwandte stellten an den Verführer die Forderung, den Schaden durch Heirat gutzumachen. Der deutsche Student aber schlug die Hacken aneinander und erklärte, er heirate kein Mädchen, das sich vor der Ehe einem Manne hingegeben hat. Von dieser Anschauung brachten ihn auch nicht die vielen Ohrfeigen ab, die er bekam.
Außer den Eltern waren für eines jeden jungen bürgerlichen Mädchens Unschuld Schutzwachen aufgestellt: die Prostituierten. Sie hüteten die Reinheit der häuslichen Herde ihrer Gasse. In ihren Armen, nicht wie heute in denen seiner Klassengenossin, stillte der Sohn bürgerlicher Eltern seinen ersten Durst. Man konnte mit weit mehr Recht und Sinn von der sexuellen Not jener Jugend von damals sprechen. Denn das heutige junge bürgerliche Mädchen der großen Städte ist freigelassen, und keine Zeit sah es willfähriger. Nie boten sich dem Manne mehr Mädchen an als heute, und hat der Mann heute nur einiges Geld, kann er da haben was er will. Die in ihrer sozialen Position bedrängte Prostituierte wird immer seltener. Man mußte ihr alle Straßen freigeben und sie von der Kontrolle befreien, denn sie zahlt Steuern und hat, wirtschaftlich von dem riesigen Angebot der Nicht-Prostituierten bedroht, ein Recht auf behördliche Hilfe. Die heutige Prostituierte ist längst nicht mehr »das Weib des armen Mannes«, sondern die willige Bereitschaft für Perversionen einer Klientel, die anders als bei der Prostituierten nicht zu ihrer Erfüllung kommen. Kein junger Mann von heute hat es nötig, die Umarmung einer Prostituierten zu suchen. »Wir würden verhungern,« sagte ein Mädchen der Straße zu einem jungen Mann, »wenn wir auf euch angewiesen wären«. Die dafür sorgen, daß diese Mädchen nicht verhungern, sind ältere Familienväter, die in ihren ehelichen Betten das nicht finden, was sie bei der Prostituierten für Geld haben können und heimlich suchen gehen.
Die sexuelle Not der heutigen Jugend ist die sexuelle Not der heutigen Eltern, die in Erinnerung an ihre eigene Jugend vor dieser Jugend ihrer Kinder fassungslos stehen und mit der Tatsache nicht zurechtkommen, daß ihre siebzehnjährige Ilse in dem achtzehnjährigen Fritz einen Freund und Bettgenossen hat. In dieser Not fragen sie nach rechts und hören da: Zucht, Strenge, Prügel, Beten, langer Rock, langes Haar in Zöpfen. Fragen sie nach links, und hören da: ausleben lassen, fördert die Gesundheit, Sport, Fortschritt, Folgen beseitigen, Schutzmittel gegen Konzeption. Ohne rechtes Vertrauen zur Predigt von rechts und zur Predigt von links sind diese heutigen Eltern, denn sie können was immer sie raten oder befehlen sollen nicht aus der Sicherheit ihrer eigenen Ehe stützen, denn diese Ehe ist zumeist ohne jede beispielsetzende Kraft dafür, wie recht zu leben sei. Oder gar wie das Glück zu erreichen sei. Denn in begreiflicher Täuschung operieren sie immer mit diesem leeren Begriff der glücklichen Ehe, ohne sagen zu können, was das ist. Höchstens, was das nicht ist. Und empfinden sich als Beispiel einer nicht glücklichen Ehe. Gab es je eine Frau, die im Alter nicht erklärt hätte, die Wahl ihrer Jugend sei ein Irrtum gewesen? Je einen Mann, der im Alter nicht sagen könnte, es hätte statt dieser Frau ihm ebenso gut ein anderer Ziegelstein auf den Kopf fallen können?
§ 2
Die Mutter von 1928, die nächstens fünfzig wird, trägt sich wie ihre achtzehnjährige Tochter, aber in müden sterilen Gedanken über die vermeinten Freiheiten dieser Tochter und an den engen Pferch des eigenen Lebens damals, als die Verwandten ihre Mitgift und sein Einkommen zusammenrechneten und übereinkamen, es ergäbe eine glückliche Ehe. Und der Einwand, der schüchterne, daß sie den Mann eigentlich nicht liebe, damit widerlegt wurde, daß man ihr sagte, die Liebe würde sich schon in der Ehe einstellen. Es gab eine kleine Lust, die sich immer mehr minderte, und Kinder. Oder Untreuen des Gatten, über die sie verzweifelte, wie es sich gehörte. Oder kleine eigene Untreuen, die auch nicht das Glück brachten, das man sich davon versprach oder versprochen bekam. Es war nicht viel anders als mit dem Gatten. Vielleicht schlimmer. Wie auch immer: angesichts ihrer Achtzehnjährigen, die ihr Leben vor sich hat, werden die Gedanken der Fünfzigjährigen, die es hinter sich hat, bitter, und so werden es ihre Worte, die sie zur Tochter spricht. Sie, die Mutter, meint, es liege zwischen ihr und der Tochter wirklich jene Welt, von der die Achtzehnjährige im Kampf um ihre vermeinten Freiheiten behauptet, daß sie läge. Es liegt aber nichts sonst dazwischen, als daß die eine alt geworden ist und ihr schwaches Denken um den Punkt kreist, der wie ein Fragezeichen geformt ist: Hat es sich gelohnt? War es das Richtige? Nun kann sie keine Liebe mehr fühlen und keine mehr wecken. Die sozialen Ambitionen und Zwecke, die sie in der Ehe ihrer Liebe beigemischt hat, sind alle so gut es eben ging erfüllt oder als nicht mehr erfüllbar erkannt. Sie ist einsam und friert. Sie sträubt sich, die zerfallende Fruchthaut zu sein, die ihren Sommer und Herbst gehabt hat. Längst ist der Gatte neben ihr erkaltet. Er ist noch da, weil er keinen sichtbaren Grund hat, eine Gemeinschaft aufzugeben, die er gewohnt ist. Sie ist nicht ein bißchen mehr jung, um noch etwas wünschen zu können, wozu Jugend gehört. Und ist doch noch nicht alt genug, um leichten Herzens zu verzichten. Ohne Zukunft, die sich ihr in den ihr fremd werdenden Kindern entzieht, wühlt sie die Erinnerungen auf, und es sind lauter kurze abgerissene Fädchen, ein verwirrter Knäuel. Versucht sie mit ihrem Manne darüber zu sprechen, so macht der über so vom gewohnten Reden Abweichendes erstaunte Augen und versteht nicht. Oder er lacht. Oder er wird ärgerlich. Ganz grob kann er sie auch eine dumme Gans nennen. Was sie sich denn eigentlich erwartet habe? Mit welchem Titel? Mit welchem Recht darauf? Und was fehlt ihr denn? Es fehlen ihr nicht das Haus, nicht das Geld, nicht das Auto, nicht die Kinder. Es fehlt ihr nichts als der Sinn ihres so Gelebten, und es quält sie, die Alternde angesichts der Jugend, die nicht zu beantwortende Frage, ob es für sie nicht ein anderes, schöneres Leben hätte geben können, so wie es, so meint sie, die heutige Jugend lebe.
Und der Vater dieser Kinder von heute, der Mann an die Sechzig, der Gatte dieser erschöpften bitteren Frau? Durch die immer rostiger werdende Maschine seines Leibes läuft das Arbeitspensum des Tages. Die Frau an seiner Seite ist ihm in diesen dreißig Jahren einer Ehe fremder geworden als sie es am Hochzeitstag war. Eine alte Frau wie irgendeine. Seltsam, daß man sie umarmt und drei Kinder mit ihr hat, gerade mit ihr. Es hätte auch jede andere sein können. Wie alle Männer hat er ein äußerst kurzes Gedächtnis für die gewährten Freuden einer Nacht: sechs Stunden später hat er sie vergessen. Er bestreitet aus diesen Dingen nicht das geringste in seinem Leben. Seine Geschäfte, sein Kredit, sein geistiges Tun sind ihm bedeutend wichtiger. Aber er mußte ein Leben lang dieser Frau immer das Gegenteil versichern mit Worten, die er als lügenhaft empfand. Die Frau brauchte das, verlangte es, und er gab nach, sagte diese Worte. Denn Frieden und Ruhe hingen davon ab. Er lebte zur Frau hin in einem Pathos der Worte, dem keinerlei Gefühl solch gesprochenen Wortes entsprach, ja dem jedes wirklich Gefühlte widersprach. Er mußte mit den Worten Dingen eine Bedeutung und Wichtigkeit geben, die sie faktisch für ihn gar nicht besaßen. Er erinnert sich, daß er mit nicht geringerem Vergnügen auch bei anderen Frauen als dieser im Bette lag, der er immer wieder zu versichern hatte, – Gott was nur alles! Jetzt ist er so alt, daß diese Last von ihm genommen. Aber er hat sie so lang getragen, daß er krumm und stumpf darüber geworden ist. Die Kinder? Er läßt sie tun, was sie wollen. Seine Erfahrungen lassen ihn zu keinerlei Pädagogik kommen. Er mißtraut seinen Urteilen, indem er sie für Vorurteile hält. Weniger als seine Frau geartet und geneigt, das, was sich vollzieht, mit Gefühlen zu begreifen und zu versteifen, hat er im Alter einen Sinn für die Komik des sexuellen Pathos bekommen. Und so schlägt er nicht wie die Mutter über die Artung und das Treiben der Kinder die Hände über den Kopf, sondern ist eher geneigt, dazu zu lächeln.
§ 3
Welchen Sinn erfüllte denn die Ehe? Welchen Sinn kann sie heute noch erfüllen?
Der älteste Hordenführer erkannte im Kampf und auf der Jagd die Söhne reiner, nämlich seiner Abstammung an ihrer frohen Tapferkeit und ihrem lebhaften Mut, wie die Bastarde, die Söhne zweifelhafter Herkunft am Fehlen dieser vornehmsten Tugenden. Das gute Blut in allen Nachkommen rein zu erhalten und zu vererben bestimmte die Wahl, die der Mann unter den Frauen traf. Auf Verunreinigung des Blutes durch Ehebruch stand das Köpfen. Des Mannes gelegentliche Lust an der Sklavin berührte die Ehe nicht, denn die Kinder der Sklavin waren zufällige Bastarde und schlecht. Persönliche Tapferkeit und Schönheit des Leibes stehen heute in geringerem Ansehen als Schlauheit und alle Arten zerebraler Gewandtheit – der Sport ist für staunende Zuschauer – also Bastardeigenschaften. Ob diesen modernen Tugenden die Ehe nachgegeben hat oder ob umgekehrt der beklagte Verfall der Ehe diese Bastardvorzüge gezeitigt hat, mag man nach Neigung entscheiden. Jedenfalls verlangte das Talent, auf der Börse reich zu werden, keine reine Ahnenreihe des mit diesem Talent Begabten. Die Rangunterschiede der älteren Zeit sind heute nur Geldunterschiede; in sogenannten fortschrittlichen Ländern wie den United States sind sogar schon die Bildungsunterschiede nur mehr solche des Geldes; in Europa soll es noch nicht soweit sein. Jedenfalls ist heute die Heirat vor allem ein Handel. Daß die Ware nicht immer, wie in der Türkei, beim Käufer bleibt, durch den Ehebruch zeitweilig in andre Hände kommt, durch die Ehescheidung den Besitzer wechselt, diese Tatsachen wurden so häufig, daß man dagegen moralisch schon ganz unempfindlich geworden ist – Kinder lachen darüber im Theater. Der Gatte weiß zumeist, daß er mit der Ehe den Ehebruch, nicht nur den seinen natürlich, eingeht; er vermeidet solang als möglich seine eigene Lächerlichkeit, indem er über Menelaus lacht. Kann er das nicht mehr gut, d.h. gibt es einen öffentlichen Skandal, so schießt er zuweilen und scheidet er sich. Das ist alles. Daß die monogame Ehe, wenn auch mit einigen Formalitäten, geschieden werden kann, hebt sie in der Idee, die ihr zugrunde liegt, völlig auf. Es fehlt nur noch eins, sie auch praktisch aus der Welt zu bringen: die Abschaffung der Mitgift. Bleiben müßten dann Paare, aus dem Adelsgefühl des Blutes einander treu, aus Verpflichtung gegen die Rasse abschweifende Instinkte bändigend, daß der Mann sagen kann: ich betrüge eine Frau nicht, die meinen Namen trägt, und die Frau: ich will von keinem andern Mann als von diesem Kinder gebären. Die Logik führt, wie man sieht, zur Utopie.
Die schamlose Geldheirat begann unter Louis XIV., der den Provinzadel ruinierte, indem er ihn an den Hof zog. Fumer ses terres nannten es die Barone, die reich heiraten mußten, um bei Hofe leben zu können. Hundert Jahre später konstatierte der ältere Mirabeau die Verheerungen. Und wieder hundert Jahre nachher ist die Geldheirat eine Selbstverständlichkeit, die keinen Zynismus mehr wie zur Entschuldigung aufwendet. Das Gesetz gab nach, indem es die Ehe als Kaufvertrag, den Ehebruch als ein Eigentumsdelikt, die Ehescheidung als eine Geschäftsauflösung behandelt und die Rechte der Kinder in Hinsicht auf ihr Geldvermögen wahrt. Die Komödie geht so: der betrogene Gatte, über den alles lacht. Die betrügende Gattin, aller Sympathien sicher. Der Freund, irgendeiner, der mit nichts weiter als mit einem Absteigequartier bezahltes Vergnügen – die Frau, die Zigarren des Gatten, dessen Jagd, dessen Komik – unverantwortlich genießt: er erfreut wie alle Schlauen. Dieser betrogene Gatte ist der Bankier seiner Frau, die ihre Liebe einem andern gratis gibt. In Frankreich hat man ein Gesetz angenommen, das der Frau verbietet, sich nach der Scheidung mit ihrem Geliebten zu verheiraten. Gott sei dank, sagten die Geliebten und zahlten erleichtert weiter die sechzehn Franken Strafe für das flagrant délit. Man denke ein Gesetz: der Ehebrecher muß die Geschiedene heiraten, d.h. er muß Bankier seiner Frau werden und Betrogener früher oder später. Entflieh mit mir und sei mein Weib ist eine Romansentimentalität. Von hundert betrügenden Frauen wird eine bereit sein, ihren bequemen Bankier aufzugeben, um ein neues Geschäftsverhältnis mit dem begreiflich mißtrauischen Freunde einzugehen. Es ist kein Unterschied dann zu bemerken zwischen der berufsmäßigen Kurtisane und der Frau, die ihren Gatten betrügt und nicht verläßt, weil der ihr alle Bequemlichkeiten des Lebens verschafft, kein Unterschied als dieser, daß die betrügende Frau lügt, die andre aber tapfer und ehrlich ist. Doch – alles dies sind Bêtisen der sozialen Kritik. Am Ehrbegriff einer ritterlichen Zeit diese heutige Zeit zu messen und zu verurteilen ist ebenso müßige Pedanterie, wie es Ohnmacht bedeutet, sich in die Bequemlichkeiten einer konstruierten künftigen Humanität zu begeben und von da aus bitter das Haus zu schmähen, in dem man wirklich lebt. Einen Zustand erkennen und mißbilligen bedeutet noch nicht ihn aufheben, bedeutet meist nicht einmal, sich im eigenen Leben danach richten. Die Menschen dieser Zeit verlangen Respekt nur vor ihrer Maske, denn sie sind unvornehmen Blutes zumeist und häßlichen Gesichtes, was sie alle wissen, denn sie sagen innerlich alle du zueinander wie zu den Hunden. Nehmen wir es hin mit Höflichkeit, die jenen langen Stäben gleicht, mit denen Herolde das Volk von der Majestät zurückhielten. Die Höflichkeit schafft die weiteste Distanz und ist das einzige Mittel, in aller Art Demokratie ungeärgert für sich zu leben. Daß wir Moral sagen und vom Ethos schweigen, daß wir Manieren verlangen und nicht Pflichten höchster Ordnung, daß wir m. a. W. Hofman sind und nicht Pascal, das ist der Demokratie aller Art Macht auch über uns Solitäre, und ist unsre Ideologie, daß wir noch immer eine Gesellschaft denken, wo es doch nichts als bloß sehr viele Leute gibt. Sagen wir es also nicht katonisch, daß die Ehe des Geldheiratens mit oder ohne Ehebruch – das Laster ist so dumm wie die Tugend – keine Ehe mehr ist. Sagen wir, sie ist ein Rethorikerthema, und lassen wir jedem das Recht auf seine Dummheit.
§ 4
Ein Konzilium staatlicher, kirchlicher, medizinischer und belletristischer Personen berät über den Patienten, dem es überall weh tut: die Ehe. Die aber ist nicht kränker, als sie es sonst schon immer war. Der eigentliche Patient ist das Kind.
Das Institut der Ehe auf die Natur des Menschen zu gründen, ist je weder dem Staat noch der Kirche eingefallen. Zur Befriedigung der Natur gibt es andre und näher liegende Mittel. Erst eine irrtümliche Staatstheorie, die als Basis jeder sozialen Entwicklung die Beziehungen der Geschlechter annahm, versuchte das. was weder theoretisch noch empirisch zu halten ist. Nichts als den bloßen Geschlechtsakt haben die Ehe und die ephemere Vereinigung miteinander gemein. Auf das Ephemere läßt sich keine »soziologische« Theorie gründen, denn es hat keine sozialen Effekte. Solche hat nur die mono- oder polygame Dauer-Ehe, als ein bestimmtes, rechtlichen Regeln unterworfenes Institut. Die Ehe ist nicht »natürliche« Keimzelle der Staatsbildung, sondern umgekehrt: die ehelichen Vorschriften sind eine verpflichtende Ordnung, die zum Ziele hat, das geschlechtliche Leben und die Kinder einer bestimmten Reglementierung zu unterwerfen innerhalb einer schon vorher existenten sozialen Gruppierung. Diese Reglementierung entspringt nicht einem Instinkt, der ja nur zum Geschlechtsakt führt, sondern einem zum Brauche gewordenen staatlichen Zwang. Die staatliche und nach ihr auch die kirchliche Autorität hat ihr Hauptinteresse an den Kindern.
Die Kirche konnte es nicht machen wie Ugolino, der seine eignen Kinder aufaß, um ihnen einen Vater zu erhalten. Sie nahm also das staatliche Institut der Dauerehe hin und fügte nichts weiter hinzu als die Weihe eines Sakramentes, das besagt, daß Ehen im Himmel geschlossen werden, also untrennbar sind durch den Menschen. Nicht weniger logisch als der Staat sah sie in der Ehe nichts dem Menschen »Natürliches«, sondern ein Institut, in dem sich die Interessen des Einzelnen dem erkannten weitern Interesse seiner Gruppe unterwerfen. Bis auf heute kümmert es weder Kirche noch Staat, ob sich die Eheschließenden im individuellen Sinn dieses Wortes lieben, weshalb die Kirche auch in der Nicht-Liebe keinen Grund einer Trennung der Ehe sieht. Sie erkennt nur einen einzigen Grund an: die Nichtvollziehung der Ehe. Eine Ehe, die keine Anstalten trifft, Kinder zu zeugen, erscheint der kirchlichen Logik als keine Ehe. Sie weiß, daß zu diesem Geschäfte das, was man Liebe nennt, nicht nötig ist. Sie dachte und denkt nicht daran, aus der Ehe so etwas wie eine Reglementierung der individuellen Geschlechtsbeziehungen zu machen. Sie überläßt das nichts als Individuelle ganz dem Individuum. Sie kennt das Anarchische der individuellen Liebesgefühle und tut alles, sie in dem Institut der Ehe nicht gelten zu lassen. Mit der Staatskirche kam ein Zwiespalt in das spirituelle Programm der Kirche, den zu lösen sich Jahrhunderte Moraltheologie vergeblich bemühten. Staatlich geworden erleidet die Kirche eben alle Wandlungen und Schicksale des Staates. Halb von theologischen Vorstellungen durchdrungen, wie in seiner Gesetzgebung, appelliert der Staat immer wieder in den Nöten an seine adoptierte Zwillingsschwester, die Kirche. Mit sinkendem Erfolg.
Die Kirche leidet an der Fassung ihres Begriffes der Sünde und erleidet ihn. Die Haltung der Kirche gegenüber der Ehefrau ist nur wenig verschieden von jener der Antike. Durchaus gegen ihren Willen ließ sich die Kirche im 5. Jahrhundert eine weibliche Gottheit in der Madonna abringen, gab hier einem Laienempfinden nach. Aber nur dem Mütterlichen gab sie in dieser Gestalt Raum, – alle »sündige Liebe« wurde durch die Unbeflecktheit der Empfängnis eliminiert. Die Frau hat Kinder zu gebären, nichts weiter. Weil die Welt sich weiter zeugen muß. Ganz nah an die Erbsünde, an den Fluch, der aus dem Paradies treibt, ist diese physiologische Tatsache gerückt. Die Ehe genügt, das Geschlecht bis zu dem Tage zu erhalten, welcher als der jüngste einmal anbrechen wird. Nur um die Kinder handelt es sich der Kirche. In schwierigen Geburtsfällen ist auf das Kind Rücksicht zu nehmen, nicht auf die Mutter. Wo nur die Lust die Geschlechter zueinander führt, ist diese Lust Sünde. Die Liebe zu Gott muß so stark sein, daß Eheleute die lustvollen Gefühle der Liebe, falls sie vorkommen, nur grade dulden, aber weder aufsuchen noch gar Freude daran empfinden. Der fromme eheliche Mensch wird das notwendig Natürliche in deutlicher Spaltung seiner Person in einen tierischen und göttlichen Leib mit geschlossenen Augen tun. Er wird es erleiden. Nicht erfreuden. Oder solches bereuen, wenn es doch eintritt. Es erwies sich, daß der Mensch einer solchen Spaltung seiner integralen Person fähig war, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, unter einer Voraussetzung: daß er im Sanatorium der Kirche blieb, welches unausgesetzt sowohl an der Krankheit wie an deren Heilmitteln arbeitete. Es erwies sich, daß der Mensch fähig war, sowohl Zuschauer wie Akteur in dem göttlich-dämonischen Theater zu sein, das sich in seinem Innern spielte. Er lernte die Mechanik von Auftritt und Abgang, er bekam Tiefen und Höhen, Vordergründe und Hintergründe. Folgte er dem kirchlichen Regisseur, konnte nichts passieren. Entzog er sich ihm, so entfesselte er den Gott oder den Teufel, und das Gleichgewicht war zerstört, der Mensch kein Mensch mehr, sondern der von Gott oder dem Teufel Besessene, Heiliger oder dessen Gegenpol, Einzelner, Losgelöster, Irregulärer auf eigne Gefahr. Übrigens konnte auch die Kirche nur die kleinen Sünder fangen. Gegen die großen als neue instituierende Kräfte war sie ohne Macht: sie fand sich mit ihnen ab.
Die Kirche hat den Begriff der fleischlichen Sünde den Menschen nicht gegen ihre Natur aufgezwängt. Unter verschiedenen Namen haben die Alten die sinnliche Leidenschaft als eine schwere Krankheit erkannt und beschrieben, als eine Art Behexung. Die Kirche hat diese Behexung mit dem Namen Sünde moralisch getauft und den Begriff vertieft. Daß die Sünde weiter als Krankheit angesehen wurde, zeigt die Ausarbeitung der kirchlichen Heilmittel, der Art wie der Zahl nach. Die Wollust der Kreaturen ist gemengt mit Bitterkeit, das hätte auch ein von der sinnlichen Leidenschaft gepeinigter Grieche sagen können. Es ist nichts spezifisch Christliches in dem Satz, den die Kirche in ihrer Frühzeit nur für großes Orchester gesetzt hat, wofür die Antike mit ihrem sehr schwach entwickelten Dualismus der Welt keinen Anlaß hatte. Die Erdsüchtigkeit der Antike war weit stärker als ihre Jenseitssüchtigkeit, ihre Todesfurcht größer als ihre Sterbenssehnsucht.
Nicht der Trieb, sondern dessen Effekt, das Kind, ist der Kirche einziges Interesse. Und des Staates. Außereheliche Kinder, die »Kinder der Sünde«, läßt sowohl Staat wie Kirche die Sünde der Eltern büßen. Denn was in der Ehe als ein notwendiges Übel grade nur geduldet wurde, das war außerhalb der Ehe vom Bösen. Notdürftig in der Ehe mit Weihwasser besprengt, mußten die Eheleute, wollten sie ihr Seelenheil nicht verlieren, immer auf der Hut sein vor der Lust. Das war der seltsame Umweg, auf dem die außerhalb der Ehe als Sünde verfolgte Liebe zu gewissen Zeiten als Constituens der Ehe auftrat, immer etwas fremdartig wie der Brauch zeigt, daß man mit einigem Erstaunen von einer »Liebesehe« spricht als einem Ungewöhnlichen. Denn die Liebe gehört als ein Affekt nicht in eine dauernde Institution. Sie tritt da, vom Dritten kommend, nur störend und zerstörend auf. Oder enthüllt bald in ihrer kurzen Dauer das Problematische ihres Daseins in der Ehe. Aber da sich das Dasein der Liebe nicht leugnen ließ, kam es in den periodischen Schwächen der Kirche zu diesen Sentimentalismen, welche der Ehe auch die Liebe als Mitgift vindizierten, wenn nicht gleich bei der ehelichen Wahl, so als ein sicheres Produkt des Paktes, als ein zu erwartender Effekt des ehelichen Zusammenlebens. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß oft so was wie Liebe in der Ehe wurde, eine leidenschaftslose Liebe, die dem meist leidenschaftslosen Temperamente der meisten Menschen durchaus entspricht. Die Kirche konstituiert sich ja in ihren Anschauungen nicht aus den Extremen, sondern gut demokratisch aus der großen Masse der Mitte. Sie wird diese Ehen mit einer nicht besonders affektiv qualifizierten Liebe immer als die rechten und gemäßen ansehen, aus ihnen Bestätigung ihrer Anschauung und Haltung holen und mit ihrer Hilfe die Klippen ihres dogmatischen Nomos umschiffen. Diese Klippen wurden in ihrer Gefährlichkeit erst im 19. Jahrhundert sichtbar, zu dessen Beginn es aufkam, daß die Liebe zu ihrem Ziele die dauernde Vereinigung in einer Ehe habe. Die frühern für eine Eheschließung maßgebenden Motive sozialer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Natur wurden zwar in der Regel nicht ausgeschaltet, aber sie kamen in der Anschauung, oft auch in der Praxis, an die zweite Stelle –, die erste nahm die gefühlsmäßige Beziehung der Eheschließenden ein, das, was sie die Liebe nannten. Damit aber trat die Ehe in ihre Krise: sie bekam die sie heute auszeichnende Labilität. Denn jenes Gefühlsmäßige stellte sich, was dessen Dauer betrifft, als eine Täuschung heraus. Die erst vorhanden geglaubte oder wirklich vorhandene Liebe verschwand, und die Eheleute finden in ihrer aus Gefühlen geschlossenen Ehe den Sinn nicht mehr: sie trennen sich, um diesen Sinn in einer neuen Ehe zu suchen. Oder sie suchen die Liebe außerhalb ihrer Ehe, wenn sie aus innern oder äußern Gründen zu einer Trennung sich nicht entschließen können. Oder sie verzichten auf die Liebe und lassen andre Momente des ehelichen Beisammenseins als wichtiger sich an deren Stelle setzen: Kinderaufzucht, Freundschaft, Hausführung, helfendes Beisammensein, was eine gelegentliche immer matter werdende sexuelle Annäherung nicht ausschließt, besonders, wenn eine freudige oder traurige Spannung in ihrem Ablauf auch die erotischen Komplexe virulent macht.
Um das Lager der ehelichen Liebe stehen Engel und Teufel. Sich über das gelinde Feuer der ehelichen Liebe lustig zu machen, um zum Preise der leidenschaftlichen Liebe Kantaten zu singen, ist ein beliebtes Thema lyrischer Jugendlichkeit, die weder die Flamme noch das Feuerchen kennt. Diese eheliche Liebe wird unterwertet aus Überwertung des erotisch Passionellen, das, je seltener es wird, um so mehr Panegyriker findet, die gar nicht merken, daß sie der erotischen Leidenschaft schon längst grobe Surrogate gewöhnlicher Ausschweifung gegeben haben, wie sie eine Zeit liefert, die für jede sexuelle Nachfrage das entsprechende Angebot bereit hat. Die Beziehungen der heutigen Menschen werden immer flüchtiger, augenblickshafter, was sich auch im Erotischen bemerkbar macht, insofern jede erotische Spannung zwischen den Individuen schwindet, da jede momentane sexuelle Erregung um ein geringes sachlich zu stillen ist. Die erotische Spannung ist aber nur in der relativen Dauer einer sinnlich-geistigen Beziehung möglich, und die Verbundenheit in einer Ehe begründet die sexuelle Entspannung zum Vorteile der in ihr engagierten Individuen. Die eheliche Verbundenheit krümmt den allzu scharfen Stachel der sinnlichen Leidenschaft und rettet das Individuum, dem in der Leidenschaft der Verlust droht für die höhern Werte der Sozietät. Aber in der sexuellen Entspannung liegen diese Möglichkeiten einer erotischen Spannung nur dann, wenn nicht wie heut meistens Eigenliebe zu einer Ehe geführt hat, die in ihr nichts als das Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen und Erfüllung von Zwecken sieht, die außerhalb jeder Liebe, also auch der Ehe liegen. Die moderne Ehe zeigt kaum je irgendwelche sexuelle Pigmentierung, von ihrem erotischen Charakter ist daher gar nicht zu reden. Sie ist ein Zweckverband, der eine Form entlehnt und sich bemüht, diese Form nach außen zu wahren. Es hat sich daraus sehr viel Heuchelei entwickelt als eine der bedeutendsten sittlichen Leistungen des 19. Jahrhunderts. Balzac und Stendhal haben sie in Meisterwerken beschrieben.
Alle Umstände heutigen Lebens wirken daraufhin, daß sich die Ehe von der staatlichen und kirchlichen Kontrolle emanzipiert und als ein nichts als privater Status etabliert. Erst das Kind wird Staat und Kirche auf den Plan rufen: die Eltern müssen Garanten seiner Aufzucht und Erhaltung sein, beide nach ihren Mitteln, ob noch vereinigt oder schon wieder geschieden. Man sagt, die Geburten gehen zurück. Das wäre Grund genug, daß sich die Ehe gegen ihre kirchliche und staatliche Einschnürung wehrt, wie eben auch irgendein Liebespaar nicht die Polizei um Erlaubnis für ihre Liebe fragt. Eine vernünftige Gesetzgebung wird einmal nichts mehr über die Ehe bestimmen. Sondern nur über die Kinder.
§ 5
Aus den leidenschaftlichen Anstrengungen, welche die Frauen vor dem Kriege um die Gewährung des Wahlrechtes in die Parlamente machten, glaubten manche, daß dort, wo die Frauen nach dem Kriege in die Parlamente einzogen, das Wesen dieser Vertretungen sich radikal ändern würde. Man glaubte, daß die außerordentliche Niederlage, die das männliche Politisieren im Kriege und nachher erlitten hatte, den guten Verstand der Frauen mobilisieren würde und daß sie als die Partei der Frauen, nichts als der Frauen, gegen die abgenutzten politischen Ideologien der Männer stehen würden. Das stellte sich alsbald als ein irriger Glaube heraus. Die in den Zeiten von den Männern und für eine wesentlich männliche Welt geschaffenen Rahmen und Inhalte des Politischen erwiesen sich als weit stärker als der Verstand der Frauen, die mit dem Stimmzettel ihre Stimme verloren zu haben scheinen. Als ob es das Selbstverständlichste wäre, ordneten sie sich in die vorhandenen Männerparteien ein, als deren Komparsen durchaus und ohne irgendeinen Versuch, diesen Parteiinhalten etwas von ihrem Weiblichen hinzuzufügen. Als einzigen Effekt ihrer Anwesenheit in den Parlamenten konnte man höchstens dieses bemerken, daß die männlichen Abgeordneten etwas hypokriter wurden, zum Beispiel in Angelegenheiten des Alkoholverbotes in manchen Ländern oder in gewissen Fragen der öffentlichen Moral, Erziehung und Kunst. Da gaben die Männer, den Vorwurf Schweinehunde zu sein fürchtend, nach.
Man kann Meinungen darüber haben, ob dieses völlige Verschwinden der parlamentarischen Röcke hinter den parlamentarischen Hosen am System liegt, aber daß es an den Vertreterinnen liege, kann man nicht behaupten,