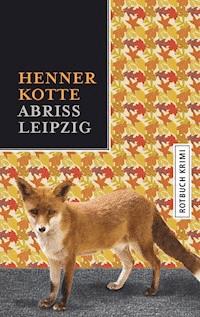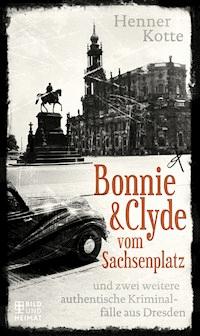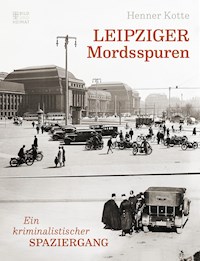Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Blutiger Osten
- Sprache: Deutsch
Money, money, money / must be funny / in the rich man's world. Nicht nur die Spaßgesellschaft lässt Menschen nach dem Gelde streben. Seitdem Zahlungsmittel im Umlauf, versucht man mehr davon zu bekommen, um sein Leben angenehmer zu gestalten. Straftaten aus materieller Bereicherung sind nicht nur Raub und Raubmord, auch betrügerischer Bankrott, Falschgeldherstellung, Insolvenzverschleppung, Unterschlagung, Steuerhinterziehung, Anlagebetrug … die Schlagzeilen letzter Jahre beweisen, dass die Phantasie auch hier keine Grenzen setzt. Doch die Praktiken gleichen sich über die Jahrhunderte in erstaunlicher Weise. Vorgeführt am Beispiel einer Stadt: Leipzig. Allein, sie steht für viele. Und auch vor Ort könnten der Verbrechen mehr aufgezählt werden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henner Kotte
Leipziger
Heimsuchung
und vier weitere Verbrechen
Bild und Heimat
Dank für die Unterstützung bei der Recherche gilt Christine Enderlein, Doris Mundus und Otto Werner Förster.
Von Henner Kotte liegen bei Bild und Heimat außerdem vor:
Schüsse im Finsteren Winkel und sechs weitere Verbrechen (Blutiger Osten, 2013)
Um Kopf und Kragen. Unbekannte Fälle aus dem Kuriositätenkabinett der Kriminalistik (2014)
Leipzig mit blutiger Hand und fünf weitere Verbrechen (Blutiger Osten, 2015)
Blutige Felsen. Kriminalstories aus der Sächsischen Schweiz (2015)
Blutiges Erz. Kriminalgeschichten aus dem Erzgebirge (2016)
Raubsache Leipzig und vier weitere Verbrechen (Blutiger Osten, 2016)
Bonnie und Clyde vom Sachsenplatz und zwei weitere authentische Kriminalfälle aus Dresden (2016)
eISBN 978-3-95958-731-0
1. Auflage
© 2016 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: capa
Umschlagabbildung: Chris Keller / bobsairport
In Kooperation mit der SUPERillu
www.superillu-shop.de
Vorwort
Geldkreislauf und Kollaps
Den lass ich bluten!, sagt mancher und meint damit nicht den Stich ins Herz. Nein, es geht ans Eingemachte: ans eigne Geld und das der andern. Finanzen halten den gesellschaftlichen Kreislauf am Leben und hauchen komatösen Staaten wieder Leben ein. Und Finanzen sind Brutstätte für Unregelmäßigkeiten, Unrecht, Misswirtschaft, Betrug und andere Verbrechen. Die täglichen Nachrichten strotzen von Schadensmeldungen aus dieser Branche. Die Geschichten sind bizarr. Wahrlich, welcher Krimiautor hätte sich die Storys ausdenken können? Kein Bankhaus, das nicht selbst die Gesetze gebrochen hat. Idole hinterziehen millionenmäßig Steuern. Whistleblower decken geheime Konten auf. Politiker verdienen außer den Diäten nebenbei, legen aber den Verdienst nicht offen. Wer schmiert wen womit und wie viel? Privatiers schleusen Tausender bar in Scheinfirmen und Depots. Der normale Bürger fragt sich bestürzt, ob er der Einzige sei, der bei Finanzen noch gesetzestreu handelt. Staaten der Europäischen Union brechen jährlich selbst die aufgestellten Regeln anstandslos. Private Gesetzesverstöße ihrer Steuerbürger bestrafen sie knallhart und ohne Milde. So wird der makabre Eindruck hinterlassen, dass zweierlei Rechtsmaßstäbe gelten: Wer zahlen kann, erhält auch von Justitia Boni.
Was uns heute die missliche Ausgeburt der Gegenwart scheint, ist seit anno dunnemals belegt. Die vorliegende Sammlung erzählt Geschichten von Neppern, Schleppern, Bauernfängern – aus drei Jahrhunderten, aus einer Stadt. Erschreckend: Die Methoden der Verbrecher waren stets dieselben. Politiker, die aus Gier öffentliche Gelder missbrauchen. Clevere, die Naive um die hart ersparten Groschen bringen. Banken, die sich verzocken und ihre Schuld nicht eingestehen. Finanzverbrechen sind Routine, nur gehen sie an unser Geld. Eins steht nämlich felsenfest: Das Buch solcher Verbrechen wird nie zu Ende geschrieben sein. Dieser Kreislauf bleibt erhalten: Man wird uns bluten lassen, bluten, bluten, bluten.
Hinter Stuck und schönem Stein
Geldpreller in Gasthaus und Palais
»Wie ich nun zu dem Sankt-Marx-Platze kam, ei sapperment! was stunden da vor wunderschöne Häuser, desgleichen ich in Holland und Engelland, wie auch in Schweden und ganz Indien an keinem Orte niemals noch nicht gesehen hatte. Sie waren, der Tebel hol mer, mit den kostbarsten Marmorsteinen ausgemauret, und war ein Haus wohl über funfzig Geschoß hoch, und vor einem jedweden Hause ringst um den Markt herum stund eine große Plumpe, aus Ursachen, weil das Wasser so seltsam ist. Mitten auf dem Sankt-Marx-Platze nun stund eine große Glücksbude, da griff nun hinein, wer wollte, es mußte aber die Person vor einem jedweden Griff einen Dukaten geben, es waren aber auch Gewinste darinnen zu sechzig- bis siebzigtausend Talern, und gab auch sehr geringe Gewinste, denn der geringste Gewinst wurde nur auf sechs Pfennige wert geschätzet. Wie ich nun sahe, daß manche Leute brav gewannen, so war ich her und wagte auch einen Dukaten daran und wollte mein Glück versuchen. Als ich nun in den Glückstopf hineingriff, o sapperment! was waren da vor Zettel, ich will wetten, daß es wohl über tausend Schock Millionen Zettel in dem Glückstopfe da vorhanden waren. Indem ich nun in den Glückstopf mit beiden Händen hineinfühlte, so tat ich auch einen solchen Griff, daß ich die Zettel bald alle auf einmal mit beiden Fäusten herausgriffe. Da dieses der Glückstöpfer sahe, o sapperment! wie klopfte er mich auf die Finger, daß ich soviel Zettel herausgeschleppt brachte, welche ich aber miteinander flugs wieder hineinschmeißen mußte und hernach vor meinen Dukaten nur einen einzigen hinausnehmen, welches ich auch tat. Wie ich nun vor meinen Dukaten einen Zettel aus dem Glückstopfe herausgenommen hatte und ihn aufmachte, so war es eine gute Nummer, und zwar Nummer elf, dieselbe mußte ich nun dem Glücksbüdner zeigen. Nun meinten damals alle Leute, ich würde was Rechts davontragen, weil ich eine ungleiche Nummer ergattert hätte, aber wie darnach gesehen wurde, was Nummer elf mit sich brachte, so war es ein Bartbürstchen vor sechs Pfeng. O sapperment, wie lachten mich die um die Glücksbude herumstehenden Leute alle miteinander mit meinem Bartbürstchen aus! Ich kehrte mich aber an nichts, sondern war her und griff noch einmal in den Glückstopf hinein und langete noch einen Zettel heraus, derselbe hatte nun wiederum eine gute Nummer, denn es war Nummer 098372641509. Sapperment! wie sperrten die Leute miteinander in und an der Glücksbude die Mäuler auf, daß ich eine so eine vortreffliche Nummer ergriffen hatte. Dem Glücksbüdner mußte es nun wohl flugs sein Herz gesagt haben, daß ich was Rechts aus seiner Bude ergriffen hätte, denn sobald er den Zettel nun ansichtig wurde, so fing er erschrecklich an zu schwitzen, und roch um ihn, als wenn er seine Hosen inclusive und exclusive stark balsamiert hätte.«
Christian Reuter: Schelmuffskys kuriöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande anderer Teil (1697)
Christian Reuter kannte Leipzig und seine Glückswilligen. Mit der Beschreibung ihres Gebarens brachte es der Autor zu weidlichem Nachruhm und einem Vermerk in der deutschen Literaturgeschichte. Seinerzeit landete Reuter vor Gericht. Allzu deutlich ließ seine Literatur Bezüge zu Leipzigs Bewohnern erkennen. Die beleidigte Gasthauswirtin Anna Rosine Müllerin, Wittib, mit ihren vier Kindern führte mehrmals Klage gegen den aufmüpfigen Studenten, der sie und ihre Familie der Lächerlichkeit preisgab. Wortgewaltig unterstützte sie ihr Schwiegersohn George Leib, ein Lehrer. Allesamt wurden sie bei Christian Reuter Komödienfiguren – und zum Gespött der Handelsstadt.
Zeitenwende 1700: Die deutschen Lande teilten Staatsgrenzen kleiner Herrschaftsbereiche absoluter Fürsten. Der Dreißigjährige Krieg hatte Sachsen geplündert, gebrandschatzt, ins Elend geführt. 50 Jahre danach waren nicht alle Kriegsschäden getilgt. Leipzig hatte ein Drittel der Bevölkerung verloren, rund 15.500 lebten nunmehr in der Metropole. Hunger grassierte und die Pest. Bewohner darbten und kämpften um jeden Groschen. Der große sächsische Kurfürst herrschte gnadenlos und baute seine Macht und seinen Einfluss aus. August der Starke wechselte für Polens Königskrone einfach so die Religion. Manch Intellektuellen in Luthers Heimat schien das ein Verrat am rechten Glauben. Nicht nur in Leipzig demonstrierten die Studenten gegen diesen plötzlichen Sinneswandel und kamen ob ihres »unsittlichen Verhaltens« in den »strengen Karzer«, was hieß: tagelang nur Wasser und Brot und Wasser und Brot und Wasser. Die Wirtschaft lag brach. Überregionaler Handel barg Misslichkeiten und Gefahren. Marodierende Banden machten Wege unsicher. Räuberhauptmann Lips Tullianmit seiner Schwarzen Garde verbreitete Schrecken auch beim gemeinen Bürger. Diebstahl, Falschgeld und Betrug. Doch hatte Leipzig seinen Ruf als Messemetropole auch während der kriegerischen Zeiten beibehalten und prosperierte. Vornehmlich zwischen Brühl und Markt entstanden sehr respektable Häuser, die hinter den schönen Barock-Fassaden Gästen Betten boten und Händlern Verkaufsfläche.
Anna Rosine Müllerin, Witwe des Eustachius Müller, residierte im Hause Zum rothen Löwen, Brühl 34 – 40 / Reichsstraße 42 / 44. Die Grundstücke »bildeten bereits im 15. Jahrhundert einen großen Gasthof mit Brauhaus usw.«. Seit »hundertundzwanzig Jahren schon saßen die Müllers in diesem stattlichen Hause, ein Eustachius war dem andern gefolgt, tüchtige Gewerbetreibende allesamt, die es doch nie bis ins Patriziat der Messestadt gebracht hatten«. Die Müllers strebten nach Höherem, doch ließ die Stadtschickeria dieses nicht zu. Sie passten halt nicht. Neben der Gewürzkrämerei übte der Eustachius Müller »die auf dem Hause ruhende Braugerechtigkeit für sechs Biersorten aus, betrieb eine Gastwirtschaft und hatte des wohlbestallten Gerichtsverwalters zu Knauthain eheleibliche Tochter Anna Rosine gefreit. Eine Familie also, die zweifellos teilhatte an dem raschen Wiederaufstieg der Messe- und Universitätsstadt nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, einem wirtschaftlichen Aufschwung, wie ihn damals nur Hamburg noch schneller erlebte. Was für Hamburg der Seehafen war, war für Leipzig die Kreuzung jahrhundertealter Handelsstraßen, der Hohen Landstraße von Frankfurt am Main nach Schlesien und weiter bis Kiew und der Reichsstraße von Süd- nach Norddeutschland. Daß Leipzig in jenen Jahren Frankfurt die führende Rolle im Buchhandel abgewann, war nur ein, vielleicht aber das charakteristischste Signum dieses gewaltigen Aufstiegs.«
Familie Müller saß wie andre Gewinner der Kriegs- und Nachkriegswirren auf ihrem schnell erworbenen Gelde. Und »das stieg nicht wenigen dieser Reichgewordenen übel zu Kopf. Obschon die Messestadt mit ihrer protestantischen Universität, in der freilich der Geist einer finsteren und militanten Orthodoxie hauste, zum katholischen Hof in Dresden ein sehr problematisches, oft widerspenstiges Verhältnis besaß, gelangte das Selbstbewußtsein ihrer neureichen Kaufleute und Manufakturisten nicht eigentlich zu sich selber. Man wußte es vielfach nicht besser zu praktizieren als in einer lächerlichen Großmannssucht, die ihre kühnsten Träume in der Gewinnung des Adelsprädikates erfüllt sah. Hatte daran auch der selige Eustachius Müller – er war 1685 gestorben – vielleicht noch keinen Anteil, so doch seine beiden Töchter Anna Rosine und Johanna Maria.« Diese Mädels wussten sich in Gesellschaft kaum zu benehmen, sprachen an vornehmer Tafel den unflätigen Jargon der Gosse und kleideten sich unbeholfen nach neuester Mode. Man sprach es nicht aus, doch gaben die Jungfern-Töchter viel Anlass zu Hohngelächter in der Stadt.
In jenem Gasthause Zum rothen Löwen nahmen anno 1694 zwei Studenten Quartier, die schon jahrelang an der Universität eingeschrieben waren. Johann Grel stammte aus Rügenwalde in Hinterpommern und bemühte sich seit mehr als zehn Jahren um seinen Abschluss. Freund Christian Reuter »begann mit dem Wintersemester 1688 sein Studium, wahrscheinlich an der theologischen Fakultät. Mit seinen dreiundzwanzig Jahren war er ungewöhnlich alt; die meisten Studenten wurden damals mit sechzehn Jahren immatrikuliert.« Allerdings war Reuter die Hochschulkarriere nicht vorherbestimmt gewesen. Er stammte aus verarmter Familie, geboren in Kütten, einem Dorfe zu Füßen des Petersberges nahe Halle an der Saale. Er besuchte die Merseburger Domschule und bewarb sich dann mehrmals um ein Stipendium in Zörbig, der Stadt, der einst sein Großvater Gelder gestiftet. Die dortigen Stadtväter lehnten Reuters Gesuch ab. Erst als er sich schon in Leipzig eingeschrieben, gewährten sie ihm nach dritter Bewerbung ein Zubrot.
Nun also bewohnte Reuter mit Busenfreund Grel das Müllersche Etablissement. Die Haustöchter Anna Rosine und Johanna Maria erblühten zu Damen, zählten sechzehn und achtzehn Jahre. »Man sagte, daß sie mit ihrer Gunst nicht zu engherzig gewesen sein sollen.« Grel und Reuter genossen ihr Studentenleben, indem sie die Alma Materwenig besuchten. Sie gingen ins Opernhaus, das 1693 auf der Rannischen Bastei eröffnet hatte, und ins Theater, das nahebei im Fleischhaus durch wandernde Komödianten bespielt wurde. Beliebt waren Harlekinaden mit dem unabdingbaren Hanswurst oder Pickelhering, der als des Königs lustiger Rat Firlefanz machte. Das Volk schlug sich auf die Schenkel.
Allerdings blieben die Studenten Reuter und Grel ihrer Herbergsmutter monatelang den geforderten Mietzins schuldig. Anna Rosine Müller hatte sie mehrmals verwarnt. Nach fast einem Jahr schmiss sie die säumigen Herren unfein hinaus auf die Straße. Die waren ob solcher Behandlung wütend, so grob geht man mit armen Studiosi nicht um. Zur Ruhe gekommen, entdeckte Reuter seine wahre Berufung: er schriftstellerte fleißig und im Geiste der Komödien Molières. Bei Veröffentlichung der Texte versteckte er sich hinter einem Pseudonym, Hilario, und gab vor, die Worte aus dem Französischen übersetzt zu haben. Zensor Johann Heinrich Ernesti zögerte, doch gab er das Lustspiel Die ehrliche Frau zu Plißine zum Drucke frei. Alsbald hatte der junge Verleger Martin Theodor Heybey 400 Exemplare verkauft. Ei sapperment!, es war ein Spaß, denn die Bezüge zur Müller-Wirtin am Brühl und ihren Kindern waren all zu offensichtlich. Der Tebel hol mer! Bis hinein in ihre Redensarten wurde Anna Rosine zitiert. Frau Schlampampe nannte sich im Stücke die Frau, ihre Kinder hießen Charlotte, Clarille, Schelmuffsky und Däfftle. Man erkannte sie alle wieder.
»Kam sie auf den Markte, so stunde sie mitten unter dem Haufen ihrer liederlichen Zuhörern und erzählete, wieviel sie vorige Nacht Flöhe in Däfftle seinem Hemde gefunden, wie sie Herrn Schelmuffsky bei der jungen Magd im Bette erwischt und daß sie den Jungfern Töchtern das Bettuch abermal an den Ofen hängen müssen, weil sie solches mit ihren jüngferlich Ostertau etwas zu sehr angefeuchtet. Bald gab sie der Frau Nachbarin den Rat, wie sie ihrem Manne durch eine gute Kraftsuppe wieder in den Sattel helfen solle, bald wußte sie ein gutes Mittel zu erzählen, wodurch der harte Leib der großen Magd wieder zu eröffnen oder wie der gefährliche Geschwulst der wassersüchtigen Jungfern künstlich zu vertreiben. Ja, wie die Ente jeden Tag nichts als Dreck, Dreck schreiet, so hatte auch Frau Schlampampe nichts als Dreck, das ist garstige Zoten, Saufratzen und unsaubere Röckeleien in dem Munde. O pfui der garstigen Plauderente!«
Reuters Kommilitonen zogen in Gruppen hin Zum rothen Löwen und skandierten genüsslich die Verse und die Gerüchte: Der Gulasch-Topf auf dem Abendtisch würde auch als Nachtgeschirr im Hotel benutzt werden. Das Bier sei gepanscht. Sauberkeit ließe zu wünschen übrig. Schaben und Motten und Ungeziefer allüberall. Eine wahre Schlampenwirtschaft sei’s Gasthaus. Solche Worte gereichen einer Wirtin natürlich zur Unehr’.
Frau Anna Rosine verzweifelte und zog am 5. Oktober 1695, vom Schwiegersohn unterstützt, vor Gericht und klagte dem Hochedlen Rath der Stadt Leipzig, »daß sie die zween Studenten Grel und Reuter, die ehemals bei ihr gewohnet, dann aber, weil sie keinen Pfennig Mietzins zahlten, nicht länger von ihr geduldet worden, bei Einer löblichen Universität denunciret habe, mit einigem Verdacht jener Comödie wegen, die kürzlich im Druck herausgekommen und aus der nachts etliche Personen allerlei Reden sowohl vor als auch gar zu ihrem Fenster herein gerufen hätten, so ach, die ehrliche Frau und Schelmuffsky auch der Tebel ho mer! oder Ei sapperment!, daß auch des Abends Jungen vors Haus getreten und eben davon gesungen und gestern des Herrn Griebners Sohn ausdrücklich vermeldet habe, daß selbige Comödie auf sie gemachet und das in ihrem Hause befindliche neue Gebäude übern Wassertroge darin deutlich abgebildet sei. Auch möchte, wofern diesem Geschrei an ihrem Hause nicht gesteuert würde, leichtlich groß Unglück entstehen, indem ihr ältester Sohn heute oder morgen heimkomme und es nicht leiden möge.«
Wer der Federführer dieses Schmähstücks war, war Anna Rosine Müller augenblicklich klar: ihr säumiger Mieter, der Christian Reuter. Und bei einem Stücke ließ es der Autor nicht bewenden. Zunächst erschien L’Honnéte Femme Oder die Ehrliche Frau zu Plißine / in einem Lust-Spiele vorgestellet / und aus dem Französischen übersetzet von HILARIO. Nebst Harleqvins Hochzeit- und Kind-Betterin-Schmause. Plißine / Gedruckt im 1695sten Jahre. Wobei Plißine den Leipziger Stadtfluss Pleißebezeichnet. Es folgten: Der ehrlichen Frau Schlampampe Krankheit und Tod, die Oper Der anmuthige Jüngling Schelmuffsky und Die ehrliche Frau Schlampampe und schließlich Schelmuffskys wahrhaftige curiöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande. Ort und handelnde Personen waren stets gleich: Familie Müller und ihr Gasthaus Zum rothen Löwen, Brühl No. 40.
Nachdem in Leipzig der Streit der Parteien kein Ende fand, wandte sich die beleidigte Wirtin nach Dresden an Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen und König von Polen-Litauen, persönlich. »Die bitteren Folgen kamen dieses Mal langsam. Am 31. Juli des nächsten Jahres wurde Reuter für acht Wochen in den verrufenen Bauernkarzer der Universität geworfen und Ende September – offenbar im Zusammenhang mit den großen Studentenunruhen vom 15. und 17. September, die sich gegen den Übertritt August des Starken zum Katholizismus wandten – auf sechs Jahre relegiert. Mutter Anna Rosine war es freilich nicht mehr vergönnt, den Triumph ihrer Rache zu feiern, schon am 3. Juni dieses bösen Sommers war sie unversehens mit Tode abgegangen. Reuter verschwand, wie es die Relegation ihm eidlich abverlangt hatte, aus Leipzig.« Ließ er sich doch in Leipzig sehen, verklagte ihn Familie Müller. Letztlich wurde er lebenslang von der Universität verbannt. Fortan verdiente Reuter sein Geld als Sekretär und später als preußischer Hofschreiber. »Keine Akte nennt rühmlich seinen Namen. Er blieb einer von vielen, die mit mythologisch-allegorischen Freuden- und Trauergedichten, mit Singspielen und Schäferpoesien, Huldigungscarmina allesamt, den Festkalender des ersten Preußenkönigs auszierten. Da war nicht Ruhm noch Ehre zu gewinnen, da verlor die Poesie jede Freiheit und Würde.
Müller-Sohn Eustachius, genannt Schelmuffsky, führte der Mutter nachfolgend die Geschäfte im rothen Löwen. »Als er 1713 das Zeitliche segnete, brach über sein Vermögen der Konkurs herein, und das Haus mußte versteigert werden.« Der Aufstieg der Familie Müller in die obere Gesellschaft Leipzigs war schmählich gescheitert. Er blieb ein Traum.
»So kamen die großen Ratspersonen, welche in vierzehnhundert Nobels bestunden, die bekomplimentierten mich und schätzten sich glücklich, daß sie die hohe Ehre haben sollten, meine vornehme Gegenwart zu genüßen. Als sie solch Kompliment gegen mich nun abgeleget hatten, so antwortete ich zu Pferde überaus artig auch wieder, in halb engelländischer, halb holländischer, wie auch bisweilen teutscher Sprache. Sobald als nun meine Antwortsrede aus war, hießen mich die sämtlichen Ratsherren absteigen und baten mich, daß ich ihr vornehmer Gast sein sollte. Worauf ich mit meinen großen Kober alsbald abstieg und gab Ordre, mein Pferd solange ins Häscherloch zu ziehen, bis daß ich gegessen hätte, welches auch geschahe. Damit so führeten mich drei Präsidenten in der Mitten auf das Rathaus hinauf, hinter mir her gingen nun die sämtlichen Mitglieder des Rats alle zu zwölfen in einer Reihe. Wie wir nun elf Treppen hoch auf das Rathaus gestiegen waren, ei sapperment! was präsentierte sich da vor ein schöner Saal. Er war mit lauter geschliffenen Werkstücken von Glase gepflastert, und anstatt des Tafelwerks waren die Wände mit lauter marmorsteinern Gipse ausgemalet, welches einen fast ganz die Augen verblendete. Mitten auf dem Saale, nicht weit von der Treppe, stund eine lange, von venedischen Glase geschnittene Tafel gedeckt, auf welcher die raresten und delikatesten Speisen stunden. Ich mußte mich nun mit meinem großen Kober ganz zuoberst an die Tafel setzen, und neben mir saßen die drei Präsidenten, welche mich die elf Treppen hinaufgeführet hatten. Weiter an der Tafel hinunter saßen die übrigen Mitglieder des Rats und sahen mich alle mit höchster Verwunderung an, daß ich solchen Appetit zu essen hatte. Unter währender Mahlzeit wurde nun von allerhand diskurieret, ich aber saß gänzlich stille und stellte mich, als wenn ich nicht bis drei zählen könnte. Da ich mich aber sattgefressen hatte, so tat ich hernach mein Maul auch auf und fing an zu erzählen, wie ich in Indien einsmal von dem Großen Mogul so vortrefflich wäre beschenket worden und wie daß ich denselben den Calculum wegen seiner Einkünfte hätte führen müssen und wie ich noch halb soviel Überschuß herausgebracht, als er jährlich hätte einzunehmen gehabt, und daß der Große Mogul mich deswegen zu seinem Reichskanzler machen wollen, weil ich Adam Riesens Rechenbuch so wohl verstanden. O sapperment! wie horchten die Männer des Rats, da ich von dem Reichskanzler und Adam Riesens Rechenbuche schwatzte. Sie titulierten mich hernach nicht anders als ihre Hochwürden und fingen alle miteinander gleich an, meiner Gesundheit zu trinken.«
Christian Reuter: Schelmuffskys kuriöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande anderer Teil (1697)
Versuchten die Müllers um Wittib Anna Rosine, mit sämtlichen Mitteln den gesellschaftlichen Aufstieg zu erlangen, gehörte die Familie des Franz Conrad Romanus zur Leipziger Oberklasse qua Geburt schon dazu.
Romanus’ Vorfahren lassen sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen und waren ansässig zu Köthen. Der Familie Erster, der in der Messestadt wirkte, hieß nach Tradition Franz. Er trug zum Namen damalig den Zusatz »von Muckershausen auf Braußwig«,was Stellung und Würde unterstreicht. Jener Franz Romanus von (Neu-)Muckershausen und Braußwig (1550–1636) war Doktor der Rechte, Oberhofgerichtsassessor, Rektor der Alma Mater Lipsiensis in den Jahren 1585, 1595, 1601, 1607. Er zeugte siebzehn Kinder und etablierte in Leipzig eine Juristendynastie. Einer seiner Söhne namens Franz machte (fast) identisch Karriere: Leipziger Professor mit dem Titel de Verborum Significatione et de Regulis Iuris und Rektor der Universität. Dieser war wiederum Vater von vierzehn Kindern, u.a. von Caspar Theophilus Romanus, Rechtskonsulent.
Diesem Caspar Theophilus Romanus wird am 7. März 1671 Sohn Franz Conrad geboren. Die Mutter erlebte dessen Taufe am 8. März nimmer, sie verstarb im Kindbett. Der Vater heiratet neuerlich, Franz bekommt einen Halbbruder: Carl Friedrich. Beide Söhne widmen ihre Studien der Rechtswissenschaft und werden zum Doctor iuris promoviert. Mit 23 Jahren heiratet Franz Conrad seine Cousine Christiane Marie Brummer, mit der er acht Kinder zeugt. Zwei davon überleben: Christiana Mariana wird anerkannte Dichterin. »Die, welche sich nur selbst erheben, / Die gerne groß und vornehm sind, / Nach allen Ehrenämtern streben, / Da doch den Kopf nichts füllt als Wind: / Die keine Wissenschaften kennen, / Und dringen sich in Würden ein, / Die kann man wohl mit Namen nennen, / Daß sie der Thorheit Kinder seyn.« Ihr Bruder Franz Wilhelm setzt nicht nur im Namen die Traditionen fort: Er wird Universitätsprofessor und unterrichtet – Rechtswissenschaft.
Franz Conrad Romanus also nahm den vorgegebenen Weg: Schule, Studium, Promotion (1692), eigene Kanzlei, erhabener Wohlstand. Die Rechtsgeschäfte gingen gut, und Gattin Christiane Marie brachte 30.358 Taler in die Ehe ein. Mehrfach wohnte der Advokat am Hofe zu Dresden, wo er im Kanzleramte tätig war und er dem Kurfürst und König angenehm auffiel. »Franz Conrad Romanus hatte eine hohe, stattliche Gestalt, unter der schweren Allongeperücke ein jugendliches Gesicht mit klarer, hoher Stirn, schöngezeichnete Augenbrauen, lebhafte und milde Augen, ein energisches Kinn, etwas aufgeworfene Lippen, um die meistens ein feines Lächeln spielte. In Dresden hatte er sich Hofschliff angeeignet, und als die rechte Hand des Staatskanzlers Beichlingen war er vielfach in Verhandlungen tätig gewesen, die mit seinem juristischen Amte nichts zu tun hatten.« Wahrscheinlich sah August der Starke in dem strebsamen und diplomatisch geschickten jungen Manne Potenz, die ihn in Leipzig Einfluss gewinnen lassen würde. Denn die selbstbewussten Bürger der Messestadt handelten nicht immer nach seinem kurfürstlichen Willen. Vor allem öffneten sie nicht ihre Schatullen, wenn August der Starke klamm war. Geld bedurfte das Herrscherhaus zu Dresden ständig, um seine Pracht entfalten zu können. Franz Conrad Romanus wurde vom Herrscher zum Appellationsrat berufen, das verpflichtete. Nun harrte der Advokat seiner weiteren Karriere. Die Hoffnungen erfüllten sich durch kurfürstliche Einflussnahme.
August des Jahres 1700: Leipzigs unabtretbar scheinendes Stadtoberhaupt Adrian Steger segnete das Zeitliche im stattlichen Alter von 78 Jahren. Dem Kurfürst wäre es genehm, wenn sein getreuer F. C. Romanus diesen verantwortungsvollen Amtsstuhl besetzen tät. So versuchte August der Starke, die freie Bürgermeisterwahl per decretum zu hintertreiben, er erließ eine Verordnung ohne Widerrede:»Demnach bei Unserer Stadt Leipzigk durch absterben Adrian Stegers eine Bürgermeisterstelle sich erledigt, welche bei nächstkünftiger Wahl des neuen Raths zu ersetzen die Nothdurft erfordert, und Wir aus sonderbaren Gnaden, gutem Wohlbedacht und reiflicher Überlegung auf Unseren Appelation-Rath D. Franciscum Conradum Romanum wegen seiner Uns bishero treu geleisteten Dienste und guten qualitaeten, absonderlich auch der zu Beförderung derer Commercien ihme beiwohnende Wissenschaft Unser Absehen gerichtet: Alß begehren Wir hiermit, Ihr wollet ernannten D. Romano das Bürgermeisteramt förderlichst antragen«, meinte der Kurfürst und hatte keinen Zweifel, dass Leipzigs Rat nach seinem Wollen auch handelte.
Der Leipziger Rat jedoch fühlte sich hintergangen, mehr noch brüskiert, sah das Wahlgesetz verletzt, das ihm alleinig das Wahlrecht seines eigenen Stadtoberhaupts zugestand. Außerdem empfanden die alten Herren den Kandidaten von Königs Gnaden mit gerade mal 30 Lenzen für das hohe Amt zu jung, viel zu jung. In der Stadt schien es Usus, dass man »70 Jahre alt sein müsse, um im Stadtregiment etwas bestellen zu können«. Öffentlich stellten sich die Ratsherren nicht gegen den herrschaftlichen Besetzungsvorschlag, hofften jedoch, dass der Kurfürst mit der Überreichung von 100.000 Gulden seinen Willen ändern möge. Bestechung.
Eilig schickte man Stadtsyndicus Gottfried Graeve zum Schloss hin nach Warschau. »Der König blieb dabei, sein Appellrat Dr. Romanus sei der geeignete Mann für den Posten eines regierenden Leipziger Bürgermeisters; auch das Angebot von Geldgeschenken, das im Namen des Rates gemacht wurde, blieb unberücksichtigt, obwohl der König sich ja, seitdem er die politische Krone trägt und seit dem unseligen Schwedenkriege, stets in größter Geldnot befindet. Man wies daraufhin, wie oft wir mit sehr hohen und starken Geldsummen aufgewartet, und daß wir ihm trotzdem einen weiteren Vorschuß von hunderttausend Gulden in Aussicht stellen wollten, wenn er seinen Befehl betreffs des Dr. Romanus zurücknehme; im übrigen sei es ohne Beispiel, daß jemand in dieser Weise, bei solcher Jugend und ohne vorher im Rate gewesen zu sein, sich ins Bürgermeisteramt eingedrängt habe.«
August der Starke verzichtete auf das ihm dargebotene Geld, es schien ihm wohl mit Günstling Romanus auf dem entscheidenden Posten Leipzigs der eigene Vorteil lang anhaltender und ungleich größer. Der Kurfürst setzte seinen Willen durch, und Romanus verdoppelte die bisherige Besoldung der Ratsleute um 50 Taler. Bestechung. Der Durchschnittslohn der arbeitenden Bevölkerung lag bei 20 Talern im Jahr, meist jedoch erheblich drunter.
Ein Jahr hatten das Postengeschacher, die Reden und Widerreden und diplomatische Hintergrundgespräche gedauert. Doch endlich: »Vor dem Leipziger Rathause stand gaffend eine dichtgescharte Menge; schwül brannte die Augustsonne auf dem Pflaster. Es war der 22. August 1701. Befremdliche Dinge waren vorgegangen; ein neuer Bürgermeister war gewählt worden, aber nicht nach der freien Wahl des Rates, sondern er war dem Rate mit Nichtachtung aller Privilegien aufgedrängt worden durch ein Dekret des Kurfürsten, und heute sollte der neue Bürgermeister in sein Amt eingeführt werden. Das alles hatte großes Aufsehen erregt. Das alte Recht war gebrochen worden.«
Die »löbliche Bürgerschaft mit jedermann Vergnügen«akzeptierte ihren neuen Bürgermeister notgedrungen. Und der Kurfürst erklärte nach Erlangung seines Willens allergnädigst und besänftigend, »daß dasjenige, was mit ietzt gedachten Dr. Romani Beförderung zum Bürgermeister-Ambte zu Leipzig vorgegangen, dem Rathe daselbst zu keinem Praejudiz gereichen noch zu einem Exempel der Nachfolge angezogen werden, sondern besagter Rath in Zukunft bei der freien Rathswahl ohne Eintrag und Hinderniß« wieder eigenverantwortlich handeln könne. Das war insofern kein Problem, da der junge Bürgermeister sein Amt und seinen Einfluss noch gut 30 bis 40 Jahre ausüben würde. Und August der Starke erleichterte den Leipziger Ratsherren die Akzeptanz seines Günstlings mit dem wohlmeinenden Hinweis, dass die »einem jeden Raths-Freunde von Bürgermeister an bis auf den Untersten über ihre bisherige Besoldung annoch einhundert Thaler« nochmal ums Doppelte aufgestockt würden. Bestechung.
Die Garde der alten Ratsherren (alle zählten über 60) verzieh wohl dem Jungspund seine despektierlichen Reden, ob diesem nun viermal höheren Salär. Und Romanus tat mehr: Er erließ der Stadt die aufwendig bürokratische Rechnungslegung. »Wir confirmieren auch weiter und bestätigen dem Rathe die Befreiung von Ablegung ihrer Administrations- und Haußhaltungs-Rechnungen und geben ihnen hiermit allergnädigste Versicherung, daß keine Revision sie wieder anordnet.« Was letztlich hieß: Romanus weitete seine Machtbefugnis aus und sah über bisherige Schlampereien in Kassen- und Unterschriftenordnung hinweg. Er forderte, »keinerlei Unregelmäßigkeiten zuzulassen und jede eigenmächtige Benutzung des Kasseninhaltes zu unterbinden«. Clever, denn alleinig ihm, Franz Conrad Romanus, oblagen nunmehr Aufsicht und Kontrolle der Leipziger Finanzen.
Solch arbeitsteiliges und freundliches Gebaren bei der Besetzung neuer Posten ließ die mürrischen Ratsherren mit Romanus gut auskommen. Die Stadtbewohner nannten ihren neuen Bürgermeister alsbald ihren »Bürgervater«. Denn Romanus brachte Leipzig auch anderweitig spürbare Erleichterungen. Am Heiligen Abend 1701, vier Monate nach Romanus’ Amtsantritt, erhellten erstmals 700 Öllampen Straßen und Gassen. Das minderte auf nächtlichen Wegen die Gefahren, machte die Stadt sicherer, so dass »viel Sünden, sonderlich wider das fünfte, sechste und siebenthe Geboth, mercklich gesteuret und kräfftiglich verwehret werden«. Die Leuchter »stehen auf zwei Meter hohen Holzpfosten. Die Laterne selbst ist aus Eisenblech gebildet und mit einem kleinen Türchen versehen, durch das der Docht entzündet wird.« Drin eine Schale mit Rübsöl (ähnlich dem Raps), welches die Flamme nährte. »Gleichzeitig mit dieser hochlöblichen Anstalt werden Strafen angekündigt, die derjenige zu erwarten hat, der eine Lampe beschädigt: Stellen an den Pranger, Landesverweisung, Anhaltung im Zuchthaus zu schwerer Arbeit, Züchtigung mit Ruten und weitere Leibesstrafen, je nach Grad der Beschädigung.«
Man war sich der Innovation und der Wirkung bewusst: Es »war ein erbaulich Schauspiel, wie auf den langen Häuserreihen auf einmal so merkwürdige Lichtscheine spielten, wenn sie auch nicht zu den Giebeln empordrangen, und die Vorübergehenden konnten sich in die Gesichter sehen, während sonst im tiefen Dunkel nur Schatten sich bewegten. Am hellsten schien der Marktplatz beleuchtet und das Rathaus, von dem all dies Licht ausgegangen war.«
Solch beeindruckende Illumination der Stadt durfte nächtens nie verlöschen, auch zeitweise nicht. Frost hätte das Öl stocken lassen, deshalb gossen Lampenwärter Alkohol ins Schälchen, damit das Licht auch bei Minusgraden hell leuchtete. Nicht allen Alkohol schütteten sie aus, die Redewendung von »einen auf die Lampe gießen«findet hier ihren Ursprung.
Trotz Erleuchtung und internationaler Messe, die Neuzeit hatte auch in Leipzig noch nicht begonnen. Mittelalterliche Städte stanken zum Himmel. Viele Menschen hielten Vieh: Schweine, Kühe, Gänse. Scheiße, Mist und Abfälle landeten auf offener Straße. Der Stadtgraben war ein einziger Fäkaliensumpf. »Bürgervater«Romanus ließ über Schleusen all den Unrat in das Flüsschen Pleiße hinwegspülen. 1702 begannen seiner Anordnung gemäß die ersten Kanalisationsarbeiten. 1755 war das Projekt innerstädtisch abgeschlossen. Er selbst kam nicht mehr in den Genuss der Hygiene.