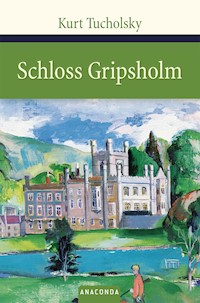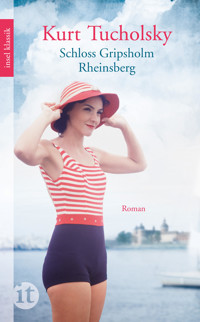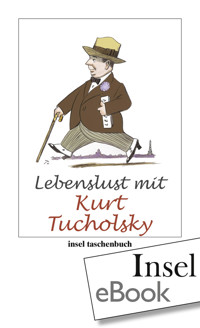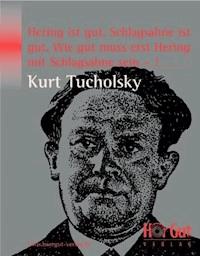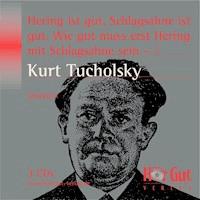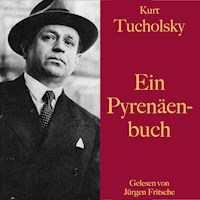Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
In dieser Sammlung von Gedichten, Artikeln und Prosatexten nimmt der Autor die Leser mit auf eine gedankenanregende Reise zwischen Krieg, Religion und Politik. Er drückt seine Verwunderung über die Ignoranz der Menschen und die Intoleranz der Völker aus, sowie über die gescheiterte Republik und das politische Marionettenspiel in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg. Dabei bringt er deutlich die Liebe zu seinem Heimatland Deutschland zum Ausdruck. Tucholsky möchte den Lesern einen realistischen Zukunftsblick gewähren und sie zum Nachdenken anregen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Tucholsky
Lerne lachen ohne zu weinen
Saga
Lerne lachen ohne zu weinen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1931, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728015483
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
DEM ANDENKEN
jakopps
An das Baby
Alle stehn um dich herum:
Photograph und Mutti
und ein Kasten, schwarz und stumm,
Felix, Tante Putti . . .
Sie wackeln mit dem Schlüsselbund,
fröhlich quietscht ein Gummihund.
„Baby, lach mal!“ ruft Mama.
„Guck“, ruft Tante, „eiala!“
Aber du, mein kleiner Mann,
siehst dir die Gesellschaft an . . .
Na, und dann — was meinste?
Weinste.
Später stehn um dich herum
Vaterland und Fahnen;
Kirche, Ministerium,
Welsche und Germanen.
Jeder stiert nur unverwandt
auf das eigne kleine Land.
Jeder kräht auf seinem Mist,
weiss genau, was Wahrheit ist.
Aber du, mein guter Mann,
siehst dir die Gesellschaft an. . .
Na, und dann — was machste?
Lachste.
KINDERWAGEN
Fahrt ins Glück
Ich ziehe meinen Rolls-Suiza aus dem Bootsschuppen, prüfe die Propeller und reite ab. Der Landweg führt durchs Holsteinische, vorbei an dem Dörfchen Lütjenburg, wo im Jahre 1601 Jakob Wasa mit Georg dem Heizbaren die berühmte Schlacht bei Lütjenburg schlug, in der ihm sechs Pferde unter dem Leib . . . vorüber; Baumwipfel und kleine Kuppen grüssen — und da liegt Mütterchen Ostsee. Die Strasse führt durch Hafkrug, Scharbeutz, Timmendorfer Strand.
Wir sind im Herbst, und Villen, Hotels und Kurhäuser stehen leer; nur hier und da ragt noch ein Strandkorb mit Wimpeln und einer Fahne; die Manikür-Fräulein sitzen gelangweilt vor den Frisiersalons in der Sonne und putzen sich selber die Nägel, um nicht aus der Übung zu kommen; Hunde lungern herum und schnüffeln in alten Zeitungen, lesen und heben ein Bein; die Ostsee ist eigentlich schon zugedeckt. Und je weiter ich komme, desto mehr blähe ich mich auf; ich nehme zusehends zu, vor Schadenfreude bekomme ich fast einen kleinen Bauch . . . Was tat der Marquis de Sade? Er röstete kleine Mädchen und bestreute sie mit gestossenem jungem Mann? Das ist gar nichts. Ich — ich geniesse eine Sommerfrische, die ich nicht zu geniessen brauche.
Meine wollüstige Phantasie bevölkert diese leeren Strassen und Häuser; es ist heiss, eng und staubig, alles ist besetzt, und die Wirte sind frech wie die Aasgeier, die nur noch aus Übermut fressen. „Ein einzelnes Zimmer geben wir nur an achtköpfige Familien ab —!“ Die Ostsee liegt faul da, wie ein alter Tümpel; sie stinkt widerwillig vor sich hin, das gefangene Raubtier, und die Leute sagen: „Nein, wie erfrischend es hier aber ist —!“ Eine Wolke von fataler Ausdünstung lagert über Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Hafkrug; Teller rasseln, Hunde bellen, Kinder quäken, und ein Brei des Geredes ergiesst sich über den Strand:
— „Geh doch ma rrüber, bei Rrröper — sach man, es wehr für uns!“ — „Nu sehn Sie sich bloss mal Frau Lahmers an, wie sie heut wieder aussieht! Wie macht die Frau das bloss?“ — „Kuck mal, ’ne Judsche!“ — „Einen Umchain haben diese Goiten!“ — „Wer mir an meinen Strandkorb rankommt und will die schwarz-weiss-rote Flagge runterholen, den hau ich — na, das wär gelacht! Wir sind doch hier zur Erholung hier!“ — „Hab ich nötig, Schwarz-Rot-Gold aufzuziehen? Wir sind doch zur Erholung hier . . .!“ — „Hat er dich für heute abend hinbestellt? Würd ich nicht gehen . . . Elli, das kannst du nicht tun! Oder du nimmst mich mit!“ — „Das kommt ganz auf die Umstände an, gnäjjes Frollein!“ — „Auf welche Umstände, Herr Assessor?“ — „Nero! Nero! Komm mal her! Komm mal hierher! Komm mal hier mal her! Nero! Pfuit! Pfuiiiit! Kannst du nicht hören! Nero!“ — „Mama, Lilly schmeisst mit Popeln!“ — „Frau Doktor! Frau Doktoor! Sie haben Ihren Büstenhalter vergessen!“ — „Schrei doch nicht so!“ — „Na, meinste, man sieht das nicht, dass sie ein hat. . .?“ — „Mir ist die ganze Reise verleidet!“ — „Meines Erachtens nach beruht die Rettung Deutschlands wesentlich auf den Kolonien. Also, meine Herren, England. . .“ — „Ein kleiner Kaffee zwei vierzig, ein Teelöffel achtzig, ein Glas Wasser fünfzig, eine Tasse dreissig, Kuchen haben Sie nicht gehabt, macht vierzig, zusammen. . .“ — „Donnerwetter, hat die Frau Formen —“ Und ich bin nicht dabei.
„Mir ist die ganze Reise verleidet —!“ Mütter tosen, bei denen man sich aussuchen kann, ob sie zu wenig geliebt oder zu wenig geprügelt worden sind; die Zuckungen in Unordnung geratener Gebärmütter vergiften ganze Existenzen. Kinder heulen, Väter fluchen, die Hunde kneifen gleichfalls den Schwanz ein, und die Grundlage des Staates ist, woran kein Zweifel, die Familie.
Jetzt bin ich aufgepumpt wie ein Ballon, das Gas der Gemeinheit erfüllt meine kleinsten Poren — ah, nicht dabei sein müssen, wenn sich diese Menschheit zwecks Erholung zu scheusslichem Klumpen zusammenballt wie vereinbaren Sie das Herr Panter mit Ihrer sozialen Gesinnung da erholen sich diese armen Leute so gut sie das können und Sie halt die Schnauze es gibt Flammri, der zittert vor Ekel über sich selbst auf dem Teller, alles ersauft in derselben Sauce, abends knallt eine dolle Nummer von Sekt an den Tischen der Réühniong und fliesst derselbe in Strömen aus Schmerz über den Schmachfrieden von Versailles . . . weil sie sich am Morgen in die wehrlose Ostsee stippen, waschen sie sich nun überhaupt nicht mehr, wieso, wo wir doch morgens baden, Emmy, du bist ein Ferkel, es ist heiss, es ist staubig, es riecht nach Milch und kleinen Kindern und Pipi, es ist überhaupt so schön, wie es nur die Natur und der Bürger vereint zustande bringen — und ich bin nicht dabei.
Hochkragige Fememörder mit Holzfressen, in deren kalten Augen eine stets parate Grausamkeit glitzert; sich erholende Buchhalterinnen für sechs Mark fünfzig den Tag zuzüglich Getränke; sie tragen eine Liebenswürdigkeit im Herzen, die nur für einen ausreicht — dem Rest gegenüber sind sie sauer und so unfreundlich. . .
Manchmal ist es schön, allein zu sein. Manchmal ist es schön, keinem Verein anzugehören. Manchmal ist es schön, vorbeizufahren.
Der Herbsttag ist blau, die hohen Bäume rauschen, und violett vor Schadenfreude passiere ich die sommerlichen Stätten der Lust, die nicht so gross sein kann wie meine, an ihr nicht teilnehmen zu müssen. Falscher Nietzsche; der Kollektivismus; der typische bürgerliche Intellektuelle; eine Frechheit; im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Reichsverbände Deutscher Ostseebäder-Vereine; der Pariser. Jude Peter Panter; eine Geschmakkklosigkeit, antisemitische Äusserungen zu bringen; wo erholen Sie sich denn, Herr? wir lebhaft bedauern müssen, diesem Artikel in unserm Blatt die Aufnahme zu verweigern, das Nähere siehe unter Inserate; Sie haben eben keine Kinder; wo liegt eigentlich Scharbeutz? wir waren dieses Jahr in Zinnowitz, Gottseidank judenrein; wir waren dieses Jahr in Westerland, also wirklich ein sehr elegantes Publikum — versteh ich einfach nicht, was er hat —
— der Herbsttag ist blau, die hohen Bäume rauschen, die . Ostsee sächselt, und ich fahre selig durch die holsteinischen Wälder des Herbstes,
hindurch, vorbei, vorüber.
Pariser Tage
Vorgestern. Vorgestern ist das Töchterchen meines Freundes Albert L. zu Papa ins Schlafzimmer gekommen, am frühen Morgen, im Nachthemd und furchtbar eilig. „Papa! wir wollen Theater spielen!“ Papa hatte am Abend vorher mit mir gearbeitet, bis drei Uhr morgens, im Louvre, und er war noch sehr verschlafen. „Theater. . .? Wie denn?“ — „Also, pass mal auf: Du musst hier sitzen. Und dann muss ich reinkommen, und dann muss ich dir was erzählen, was ganz Langes!“ — „Ja, aber was?“ — „Das weiss ich noch nicht. Ich komme also da rein und erzähle dir was, und du musst gut zuhören. Und dann musst du sagen: „Trop tard! Rideau!“ Vier Silben . . . und das ganze französische Boulevard-Theater.
Gestern. Auch in Frankreich gibt es so etwas wie eine neofascistische Literatur. Alles, was um Charles Maurras herumwimmelt, der zur grossen Wut der „Action Française“ nicht in die Akademie gekommen ist; alle jüngeren Herren, die da in Firma Barrès Nachfolger auftreten — sie alle sind für eine Erneuerung Frankreichs von Grund auf. Es gibt eine Parallelerscheinung in allen Ländern Europas, und überall schneidet die Sozialdemokratie in dieser Bewegung sehr schlecht ab. Man schilt sie kleinbürgerlich. Es sind nicht nur die Kommunisten, die der Partei diesen Vorwurf machen. „On est“, steht geschrieben, „on est toujours le réactionnaire de quelqu’un.“ Das ist sehr wahr. Es muss übrigens gesagt werden, dass diese neue französische Literatur durchaus nichts mit dem Sonnenwendkultus der Teutschen zu tun hat, und dass sie sich gar nicht im Chauvinismus gefällt. Obgleich es den auch gibt. Aber ein Buch wie „Explication de notre temps“ von Lucien Romier ist eine bemerkenswerte Erscheinung, die man auch vom andern Ufer her durchaus ernst nehmen kann.
Heute war es in der zweiten Klasse der Métro genau so voll wie abends um sieben zwischen Nollendorfplatz und Zoo. Eng aneinandergepresst stehen die Leute, es geht liebenswürdig und ohne Krach ab. Nur kommt es in der Enge manchmal vor, dass mancher ein bisschen galant wird . . . Alles ist ganz still. Auf einmal sagt eine feine Mädchenstimme in der Stille: „Germaine, tu vas prêter tes fesses à Monsieur — car moi j’en ai assez!“ Jetzt werden Sie nachsehen, was „fesses“ heisst, und dann ist das Unglück fertig.
Morgen. Morgen kommen die letzten dreissig Seiten von „Chacun son tour“ daran. Das ist der dicke Angriff des dicken Karls, Charles Humbert, des ehemaligen Senators, der sich dafür rächt, dass Poincaré ihn einmal vors Kriegsgericht geschleift hat. Was ich bis jetzt zu mir genommen habe, ist so munter, dass man sich voller Freuden nach dem nächsten Krieg sehnt. Also so sieht es hinter den Kulissen der Fronten aus! Geschäfte, Spionage, Gegenspionage, Intriguen, dass die Akten wackeln; du hast gewusst, dass sie eine Spionin ist, wir haben nicht gewusst, dass du einer bist, ihr habt nicht wissen können, dass er einer gewesen sein muss. Allmächtiger Himmel! Bolo war offenbar wirklich einer, vielleicht weiss darüber der Oberst Nicolai besser Bescheid als ich. Und man ahnt bei diesem Geschäft nie, wo das Geschäft aufhört und wo der Kintopp anfängt. Da haben sie mutmasslich — so stehts bei Humbert mit viel Dokumenten dafür und dagegen — die kleinen Anzeigen des „Journal“ dazu ausgenutzt, dem deutschen Nachrichtendienst in der Schweiz nützliche Winke zu geben. Die Rubrik „Pour se retrouver“ war für die Flüchtlinge aus den besetzten Provinzen ein gutes Mittel, um die Familienmitglieder wieder zusammenzuholen, und das soll nach den Behauptungen des französischen Generalstabs zu Spionagezwecken verwendet worden sein. Also etwa so:
„Franz ist gesund. Georgette ist in Valmy, Mama in St. Quentin, angekommen am 8. 3. mit viel Mobiliar.“
Jeder geübte Spion sieht sofort, dass das nur heissen kann:
„Schwere Artillerie im Anmarsch. Bei Valmy nichts Neues, Ablösung in St. Quentin. Das VIII. Armeekorps ist mit drei Divisionen und Tanks angriffsfertig.“
Ja, heute lachen wir darüber. Aber als die Humbertschen Geschichten spielten, war der allgemeine Geisteszustand mehr zum Weinen, und es soll ja heute noch in allen Ländern Europas Gerichte geben, die den Spionagedienst sehr ernst nehmen. Lebenslänglich ernst.
Übermorgen. Da hätten wir Dienstag, und da habe ich mir aufgeschrieben: Vormittag Quais. Ich suche nämlich etwas. Ich suche eine Zeitschrift.
Auf den Quais ist es nicht mehr dasselbe wie früher, und wenn Ihnen jemand mit dieser falschen Feinschmeckermiene erzählt: „Ich habe gestern bouquinisiert“, dann lachen Sie ihn nur ruhig aus. Denn die Automobile, die neue Schnelligkeit, die neuen Leute haben das bisschen Romantik an den Quais ratzekahl abrasiert, man findet hier und da noch ganz hübsche Sachen, manchmal sogar so etwas wie eine billige Seltenheit . . . aber gar so arg ist das alles nicht mehr. Trotzdem: ich suche. Ich suche die alte „Assiette au Beurre.“
So etwas wie dieses Blatt haben wir nie gehabt. Es erschien lange Jahre hindurch, war in Deutschland selbstverständlich immer, durch direkte Verfügung des Reichskanzlers stets auf zwei weitere Jahre, verboten, und enthielt das Kostbarste an Gesellschaftssatire, was man sich denken kann. Gewöhnlich war jede Nummer nur von einem Künstler gezeichnet: Hermann-Paul und Jossot und Galanis und Vadasz haben da mitgetan, und jeder behandelte in der ganzen Nummer immer nur ein Thema. „Der Selbstmord“, „Die Autorität“, „Die Rekruten“, „Russland“ (das war ein Lieblingsstoff des Blattes), die Stützen von Bank, Thron und Altar — es war ganz herrlich. Man könnte heute noch ein Album zusammenstellen, es blinkte nur so von Aktualität. Von der dicken Concierge, die das grosse Los gewonnen hat und sagt: „Die Sache hat nur einen Haken — jetzt kann ich die Post von den Mietern nicht mehr lesen!“ bis zu dem Skelett, das sich mit den andern auf dem Kirchhof unterhält: „Warum ich heute abend im Frack bin? Ich bin zu einer spiritistischen Sitzung eingeladen!“ — es ist alles da. Ich will mir zusammenkaufen, was es noch gibt, und dann will ich davon träumen . . . Den unmöglichen Gedanken zu Ende träumen: Ein deutsches Witzblatt.
Interview mit Frau Doumergue
Paris, im Juli
Es war nicht leicht. Ein Ministerium nach dem andern erklärte sich für unzuständig, schliesslich versuchte ich es direkt an der Quelle: beim Sekretär des französischen Präsidenten. Der wies mich ab. Weil ich aber über die „besten Beziehungen“ verfüge (diese Worte sind zu lispeln) — so gelang es mir schliesslich doch. Ich hielt ein kleines Kärtchen in der Hand; wenn ich meinem Lexikon Glauben schenken durfte, so stand darauf: „. . . gibt sich die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass die Frau Präsidentin Sie Montag, den 21. Juli, vormittags 12 Uhr . . .“ Der Montag kam heran.
Ich rasierte mich erheblich, einmal in die Backe, denn meine Hand war unsicher, man interviewt schliesslich nicht alle Tage eine Präsidentin. Obgleich aus Deutschland, hatte ich darin gar keine Übung . . . Ich fuhr hin.
Sie kennen den Eingang zum Hause des Präsidenten in Paris? Nicht? Es ist sehr hübsch da, ein Posten steht vor der Tür, ein feiner, geschlossener Hof empfängt den Eintretenden, ängstlich hielt ich immerzu meine Karte fest, und wenn mir einer etwas tun wollte, wedelte ich leise mit ihr. Ich stieg über die grauen Steinstufen, wurde in ein herrliches Wartezimmer geführt, das Louis Seizeste, was ich je gesehen habe — dann öffnete ein untersetzter Diener eine hohe Flügeltür. „Mein Herr . . .“
Bumm—bumm—bumm machte mein Herz. Aber ich dachte an alle Gefahren, die ich in meinem Leben schon bestanden hatte: das Abiturientenexamen, zwei Bücher von Edschmid gelesen, einmal einem preussischen Schutzmann gesagt, dass er sich geirrt hätte, an der Börse auf meinen Bankier gehört — man war doch wer, Herrgott . . .! Rein.
Eine majestätische Blondine empfing mich, sehr fein und diskret gekleidet, mit dunkelblauen Augen. („Blond — in Paris“, dachte ich. „Wie merkwürdig!“) Eine runde Handbewegung hiess: Bitte. Setzen Sie sich. Ich setzte mich; der alte Quaritsch, der einmal für teures Geld versucht hat, mir das Tanzen anzugewöhnen, hätte seine Freude an meinen feinen Sitten und Gebräuchen gehabt. Ich sah schnell in meine hohle Hand, wo ein kleines Pappkartonchen stak, darauf stand einiges geschrieben.
„Gnädige Frau!“ sagte ich. „Frau Präsidentin: ich habe die Ehre, mir die Freiheit zu nehmen, Sie zu fragen: was halten Sie von der Situation der Lage?“ (Das ging glatt wie bei einem dressierten Star — ich hatte es mit meiner Portierfrau geprobt.) Die Frau Präsidentin hob anmutsvoll das Haupt: „Etwas ist immer“, sagte sie. „Aber es gleicht sich alles im Leben aus—!“ Ich machte verstohlen eine Notiz, das war ein guter Anfang. „Sie beabsichtigen, längere Zeit hier zu wohnen?“ fragte ich. Bautsch! das war eine Dummheit. Aber nun war es einmal heraus, da war nichts mehr zu machen.
„Ja“, sagte die hohe Frau. „Meine Vorgängerin, Frau Millerand, ist plötzlich ausgezogen, ihr Mann ist über einen Block gestolpert und hat sich seine rechte Hand verstaucht. Kannten Sie seine rechte Hand? Ein sehr begabter Mann. Ja, wenn er linkshändig gewesen wäre! Aber so … Man bot uns die Wohnung an, und Sie wissen: Paris hat ein bisschen Wohnungsnot, wir sagten sofort zu. Erst sollte hier ein anderer einziehen, aber das Wohnungsamt, ich meine: der Senat wollte nicht recht . . . Und nun wohnen wir hier — und wie ich sagen darf: das Land wäre sicherlich glücklich, wenn wir bis zum Ablauf des Mietskontraktes auch hier blieben! Ja.“
„Und London —?“ fragte ich vorsichtig.
„Wie Sie wissen, stammt mein Mann aus kleinen Verhältnissen“, antwortete sie. „Sie müssen nie glauben, was in den Zeitungen steht. Die kleinen Leute auf beiden Seiten hassen sich gar nicht — wir wissen es recht gut. Frankreich will Deutschland nicht fressen — Sie kennen doch den kleinen Mann in Frankreich: sein Essen, seinen Wein, ein glückliches Familienleben, seine ungestörte Arbeit und keine Geschichten. Da haben Sie sein politisches Programm.“ Ich kritzelte. „Und dann noch eines“, sagte sie. „Lassen Sie sich doch ja nicht von den militärischen Ruhmes- und Erinnerungsfeiern täuschen. Ich habe nicht die Ehre, Deutschland zu kennen — aber ich vermute, dass es bei Ihnen ebenso sein wird: die menschliche Freude am Gepränge, die Eitelkeit über erhaltene Auszeichnungen, die Lust an Massenerlebnissen . . . das Militär ist der Zirkus des kleinen Mannes.“ Ihre braunen Augen sahen mich still an.
„Und Sie erlauben, gnädige Frau“, sagte ich. „Was halten Sie von der französischen Kunst?“ — „Europa stagniert“, sagte sie. „Ist es bei Ihnen anders? Die Leute vertreiben sich auch hier die Zeit, wie sie können — sogar die Dichter malen bei uns vor Langeweile. Haben Sie die Zeichnungen von Jean Cocteau gesehn? Eine lustige Sache. Aber das war ja immer so. Im Museum des Luxembourg-Gartens hängt ein Bild: „Souvenirs.“ Es ist Charles Chaplin signiert — ich denke, das ist Charlot. Wie? Picasso soll seit gestern kurz nach Tisch wieder klassizistisch malen. Ein bedeutender Mann. Wie viele Kunsthistoriker wären ohne ihn schon längst verhungert! Und haben Sie Proust gelesen? Und Duhamel? Gute Leute.“ Ich schrieb — 180 Silben in der Minute. Die hohe Frau fuhr fort.
„Jetzt kann ich ja mur noch selten auf den Montparnasse in das Maler-Café de la Rotonde gehen“, sagte sie. „Früher besichtigte ich es ab und zu. Wir wollten eine Inschrift über der Tür anbringen lassen, aber mein Mann riet ab.“ Eine Inschrift? fragte ich mit einer Kopfneigung. „Ja“, sagte sie. „Sie sollte lauten: Psychopathen aller Länder, vereinigt euch! Aber, wie gesagt, mein Mann möchte es nicht gern. Sie gehen viel ins Theater —?“
Ich nickte schmerzlich. „Ja, so hat jeder Beruf seine Last!“ sagte sie. „Wie ich höre, hat man neulich eine Pariser Revue ohne nackte Frauen gegeben — es ist nicht recht, dem Fremdenverkehr so ins Gesicht zu schlagen. Und Frau Cécile Sorel von der Comédie Française — ist es, dass Sie sie gesehen haben?“ Ich nickte tief ergriffen. „Auch ich kenne sie“, sagte die Frau Präsidentin, und ihre schwarzen Augen verloren sich in der Erinnerung. „Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich sie gesehn — sie war schon recht gebrechlich damals . . .“
Vom nahen Kirchturme St. Mendel schlugs halb eins. Die Frau Präsidentin erhob sich — ihre hellen grauen Augen blickten lebhaft. „Sagen Sie bei sich zu Hause, dass wir gemeinsam das Vergangene begraben wollen. Frankreich braucht Sicherheit und Ruhe — Sie Luft und Atem. Hoffen wir auf beides. Gleich kommt mein Mann; ich denke, man wird das Frühstück angerichtet haben . . . Sie entschuldigen mich. Ja, noch eines. Warum haben Sie kein rotes Bändchen —?“
Ich sagte schüchtern: „Ich bin erst vier Monate in Frankreich — aber ich hoffe . . . Und dann, Frau Präsidentin: die deutsche Republik verbietet in ihrer Verfassung ihren Bürgern Orden und Ehrenzeichen!“
„Aber das wird doch hoffentlich nicht eingehalten?“ fragte sie entsetzt. Ich sagte: „Frau Präsidentin, eine Verfassung ist wie eine Flöte: man kann sie an die Wand hängen, man kann aber auch noch etwas andres damit machen!“
Sie nickte beifällig. „Auf Wiedersehen, Herr . . . Pantère!“ sagte sie. Ein grünlich schillernder Blick entliess mich. Verbeugung. Untersetzter Lakai. Flügeltür. Louis Seize. Grauer Steinhof. Posten. Auf der Strasse.
*
Herr Doumergue ist zu seinem Glück nicht verheiratet.
Merk: Er ist nicht mehr Präsident und hat inzwischen geheiratet.
Der liebe Gott in Frankreich
Wie verschieden ist es doch so im menschlichen Leben —!
Bringt in Deutschland jemand die Gedankenvorstellungen der Kirche mit dem Humor in nähern Zusammenhang, dann finden sich nicht nur etliche Domdechanten, sondern noch mehr Richter, die aus einem politischen Diktaturparagraphen — dem § 166 — herausinterpretieren, was man nur wünscht. In Frankreich gibt es doch immerhin dieselbe katholische Kirche (über den Erdkreis hinweg), aber da sieht es nun so aus:
In den „Deux Anes“ steigt eine der kleinen Revuen, über die wir uns schon manchmal unterhalten haben. Siebentes Bild: „Restaurant zum bekränzten Bürzel.“ Und weil ja in den feinen Hotels die Speisen feierlich dargebracht werden, dort also nicht gegessen, sondern das Essen zelebriert wird, so sehen wir nunmehr ein ganzes Diner auf eine recht absonderliche Weise serviert.
Vor dem Altar der Office steht der Maître d’Hotel, er macht viele kleine Verbeutzungen und ruft mit modulierender Stimme die Speisen aus. „Le Potage de la Vierge Printanière“ — und Frauenstimmen aus der Küche respondieren: „… printanière —!“ die Gäste nehmen keine Abendmahlzeit ein, sondern ein Abendmahl, der zweite Kellner schwenkt den Salatkorb wie eine Räucherpfanne, die Musik spielt Gounod-Bach, und es ist — wie die Prospekte der Beerdigungsinstitute sagen — eine Mahlzeit erster Klasse. Der Ober nennt die Gäste „Nos fidèles“, was gleichzeitig treu und gläubig heisst, alles geht sehr schnell, und wenn es vorbei ist, dann singt der Chor der Kellner:
„Avé — avé — avez-vous bien diné?“
Alles lacht und klatscht. In den Zeitungen kein böses Wort. Im Publikum kein fader Jude, dem plötzlich das böse Gewissen schlägt und der pogromängstlich „geschmakkkkklos“ murmelt, denn es geht nichts über den Katholizismus gebildet aufgeklärter Juden; kein frommer Abgeordneter, der nun aber neue Gesetze gegen Schmutz und Schund fordert . . . nichts.
Eine andre Rasse, gemiss. Damit ist noch nicht bewiesen, dass es in lateinischen Ländern mit dem Humor anders sei als bei uns, gewiss.
Aber glaubt doch ja nicht, dass es, alle Leichtigkeit des französischen Humors zugegeben, hier immer so gewesen ist. Die Kirche hat das Land einmal beherrscht. Und mit dem Patriotismus könnte man sich die gleiche Szene kaum ausdenken — da gäbe es Krach. Mit der Kirche aber . . .
Die hat eben — trotz allem — in Frankreich zum mindesten nicht die Macht, das öffentliche Leben so zu knebeln, wie sie das lautlos in Deutschland tut, wo alles kuscht, wenn sie bimmelt, und wo kein Mensch auf unsre Empfindungen Rücksicht nimmt, auf uns, deren Gefühle verletzt werden, wenn ein Pfaffe von der Kanzel herunter zum Mord hetzt. „Avez-vous bien diné?“ Wenn man die deutsche Zentrumsherrschaft mitansieht, kann man nur sagen: Mahlzeit!
Alter Burgunder wird versteigert
Beaune, 20. November
Um halb zwei Uhr ist der alte Keller im Hospital von Beaune schon gesteckt voll. Im Saal sitzen die Händler; vor ihnen auf einem Podium, vor riesigen Fässern, der Bürgermeister und die Stadträte; an einem der Fässer hängt ein kleines Telephon; Neugierige sitzen auf den Fässern ringsum und lassen die Beine baumeln. Die kleine Holztribüne steht auf Fässern, da drängen sich die Leute in beängstigender Fülle. Um zwei Uhr beginnts.
Dies ist der grosse Tag der „Côte d’Or“, wo auf sechzig Kilometer Länge die grossen Weine der Bourgogne wachsen: der. Clos Vougeot und der Pommard und der Romanée Conti und alle die andern. Die Winzer sind mit diesem Weinjahr mehr als zufrieden, und mit Recht. Der Most des Pommard ist nun zwei Monate alt, aber das Kind kann schon laufen — das wird einmal, wenn nicht alles täuscht, ein grosser Wein. Nun eröffnet der Bürgermeister die Versteigerung.
Vor einem Beisitzer steht eine Wachskerze, an der er ununterbrochen zwei winzige Lichtchen nacheinander entzündet: solange die brennen, darf geboten werden, jedes leuchtet nur etwa eine halbe Minute, ist bis dahin der Zuschlag nicht erfolgt, so wird wiederum angezündet; das ist ein sehr alter Brauch. (Wird in Frankreich etwas gerichtlich versteigert, so brennen drei Kerzen — in Beaune nur zwei.) Sie bieten.
Ein Doppelfass „Nicolas Rollin“, so heisst der Begründer des Spitals, das heute der Stadt gehört, ein Doppelfass von 456 Litern bringt 15 000 Franken — und der ganze Saal applaudiert — der Wirt vom Hôtel de la Poste in Beaune strahlt über das ganze Gesicht: er hat etwas für seinen Keller.
Vorher haben die Händler den Wein aus kleinen silbernen gobelets gekostet, niedrigen, flachen Schalen mit einem Handgriff, von uralter Form; ihr Grund ist ornamentiert, damit sich der Wein richtig spiegelt. Sie heben die Tasse an die Nase, ziehen den Duft ein und kosten, unendlich behutsam.
Die alten Stiftungen legten gern den Wein mit der Fürsorge für die Kranken zusammen — man denke nur an das Bürgerspital in Würzburg. Dieses Hospital in Beaune ist ein wunderschönes, altes Bauwerk, mit einer Küche, darin noch ein alter eiserner Bratenröster unermüdlich seine Räder dreht.
Vorher hat die Stadt ein Frühstück gegeben: der Bürgermeister und der Souspräfekt präsidierten.
Die Weine rannen in die Gläser — ich liebe die deutschen Weine und denke, dass man zuerst die Weine seines Landes trinken solle, weil sie eine Verkörperung der Heimat sind. Mit allem schuldigen Respekt vor dem Rhein und Franken aber darf gesagt werden: als eine Grande Réserve 1919 erschien, verstummten auch die grössten Kenner: das war kein Wein mehr, das war Sonne und der ganze Garten Frankreichs. Dieses Glas wollte getrunken sein.
Die „sommeliers“ gingen umher, die Kellermeister, die so gar nichts vom Kellner haben: sie stellen vielmehr etwas dar, was zwischen einem alten Bauern und einem Mönch liegt. Ammen des Weins.
Und Reden wurden gehalten, ich hatte mit meinen Weinen zu tun, und soweit ich hörte, war da von dem „Phänomen der Prohibition“ die Rede, wie eine graue Wolke zog das durch den Saal. Und die Jury verteilte kleine Zettel, auf denen geschrieben stand, wie der heurige Wein beschaffen sei, und es gab auch, mit vielen Fehlern und sehr viel gutem Willen, eine deutsche Übersetzung dazu:
„Diese Schätzung passt auf den Weinen der sogenannten Gegenden: ,Beaujolais, Mâconnais, Câhlonnais, Côte d’Or, Yonne‘; sie passt nicht auf den Weinen von der zweiten Blütenzeit, die von Trauben errühren, die nach dem Gewitter vom 6 ten Juni gewachsen sind, welches den Ruits-Rebenberg zum Teil gerüstet hat.“
Sie versteigern noch immer. Fass auf Fass geht hinaus in die Welt — der Lohn für die Arbeit eines Jahres wird einkassiert. „Premier feu!“ ruft der dicke Ausrufer — soviel wie unser „Zum ersten!“ — das kleine Licht erglänzt, erlöscht, erglänzt, es riecht nach Wein und weingetränktem Holz, die Glatzen glänzen, der freundliche, alte Bürgermeister, der so hübsch die Bilder des in Beaune geborenen Impressionisten Ziem erklärt hat, spricht den Käufern ihre Fässer zu, die Schreiber schreiben . . .
Und wieder einmal ist zu sehen, dass Paris nicht Frankreich ist, und seine Fremdenviertel schon gar nicht. In den sanftblauen Spätherbsthimmel klingelt die Turmuhr, ein braunes Licht liegt über diesem Garten Gottes, und wie schön müsste es sein, mit diesem Lande dauernd in Frieden zu leben —!
In der Geburtsstadt Fragonards
Grasse, im November
„Sie müssen sich unbedingt Cannes ansehen!“ hatte mir Victor Margueritte zum Abschied gesagt. Und Frau Margueritte hatte hinzugefügt: „Das ist das Deauville des Mittelmeers!“ Wenn Saison ist. Jetzt ist aber noch keine Saison.
Die Kulissen der grossen Welt liegen stumm und still. Die Bühnenarbeiter richten die Soffitten her und bauen an Hafendamm und Kasino. Selbst das Meer gibt sich noch nicht die richtige Mühe, faul und grau plätschert es ans Ufer. Hier wogen also die in leichte Gewänder gekleideten Damen und bewegen zierlich . . . aber um das festzustellen, hat mich die Vossische Zeitung nicht nach Frankreich geschickt. Es ist das auch schon ein bisschen oft geschrieben worden, scheint mir. Aber was selten und fast nie beschrieben wird, das ist dies: Wie sieht die Existenz eines Zimmerkellners in der Hochsaison aus? Was denken sich diese Leute? Wie arbeiten sie? Unter welchen Bedingungen? Und, was noch wichtiger ist: wie sieht die feine Welt von hinten, von unten, von dieser Seite gesehn aus? Warum nimmt niemals einer von uns für ein paar Monate die Arbeit eines Stewards, eines Kellners, eines Bedienten an und schildert die Welt einmal von da aus? Romane und Genrebilder werden es nicht werden — aber sicherlich eine sehr lehrreiche Ergänzung zu den bis zum Überdruss wiederholten Bildern aus der eleganten Welt . . . Das sind so Bücher, die nicht geschrieben werden.
Drehen wir uns um und gehen wir zum Bahnhof. Das nette Leben fängt ja doch immer erst an der Kleinbahn an.
*
Der Deutsche kann das Bücherlesen nicht lassen. Ich auch nicht. Ich habe gelesen, und ich habe mir da etwas ausgeknobelt . . . Wie wird es wohl werden? Der Zug rumpelt durch die Nacht, an kleinen Stationen mit unlesbaren Namen hält er, es ist ganz schwarz um mich her. Denn so dankbar man für diesen November-Sommer hier unten sein muss: Die Tage haben um Schlag fünf ein Ende, schon nach vier Uhr blitzen überall Lichter in das Halbdunkel des Nachmittags, und dann ist es aus: man sieht nichts mehr.
Im Dunkel des Abends liegt ein lichterbestickter Teppich. Eine Stadt, scheints, Hunderte von glitzernden Punkten in einem Tal, auf den Anhöhen, überall. Kein Lichtermeer . . . ein Lichtergerinnsel. Das ist Grasse, und in Grasse ist Fragonard geboren, Fragonard, der freche, entzückend leichte, himmlisch beschwingte Hofmaler Ludwigs des Sechzehnten. Aussteigen, Zahnradbahn — guten Abend. Bleich und mondsüchtig liegt auf der Anhöhe über der Stadt das Hotel. Sie kennen das Gefühl, das einen beschleicht, wenn der Kellner die Zimmertür hinter sich geschlossen hat . . . allein. Ich öffne die Fenstertür, trete auf den Balkon.
Unter mir liegt die Stadt. Im Talkessel, auf die Berge geklettert, über Rampen und treppenartige Steigungen verstreut, mit Lichtpunkten besät, leuchtend, schimmernd, glitzernd, halb verlöschend . . . trink, Auge! Und ich sehe und sehe. So hat den Bauern-Breughel einst gemalt: das Weite und das greifbar Nahe gleich weit und gleich deutlich. Da sind keine Plätzchen, von einer Laterne notdürftig beleuchtet, man sieht grade eine Strecke Wegs von ein paar Metern, die ist leer; um ein andres Licht sind Menschen versammelt, die bereden etwas; weiter oben rollt ein Automobil langsam und vorsichtig die beleuchtete Strasse entlang, dann verschwindet es; da sucht eines mit zwei Glotzaugen den dunklen Weg ab; hier liegt eine beleuchtete Halle; da ist ein Haus mit rötlich-gelblichen Lichtern; da eins mit weissen; in der Ferne verdämmern andre; ein Brückchen führt über einen kleinen Abgrund; bis weit ins Land kann man sehen, und oben auf den Bergen wohnen auch Menschen und blinken Lichter. Und jeder Lichtfleck erzählt eine kleine Geschichte — es ist wie ein Rundblick für Andersen. Gute Nacht, Grasse —!
Der Tag hält, was der Abend versprochen hat. Treppauf, treppab klettere ich durch die Stadt. Sie ist in der Mitte ganz alt, die Gässchen sind so eng, es geht steil abwärts und brüsk nach oben. Der französische Baedeker murmelt etwas vom sechsten Jahrhundert — jedenfalls waren 1746 die Österreicher einmal hier, kriegshalber, es muss schrecklich für die armen Soldaten gewesen sein: monatelang ohne Nachrichten aus dem Burgtheater . . .
Alte Häuser, alte Gassen. Aber was das Merkwürdigste ist an diesem alten Bergstädtchen, das ist die unbekümmerte Modernität ihrer Bewohner. Wir haben gelesen, dass in den verlassenen Herrensitzen Kurlands arme Bauern hausen — die Dürftigen im Zivilisierten. Hier ist es umgekehrt. In diesen alten, alten Häusern liegen gut ausgestattete Geschäfte mit modernen Auslagen, hübsche Wohnungen — und alles ist so blitzsauber, reingefegt, so bis ins letzte Stäubchen gekehrt, dass man an gewisse Hamburger oder Lübecker Strassen erinnert wird. Gekalkt, gewaschen, geschrubbert, es strahlt nur so von Sauberkeit.
Fabrikschornsteine? Sie haben im Stadtbild kaum gestört. Grasse fabriziert Süssigkeiten und Parfümerien. Ich sehe zu, wie man kandierte Birnen macht und gezuckerte Rosenblätter und Veilchen zu Süsszeug umarbeitet, und, wahrhaftig, auch die kleinen gelben Kügelchen der Mimose. Ich darf probieren; sie schmecken nach gar nichts, und ich mache ein bewunderndes Gesicht, es ist das erstemal, dass ich eine Rose esse. Und ich sehe zu, wie Parfüm hergestellt wird, eine komplizierte Sache, es riecht wie in einer Premiere, und die grossen Kolben und Retorten der Kochapparate stehn in einem alten Kloster, mitten im Refektorium. Auch hier eine musterhafte Sauberkeit.
Ja, aber Fragonard —! Fragonard ist in Grasse — einen Augenblick mal! — 1732 geboren, und er war kurz vor der Revolution in seiner Heimatstadt und dann wieder während der Revolution. Wo er geboren ist . . .? Da ist die kleine Strasse de la Font-Neuve, aber sie hat mehrere Häuser, zwei rechts und zwei links, und Genaues weiss man nicht. Hier hat „Frago“ zum ersten Male die Beinchen in den Rinnstein gesteckt . . . Und hat gerufen: „Mutta! Schmeiss Stulle runta —!“ Aber vor welchem Haus: das steht nicht geschrieben.
Auf einem Platz mit wunderschöner Weitsicht ins Land steht auch ein Denkmal für den seligen Maler. Seien wir höflich und gucken wir weg.
Bis zu seinem vierzehnten Jahr hat Fragonard in Grasse gelebt. Später besuchte er zum Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts seinen Vetter Maubert, und dem hat er für 3600 Livres — laut Quittung vom 10. März 1791 — fünf Bilder gemalt: „Der Einstieg“, „Die Verfolgung“, „Vertrauliche Mitteilung“, „Krönung“ und „Die Hingabe“. Für wen hat er sie gemalt? Für seinen Vetter Maubert? Natürlich nicht, sondern letzten Endes für Pierpont Morgan, der sie gekauft hat. Grasse hat nur die Photographien, und das ist auch etwas wert. Aber weil Grasse eine pietätvolle Stadt ist, so hat es ein kleines Palais zu einem reizenden Museum ausgebaut, das kleinste Museum der Welt, von Herrn Carnot begründet, und darin ist noch manches Hübsche zu sehen. Reproduktionen nach Bildern des Meisters, ein paar Originalskizzen, jene Photographien und, verhüllt von einer grünen Decke in einer kleinen Vitrine: der Malkasten Jean Honoré Fragonards. Es ist ein einfacher, alter Kasten mit vielen kleinen Flaschen und Fläschchen, so, wie er ihn benutzt hat; auf jedem Etikett steht noch in vergilbten Buchstaben, welche Farbe jetzt darin trocknet . . . Ein Pinselchen, zart und lang, liegt dabei.
In den Nebenräumen provenzalische Kunst und Andenken, Möbel und Bauerngerät, alles in dem reinlichen und fröhlichen Geschmack der Provence. Eine lustige, runde Kinderwiege; eine zärtliche Sänfte; himmlische alte Kommoden; eine rötlich flammende, riesige Chaiselongue im Stil Louis XIII., eine gradezu verlockende Chaiselongue; ein Ton-Tier aus dem siebzehnten Jahrhundert, eine Art Schildkrötenuhu oder Uhuschildkröte, ein geflügelter Traum; Stricke, mit denen der Marschall Bazaine, eingesperrt auf St. Marguerite, entfliehen sollte (er entfloh aber durch die Tür, weil er als Soldat den graden Weg liebte, direkt nach Spanien, wo er auch gestorben ist); Waffen und Bilder und Putten. Das Ganze so fein im Geschmack, so reinlich im Stil, und ein zweites Treppenhaus führt hinunter in den Garten, vor eine jener Fassaden französischer Hotels, die die Strasse niemals zu sehen bekommt.
Jetzt ist es Abend. Und während ich dieses schreibe, unterbreche ich mich, trete ans Fenster, schlage die Vorhänge zurück und sehe noch einmal auf die ruhende Stadt. Da blinkt es, kreisrunde und kleine Sterne, eckige und leuchtende Scheiben, das Laub rieselt, ein Wagen rollt, und aus einer fernen Schmiede klingt das fröhliche Ping-Pang der Werkstatt. Die Glocken rufen sich die Stunde zu und singen, hoch und tief, das schöne Lied von der Pünktlichkeit; eine ganze Viertelstunde lang ist es halb acht. Ein kleiner Viadukt verschwimmt im Dunkel; diese leuchtende Linie, das ist der Boulevard mit den dunklen Bäumen; Licht steht bei Licht, so weich, so zärtlich, so fest . . . Eine Stadt, die man streicheln möchte. Hoch über dem Tal fliegt der Mond durch die ziehenden Wolken, silbergrau verdämmern die Berge, und dort hinten liegt, unsichtbar, das Meer . . . Und von den schweigsamen Bergen herunter kommt es und greift ans Herz, ungesungenes Lied und ungesagte Worte, Sehnsucht in der Ferne nach der Ferne.
*
„Kennen Sie Grasse?“ fragte ich Herrn Wendriner.
„Grasse?“ sagte er und stocherte sich in den Zähnen. „Warten Sie mal — Grasse . . .? Ja, da warn wir mal, von Cannes aus. Na, ich danke! Ein kleines Nest, ganz nett, gewiss, aber kein anständiges Kasino, gar nichts Elegantes. Wir sind bloss durchgefahren und haben eine Kleinigkeit gegessen, Bouillon baisse, oder wie das heisst. Richtig! Meine Frau hat sich noch mächtig den Magen an den Langusten verdorben. Wissen Se: Grasse ist nischt —!“
Ein schwedischer Sachse
Einmal habe ich in Schweden, in einer südlichen Provinz, ein Ding kennengelernt, das war mir neu.
Es war ein kleiner Mann mit viereckig geschnittenen Borsthaaren, einer Brille und kurzen Hosen, der mir da im Hotel entgegentrat und sehr freundlich sagte: „Ich habe gehört, dass Sie Deutscher sind; ich spreche deutsch.“ Ich horchte auf — nein, er sprach nicht deutsch. Dieser Schwede sprach sächsisch. Es war ganz seltsam.
Er sprach nicht nur sächsisch: er sang es, er schleifte die Worte, wie uns Hans Reimann das vergeblich gelehrt hat; er zog und lutschte an der Sprache und hatte auch alle diese kleinen Verlegenheitswörter, die das Sächsische so unendlich kommun machen. Er sagte: „Es blääst che nu hier e galdr Wind“, wobei er das W von „Wind“ aussprach wie die Engländer; er tauchte bis auf den tiefsten Flussgrund dieses breiigen Dialektes herunter, und mittendrin konnte es geschehen, dass er plötzlich versagte, dann fehlte ihm ein Wort. Das war nicht gespielt, der Mann war durch und durch echt.
Er war so echt, wie Menschen sonst gar nicht sind — denn niemand ist ja ganz und gar sich selbst ähnlich, aber dieser war es. Er war so:
Er trug immer kurze Hosen, und wenn er auf die Berge stieg, die in dieser Gegend etwa die Höhe eines mittleren Küchenstuhls erreichen, dann legte er einen blauen tiroler Leinen-Kittel an, auch hatte er einen Alpenstock. Der Mann war nicht mehr jung und marschierte ausgezeichnet, er hatte auch weite Reisen gemacht. „Im Chahre 1914, da wolldch eene weide Reise machen, durch kanz Euroba — ’s war schon alles vorbereid . . .“ Die Vorbereitung passte so schön zu ihm, wie alles zu ihm passte:
Er sprach natürlich Esprando, wie er sich auch für „religiöse Sachen“ und Naturheilkunde sähr indressierde, und er hatte nun an alle Esperantisten der verschiedensten Länder geschrieben; die sollten ihn auf den Bahnhöfen erwarten, abholen und ihm ein billiges Quartier zuweisen. ’s war alles vorbereid, aber Ende Chuli 1914 blieb er an der französischen Grenze stecken . . . da muss etwas dazwischen gekommen sein.
Er bekleidete nicht nur die Stellung eines Buchhalters — er war wirklich einer, er war es durch und durch. Wenn man mit ihm ging, so las er in der Natur wie in einem Hauptbuch, er unterwarf sie sich dadurch, dass er in ihr genau Bescheid wusste, sie konnte ihm nicht entrinnen. Er rationalisierte sie, und das bezaubernd Sächsische daran war, dass er Schweinezucht, Wegentfernung und schöne Aussicht gleichermassen rationalisierte; war im Führer vermerkt, dass dies eine altberühmte historische Stätte sei, so war dies eine altberühmte historische Stätte, und war eine schöne Aussicht vermerkt, dies Ideal aller Kleinbürger, dann blieb er stehn und nahm sie zu sich. Und ging ungerührt weiter.
Ich liess ihn keinen Tag aus den Augen; wir sprachen viel und unterhielten uns über mancherlei im Leben. Nie habe ich ihn zögern sehen, niemals war er unsicher; mit buchhalterischer Sicherheit hatte er für alles eine Formel, einen Satz, etwas Eingelerntes, das ihm niemals jemand entreissen würde. Kleine Irrtümer berichtigte er sofort, blätterte gewissermassen zurück und stornierte; er war sehr sparsam, dabei in guten Verhältnissen, er hatte in einer schwedischen Provinzstadt ein eignes kleines Haus, dessen Masse er auswendig wusste.
Er hatte einen Hund, der ihm aufs Wort — verstehn Sie? aufs Word! — gehorchte, und auf der andern Seite hatte er einen Chef. Er lebte ausserordentlich rationell, turnte jeden Morgen, badete Luft, und alles, was er machte, war vernünftig, aber es war nur vernünftig, und das hatte etwas Schreckerregendes. Ich wartete darauf, dass er einmal, doch nur ein einziges Mal, etwas Irrationales, etwas ganz und gar Unsinniges tun oder sagen möchte — er tat es nicht.
Bei Tisch sassen wir uns oft gegenüber; er ass, was er sich auf den Teller getan hatte, sorgfältig auf, er hob den Teller schräg an und löffelte noch den letzten Rest Milch in sich hinein, und noch einen Rest, und nun den allerletzten, und ich begriff, dass eine Frau mit Nerven ihn im sechsunddreissigsten Ehejahr deswegen ermorden könnte. Er stand auf und wischte sich den Mund und hatte diese Mahlzeit bestellt, bezahlt, absolviert, und alles war in Ordnung.
Er nahm gern Kleinigkeiten an, liebte es, wenn man für ihn bezahlte — aber er bedankte sich freundlich dafür. Er war gefällig, übersetzte, dolmetschte, erklärte: er war gar kein schlechter Kerl.
Erregt habe ich ihn nur einmal gesehen, da kamen wir auf die Automobile in Schweden zu sprechen, und er sagte: „Ich bin che nu ein Gächner von diese Luxussachn, dieses Rumfahrn — was solln das?“ Ich machte eine kleine Einwendung . . . da brachen aus dem kleinen Mann die Polizei heraus, der geduckte Kleinbürger, der Paragraph und das Reglement, dem sich auch die Reichen beugen sollten . . . „’s iss näämlich wäjn dr Handelsbilanz, was da de fier Keld ausn Lande rausgähd . . .!“ Nie noch bin ich dem Sächsischen so nahe gewesen wie bei ihm.
Er war der Sachse der ganzen Welt, ausgedrückt in einem seltsamen Mischtypus. Er war der Kitt, mit dem das Erdenbauwerk zusammengehalten wird, der Zement der Pflicht. Er war einer von denen, die man einsetzen kann, wo man will; einer von denen, die immer ihren Dienst machen, ohne zu fragen, ob es denn auch ihre Pflicht sei; treue Diener ihrer Herren, ohne die sie traurig verdorrten, Anhänger der bösesten Gesetze, der Kriege, der Todesstrafe; Gegner des Überflüssigen, und wieviel ist nicht überflüssig auf der Welt! von tiefstem Misstrauen erfüllt gegen den Geist, der Selbstzweck ist; amusisch, aber musikalisch, naturentfremdet, aber tierlieb, begeistert für alles Zivilisatorische, abgeneigt dem Kulturellen, Gabelsbergianer, Mitglieder des freisinnigen Vereins Waldeck, der Bezirksgruppe Süd und eines Vaterlandes. Ewige, ewige Sachsen.
Über die wir nicht spotten sollen, weil auch wir, wenn man uns als Typus schildert, komisch sind, alle miteinander.
Koffer auspacken
In der Fremde den Koffer auspacken, der etwas später gekommen ist, weil er sich unterwegs mit andern Koffern noch unterhalten musste: das ist recht eigentümlich.
Du hast dich schon ein bisschen eingelebt, der Türgriff wird leise Freund in deiner Hand, unten das Café fängt schon an, dein Café zu sein, schon sind kleine Gewohnheiten entstanden . . . da kommt der Koffer. Du schliesst auf —
Eine Woge von Heimat fährt dir entgegen.
Zeitungspapier raschelt, und auf einmal ist alles wieder da, dem du entrinnen wolltest. Man kann nicht entrinnen. Ein Stiefel guckt hervor, Taschentücher, sie bringen alles mit, fast peinlich vertraut sind sie dir, schämst du dich ihrer? Wie zu nahe Verwandte, denen du in einer fremden Gesellschaft begegnest; alle siezen dich, sie aber sagen dir: Du —! und drohen am Ende noch, sprichst du mit einer Frau, schelmisch mit dem Finger. Das mag man nicht.
Wer hat den Koffer gepackt? Sie? Eine warme Welle steigt dir zum Herzen empor. So viel Liebe, so viel Sorge, so viel Mühe und Arbeit! Hast du ihr das gedankt? Wenn sie jetzt da wäre . . . Sie ist aber nicht da. Und wenn sie da sein wird, wirst du es ihr nicht danken.
Die Sachen im Koffer sprechen nicht die Sprache des Landes, nicht die Sprache der Stadt, in der du dich befindest. Ihre stumme Ordnung, ihre sachliche Sauberkeit im engen Raum sind noch von da drüben. Da liegen sie und sprechen schweigend. Mit etwas abwesenden Augen stehst du im Hotelzimmer und erinnerst dich nicht . . . nein, du bist gar nicht da — du bist da, wo sie herkommen, atmest die alte Luft und hörst die alten, vertrauten Geräusche . . . Zwei Leben lebst du in diesem Augenblick: eines körperlich, hier, das ist unwahrhaftig; ein andres seelisch, das ist ganz wahr.
Ein Mann, der sich lyrisch Hosen in den Schrank hängt! Schämen solltest du dich was! Tuts ein Junggeselle, dann geht es noch an; mit sachlich geübten Händen baut er auf und packt fort, glättet hier und bürstet da . . . Ein Verheirateter, das ist immer ein bisschen lächerlich; wie ein plötzlich selbständiges Wickelkind ist er, ohne Muttern, etwas allein gelassen in der weiten Welt.
Der Bademantel erinnert nicht nur; in seinen Falten liegen Stücke jener andern Welt, aus der du kamst. Das ist schon so. Aber faltest du ihn auseinander, dann fallen die Stücke heraus, verflüchtigen sich, auf einmal hängt er vertraut und doch fremd da, ein gleichgültiger Bademantel, den das Ganze nicht so sehr viel angeht . . . Und da ist etwas praktisch zusammengerollt, hier ist ein besonderer Trick des Packens zu sehn, hast du die Krawatten gestreichelt, alter Junge? Als ob du noch nie gereist wärst!
Leicht irr stehst du im Zimmer, in der einen Hand einen Leisten, in der andern zwei Paar Socken, und stierst vor dich hin. Gut, dass dich keiner sieht. Um dich ist Bäumerauschen, ein Klang, Schmettern dreier Kanarienvögel und eine Intensität des fremden Lebens, die du dort niemals gefühlt hast. Tropfen quillen aus einem Schwamm, den du nie, nie richtig ausgepresst hast. So saftig war er? Hast du das nicht gewusst? Zu selbstverständlich war es, du warst undankbar — das weisst du jetzt, wo es zu spät ist.
Eine Parfümflasche ist zerbrochen, das gute Laken hat einen grünlichen Fleck, ein Geruch steigt auf, und jetzt erinnert sich die Nase. Die hat das beste Gedächtnis von allen! Sie bewahrt Tage auf und ganze Lebenszeiten; Personen, Strandbilder, Lieder, Verse, an die du nie mehr gedacht hast, sind auf einmal da, sind ganz lebendig, guten Tag! Guten Tag, sagst du überrascht, ziehst den alten Geruch noch einmal ein, aber nach dem ersten Aufblitzen der Erinnerung kommt dann nicht mehr viel, denn was nicht gleich wieder da ist, kommt nie mehr. Schade um das Parfüm, übrigens. Die Flasche hat unten ein hässlich gezacktes Loch, es sieht fast so aus, wie etwas, daraus das Leben entwichen ist . . . Also das ist dummer Aberglaube, es ist ganz einfach eine zerbrochene Flasche.
Unten, auf dem Boden des Koffers, liegen noch ein paar Krümel, Reisekrümel, Meteorstaub fremder Länder. Jetzt ist der Koffer leer.
Und da liegen deine Siebensachen auf den Stühlen und auf dem Bett, und nun räumst du sie endgültig ein. Jetzt ist das Zimmer satt und voll, fast schon ein kleines Zuhause, und alle Erinnerungen sind zerweht, verteilt und dahin. Noch ein kleines — und du wirst dich auf deiner nächsten Station zurücksehnen: nach diesem Zimmer, nach diesem dummen Hotelzimmer.
Die Apotheke
Manche Leute gehen in den fremden Orten immer erst in den Ratskeller, manche zur Sehenswürdigkeit — ich gehe in die Apotheke. Da weiss man doch.
Es beruhigt ungemein, zu sehen, dass auch in Dalarne, in Faido oder in Turn-Severin die Töpfchen der Reihe nach ausgerichtet stehn, jedes mit einem Namen auf dem Bauch, und fast von keinem wissen wir, was es ist. Manche heissen furchtbar unanständig, aber die Apotheker meinen das nicht so. Und immer riecht es nach strengen und herben Sachen, es sind jene Düfte, die dem guten, alten Apotheker langsam zu Kopf steigen, woher er denn den altbewährten Apotheker-Sparren hat. (Protest des Reichsverbandes Deutscher Apotheken-Besitzer. Reue des Autors. Denn ihr habt keine Spezial-Sparren mehr, sogar die Geometer sind vernünftig geworden . . . ihr habt alle zusammen nur noch eine Verrücktheit: die Berufseitelkeit.) Ja, also die Apotheken.
Mir fehlt eigentlich nie etwas Rechtes, aber es gibt so nette kleine Mittel, die sich hübsch einkaufen: Baldrian oder doppelkohlensaures Natron oder Jodtinktur . . . irgend etwas wird man schon damit anfangen können. „Bitte geben Sie mir. . .“
Da kommt dann ein weisser Provisor-Engel angeschwebt, die jüngern Herren haben, wenn es in deutschen Apotheken ist, Schmisse und sehen grimmig-gefurcht drein, so: „Du! Wir sind hier akademisch gebildet, und dass wir dir etwas verkaufen, ist eine grosse Gnade!“ Da wird vor Angst sogar die Tonerde doppelt sauer. Oder es ist da ein Apothekermädchen, blond und drall, und man kann gar nicht verstehen, wie so ein freundliches Wesen alle die vielen lateinischen Namen auswendig weiss. Und immer mixt ein älterer, schweigsamer Mann hinter einem hohen Pult eines der zahllosen Medikamente . . .
Es gibt übrigens nur fünfzehn, hochgegriffen.
Es gibt nur fünfzehn Medikamente, seit Hippokrates selig, und doch ist es einer weitentwickelten Industrie von Chemieunternehmen und den Fabriken zur serienweisen Herstellung von Ärzten gelungen, aus diesen zehn Medikamenten vierundvierzigtausendvierhundertundvierundvierzig gemacht zu haben; manche werden unmodern, die werfen wir dann fort. Ja, verdient wird: auch daran. Aber das ist es nicht allein: die Leidenden wollen das so. Sie glauben nicht nur an den Wundermann — Professor oder Laien —, sie glauben auch an diese buntetikettierten und sauber verpackten Dinge, die mit . . . „in“ oder mit . . . „an“ aufhören und eben einige jener zehn Medikamente in neuer Zusammensetzung enthalten.
Hübsch, so eine Apotheke. Man fühlt sich so geborgen; es kann einem nichts geschehn, weil sie ja hier gegen alle Krankheiten und für alle Menschen ihre Mittel haben. Es ist alles so ordentlich, so schön viereckig, so abgewogen rund — so unwild. Hat der Apotheker einen Vogel? eine treulose Frau? Kummer mit seiner Weltanschauung? Das soll er nicht — wir wollen es jedenfalls nicht wissen. Wir stehen vor ihm, dem Dorfkaplan der I. G. Farben und dem Landprediger der ärztlichen Wissenschaft. Die Apotheke macht besinnlich, wir fordern, nehmen, zahlen und sind schon halb geheilt. Bis zur Tür.
Draussen ist es wesentlich ungemütlicher, und von der sanft duftenden Medizin-Insel steuern wir wieder auf das hohe Meer. Die Apotheke ist das Heiligenbild des ungläubigen kleinen Mannes.
Einfahrt
Erst tauchen auf dem grüngrauen Land ein paar Baracken auf, dann Häuschen, dann Häuser, da steht die erste Fabrik. Ein Holzlager. Grau ist die Natur — immer sieht die Grenze zwischen der Stadt und dem flachen Land aus wie ein Müll- und Schuttplatz. Da ist eine Vorortbahn, viele Schornsteine; die erste Elektrische. Noch rollt der Zug glatt und mit unverminderter Geschwindigkeit; Strassenzüge begleiten uns, noch mit Bäumen besetzt, dann bleiben die Bäume zurück; Reklametafeln, Wagen, Menschen, nun fährt der Zug langsamer und langsamer, nun rollt er im Schritt. Da — das sind die hohen Steinmauern der Einfahrt.
Schwarzgespült vom Rauch sind sie, ruhig und trübe; hier schlagen die Wellen der Fremde an das heimische Gestade . . . Heimisch? Für wen? Wir sind Fremde. Wir kommen in die fremde Stadt.
Die ahnt nichts von denen, die hier ankommen. Heute kommen an: achtundvierzig Leute, die nur ihr Geld ausgeben wollen — (zum Hotelportier: „Sagen Sie mal, wo kann man denn hier mal —?“); zweiunddreissig Reisende in Tuch, Eisenwaren und Glastöpseln; ein Kranker, der einen Arzt konsultieren will; achtundsechzig Menschen, die in ihre Stadt zurückkommen, die zählen nicht; und Fremde, Fremde, Fremde: herangewanderte, arme Teufel, die ein Glück versuchen wollen, das sie noch nie gehabt haben — der berühmte junge Mann, der „mit nichts hier angekommen ist, und heute ist er . . .“ Fremde, Fremde.
Unberührt von ihnen liegt die Stadt. Haus an Haus schleicht vorbei — mir sehen in die Kehrseiten der Häuser, wo schmutzige Wäsche hängt und russige Kinder schreien, wo Achsen auf den Höfen ächzen und Küchen klappern — die Stadt zeigt uns Fremden ein fremdes Gesicht. Innen sieht sie ganz anders aus.
Es gibt an einer bestimmten Stelle Schreibmaschinen billiger; morgens um halb elf müssen alle Leute, die zur feinen Gesellschaft gehören wollen, in einer bekannten Allee ihr Auto einen Augenblick halten lassen; Mittag isst man gut bei . . .; ja, das wissen wir nicht; Schuhe kauft man vorteilhaft . . . in welcher Strasse? — im . . .-Theater ist eine herrliche Premiere mit einem wundervollen Krach zwischen dem Direktor und der Geliebten des Geldgebers. Ihre eigne Sprache hat die Stadt: statt „Geld“, sagt man hier . . . ja, das wissen wir nicht; um den Witz in der Zeitung zu verstehen, die sich der ganze Zug eine Station vorher gekauft hat, muss man wissen, dass es sich um Frau H. handelte, die mit einer Mörderin zusammen eingesperrt sowie homosexuell ist; auf dem Witzbild erkundigt sie sich nach ihrer Zellengenossin: „Ist sie blond —?“ fragt sie den Schliesser — das verstehn wir alles nicht. Wir wissen gar nichts. Für uns ist das eine fremde Stadt.
Und wir werden ihr einen Teil unsres Lebens geben; wir werden uns einleben, die Stadt wird sich in uns einleben, und nach zwei Jahren gehören wir einander, ein bisschen. Wir sagen nicht mehr „gnädige Frau“ zur Stadt — wir sagen dann einfach „Sie“. Wir wissen schon, wo man vorteilhaft Regenschirme kaufen kann, und das mit der schicken Allee, und wo man gut und billig zu Mittag isst, das alles können wir den neuen Fremden, die nach uns kommen, schon ganz leichthin sagen, als seien wir damit aufgewachsen, und als sei das gar nichts. Aber: du . . . du sagen wir noch nicht zur Stadt.
Das sagen nur die, die hier gross geworden sind. Die, die ihre ersten Worte in ihren Gassen, in ihren Kinderliedern und auf ihrem Rasen gestammelt haben; die ein bestimmtes Viertel der Stadt auf ewig mit einer bestimmten Vorstellung verbinden, denn dort haben sie zum erstenmal geküsst; die in den vorweihnachtlichen Tagen im Omnibus in die Hände gepatscht und sich die Nase an den Scherben platt gedrückt haben. „Guck mal, Papa! Mama! Sieh mal, da —!“ und denen dort im Omnibus die Welt erklärt worden ist . . . die sagen du zur Stadt.
Die kümmert sich nicht um die Fremden, die täglich heranbrausen. Sie führt ihr Leben . . . wer will, darfs mitleben. Sie formt die Fremden langsam um, und wenn die Fremden Geduld haben, dann sind sie es nach zwanzig Jahren nicht mehr. Nicht mehr so ganz. Nur tief, im fremden Herzen, sind sie es noch: da frieren sie, die Fremden.
Da hält der Zug. Und alle steigen aus; sie suchen, die Wurzellosen, eine Heimat in der Heimat der Stadt, die schon eine Heimat ist: für die andern. In wieviel Städte werden wir noch einfahren —?
BEISSRING
Wahnsinn Europa
Im Jahre 1902 wird in der italienischen Kleinstadt Cerignola ein Proletarier geboren, der di Modugno heisst. Erst Landarbeiter, dann Bauarbeiter, gleitet der klassenbewusste junge Mensch rasch in die Gewerkschaftspolitik; er wird mehrere Male verhaftet, das erstemal schon im Jahre 1921, also vor der Herrschaft der Fascisten, und als die ans Ruder kommen, lernt er ein Gefängnis nach dem andern kennen. Flieht im April 1927 aus Italien, denn es ist eine Flucht, die Italiener lassen ihn nicht heraus, ein Auslandspass ist eine Gnade. Geht nach Frankreich, nach Luxemburg, arbeitet dort, geht wieder nach Frankreich und denkt: Italien, und hat eine Idee im Kopf: Italien. Denn in Italien sind Frau und Kind.
Nichts einfacher, als Frau und Kind nachkommen zu lassen? Das erlauben die Italiener nicht; Frau und Kind sind Geiseln für den Entflohenen, und überhaupt „hat der Italiener im Ausland nichts zu suchen“. Die Frau di Modugnos versucht es mit einer Wallfahrt nach Lourdes — man verweigert ihr dennoch den Pass. Sie bittet und beschwört die Behörden — man verweigert ihr den Pass.
Im Jahre 1927 macht di Modugno in Paris neue Anstrengungen. Das Spiel der Ämter beginnt von neuem. „Da müssen Sie erst . . .“ Gesuch; Beglaubigung des Gesuchs durch die französische Polizei; Beglaubigung der Beglaubigung durch das italienische Konsulat; Formulare, Gänge, Warten, Warten . . . und dabei ist nie zu vergessen, dass das ein Arbeiter in seiner Freizeit macht, dass er müde ist, unausgeschlafen, gereizt durch all diesen Widersinn . . . Frau Modugno schreibt aus Italien: „Liebster, wieder ist mein Gesuch abgeschlagen, aber ich habe gute Beziehungen, und ich glaube, dieses Mal wird es doch gelingen. Ich habe einen Anwalt genommen . . .“ Also um einen gewöhnlichen Auslandspass zu erlangen, braucht man in der Ordnungszelle Italien einen Anwalt, denn es muss doch Geld unter die Leute kommen. Di Modugno wartet, in Paris.
Und eines Tages, als es gar nicht weiter geht, am 12. September 1927, steckt er einen Revolver zu sich und geht noch einmal aufs italienische Konsulat. Der Generalkonsul ist zu seinem Glück nicht da, den jungen Arbeiter empfängt sein Vertreter: ein Graf Nardini. Das kleine Büro ist von dem Warteraum nur durch eine dünne Wand getrennt. Die dort Sitzenden hören eine kurze Unterhaltung, dann die Stimme des Arbeiters, dann Nardini, auf italienisch: „Ich kann nicht! ich kann das nicht!“ — dann zwei Schüsse. Di Modugno hat den Konsularvertreter Italiens in Paris erschossen. Da sitzt er, auf der Anklagebank.
Der Flügel des Palais de Justice ist in weitem Umfang abgesperrt, drei Reihen Schutzleute sind zu passieren, ehe du heraufkommst — der Saal ist halb leer; in dem viel zu kleinen Zuschauerraum, der Formalität halber, jene, die die Geduld gehabt haben, lange genug anzustehen; sehr viele Anwälte, auch weibliche, unter denen übrigens keine grosse Nummer ist; Zeugen, Presse, Polizei.
Di Modugno ist ein kleiner Mann, der recht kümmerlich vor seinen drei Wächtern in der Anklagebank hockt. Die drei Richter und der Staatsanwalt in roten Talaren; links die Geschworenen, mittleres und kleines Bürgertum. Die zwei Damen in Schwarz sind Frau und Tochter des Ermordeten, sie haben sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen, was nach französischem Recht möglich ist, wenn sie ein Interesse geltend machen; zu diesem Zweck wird, der Form halber, ein Frank Schadenersatz verlangt, und auf solche Art haben die natürlich nur moralisch Interessierten die Möglichkeit, mit ihrem Anwalt, Herrn Gautrat, in den Prozess einzugreifen. Di Modugno wird von dem Donnerer Torrès und Herrn Lazurick verteidigt. Los gehts.
*
Warum? Warum haben Sie das getan —?
Di Modugno beginnt in einem harten Französisch, das er im Gefängnis gelernt hat, zu erklären . . . sein Temperament entlädt sich ungeschickt, er erzählt zu viel, zu viel Einzelheiten, die hier keinen Menschen interessieren, die für ihn aber Lebensfragen, Todesfragen gewesen sind: Italien und die Fascisten und die Gefängnisse . . . Die Rolle des Vorsitzenden, des Herrn Warrain, ist nicht beneidenswert: da sitzen Vertreter der italienischen Botschaft, sehr viel italienische Presse schreibt im Saal, und ein Angriff des Herrn Torrès, ist kein Zuckerlecken. Trübe ist der Tag, die elektrischen Lampen glühen, sie leuchten nicht, die braune Holztäfelung schwimmt im Dunkel, da steht ein Photograph und hält dem Angeklagten seinen Kasten vors Gesicht; die Anwälte gemahnen unfehlbar an Daumier, was mögen sich diese Schauspieler der Gerechtigkeit wohl nachher hinter den Kulissen beim Frühstück erzählen? Warum übrigens alle Gerichtssäle der Welt so schlecht gelüftet sind, bleibt ein ewiges Rätsel.
Di Modugno hat viel zu reden, aber nicht viel zu sagen. Man errät die unendliche Qual der Passplackerei; er hat Pech, er ist kein „sympathischer Angeklagter“, und ausserdem hat er, wie das immer so geht, einen Mann getötet, der wohl einem System angehörte, aber selbst kein enragierter Fascist gewesen ist. Es trifft immer die Falschen.