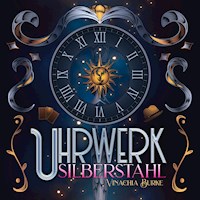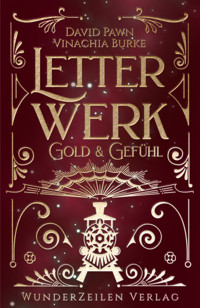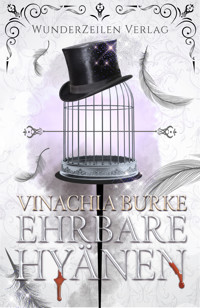Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: WunderZeilen Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Letterwerk
- Sprache: Deutsch
Sie ist auf der Flucht.
Er ist frustriert.
Sie ist erst achtzehn.
Er bereits vierundfünfzig.
Cannie - Senatorentochter aus gutem Hause, und Timothy - Journalist, aufgewachsen im Armenviertel der Hauptstadt. Ein ungleicheres Paar konnte im Zug auf der Fahrt von Romaleon nach Sidarap kaum zusammentreffen.Auf den ersten Blick verbindet sie eine gegenseitige Abneigung füreinander. Und doch ist jeder vom anderen abhängig, wenn sie die zehntägige Zugfahrt überstehen und unbeschadet in der Hauptstadt eintreffen wollen.
Band 1 der Letterwerk-Dilogie.
Basiert auf der Welt der „Uhrwerk“-Reihe von Vinachia Burke. (Kann unabhängig gelesen werden.)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
David Pawn Vinachia Burke
Impressum
Copyright © 2024 by
WunderZeilen Verlag GbR (Vinachia Burke & Sebastian Hauer) Kanadaweg 10 22145 Hamburghttps://[email protected]
LETTERWERK – Stolz & BleiText © Vinachia Burke, David Pawn, 2024 Story Edit: Vinachia Burke (www.vinachiaburke.com) Lektorat 1: David Pawn (www.davidpawn.de) Lektorat 2: Cao Krawallo (www.caokrawallo.de) Korrektorat: Monika Schulze (www.suechtignachbuechern.de) Cover: Vinachia Burke Satz & Layout: Vianchia Burkewww.vinachiaburke.com ISBN: 978-3-98867-022-9 Alle Rechte vorbehalten.
Die Welt Theah …
… wird nicht nur von Menschen bewohnt, sondern auch von Dämonen, Bizach, wie sie sich selbst nennen. Manchmal zeigen Menschen Fähigkeiten, die eigentlich nur den Dämonen eigen sein sollten. Mit dem 21. Lebensjahr wird daher jeder Bürger auf seine Elementverteilung geprüft. Stellt sich dabei heraus, dass jemand übernatürliche Fähigkeiten besitzt, so verliert er seinen Status als Mensch und muss fortan unter den Dämonen leben. Folgende Dämonenfähigkeiten bei ungewöhnlicher Elementverteilung sind mittlerweile bekannt:
Sidarap ist die Welthauptstadt von Thea. Sie wird regiert von Adonai, einem unsterblichen Wesen, das gottgleiche Verehrung genießt. In ganz Theah ist Sidarap der einzige Ort, an dem Menschen und Dämonen zusammenleben. Außerhalb der Hauptstadt trifft man selten einen Bizach an. Vermutlich, weil sie nirgendwo gern gesehen sind und außerhalb von Sidarap keinerlei Schutz genießen …
Tag 1
REISEPLAN ROMALEON (Zentralbahnhof) DROISTINGEN DREISANDE
1. Cannie
Nun gab es kein Zurück mehr. Ein letztes Mal zog ich mir die braune Ballonmütze tiefer ins Gesicht. Adonai, sorg dafür, dass ich nicht auffliege! Ich trat einen Schritt vor und lugte unter dem Mützenschirm hervor. Ein Mann mit weißen Haaren und reichlich Falten im Gesicht sah gelangweilt zu mir auf, als ich vor die Glasscheibe trat.
»Ein Ticket nach Sidarap bitte.«
»Klasse?«
»Zweite.«
»Zweihundertachtzig Lin.«
Zeithundert ...? Oh Mist. Ich hatte etwas mehr als dreihundert Lin in der Tasche, aber ich brauchte noch Geld für Essen und meine ersten Wochen in Sidarap. Mit weniger als hundert Lin käme ich nicht weit.
»Dann doch die Dritte«, sagte ich schnell.
Der Fahrkartenverkäufer atmete tief ein. »Offen oder geschlossen?«, fragte er, während er die Preistabelle studierte.
Wollte ich wirklich in der Offenen Dritten Klasse fahren? Absolut nicht. Aber ich wollte auch nicht hierbleiben. Das Herz schlug mir bis zum Hals und schnürte mir die Kehle zu. All das war eine ganz miserable Idee.
»Hallo?«
Ich schluckte schwer. Jetzt war ich schon so weit gekommen, da würde ich nicht umkehren.
»Entschuldigung, die Offene bitte.«
»Sicher, Mädchen?«, fragte er mit der Stimme eines gutmeinenden Großvaters.
»Ja!«
Er zögerte einen Moment, aber zuckte dann mit den Schultern, wie um sich selbst zu sagen, dass mein Schicksal nicht seine Verantwortung war.
»Dann bekomme ich hundertfünfzig Lin.«
Ich zog verstohlen das Geld aus meiner Tasche und schob es durch die runde Öffnung in der Scheibe. Im Gegenzug löste der Alte einen Fahrschein und stempelte diesen, bevor er ihn mir auf dem gleichen Weg hinausreichte.
»Gute Reise«, sagte er.
Ich ging mit einem leisen »Danke« davon. Vermutlich hörte er mich nicht, aber das sollte wohl meine geringste Sorge sein. Ich verstaute den Geldbeutel wieder und durchquerte das Bahnhofsgebäude.
Drei Monate waren vergangen, seit ich bei der Eröffnung der ersten direkten Zugverbindung von Romaleon nach Sidarap zuletzt hier gewesen war. Da vorn am Treppenaufgang hatte ich mit dem Rest meiner Familie für die Fotografen gestanden, bevor mein Vater unter allgemeinem Beifall das rote Band zerschnitten hatte.
Ich erklomm die marmornen Stufen und sah mich am oberen Ende dem riesigen Ziffernblatt einer Uhr gegenüber, die inmitten des Vorplatzes der einzelnen Bahngleise stand. Tatsächlich besaß sie vier Ziffernblätter. Eines auf jeder Seite ihres quaderförmigen Aufbaus. Halb acht. Mir blieb noch eine halbe Stunde bis zur planmäßigen Abfahrt.
Wie lange es wohl dauern würde, bis jemand bemerkte, dass ich fort war?
Heute Morgen hatte ich das Haus wie immer zusammen mit Jora verlassen. Da sie noch die Mittelschule besuchte, begleitete ich sie bis dorthin, so wie es als große Schwester meine Pflicht war. Dort angekommen, verabschiedete ich mich von ihr, doch statt wie gewöhnlich meinen Weg zur Oberschule fortzusetzen, ging ich zum Bahnhof.
Mister Meldon informierte sicherlich nicht sofort meine Eltern über mein Verschwinden. Ich mochte zwar die Tochter des Senators sein, aber mein Klassenlehrer hatte seit jeher deutlich gemacht, dass ich deswegen keine Sonderbehandlung in seinem Unterricht zu erwarten brauchte. Mit etwas Glück fiel meiner Familie erst am Nachmittag auf, dass ich gegangen war. Bis dahin hatte ich hoffentlich schon viele Hundert Meilen zwischen uns gebracht.
Ich erreichte das Gleis, auf dem mein Zug bereits zischend bereitstand. Ein mulmiges Gefühl stieg in mir auf. Ich war erst wenige Male mit einem solchen Gefährt unterwegs gewesen, aber nie war mir ganz wohl bei der Sache, kursierten doch allerhand Meinungen über die schädlichen Auswirkungen von Bahnreisen auf die Gesundheit.
Im Näherkommen traf mich der Blick eines Schaffners, der in seiner nagelneu wirkenden dunkelblauen Uniform mit den typischen bronzefarbenen Knöpfen an einem der Wageneingänge stand und auf Passagiere wartete. Er sah mich so auffordernd an, dass ich ihm einfach meine Karte reichte, die er in seine behandschuhte Linke nahm, einen flüchtigen Blick darauf warf, und sie mir anschließend sofort wieder hinhielt.
»Dritte. Da müssen Sie zum Ende des Zuges, Miss«, sagte er und winkte mit ausladender Geste in die entsprechende Richtung.
Ich nickte und machte mich auf den Weg. Der führte mich einmal die gesamte Gleislänge entlang, vorbei an einem Dutzend Wagen. Am achten oder neunten, so richtig zählte ich nicht mit, erreichte ich einen, auf dem eine große gelbe Drei aufgemalt worden war. Auch dort stand einer der Uniformträger und hatte mich bereits im Visier.
»Willkommen im Transtheah, Miss. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise«, sagte er, nachdem er meine Fahrkarte kurz in Augenschein genommen und gelocht hatte.
Als ich endlich in einem der Wagen stand, atmete ich innerlich auf. Auf dem Bahnsteig hatte mich bei jedem Schritt die Sorge verfolgt, jemand könnte mich erkennen und unangenehme Fragen stellen. Am besten sollte sich niemand an mich erinnern, dann könnten die Ermittler der Stadtwacht oder gar der Provinzwacht mich auch nicht so schnell aufspüren.
In den Wagen der Dritten Klasse herrschte reges Treiben. Gepäck wurde hektisch verstaut, Kinder liefen umher, schrien oder weinten. Ich schlich mich durch das Gedränge, immer mit dem Vorsatz, nicht unnötig aufzufallen, und musste zwei weitere Wagen durchqueren, bis ich endlich meinen Platz, oder vielmehr meine Liege, erreichte.
Die Offene Dritte Klasse bestand aus einem Gang auf einer Seite des Zuges und drei Trennwänden auf der anderen. Drei Trennwände, an denen auf jeder Seite jeweils zwei Liegen übereinander an der Wand angebracht worden waren. Das bedeutete, ich würde mir im schlimmsten Fall mit drei fremden Menschen ein offenes Abteil teilen. Vielleicht hätte ich doch ein paar Monate länger mein Taschengeld sparen sollen. Nie hatte ich mit mehr als einer Person ein Zimmer geteilt und das waren entweder meine Schwester oder eine Schulfreundin gewesen. Aber wildfremde Menschen?
Betreten knetete ich die Finger und starrte zu meiner Liege hinauf. Ich würde unter dem Dach schlafen. Da oben konnte ich nicht einmal sitzen, so niedrig war die Decke.
»Hrhrm.«
Erschrocken fuhr ich herum. Ich hatte mit meinem In-der-Gegend-Herumgestehe den Platz für alle anderen auf dem Gang in diesem Wagen blockiert.
Ich spürte, wie mir das Blut in die Wangen schoss. Sofort sprang ich beiseite, um die wartende Familie in meinem Rücken durchzulassen.
Bei Adonai, worauf hatte ich mich hier eingelassen? Was sollte ich jetzt tun? Mich da oben hinlegen und zehn Tage lang nicht mehr aufstehen?
Hilflos sah ich von links nach rechts in der Hoffnung auf einen Hinweis darauf, was andere in meiner Situation so taten.
Unvermittelt schlug mir etwas gegen den Kopf und riss mir die Mütze herunter. Ich keuchte überrascht und stolperte gegen die nächste Zugwand.
Ein Blick über die Schulter offenbarte mir den Übeltäter: Eine erschrocken dreinblickende Frau, die anscheinend gerade versucht hatte, ihr Gepäck zu verstauen und dabei die Tasche mit ordentlich Schwung über meinen Scheitel hinweggedonnert hatte.
»Oh nein, geht es Ihnen gut?«, fragte sie und machte Anstalten, sich zu mir hinunterzubeugen.
Doch ich las nur flink meine Mütze vom Boden auf und wich vor ihr zurück.
»Ja, kein Problem«, sagte ich im Weghuschen.
Kein Problem? Puh, wenn sie jetzt nicht dachte, dass ich mir ernstlich den Kopf gestoßen hatte, dann wusste ich auch nicht. Ich flüchtete zum Anfang des Wagens, an dem sich auch ein Waschraum befand und der ein klein wenig mehr Platz bot. Dort angekommen stopfte ich mir eilig die langen roten Locken wieder unter die Mütze. Vielen Dank Mama für diese überaus unauffällige Haarpracht.
Ich kontrollierte meine Erscheinung in einem der kleinen Spiegel nahe dem Waschbecken. Sobald auch die letzten Spitzen wieder unter dem Stoff verschwunden waren, trat ich hinaus und sah mich um. An der Wand gegenüber hing ein Schild mit der Aufschrift ›Speisewagen‹, darauf ein Pfeil, der in die Richtung zeigte, aus der ich gekommen war. Vielleicht fand ich dort einen Platz, an dem ich meine Tage verbringen konnte.
2. Timothy
Wie ich diese Provinzbahnhöfe hasste! Aber selbst als Reporter konnte ich nicht immer nur in der Hauptstadt arbeiten. Zwei Wochen hatte ich in Romaleon über die aktuellen Probleme des Senats recherchiert. Zwischen den beiden konkurrierenden Parteien gab es Querelen und gegenwärtig war keineswegs klar, ob sich Senator Glanvalli gegen seine die Bizach ablehnenden Gegenspieler würde behaupten können. Daheim in Sidarap hatte sich Viktor Jossum bei den Bürgermeisterwahlen durchgesetzt, ein Mann, der mit dem Buckeln vor den Dämonen Schluss machen wollte. Aber ehe sich so eine Haltung bis in die hintersten Winkel der Welt verbreitete, verging gewiss einige Zeit.
Hier um Romaleon herum gab es größtenteils Rübenfelder und die Köpfe mancher Bauern waren verdächtig ähnlich geformt. Für sie galt, dass Die-da-oben entschieden und Sie-da-unten ausführten. Und sie handelten dabei mit dem stoischen Gleichmut ihrer robust gebauten Ackergäule.
Wie anders war dagegen meine Heimatstadt. Sie wurde oft wegen ihrer Teilung in sechs Bezirke durch sternförmig diese voneinander teilende Hauptstraßen mit einem Uhrwerk verglichen, denn diese waren wie die Stundenmarken auf einem Zifferblatt angeordnet, aber ein Scherzbold in der Redaktion hatte mal geschrieben, die Stadt sei ein großer Apfel, den man in sechs Spalten zerlegt hätte. Der Artikel wurde nie gedruckt, zumal ein paar Zeilen weiter unten davon zu lesen war, dieser große Apfel sei madig.
Ich blieb also lieber bei jenem Bild eines gigantischen Uhrwerks, denn natürlich war nicht allein die Stundenteilung ein bestimmendes Merkmal einer Uhr. Sie war nicht einmal erforderlich, wie viele verschiedene Bauarten von Uhren ohne eine solche bewiesen. Was aber allen Uhren gemein war und sie mit Sidarap verband, war die Rastlosigkeit des Uhrwerks. Wenn es sich nicht mehr bewegte, stillstand, war es defekt. Und so wie ich mir kein Uhrwerk in völliger Ruhe vorstellen konnte, so würde jedermann, der dort lebte, bestätigen, dass dies auch für jene Stadt galt.
Ich kaufte mir einen Becher Kaffee an einem der Imbissstände und warf ihn in die erste Mülltonne am Wege, nachdem ich einen Schluck probiert hatte. Vermutlich machten sie den hier auch aus Rüben. Ich würde also mein Spesenkonto im Speisewagen des Zuges weiter überziehen müssen.
Ich passierte die große Uhr am Querbahnsteig. Sie zeigte, dass mir fünf Minuten bis zur Abfahrt blieben. Genug Zeit, um im Vorbeigehen ein Exemplar der Tagesthemen zu kaufen. Ich wollte nachschauen, ob die Redaktion meinen Artikel vom Vortag erhalten und gedruckt hatte. Dem ersten Zeitungsjungen, der mir hoffnungsvoll ein Blatt entgegenhielt, drücke ich einen Lin in die Hand und blätterte sogleich durch die Seiten.
Verdammt! Hatten diese Ar… Chefredakteure meine Arbeit tatsächlich zu Makulatur erklärt? Und warum? Weil ich Senator Saradotti im Interview nicht um den Bart gegangen war? Weil ich mich erdreistet hatte, die Allwissenheit Adonais anzuzweifeln? Hatte er die Eisenbahn erschaffen? Oder die neumodischen Motorkutschen? Oder unsere gottverdammte Druckerpresse, die meinen wunderbaren Artikel nicht gedruckt hatte? Nein, das waren allesamt Erfindungen von Menschen – Zeichen der Kraft des Geistes und der Wissenschaft – die sich über den Aberglauben erhoben.
Ich knüllte das Blatt zusammen. Warum nur ließ ich mich immer wieder darauf ein, tauben Ohren zu predigen?
Ich passierte die Wagen der Ersten und Zweiten Klasse, registrierte dabei die Gardinen mehrerer Salon- und Speisewagen und erreichte schließlich die Dritte Klasse. Wenigstens hatte mein Chef mir ein Ticket für ein geschlossenes Abteil genehmigt. Der Schaffner sah kurz drauf, stanzte das obligatorische Loch zur Entwertung hinein und sagte: »Sie sind spät dran.«
Ich deutete auf die Uhr hinter mir. »Noch eine Minute. Ausreichend Zeit.«
»Wenn Sie meinen, Sir. Aber jetzt, einsteigen bitte. Der Transtheah wartet nicht.«
Ich diskutierte nicht weiter, sondern erklomm die Treppe und stieg ein. Der Zug setzte sich in Bewegung, während ich den Gang entlangschritt. Wenig später stand ich in meinem Abteil und wuchtete meinen Koffer in das Regal über der Tür.
In der Dritten Klasse gab es statt der weichen Betten der anderen beiden Klassen vier Pritschen je Abteil. Für Gepäck war lediglich über der Tür und über dem Fenster Platz. Oder man stellte seinen Koffer vor das Fenster. Aber wer so etwas tat, lud nächtliche Besucher mit räuberischen Absichten geradezu ein.
Zu meinem Glück war noch eine der oberen Pritschen frei. Ich kannte Leute, die verstanden nicht, wieso jemand eine Liege bevorzugte, zu der die gesamten nächtlichen Duftwolken der übrigen Fahrgäste aufstiegen und die einem darüber hinaus nicht einmal erlaubte, aufrecht auf ihr zu sitzen. Wenn ihnen mitten in der Nacht das erste Mal jemand ins Gesicht getreten war, weil er ein dringendes Bedürfnis verspürte und darum hinunter- und später wieder hinaufgeklettert war, ohne darauf zu achten, wohin er seine Füße setzte, kannten sie die Antwort. Außerdem versetzte die erhöhte Position einen in eine bessere Lage, wenn nachts irgendein Strolch ins Abteil eindrang, um einen zu berauben. Dem schmetterte man einfach die Faust aufs Haupt, dann trollte er sich.
Mit mir im Abteil fuhren zwei vollbärtige Holzfällertypen, die sich gerade einen Flachmann teilten. Trotz ihrer Muskeln und gebräunten Haut, die sie als täglich hart arbeitende Kerle auswiesen, machten sie auf mich einen eher friedlichen Eindruck. Vermutlich hatten sie ihre Ersparnisse zusammengekratzt, um einmal aus der Provinz herauszukommen und ein paar fröhliche Tage in der Hauptstadt zu verbringen. Wenn ich mich nicht zu hochnäsig gab, ließen sie mich vermutlich in Ruhe. Das Schlimmste, das mir passieren konnte, mochte sein, dass ich mit von dem Gebräu trinken musste, das sie begleitete.
Direkt unter mir hatte sich ein kleiner Mann mit Melone einquartiert. Sein Gesicht erinnerte an einen Frosch, dem man eine Nase angeklebt hatte. Er gefiel mir weitaus weniger als die beiden Bärtigen. Auf mich wirkte er wie ein Mann, der irgendwelche Dinge im Verborgenen tat.
Ich wollte gerade aus dem Abteil hinaus und mich nach dem Speisewagen umsehen, denn ich brauchte endlich einen Kaffee, wenn ich den Rest des Tages funktionieren wollte, da sprach er mich an.
»Simmons«, sagte er und hielt mir die Hand hin.
»Rook«, erwiderte ich und schüttelte sie. Sie war leicht und trocken wie ein alter Lappen.
»Ich finde«, sagte er, »wenn man zehn Tage gemeinsam in so einem Abteil zusammengepfercht ist, sollte man sich so früh wie möglich miteinander bekannt machen. So vermeidet man unnötige Reibereien.«
Ich erwiderte nichts und lächelte unverbindlich. Ich wollte mich nicht mit diesem Typen unterhalten, ich wollte endlich in den Speisewagen. Allerdings legte ich auch keinen Wert auf seine Begleitung. Er hatte etwas Schmieriges an sich, auch wenn er völlig sauber und adrett gekleidet aussah. Ich kannte solche Typen aus Sidarap, meist ehemalige kleine Gauner, die sich zu großen Gaunern gemausert hatten und jetzt ganze Straßenzüge unter ihrer Knute hielten, wobei die eigentliche Drecksarbeit von gut bezahlten Handlangern ausgeführt wurde. Ich hatte doch bereits erwähnt, dass in dem edlen Uhrwerk einige Zahnräder arg versottet waren, oder?
Ich zog die Schiebetür auf und drängte hinaus auf den Gang. Einige weitere Fahrgäste standen herum, schauten aus den Fenstern auf die vorbeieilende Landschaft und ergötzten sich an belanglosem Geplauder. Da standen eine Dame in einem hochgeschlossenen Kleid mit Pailletten, die überhaupt nicht in die Dritte Klasse passen wollte, zwei Arbeiter in Drillichkleidung, von denen ich vermutete, sie kehrten von einem Auftrag in der Provinz in die Heimat zurück und eine Mutter mit einem Kind mit einem Lutscher im Mund, um das ich einen weiteren Bogen als um die anderen machte, denn es sah klebrig aus.
Der Speisewagen der Dritten Klasse war ähnlich schlicht wie die Abteilwagen selbst. Einfache Holzbänke für je zwei Personen standen gegenüber an einem am Boden verankerten Tisch. Keine Tischdecke, kein Zierrat, keine Blumen. Nur ein Blatt Papier lag darauf, auf dem die Speisen und Getränke samt der Preise aufgelistet waren. So kurz nach der Abfahrt war der Besuch noch spärlich.
3. Cannie
Ich hatte mir einen Platz in einer der Ecken des Speisewagens gesucht, möglichst geschützt vor den meisten Blicken der ein- und ausgehenden Gäste. Meinen Rucksack stellte ich neben mich auf die schmuck- und komfortlose hölzerne Sitzbank, sodass er zwischen mir und dem Gang eine Barriere bildete. Eine kleine, in den Augen der Vorbeiziehenden, wohl unbedeutende Geste, aber für mich eine Möglichkeit, mich sicher zu fühlen. Je weniger Leute mir zu nahekamen, desto besser. Ich wollte unsichtbar werden. Zumindest bis ich in Sidarap ankam.
Ich zog die Speisekarte heran und studierte das Angebot. Augenblicklich wurde mir klar, dass ich mir mehr Essen hätte einpacken sollen oder länger hätte sparen müssen. Wahrscheinlich finanzierte sich die Transtheah durch das Essen den teuren Streckenbau. Anders konnte ich mir die Wucherpreise nicht erklären. Was taten die hier eigentlich, wenn jemand kein Geld hatte? Die ließen wohl kaum ihre Fahrgäste verhungern, oder? Verstohlen sah ich mich um. Oder? Mit Sicherheit nicht, ich hatte noch nie irgendwelche Nachrichten über verhungernde Fahrgäste gehört. Außerdem duldete Adonai so etwas mit Sicherheit nicht. Selbst mein Vater, der sonst keine Gelegenheit ausließ, um über die Bizach zu schimpfen, sagte immer, dass auf Adonai zu vertrauen nie falsch sei. Ich wusste nicht, woher er diese Überzeugung nahm, aber ich lehnte den Gedanken auch nicht ab.
Hin und wieder fragte ich mich, warum gerade ich anders als alle anderen aus meiner Familie geworden war. Diese Frage würde ich dem Allwissenden stellen, sollte ich je das Privileg bekommen, mit ihm reden zu dürfen. Bei dem Gedanken fühlte ich mich schlagartig, als hätte mir jemand Steine in den Magen gelegt. Ein Teil von mir wollte so sein wie der Rest meiner Familie, normal eben. Aber dann würde ich verleugnen, wer ich war - was ich war. Und der Gedanke, mich selbst zu verraten setzte mir mehr zu, als die Vorstellung meine Familie zu verlieren. Ein schlechtes Gewissen hatte ich trotzdem und ich wusste, ich würde sie beizeiten schrecklich vermissen. Aber ich musste das hier tun. Ich wollte herausfinden, wie mein Schicksal aussehen könnte. Allerdings nur, wenn ich es überhaupt bis in die Hauptstadt schaffte, denn mein Vater scheute mit Sicherheit keine Ressourcen, um mich wiederzufinden. Wahrscheinlich kannte in wenigen Tagen ganz Theah mein Gesicht. Wie ich damit umgehen sollte, wusste ich noch nicht.
Der Hunger war mir inzwischen vergangen, daher beschloss ich, mir nur etwas zu trinken zu bestellen. Ich ließ meinen Rucksack am Tisch zurück und ging zu dem Tresen auf der anderen Seite des Wagens.
»Was darf es sein, junge Dame?«, fragte eine stämmige Frau mittleren Alters, die mich ansah, als hätte ich sie gerade bei irgendwas Wichtigem unterbrochen. Das fand ich kurios, da sie seit meinem Eintreten nur an der Kasse gestanden und Löcher in die Luft gestarrt hatte.
»Einen Cubanjosaft.«
»Groß? Klein?«
Wenn das Servicepersonal schon zu Beginn der Reise derart gut gelaunt war, wollte ich nicht wissen, wie das in ein paar Tagen aussehen sollte. War Unfreundlichkeit in der Dritten Klasse normal? Wenn meine Familie irgendwo hinreiste, waren wir immer mit allen Höflichkeiten behandelt worden. Aber gut, vermutlich wäre es sehr blauäugig von mir, den gleichen Respekt auch hier zu erwarten. Und mit meiner Mütze im Speisewagen war ich nun auch nicht die Ausgeburt von Anstand und Etikette.
»Klein, bitte.«
»Drei Lin achtzig.«
Ich suchte die passenden Münzen heraus, während die Frau mir eine kleine Glasflasche auf den Tresen stellte.
»Bitte, stimmt so«, sagte ich und packte einige Groschen extra dazu.
Ohne eine Antwort sammelte die Bedienung mein Kleingeld ein.
Ich wartete noch einen Moment auf ein vermeintliches »Danke«, doch musste mich in Anbetracht eisigen Schweigens schließlich geschlagen geben. Meinen Saft in der Hand, wandte ich mich ab, um zu meinem Platz zurückzukehren. Vielleicht musste ich mich von nun an an die fehlende Freundlichkeit meiner Mitmenschen gewöhnen.
Wie um den Gedanken zu bestätigen, bellte plötzlich jemand: »Vorsicht!«
Reflexartig blieb ich stehen. Um ein Haar wäre ich in jemanden hineingerannt und trat überrascht einen Schritt zurück. Vor mir stand ein hochgewachsener Mann, der mit strengem Blick auf mich hinabsah. »Augen sind zum Sehen da, Mädchen. Das sollten Sie vielleicht auch einmal versuchen.«
Zu perplex für eine schlagfertige Antwort starrte ich den Kerl, der mich angeblafft hatte, einfach nur an. Für die Dritte Klasse war er viel zu gut gekleidet. In dem Aufzug würde er auch bei einer der Veranstaltungen meiner Familie nicht besonders auffallen. Gehörte er zur Transtheah? Merkwürdigerweise kam mir sein Gesicht irgendwie bekannt vor, aber ich wusste beim besten Willen nicht, wo ich ihn schon einmal gesehen haben sollte.
»Was ist? Wollen Sie da festwachsen, Miss?«, fragte er schroff und wedelte mich mit der Hand beiseite.
Was war dem denn über die Leber gelaufen? War das vielleicht einer von denen, die aus der Ersten Klasse zum Pöbel kamen, um sich in ihrer Wichtigkeit aufzuspielen? Ich schluckte meine Entschuldigung herunter, schnaubte leise und marschierte einfach um ihn herum, zurück zu meinem Platz. Was glaubte der, wer er war?
Wieder verbarrikadiert hinter meinem Rucksack schraubte ich meinen Saft auf und trank einen großen Schluck auf den Schreck. Dieser Zug entwickelte sich zum reinsten Spießrutenlauf für mich. Waren Leute in Wahrheit so viel schlechter, als ich bisher geglaubt hatte? Irgendwie kam ich mir in dem Augenblick sehr naiv vor.
Kurz sah ich aus dem Fenster, doch dann zog der unfreundliche Fremde meine Aufmerksamkeit wieder auf sich. Ich beobachtete ihn dabei, wie er einen großen dampfenden Kaffee bestellte und sich dann an den übernächsten Tisch mit dem Rücken zu mir setzte. Woher kannte ich dieses Gesicht? Mir war, als hätte ich den Mann erst kürzlich irgendwo gesehen, aber wo?
Ich schüttelte den Gedanken ab. Im Moment würde ich mich sowieso nicht erinnern. Besser, ich beschäftigte mich mit etwas anderem. Deshalb kramte ich im Rucksack herum, bis ich meine Übungsmurmel fand. Eine Kugel aus Glas, in deren Mitte ein metallisches C glänzte. Meine Oma hatte mir einen ganzen Satz dieser Murmeln als Kind geschenkt. Auch all meine anderen Schwestern hatten solche bekommen, jeweils mit ihrem eigenen Anfangsbuchstaben. So gäbe es nie Streitereien, wem welche gehörten, und unsere Mutter wusste stets, wer nicht aufgeräumt hat, hatte sie immer gesagt.
Ich legte die Murmel vor mich auf die Speisekarte und sah noch einmal kurz auf, um sicherzustellen, dass niemand mir besondere Aufmerksamkeit schenkte. Wieder blieb mein Blick an dem Unfreundlichen hängen, der gerade kopfschüttelnd aus dem Fenster sah und einen Schluck trank. Dieser Kaffee …
Ich biss mir auf die Unterlippe. Meine Mutter würde diesen Gedanken nicht gutheißen, aber da sie nicht hier war und ich mich schleunigst an die Gepflogenheit meiner neuen Gesellschaftsschicht gewöhnen sollte, setzte ich meine Idee einfach in die Tat um.
Ich atmete tief durch, um mich zu konzentrieren. Zwar wollte ich mich für die Unfreundlichkeit revanchieren, aber das bedeutete nicht, dass ich mehr Ärger als notwendig verursachen wollte. Mit neun Jahren hatte ich versucht, Milch für meine kleine Schwester zu erwärmen. Dabei war mir eine ganze Kanne explodiert und hatte aus der Küche ein Schlachtfeld gemacht. Mittlerweile übte ich meine Fähigkeiten zwar regelmäßig, aber was ich vorhatte, erforderte reichlich Fingerspitzengefühl.
Der heiße Kaffee des Fremden besaß jede Menge Energie, die ich anzapfte, um meine Murmel in einer gleichmäßigen Kreisbewegung über den Tisch rollen zu lassen. Es dauerte nicht lange, bis das Getränk nur noch Raumtemperatur hatte, doch an dem Punkt hörte ich nicht auf. Ich machte weiter, bis jedes einzelne Teilchen beinahe zum Stillstand kam und zu wenig Energie für meine Murmel übrigblieb. Ein hoch auf meine Bleibegabung!
Ja, ich musste zugeben, ich fühlte mich mächtig stolz auf meinen Unfug. Zwar hatte ich schon öfter Flüssigkeiten als Energiequellen genutzt, aber gleichzeitig die Murmel kreisen zu lassen, war eine neue Spielerei in meinem Experiment. Ich genoss meinen Triumph nur kurz, denn im nächsten Moment bemühte ich mich darum, unbeteiligt und gelangweilt aus dem Fenster zu sehen und gleichzeitig nicht den Augenblick zu verpassen, in dem der Fremde feststellte, dass sich plötzlich Kaffeeeis in seiner Tasse befand.
4. Timothy
Ich liebte sie. Leute, die irgendwo mitten in der Gegend versteinerten. Besonders mochte ich sie natürlich, wenn ich aus einem Zug aussteigen wollte, sie direkt vor mir auf den Perron traten und dann in Stasis verfielen, warum auch immer. Meistens überlegten sie vermutlich, wo sie eigentlich waren und wohin sie wollten.
Was die junge Frau gerade beschäftigt haben mochte, konnte ich mir noch weniger denken. Sie war zwar in Bewegung gewesen, aber die Symptome waren die gleichen. Momentane Blind- und Taubheit.
Sie war ein hübsches kleines Ding, könnte sich selbst in Sidarap sehen lassen, wenn sie sich ein wenig fescher kleidete. So einen braunen Rock und diese graue Bluse passten doch eher zu Frau Gaschner aus der Expeditionsabteilung, die sah ihrer Pensionierung mit Freuden entgegen.
Ich nippte an meinem Kaffee. Er war noch ein bisschen zu heiß, aber wenigstens nicht dieses untrinkbare Gebräu aus Romaleon.
Woher kannte ich das Gesicht? Die Frage erschien in meinen Gedanken wie eine Leuchtreklame. Ich hatte diese schmalen Züge mit den hohen Jochbeinen und dem spitz zulaufenden Kinn schon einmal gesehen.
Ich schüttelte den Kopf und schaute aus dem Fenster. Ich wurde offenbar alt. Da vergaß man hin und wieder Dinge. Draußen flogen die Rübenfelder vorbei. Oder Kartoffeln oder Kohl oder was immer die Leute hier anbauten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich hatte kürzlich einen Artikel über Bemühungen gelesen, die Reifezeiten von Gemüse zu verkürzen, indem man Energie aus fließenden Gewässern in Wärme wandelte und das Gemüse dann in Glashäusern hielt, die so beheizt werden sollten.
Einige Klugsch… Oberschlaue meinten, man solle einfach die Fähigkeiten von Bleibegabten nutzen. Aber damit machten wir uns nur einmal mehr von Bizach abhängig. Sie könnten uns erpressen. Wenn wir nicht parierten, gab es keine Energie und dann also kein Gemü…
Hey, was war das? Ich starrte in die Tasse, die ich an die Lippen gesetzt hatte. Sie wären beinahe dran festgefroren. Und mein Kaffee steckte als Eisklumpen darin fest. Bei Adonai, hatte einer der Dämonischen meine Gedanken gelesen und sich dafür gerächt? Unsinn! So funktionierten sie nicht, jeder von ihnen besaß eine Inselbegabung. Offensichtlich arbeitete mein Denkapparat wirklich noch nicht richtig, wenn mir solche Einfälle durch den Kopf schossen. Aber was war dann passiert?
Ich blickte mich im Wagen um. Vorn am Eingang der Dritten Klasse saß ein älteres Paar und verzehrte einträchtig Kuchen. Auf der anderen Gangseite schräg gegenüber trank ein Herr mit Kneifer und der Statur eines Pfeifenreinigers Tee und verzehrte ein Hörnchen. Und hinter mir saß die junge Dame mit den abwesenden Gedanken und starrte aus dem Fenster. Sie schaute derart intensiv nach draußen, als würde dort das neueste Bühnenstück von Tschewalski aufgeführt. Genau mit jenem Blick, den kleine Kinder aufsetzten, wenn sie versuchten, unschuldig zu wirken. Fehlte nur noch, dass sie lässig vor sich hin pfiff.
Ich nahm meinen Kaffee, erhob mich und schlenderte den Gang entlang. Ich stellte die Tasse vor ihr auf den Tisch. »Für Sie. Kassieren komme ich später.« Ich trat zum zweiten Mal an den Tresen heran und bestellte bei dem dort agierenden Drachen einen Kaffee. Die Dame knallte mir die Tasse vor die Nase und verlangte die unverschämten vier Lin.
»Für den Preis könnten sie wenigstens lächeln«, sagte ich.
Ich nahm mir einen Löffel aus der Ablage und mein Getränk. So ausgerüstet trat ich an den Tisch des Mädchens, das ganz offensichtlich eine Bizachrei, eine Mischform aus Mensch und Bizach, war. Sie blickte mir mit blauen Augen gelangweilt entgegen.
»Ich bekomme von Ihnen vier Lin«, sagte ich. »Dafür habe ich Ihnen den hier mitgebracht.« Ich legte den Löffel neben die eisgefüllte Tasse und hielt ihr die offene Rechte hin.
»Was erdreisten Sie sich?«, fragte sie mit unbewegter Miene.
»Sie sprechen meinen Text. Nicht genug damit, dass Sie mich um meinen Kaffee bringen, jetzt klauen Sie mir auch noch meinen Text.« Ich schob die Tasse näher zu ihr. »Glauben Sie, ich verdiene mein Geld im Schlaf?« Ich deutete zum Tresen. »Nicht genug damit, dass man in diesem Zug beraubt wird, wenn man etwas essen oder trinken will. Die Räuber sind auch noch grimmig. Und dann kommen Sie und nehmen mir mein Lebenselixier.«
»Ausgerechnet Sie reden von grimmig«, blaffte sie mich an. »Was habe ich Ihnen getan, dass Sie mich so anfahren?«
»Sie standen im Weg, junge Frau.«
»Na und, können Sie nicht höflich fragen, ob Sie vorbei dürfen?«
»Warum sollte ich?« Ich sah den Gang entlang nach oben und unten. »Wir sind alle nur Fahrgäste in diesem Zug. Es ist mein Recht, mir in Ruhe einen Kaffee zu holen, wie es Ihres ist, sich dieses Zeug da zu holen, was Sie trinken.« Ich beugte mich näher heran. »Was ist das überhaupt? Sieht nicht sehr lecker aus.«
»Ist aber bestimmt gesünder als Ihr Kaffee. So, und jetzt lassen Sie mich in Ruhe.« Sie drehte sich weg und schaute ostentativ aus dem Fenster.
Ich wollte keine zweite Portion Eis. Also nahm ich meinen frischen Kaffee, trank einen ersten Schluck und kehrte zu meinem Platz zurück. Während ich mich setzte, wandte ich mich noch einmal zu der jungen Frau um. Ich kannte dieses Gesicht ganz gewiss, war mir andererseits jedoch sicher, diese Dame nie zuvor getroffen zu haben. Ihre aufsässige Art wäre mir bestimmt in Erinnerung geblieben.
Ich trank ziemlich eilig, erstens, weil ich wirklich meine Dosis Koffein brauchte und zweitens, weil ich sichergehen wollte, dass diese Portion nicht auch Opfer eines üblen Scherzes eines halben Kindes werden würde. Nachdem ich ausgetrunken hatte, stand ich auf und kehrte zu der jungen Dame zurück. Sie starrte inzwischen nicht mehr aus dem Fenster, sondern schaute zum Verkaufstresen hinüber.
»Bitte lassen Sie unsere Verpflegung in Ruhe«, sagte ich.
»Oh, Sie kennen das Wort also doch?«
»Ja, und manchmal verwende ich es sogar. Aber nur, wenn ich es für angebracht halte. Und ich bitte nicht, wenn ich Schulden eintreibe. Sie schulden mir einen Kaffee oder vier Lin.«
Sie schob die Tasse zu mir hinüber. »Der Kaffee ist noch da. Was wollen Sie also?«
»Heißen Kaffee.« Ich setzte mich, ohne zu fragen, ihr schräg gegenüber. »Wissen Sie, eigentlich sind wir uns sehr ähnlich. Wir machen beide in Blei.«
Sie runzelte ganz leicht die Stirn. »Wenn Sie auch bleibegabt sind, warum erwärmen Sie Ihren Kaffee nicht selbst?«
»Weil ich eine andere Beziehung zu Blei habe. Ich verdiene mein Geld mit bleiernen Lettern. Und das kann ich nur, wenn ich eine ausreichende Menge jenes Getränks bekommen habe.« Ich deutete auf die Tasse.
»Sie hatten eine.«
Zum ersten Mal zeigte sich der leichte Anflug eines Lächelns auf ihren Lippen. So kurz, dass ich am Ende glaubte, mich geirrt zu haben.
Ich knurrte. Vier Lin für eine Zurechtweisung, weil ich nach ihrer Meinung zu harsch darauf reagiert hatte, als sie mir in den Weg gelaufen und dann versteinert war, erschienen mir einfach zu viel.
»Machen wir einen Handel«, sagte ich. »Sie erzählen mir, was Sie nach Sidarap treibt. Ich habe immer Interesse an guten Geschichten. Vielleicht ist Ihre vier Lin wert.«
Schweigen antwortete mir. Sie hatte wieder ihre Stimme verloren.
5. Cannie
Von allen Professionen auf diesem Planeten musste ich ausgerechnet einen Journalisten erwischen. Ein wenig überraschte mich sein plötzliches Interesse allerdings. Hatte er vor wenigen Minuten noch gewirkt, als wollte er jeden zu Staub verwandeln, schien er jetzt geradezu erpicht darauf, mit mir ins Gespräch zu kommen. Vielleicht hatte Kaffee wirklich eine besänftigende Wirkung auf ihn.
Allerdings hatte ich keinesfalls vor, auch nur einen Lin von meinem knappen Geld an diesen Mann zu verlieren. Und erst recht wollte ich meine Geschichte nicht mit ihm teilen.
»Wenn Ihnen Ihr Kaffee so wichtig ist, dann heize ich ihn eben wieder auf«, sagte ich nach einer längeren Gesprächspause. Eine Pause, die viel zu laut danach schrie, dass ich offensichtlich nicht gewillt war, ihm mehr über mich zu verraten. Und wie bei jedem halbwegs brauchbaren Sensationsschreiber leuchteten seine grünen Augen nun umso interessierter auf.
»Ich sagte Ihnen doch schon: So funktioniert das nicht. Ich wollte nur einen Kaffee und musste mir einen zweiten kaufen. Diesen hier können Sie jetzt behalten«, erklärte er voller Überzeugung, als handelte es sich dabei um eine festgeschriebene Regel.
»Sie bekommen allerdings kein Geld dafür.« Ich verschränkte die Arme.
Einer seiner Mundwinkel zuckte. Das hatte er offenbar hören wollen. »Dann Ihre Geschichte.«
»Das ist doch …«, brummte ich und sah wieder aus dem Fenster. Dieser Mann gefährdete meinen Plan. Wenn er aus meiner Geschichte eine Schlagzeile machte, würden Feuer und Asche auf mich niederregnen. Natürlich wollte ich früher oder später meiner Familie sagen, wo ich mich aufhielt, und dass es mir gut ging, aber so was sollten sie nicht aus der Tagespresse erfahren müssen. Allerdings …
»Meine Geschichte ist weit mehr wert als vier Lin. Und im Übrigen sehen Sie nicht so aus, als würden Sie am Hungertuch nagen.« Demonstrativ warf ich bei diesen Worten seinen funkelnden Manschettenknöpfen einen Blick zu. Bei denen handelte es sich in der Tat um ausgefallene Schmuckstücke, die diese Bezeichnung verdienten. Wenn ich das richtig erkannte, besaßen sie die Form gekreuzter goldener Rosen. Ob das Motiv wohl eine besondere Bedeutung hatte?
»Ich soll Ihrer Meinung nach also auf einen gerechten Ausgleich verzichten, weil ich so aussehe, als könnte ich es mir leisten?« Die Implikation dieser Frage schien ihm absurd und er schaute entsprechend brüskiert drein.
»Das würde Sie sympathischer machen.«
»Ich bin nicht Journalist geworden, um sympathisch zu sein.«
Ich zog eine Augenbraue hoch. »Offensichtlich.« Bei dem Wort musste ich all meine Willenskraft aufbringen, nicht noch einmal meinen Blick in Richtung seiner Hände zu lenken. Auf den Umstand anzuspielen, dass er keinen Ehering trug, erschien mir ein wenig zu dreist. Ich hatte schließlich keine Ahnung, welche Umstände dazu geführt haben mochten, und um ehrlich zu sein, wollte ich mich auch gar nicht auf dieses Terrain begeben. Also starrte ich ihm weiter stur in die Augen.
Dann plötzlich machte es Klick. Bei Adonai, das konnte doch nicht wahr sein!
Jetzt wusste ich wieder, woher ich dieses Gesicht kannte. Ausgerechnet dieser Mann hatte kürzlich meinen Vater interviewt. Rook lautete sein Name, irgendwas Rook. Der arbeitete bei den Sidarap Tagesthemen. Ich erinnerte mich an ihn, weil mein Vater sich nach dem Gespräch so dermaßen über den Mann aufgeregt hatte, dass er kurzerhand in deren Zentrale angerufen und denen eingeheizt hatte, sie mögen diesen Kerl vor die Tür setzen, und wehe ein Wort von dessen Verriss würde gedruckt werden.
Der Schock musste sich in meiner Miene abzeichnen, denn meine neue Bekanntschaft legte mit einem Mal den Kopf schief und runzelte die Stirn, ganz so, als fragte er sich, ob ich im nächsten Moment einen Anfall bekäme.
Oh, verdammt! Der Mann hatte mich gesehen. Er könnte sich an mich erinnern und dann … ja, dann wäre mein kleiner Ausflug schneller vorbei, als ich Sidarap sagen konnte. Schöner Bockmist, Cannie! Wirklich!
»Ist Ihnen nicht gut?«
Ich nahm meinen Saft und trank hektisch. Reflexartig zog ich meine Mütze dabei ein Stück tiefer und versuchte, mein Gesicht möglichst unauffällig wegzudrehen.
»Ja. Nein«, sagte ich und stellte die Flasche zurück auf den Tisch.
Dann holte ich meinen Geldbeutel heraus und legte dem Mann seine vier Lin hin. Für meine Dummheit war das noch ein gemäßigtes Lehrgeld. Diese Strafe hatte ich wahrlich verdient.
»Da ist Ihr Geld. Ich würde jetzt gern allein sein.«
Der Widerwillen stand dem Fremden ins Gesicht geschrieben, doch ich musste ihm zugutehalten, dass er tatsächlich den Platz räumte und auf seinen zurückkehrte.
Wieder allein stütze ich den Kopf auf den Ellenbogen ab und starrte auf die Holzmaserung des Tisches. Natürlich hatte ich auch noch großkotzig behaupten müssen, dass meine Geschichte weit mehr wert wäre als vier Lin. Leider schien es so, als wäre dieser Rook beharrlich, gewitzt und wie schon festgehalten, nicht unbedingt auf Sympathie aus. Alles Eigenschaften, die einen sehr guten oder – je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachten wollte – schrecklichen Journalisten ausmachten. Zweifellos würde der nicht lockerlassen, wenn ihn einmal etwas beschäftigte und ich verwettete all meine Ersparnisse darauf, dass er in eben diesem Augenblick über mein bizarres Verhalten nachgrübelte.
Wie kam ich glaubhaft aus dieser Sache wieder heraus? Was, wenn die Tagesthemen ihn tatsächlich wegen meines Vaters rauswarfen? Dann brächte ihm die Geschichte, er hätte die verschollene Saradotti-Tochter ausfindig gemacht, im Handumdrehen seinen Job zurück und wahrscheinlich noch einen Romaleon-Verdienstorden obendrauf.
Denk nach, Cannie! Was konnte ich tun?
Wenn ich ihn jetzt einfach mit seinen Eindrücken allein ließ, gab ich die Zügel aus der Hand und überließ mein Schicksal dem Zufall. So wie der Kerl aussah, würde er sich früher oder später an mich erinnern. Spätestens jedoch, sobald weit und breit nach mir gesucht wurde, und wer wusste schon, was er dann aus der Geschichte machte?
Vielleicht nahm er das am Ende als Aufhänger, um meiner Familie noch mehr zu schaden. Diesen Buchstabenhelden war wirklich alles zuzutrauen. Mir blieb also nur eine Lösung, sofern ich keine gigantische Lügengeschichte auftischen wollte: die Flucht nach vorn.
Entschieden packte ich meinen Rucksack und meine Saftflasche und ließ mich wenige Sekunden später unaufgefordert an seinem Tisch auf die Bank ihm gegenüber sinken.
Seine Miene verriet Überraschung. »Oh. Was kommt jetzt?«
Ich biss mir auf die Unterlippe und starrte ihn wieder nur an. Wahrscheinlich glaubte der Mann inzwischen, dass ich irgendeine merkwürdige Behinderung hatte. Aber die Worte auszusprechen, erforderte weitaus mehr Überwindung, als ich in meiner Vorstellung angenommen hatte.
Ich atmete tief ein und setzte mich aufrechter hin. Die Hände legte ich offen auf der Tischplatte ab. Ich wollte, dass er mir glaubte und hoffte zugleich, dass er sich vielleicht doch nach einem Funken Restsympathie von anderen Menschen sehnte.
»Mein Name ist Cannie. Also eigentlich Canleycana Saradotti.« Die letzten beiden Worte sagte ich so leise wie möglich.
Interessiert beugte er sich über den Tisch. »Saradotti?«
Sofort sah ich Erkenntnis über seine Züge wandern. »Ich wusste es!«, rief er.
Was er damit genau meinte, war mir nicht klar. Hatte er schon vermutet, wer ich war?
»Ja, ich bin eine von Senator Saradottis Töchtern. Im Moment habe ich jedoch mindestens genauso große Differenzen mit meinem Vater wie Sie, Mister Rook.«
Zwar wusste ich nicht, in welchen Punkten die beiden tatsächlich voneinander abwichen, aber ich kannte den politischen Kurs meines Vaters. So viele Alternativen existierten nicht und jede davon sollte mir eigentlich entgegenkommen. Wo doch die Einstellung meines Vaters die kompromisslose Ablehnung aller Wesen meiner Art forderte, genauso wie eine konsequente Menschen-zuerst-Politik.
Ich betete, dass diese Gemeinsamkeit ausreichte, damit Mister Rook mich wenigstens anhörte, bevor er mich verpfiff.
»Woher kennen Sie meinen Namen?«
»Mein Vater hat den unüberhörbar durch die Gegend gebrüllt, als er mit Ihrem Vorgesetzten sprach.«
Nun schien mein Gegenüber für einen Augenblick zu verblüfft, um sofort zu antworten.
»Also was denken Sie? Ist meine Gesprächigkeit vielleicht sogar eine Mahlzeit wert?«, fragte ich. Wie zur Bestätigung knurrte mein Magen lautstark. Nun blieb mir nur zu hoffen, dass dieser Mann wirklich so klug war, wie ich ihn einschätzte.
6. Timothy
Das Leben spielt einem an manchen Tagen seltsame Streiche. Wären wir uns in Sidarap begegnet, wäre ich Wetten eingegangen, Adonai hätte seine Finger im Spiel. Aber er kümmerte sich nur höchst selten bis nie um die Ereignisse in der Provinz. Also hatte die Göttin Zufall, die heimliche Geliebte meiner gesamten Berufskollegen, ihre Hand im Spiel.
Ich stellte mir vor, wie sie von irgendeinem imaginären Thron auf uns beide herabgrinste und sich die Hände rieb, während sie im Ton einer ältlichen Tante murmelte: »Nun spielt schön miteinander, Kinder.«
Da saß mir tatsächlich die zweitjüngste Tochter des Herrn Senators gegenüber. Und, oh wie peinlich, sie war eine Bizachrei. Ausgerechnet die Tochter eines Senators, der nicht müde wurde zu betonen, dass die Menschen das Joch der Bizach abschütteln mussten. In der Redaktion hieß er nur der Bizachfresser.
Aus all dem ergaben sich mehrere Fragen. Die Erste lautete: Was trieb eine Tochter dieses Mannes hier? Die Zweite: Wieso reiste sie Dritter Klasse und musste um Essen betteln? Und die Dritte hieß: Was konnte ich daraus machen?
Im Grunde beantworteten sich die ersten beiden Fragen von selbst. Sie musste von daheim abgehauen sein. Hätten ihre Eltern sie, aus welchen Gründen auch immer, nach Sidarap entsandt, wäre sie in Begleitung einer Anstandsdame, reiste Erster Klasse und genösse gerade ein Menü in ihrem Abteil. Außerdem würde sie sich nicht im Minutentakt nach links und rechts umsehen wie ein Kaninchen, das den Fuchs wittert. Mädchen, geht es noch ein bisschen auffälliger? Warum stellst du dich nicht einfach auf die Bank und schreist in den Wagen: Ich habe ein Geheimnis und niemand soll es wissen.
»Sie denken also, ich zahle Ihnen ein Essen, nur um über Ihre ach so beschwerliche Kindheit zu hören?«
»Oder um Ihren Job zu behalten«, erwiderte sie.
Ich winkte ab. »Ach, kommen Sie, damit machen Sie mir keine Angst. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Chefredakteur mich feuert, nur um mich eine Woche später wieder in die Redaktionsstube hereinspazieren zu sehen, während er seine Siebensachen packt. Wer einen Job wie ich hat, macht sich unbeliebt bei den hohen Herren. Was, glauben Sie, habe ich Ihrem Vater vorgeworfen?«
»Dass er sich gegen die Bizach wendet«, antwortete sie postwendend.
Ich lehnte mich zurück und lachte schallend. »Sie haben zumindest nicht gelauscht«, sagte ich anschließend und schüttelte energisch den Kopf. »Die Bizach sind eine Plage. Das Schlimmste ist, sie sind sich dessen nicht bewusst. Sie glauben, von Adonais Gnaden eingesetzt zu sein und über Sidarap und die Provinzen zu herrschen.«
»Das sind sie«, fiel mir Miss Saradotti ins Wort.
»Jetzt wird mir alles klar«, sagte ich.
»Was wird Ihnen klar?« Sie setzte sich aufrechter hin und fixierte mich.
»Warum Sie von zu Hause abgehauen sind. Sie haben die Meinung Ihres Vaters nicht mehr länger ausgehalten. Ich weiß ja nicht, wie er Sie behandelt hat, aber ich vermute, nicht auf die freundlichste Art und Weise. Es muss ihn schwer getroffen haben, als sich Ihre Begabung gezeigt hat. Oder hat er Sie gar aus dem Haus gejagt?«
»So ist mein Vater nicht. Er liebt mich, auch wenn ich anders geworden bin, als er sich das vermutlich gewünscht hat. Nur kann er nicht ertragen, dass die Bizach sich über die Menschen erheben.«
»Oh, da sind wir einer Meinung, Ihr Vater und ich«, sagte ich.
Sie schnaubte ungläubig. »Und warum brüllte er das ganze Haus zusammen, nachdem Sie uns verlassen hatten?«
»Weil ich ihm ins Gesicht gesagt habe, er sei auch nicht besser als die.«
»Sie haben was?« Sie beugte sich halb über den Tisch und starrte mich an, als sei mir soeben eine Rübe aus der Nase gewachsen. Dann schüttelte sie den Kopf. »Sie müssen verrückt sein. Oder dumm.« Ungehalten wedelte sie mit einer Hand vor meinem Gesicht herum, als könnte sie meine Worte auf diese Weise verscheuchen. »Mein Vater setzt sich für Gerechtigkeit ein. Er will den Menschen zu einer Stimme verhelfen. Er will, dass niemand, nur weil er als Bizach geboren ist, automatisch mehr als andere zu bestimmen hat.« Sie redete sich in Feuer. »Hat er Sie nicht sogleich niedergeschlagen, als Sie behaupteten, was Sie mir gesagt haben?«
»Ich denke, er war nahe dran. Er hat es ebenso wenig verstanden wie Sie. Aber bei Ihnen ist es verzeihlich. Sie sind praktisch noch ein Kind. Kinder dürfen naiv sein.«
»Ich bin nicht naiv und ein Kind bin ich erst recht nicht mehr.« Eine steile Falte grub sich in ihre Stirn. Da sie sonst recht stoisch dreinschaute, war dies ein deutliches Alarmsignal. Ich hatte sie in Rage versetzt.
»Darum haben Sie auch nicht ausreichend für diese Reise vorgesorgt, müssen um Essen betteln und Dritter Klasse fahren.« Ich ließ mich weder von wütenden Politikern noch von deren Kindern einschüchtern, wenn es eine Wahrheit auszusprechen galt.
Sie lehnte sich zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und wirkte plötzlich wie eine schlecht gefertigte Steinfigur. Ihr Gesichtsausdruck war wie weggewischt, jegliche Regung schien daraus verschwunden. So gäbe sie eine ausgezeichnete Pattue-Spielerin ab. Niemand würde ihren nächsten Zug vorhersagen können.
»Ich sage Ihnen, worin das Problem besteht«, sagte ich, um sie zu besänftigen.
Sie antwortete nicht, starrte mich nur weiter an. Wollte sie ihre Kräfte an mir ausprobieren? Sank ich womöglich gleich wie ein Sack Lumpen in mich zusammen?
»Tun Sie nichts Unüberlegtes«, beeilte ich mich zu sagen.
»Wovon reden Sie?« Endlich sprach sie wieder.
»Einen Moment fürchtete ich, Sie würden mich wie meinen Kaffee behandeln.«
Für den Bruchteil einer Sekunde wurden ihre Augen groß. Dann schlug sie auf den Tisch, sprang auf und rannte davon. Sie kehrte nicht an den Platz zurück, an dem sie anfangs gesessen hatte, sondern stürmte aus dem Speisewagen in Richtung der Abteilwagen. Sogar ihre Sachen ließ sie stehen. Offenbar hatte ich eine Stelle in ihrem Wesen berührt, die sehr empfindlich war.Ich schulterte ihren Rucksack, nahm das Getränk und folgte ihr. In den engen Gängen der Dritten Klasse konnte sie sich nicht verstecken. Ich musste nicht rennen, um sie früher oder später wiederzusehen.
Ich passierte die Abteile meines Wagens und des nächsten, der ebenfalls zur Geschlossenen Dritten gehörte. Ich fand sie in beiden nicht. Die nächsten Wagen gehörten zur Offenen Dritten Klasse. Sie musste wirklich schlecht geplant haben und darüber hinaus völlig naiv sein, wenn sie in der Offenen Dritten reiste. In Sidarap nannten wir sie die Strauchdiebklasse. Ein junges Mädchen ohne Begleitung musste hier bestenfalls damit rechnen, beraubt zu werden.
In den ersten beiden Abteilen saßen Männer mit schwieligen Händen und Gesichtern, aus deren Falten sich der Staub nicht mehr vollständig auswaschen ließ. Wahrscheinlich waren sie Bergarbeiter. Einen hörte ich röchelnd husten. Dieses Geräusch hatte meine Kindheit begleitet, bis mein Vater starb.
Im dritten Abteil saßen zwei Nonnen auf den unteren Liegen. Sie passten so gar nicht zu den beiden Kerlen, die weiter oben eine Flasche pendeln ließen und einander zotige Witze erzählten. Seltsamerweise störten sich die Nonnen nicht daran. Sie sahen nicht einmal betroffen oder genervt aus. Mit dieser Bande stimmte eindeutig etwas nicht. Ich nahm an, es handelte sich um irgendwelche Gauner, die ihr Geschäftsfeld in die große Stadt verlegen wollten.
Im nächsten Abteil lag Miss Saradotti auf einer der oberen Liegen. Wenigstens das war eine kluge Entscheidung.
»Sie sollten in dieser Umgebung nicht allein reisen«, sagte ich.
Prompt drehte sie sich mit dem Gesicht zur Wand.
»Wollen Sie denn nichts mehr essen?«
»Was wollen Sie von der jungen Frau? Lassen Sie sie in Ruhe!« Die Stimme gehörte einer Dame, die auf dem unteren Bett auf der anderen Seite am Fenster saß. Sie trug ein streng geschnittenes Kleid und sah mich mit dem typischen Lehrerinnenblick einer Gouvernante an. Reiste Miss Saradotti doch nicht allein?
Unsinn, der Senator ließe seine Tochter niemals in dieser Umgebung reisen.
»Timothy Rook, Sidarap Tagesthemen. Die junge Dame und ich führen ein Interview«, erklärte ich.
»Ist mir egal, wie Sie so etwas nennen. Ich nenne es Belästigung.« Sie straffte sich und traf Anstalten, sich zu erheben. Vermutlich wäre die nächste Phase, mich mit einem Regenschirm aus dem Abteil zu treiben.
In dem Moment drehte sich Miss Saradotti wieder um und richtete sich halb auf. »Es ist in Ordnung«, sagte sie. Dann hielt sie mir einen Zeigefinger vor die Nase. »Sagen Sie so etwas nie wieder. Das nächste Mal schreie ich den Zug zusammen und erkläre, Sie wären mir unsittlich zu nahegetreten. Es gibt nichts, was ich für verabscheuungswürdiger hielte, als Menschen etwas anzutun. Egal, wie widerwärtig die sich benehmen. Haben Sie das verstanden?«
Ich konnte mich gerade noch beherrschen, zu salutieren.
»Verstanden. Gehen wir wieder in den Speisewagen«, sagte ich.
Ich trat einen Schritt in den Gang zurück und wartete, bis Miss Saradotti von ihrer Liege heruntergeklettert war, dann setzte ich mich in Bewegung. Sie würde mir schon folgen, wenn sie wirklich Hunger hatte.
Zurück im Speisewagen setzten wir uns an den gleichen Tisch, den sie so fluchtartig verlassen hatte. Ich reichte ihr den Rucksack und stellte ihre Saftflasche vor sie hin. »Ist noch nicht ganz leer«, sagte ich.
»Danke«, brummte sie in einem Ton, in dem andere Verbalinjurien von sich gaben. Offenbar war sie noch nicht völlig versöhnt. Sie nahm einen Schluck, schaute kurz aus dem Fenster und sagte dann: »Also, wie kommen Sie auf die Idee, zu behaupten, mein Vater sei auch nicht besser als die Bizach?«
»Weil er nicht davon träumt, eine gerechte Welt für alle zu erschaffen. Er träumt davon, eine gerechtere Welt für sich, seinesgleichen und jene zu erschaffen, die von der Arbeit der großen Masse leben. Rennen Sie nicht gleich wieder weg, denn jetzt wird es hart für Sie: Sie sind mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Ihnen standen alle Wege offen. Sie konnten die Bildung erlangen, die Ihren Talenten und Ihrem Intellekt entspricht. Das gilt nicht für alle.«
»Weil die Bizach regieren, sagt mein Vater.«
»Unsinn. Weil das Geld regiert. Kennen Sie seinen Wahlspruch, den er nutzte, um Senator zu werden?«
»Natürlich. Für eine menschengemachte Welt. Keinem soll es schlechter gehen.«
»Sehen Sie den Fehler nicht?«
Sie schüttelte den Kopf. »Er will sich dafür einsetzen, dass es allen gut geht.«
»Ach? Und warum sagt er das nicht? Warum lautet sein Slogan nicht: Allen soll es besser gehen?«
»Weil … weil … Verdammt, woher soll ich das wissen? So lautete eben der Slogan seiner Partei!«
»Ja, die Partei derer, denen es bereits gut geht, die fürchten, wenn sich etwas ändert, könnte sich das Blatt zum Schlechteren wenden. Denen muss man natürlich sagen, dass der Status quo erhalten bleibt. Das Perfide ist, dass die einfachen Leute aus so einem Slogan herauslesen, ihnen würde es hinterher besser gehen. Warum? Weil es ihnen praktisch nicht schlechter gehen kann. Wie oft habe ich im Bleibezirk vor der Wahl die Leute sagen hören: Schlechter kann es ohnehin nicht werden, probieren wir es also mal mit Jossum. Verstehen Sie? Weg mit den Bizach heißt für die Klientel Ihres Vaters: ihre Villen für uns, ihre Macht für uns, ihre Einflusssphären für uns. Sie treiben Adonai mit Ianoda aus. Wissen Sie, gerade wird mir klar, vielleicht ist alles noch viel schlimmer, als ich bisher glaubte.«
»Wie meinen Sie das? Sie denken doch bereits schlecht genug über meinen Vater. Ich sollte wieder in mein Abteil gehen.«
»Nein, bleiben Sie. Ihre Gegenwart regt meinen Verstand an. Mir ist gerade klar geworden, dass wir mit den Bizach vielleicht sogar besser bedient sind als mit einer plötzlichen Menschenregierung.«
»Jetzt überraschen Sie mich.« Sie klang sowohl spöttisch als auch ehrlich erstaunt.
»Sehen Sie, die Bizach haben jahrhundertelange Erfahrung beim Regieren. Sie haben die Pfründe aufgeteilt. Nur selten flammt noch Streit zwischen ihnen auf, bei dem dann am Ende meistens Menschen die Opfer sind. Wie es weiterginge, wenn die Menschen die Macht übernähmen, kann keiner vorhersagen. Wir sind eine streitlustige Spezies. Sehen Sie ja an mir.«
»Vermutlich hat Adonai darum die Bizach erschaffen«, sagte sie.
»Oh, bitte, hören Sie mir bloß mit dem auf.«
»Sie wollen mich bloß aufziehen, oder? Sie haben nicht allen Ernstes auch noch was gegen unseren Schöpfer?«
»Wissen Sie, ehe ich das ausdiskutiere, brauche ich noch einen Kaffee. Soll ich Ihnen was zu essen mitbringen?«
7. Cannie
Ich sah ihn kurz verärgert an und dachte wirklich für einen Moment darüber nach, sein Angebot aus Trotz wegen all der Unverschämtheiten auszuschlagen. Mit Sicherheit würde er mir die Tatsache, dass ich auf das Angebot anscheinend angewiesen war, noch mehrfach unter die Nase reiben. Allerdings hatte ich wirklich quälenden Hunger und allein konnte ich den Mann mit all seinem neuerworbenen Wissen über mich auch nicht lassen.
Also seufzte ich in mich hinein, schluckte für einen Moment meinen Stolz hinunter und zog die Speisekarte zu mir heran. Die meisten der Speisen hatte ich noch nie im Leben gegessen. Ich kannte sie nur von den Karten der Schulspeisung. Meine Mutter achtete jedoch sehr auf unsere Ernährung, weshalb unsere Köchin Andranka nur ausgewählte Gerichte zubereiten durfte, die sie täglich zur Pause in die Schule brachte. Einmal hatte ich mich erdreistet, vom Schulessen zu kosten und das Essen von Andranka wieder mit nach Hause zu bringen.
Sie hatte einen Aufstand veranstaltet, als wollte ich sie entlassen, und meine Mutter hatte das selbstverständlich mitbekommen und war nicht minder entsetzt und erbost gewesen - wenn auch aus anderen Gründen. Jedenfalls hatte die Erfahrung ausgereicht, um mich keinen weiteren Versuch unternehmen zu lassen.
Entsprechend ratlos fühlte ich mich beim Betrachten der Speisenauswahl. Ich wusste nicht, was mir davon schmecken würde. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie dieser Mister Rook tatsächlich die Dreistigkeit besaß auf die Uhr zu schauen, während er auf meine Antwort wartete. Ich hatte in dem Moment große Lust, ihm gegen das Schienbein zu treten, aber so weit war ich noch nicht gesunken.
»Den Auflauf bitte«, sagte ich und deutete auf die entsprechende Nummer.
Kurz schien er überrascht, dass ich tatsächlich noch eine Stimme besaß. Er hatte die Uhr wieder in einer Westentasche verschwinden lassen und stand nun aufrecht neben dem Tisch, eine Hand auf dem Rücken. Wieder wirkte er, zumindest rein äußerlich, als gehörte er in eine andere Wagenklasse.
Seine Haltung löste sich jedoch, als ich meine Wahl verkündete, und er beugte sich zu mir herunter, um selbst auf der Karte nachzulesen, was ich essen wollte. Er verzog keine Miene, nickte nur und stolzierte abschließend zum Tresen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich schüttelte leicht den Kopf und wandte mich wieder dem Fenster zu, um mich nicht weiter über den Journalisten ärgern zu müssen. Wenn ich darüber nachdachte, dass ich vom Tisch fortgerannt war, und mich wie ein bockiges Kind auf meine Liege verzogen hatte, konnte ich mich über seinen Spott wahrlich nicht beschweren.
Meine Wangen begannen zu glühen. Rückwirkend betrachtet war mir mein Verhalten sehr unangenehm. Ich legte meine kühlen Fingerspitzen auf die Haut, damit die Rötung möglichst schnell wieder verschwand. Ein kleines bisschen mehr sollte ich mich im Griff haben, wenn nicht bald der ganze Zug wissen sollte, wer ich war. Allerdings könnte das ein schwierigeres Unterfangen werden als zunächst angenommen. Insbesondere in Anbetracht meiner Reisebekanntschaft, mit der ich mich wohl selbst verflucht hatte.
Vor dem Fenster zogen noch immer die vertrauten Gemüsefelder der Provinz vorbei, bald würden ausgedehnte Waldflächen folgen, bevor wir in wenigen Tagen das Grenzgebirge erreichen sollten.
Der Gedanke brachte mich zu einem anderen Problem, das ich seit Reiseantritt erfolgreich verdrängt hatte: die Grenzkontrolle. Irgendwie musste ich mich um die Registrierung meines Ausweises bei der Einreise in die Provinz Sidarap herummogeln. Ich wusste nur noch nicht wie. Auch jetzt drängte ich den Gedanken an den Rand meines Bewusstseins zurück. Mir würde bis dahin sicherlich etwas einfallen. Ein Problem nach dem anderen und das im Moment größere, kehrte gerade wieder zu mir an den Tisch zurück.
In einer Hand hielt meine Reisebekanntschaft erneut eine dampfende Kaffeetasse und in der anderen einen Teller und ein in eine Serviette eingewickeltes Besteck. Beides setzte er mir vor die Nase, bevor er sich wieder auf seinen Platz sinken ließ.
»Danke. Jetzt trinken Sie ja doch einen zweiten Kaffee«, sagte ich und wickelte Messer und Gabel aus.
»Ich habe meine Meinung geändert.«
»Das finde ich gut«, erwiderte ich und nahm einen ersten Bissen von dem Auflauf. Das Essen war weitaus fettiger als das von Andranka und es fehlte an den meisten Gewürzen, aber es war essbar. Bei meinem Hunger wäre vermutlich alles erträglich.
»Wieso?«, fragte er, sein Gesicht zeigte Verwunderung.
»Besser die Meinung ändern, als auf einem Standpunkt beharren, der mehr schadet, als nützt.«
Auf die Aussage antwortete er nicht mehr und ich nutzte die Gelegenheit, meinen Hunger ausgiebig zu stillen. Auch hierbei vergaß ich für einen Moment meine Erziehung und aß wahrscheinlich eher wie ein Arbeiterkind, wobei das im Sinne meiner Tarnung wahrscheinlich besser war.
Schließlich schob ich den leeren Teller zur Seite, lehnte ich mich zurück und legte selig eine Hand auf meinen Magen.
Mein Gegenüber verschwendete natürlich keine wertvolle Zeit, bevor er sich wieder zu Wort meldete. »So, Sie hatten Ihr Essen und ich meinen Kaffee. Jetzt bin ich bereit für die Diskussion über den sogenannten Allmächtigen.«
»Schön«, sagte ich und setzte mich ein wenig aufrechter hin.
»Beantworten Sie mir eine Frage: Glauben Sie wirklich dieses Ammenmärchen?«
»Ammenmärchen? Wollen Sie damit sagen, Sie bezweifeln die Existenz Gottes?«
»Adonai existiert zweifellos. Ob es sich bei dieser Kreatur um einen Gott handelt, der alles Leben erschaffen hat, darüber würde ich mit Ihnen streiten. Ich meine …« Er beugte sich weit über den Tisch, als könnte er nicht glauben, dass er die Frage ernsthaft jemandem stellte. »Ist das Ihre ehrliche Überzeugung?«
»Adonai ist unsterblich«, antwortete ich ausweichend.
Mein Gegenüber machte eine wegwischende Handbewegung. »Das wird immer behauptet. Aber andere Bizach scheinen auch unendlich zu leben. Was ist mit den Kyal aus seiner Garde? Angeblich sollen die auch schon Tausende von Jahren alt sein.«
»Aber das sind Kyal. Adonai ist Adonai.«
In seiner unsympathischen Art konnte es sich Mister Rook bei dieser Aussage nicht nehmen lassen, einmal quer mit den Händen übers Gesicht zu wischen.
»Gut, versuchen wir das anders«, sagte er daraufhin.
Dass er mich wie ein dummes Kind behandelte, ärgerte mich. Ich wusste, dass ich nicht blöd war. Gleichzeitig heizte sein Verhalten meinen Ehrgeiz an, ihm genau das zu beweisen.
»Was ist über Adonai wirklich und damit meine ich zweifelsfrei nachweisbar bekannt?«, fragte er.
Ich dachte an meine Schulbücher zurück und an die Dinge, die meine Eltern und meine Schwestern so erzählt hatten. »Er war das erste lebende Wesen auf Theah.«
Mein Gegenüber lachte schallend auf. »Gerade das wird wohl keiner von uns zweifelsfrei beweisen können oder sind Sie dabei gewesen? Vielleicht habe ich mich auch in Ihrem Alter verschätzt, einige Bizachrei können schließlich ihr Äußeres und ihre Lebensspanne manipulieren, oder nicht?«
Und da war er wieder. Der Drang, diesem ungehobelten Mann auf die Füße zu treten, für die Art wie er andere behandelte. Ich verschränkte die Arme und presste die Lippen aufeinander. Warum tat ich mir das noch mal an?
»Ich bin achtzehn«, verkündete ich. »Also nein, ich war nicht dabei, als Adonai die Menschen und die Bizach erschuf.«
»Gut. Aber warum glauben Sie dann diesen Blödsinn?«
»Warum glauben Sie nicht daran? Hat er Ihnen irgendwas getan? Adonai sorgt für Ordnung, Stabilität und Frieden. Ist Ihnen eigentlich klar, dass sich viele Bizach von ihm im Stich gelassen fühlen, weil er die Menschen seit Jahrhunderten bevorzugt?«
»Sie missverstehen den Punkt. Es geht nicht darum, dass er all das tut, wobei ich Teile davon auch anzweifeln möchte. Die Frage lautet: Mit welcher Berechtigung tut er das?«
Ich schob den Teller beiseite und trank den Rest meines Saftes. »Sie meinen, weil er nie von jemandem bestätigt wurde, wie bei einer Wahl?«
Zum ersten Mal fuchtelte er in meine Richtung, als wäre er erfreut über eine meiner Antworten. »Genau!«
»Wieso sollte sich ein Gott wählen lassen?«
»Wieso nicht?«