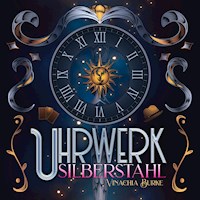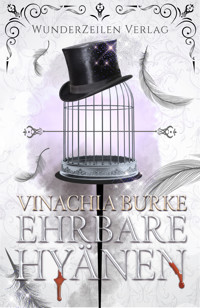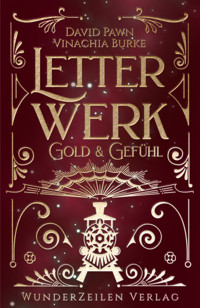
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: WunderZeilen Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Kann die Freundschaft zweier so unterschiedlicher Menschen bestehen?Die Grenzkontrolle liegt hinter Timothy und Cannie. Für einen Moment glauben beide, aufatmen zu können. Aber die echten Probleme beginnen erst. Denn galt Cannie zunächst nur als verschwundene Tochter, heißt es plötzlich, sie sei ein Entführungsopfer und Timothy ihr Entführer. Gottes Leibgarde, Gedankenleser, Gestaltwandler - alle sind bestrebt, Cannie zurück in die Fesseln ihrer Familie zu schicken und Timothy vor Gericht zu stellen.Nichts ist gewiss auf dieser Fahrt: Weder, ob die beiden Sidarap erreichen, noch ob ihre Freundschaft die Belastungsprobe übersteht.Band 2 der Letterwerk-Dilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Pawn Vinachia Burke
Impressum
Copyright © 2024 by
WunderZeilen Verlag GbR (Vinachia Burke & Sebastian Hauer) Kanadaweg 10 22145 Hamburghttps://[email protected]
LETTERWERK – Gold & GefühlText © Vinachia Burke, David Pawn, 2024 Story Edit: Vinachia Burke (www.vinachiaburke.com) Lektorat 1: David Pawn (www.davidpawn.de) Lektorat 2: Cao Krawallo (www.caokrawallo.de) Korrektorat: Monika Schulze (www.suechtignachbuechern.de) Cover: Vinachia Burke Satz & Layout: Vianchia Burkewww.vinachiaburke.com ISBN: 978-3-98867-032-8 Alle Rechte vorbehalten.
Die Welt Theah …
… wird nicht nur von Menschen bewohnt, sondern auch von Dämonen, Bizach, wie sie sich selbst nennen. Manchmal zeigen Menschen Fähigkeiten, die eigentlich nur den Dämonen eigen sein sollten. Mit dem 21. Lebensjahr wird daher jeder Bürger auf seine Elementverteilung geprüft. Stellt sich dabei heraus, dass jemand übernatürliche Fähigkeiten besitzt, so verliert er seinen Status als Mensch und muss fortan unter den Dämonen leben. Folgende Dämonenfähigkeiten bei ungewöhnlicher Elementverteilung sind mittlerweile bekannt:
Sidarap ist die Welthauptstadt von Thea. Sie wird regiert von Adonai, einem unsterblichen Wesen, das gottgleiche Verehrung genießt. In ganz Theah ist Sidarap der einzige Ort, an dem Menschen und Dämonen zusammenleben. Außerhalb der Hauptstadt trifft man selten einen Bizach an. Vermutlich, weil sie nirgendwo gern gesehen sind und außerhalb von Sidarap keinerlei Schutz genießen …
Tag 5
REISEPLAN SIDARAP (Grenzstation)
1. Cannie
Einer dieser Grenzer sah mich sehr merkwürdig an. Das bildete ich mir nicht ein. Den gleichen Blick hatte ich auch schon bei Madam Scradelli gesehen. Dieser Kerl ahnte etwas. Ich konnte nur hoffen, dass ihm erst ein Licht aufging, nachdem er mit seinem Kameraden den Zug verlassen hatte. Plötzlich zeigte er über die Schulter in meine Richtung. Oh nein. Sein Kamerad schüttelte zum Glück vehement den Kopf, einige Sätze wurden gewechselt und sie gingen ein paar Meter weiter. Doch dann griff der Erste in seine Uniform und zog mein Foto hervor. Ich war geliefert. Was sollte ich tun? Wie kam ich aus der Geschichte raus?
Hektisch sah ich mich um und wandte mich dem einzigen Fluchtweg zu, der mich nicht in die Arme des nächsten Beamten der Grenzwacht warf: die Hintertür. Mit einem ohrenbetäubenden Knall, der vermutlich jeden im Zug aufschreckte, sprengte ich sie aus dem Schloss. Ich erschrak über die Wucht, die ich in meiner Panik heraufbeschworen hatte. Doch mir blieb keine Zeit, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Die Grenzer stürmten hinter mir durch den Gang. Ich musste weg. Einfach nur weg von hier, bevor sie mich zu fassen bekamen. Ich betrat die schmale Plattform außerhalb des Wagens und sprang zwischen die Gleise. Unsanft landete ich und stolperte über die Kante einer der Holzschwellen. Dabei verlor ich die Dienstmütze, doch ich verschwendete keine wertvollen Sekunden darauf, sie wieder einzusammeln. Eilig rappelte ich mich auf und hastete um den Wagen herum. Die hereinbrechende Nacht bot mir glücklicherweise Deckung. Zwar lief ich auf der Zugseite entgegengesetzt der Grenzstation entlang, aber ich hegte keinen Zweifel daran, dass auch hier Patrouillen der Grenzwacht unterwegs waren.
Wo sollte ich hin? Wie kam ich zurück in den Zug?
Kurz vor Ende des Wagens blieb ich stehen. Dort ragte eine einzelne Stufe hervor, die normalerweise zur Überbrückung des Höhenunterschieds zwischen Zug und Bahnsteigkante gedacht war. Entlang der Außenwand des Zuges befand sich eine Metallstange, die Passagieren bei Bedarf eine Haltmöglichkeit beim Ein- oder Aussteigen bot.
Ich starrte diese schmale Stufe und die Stange an. Das wäre Wahnsinn. Selbstmord. Es sei denn … Ich musste keine Stunden dort aushalten, nur lange genug, bis wir die Grenzstation hinter uns gelassen hatten. Schaffte ich das? Hielt ich das durch? Oder unterschrieb ich damit mein Todesurteil?
Der Pfiff zur Abfahrt ertönte und nahm mir jede Wahl. Keinesfalls konnte ich hierbleiben. Beherzt kletterte ich auf die Stufe und klammerte mich an die Stange, als der Zug ächzend anfuhr.
Ich hielt mich geduckt, um nicht von innen durch die Fenster erspäht werden zu können. Der kühle Fahrtwind, der mir zunächst wie eine steife Brise entgegenschlug, verwandelte sich mit zunehmender Geschwindigkeit in einen Sturm, dessen Ausmaß ich unterschätzt hatte. Meine Finger wurden nach kürzester Zeit taub, meine Augen tränten, meine Glieder versteiften. Die Schaffneruniform bestand nur aus dünnem Stoff und bot kaum Schutz gegen die Brutalität des Fahrtwindes.
Hatte ich jemals in meinem Leben so sehr gefroren?
Vielleicht damals, als ich beinahe im Halikin See ertrunken war. Auch jetzt fiel mir das Atmen schwer und eine übermächtige Kraft zerrte an mir, schlug auf mich ein.
Nur noch eine Minute. Wir mussten nur weit genug weg sein. In Wahrheit wusste ich jedoch nicht einmal, ob ich auch nur noch zehn Sekunden länger durchhielt. Umklammerte meine Hand noch immer die Stange? Oder lösten sich meine tauben Finger schon von dem unnachgiebigen Metall?
Bei Adonai, ich brauchte Hilfe …
Aber hier gab es keine Hilfe. Niemand wusste, wo ich war. Wahrscheinlich dachte selbst Timothy, ich wäre aus dem Zug gesprungen und in den Wald geflüchtet.
Mein ganzer Körper schmerzte mittlerweile so sehr, dass ich mir sicher war, ich würde nur noch Momente durchhalten. Ich musste handeln, wenn ich eine Chance haben wollte, die Sonne noch einmal aufgehen zu sehen. Ich wusste nicht, wie weit wir von der Grenzstation entfernt waren, aber ich musste das Risiko jetzt eingehen. Ich schloss die Augen, konzentrierte mich und griff nach den Kräften, die drohten, mich zu zerreißen. Wie damals, als die Wassermassen mich tiefer und tiefer in ihr düsteres Reich gezogen hatten, stoppte ich meine Gegenwehr. Stattdessen lief ich nun auf die Energie zu, gegen die ich mich zuvor gesperrt hatte. Ich vergaß meine Angst und ergab mich dem Fluss. Ich tastete nach ihr, ließ sie durch meinen Körper strömen, verleibte sie mir ein und wandelte sie in etwas Neues.
Endlich. Mehr. Ich brauchte mehr und ich wollte mehr.
Der Zug quietschte ohrenbetäubend auf, doch seine Energie wärmte mich, schützte mich gegen die Windmassen. Ich betete, dass mein Plan funktionierte. Alle überschüssige Energie wandelte ich in Wärme, die ich in die Umwelt leitete.
Mehr. Wurden wir wirklich langsamer oder bildete ich mir das nur ein? Mehr, verdammt!
Ich entriss dem Zug jede Form von Energie, Bewegungsenergie, Wärmeenergie, Druck aus der Dampfmaschine der Lokomotive …
Nie zuvor hatte ich so viel Kraft zur Verfügung gehabt. Beinahe bedauerte ich, dass ich die Energie zu nichts Sinnvollem verwenden konnte.
Stattdessen nahmen die Winde im Umkreis des Zuges zu, peitschten unnachgiebig, bildeten mittelgroße Windhosen und tanzten zwischen Feldern und Bäumen umher. Wer jetzt aus dem Gefährt sah, musste denken, das Wetter wäre verrückt geworden.
Ich wusste nicht, wie lang das Spektakel anhielt oder welchen Preis es mich am Ende kostete, doch ich verschlang jeden Tropfen Kraft dieses Zuges.
Mit einem Mal versiegte der Strom wärmender und revitalisierender Energie jedoch und erst in dem Augenblick registrierte ich, dass die Wagen stillstanden. Das Ende des Energiestroms ließ mich unsanft in die Realität zurückkehren. Ich fühlte mich kraftlos und genauso Elend wie vor dem Einsatz meiner Fähigkeit. Meine Finger versagten mir den Dienst und rutschten von der Stange. Ich ließ mich einfach auf den Rand des Gleisbettes fallen, den Aufschlag auf dem Schotter spürte ich kaum noch, so sehr schmerzte bereits jeder Quadratzentimeter meines Körpers.
Den Bruchteil einer Sekunde fühlte ich mich wohl, bevor die Schmerzen mich einholten. Ich musste weiter! Eine drängende Stimme aus meinem Hinterkopf warnte mich davor, auf den Steinen einzuschlafen. Ich musste zurück in den Zug, bevor dieser weiterfuhr und mich zurückließ.
Ich stemmte mich mühsam auf alle viere und brachte mich in die Senkrechte. Schwankend und mit einer Hand an der Außenwand des Waggons abgestützt, stolperte ich an das Ende des Zuges zurück. Nur die Stimme in meinem Hinterkopf, die mich eindringlich dazu antrieb, hielt mich bei Bewusstsein. Mühsam zog ich mich auf die kleine Plattform. Die aufgesprengte Tür stand noch immer offen. Ich kroch über die Schwelle in das Innere des Wagens und blieb dort einfach liegen. Erleichterung durchströmte mich. Ich hatte es geschafft. Ich lebte noch. Ich war zurück im Zug. Und mit einem erleichterten Atemzug schwanden mir die Sinne.
2. Timothy
Ich saß noch immer an die Wand gelehnt da, ein paar letzte Tränen liefen mir über die Wange, da tauchte der Schaffner wieder auf, in einer Hand einen Hammer, in der anderen einen Schraubenzieher. Eilig wischte ich mir mit dem Ärmel über die Augen.
»Was ist denn mit Ihnen los?«
»Ruß ins Auge bekommen«, sagte ich knapp. Langsam richtete ich mich wieder auf, während der Schaffner sich der Tür näherte.
Ich trat hinter ihn und starrte in die Dunkelheit. Irgendwo dort musste Cannie jetzt sein, irrte vielleicht durch den Wald des Grenzgebirges, schutzlos, ohne ein Dach über dem Kopf, verfolgt von der Wacht wie ein Verbrecher. Oder sie klammerte sich verzweifelt irgendwo am Zug fest, kalte Luft peitschte ihr ins Gesicht. Wie lang konnte sie das bei dieser rasenden Fahrt durchhalten?
»Könnten Sie mich mal halten?« Der Schaffner deutete auf seinen Gürtel. »Ich möchte ungern auf die Schienen fallen.«
Ich nickte und packte ihn mit beiden Händen. Er beugte sich vor und hämmerte auf die letzte Halterung der Tür ein. Hin und wieder bog er mit dem Schraubenzieher an dem Metall der Führung herum.
»Scheiße!«, fluchte er nach einigen vergeblichen Versuchen, was bestimmt nicht der Dienstvorschrift entsprach. Er trat einen Schritt zurück. »So wird das nichts. Sie können mich jetzt wieder loslassen.«
Ich gehorchte. Mein Blick hing gebannt an dem Schienenstrang, der sich scheinbar in der Unendlichkeit verlor. Hin und wieder passierten wir ein einsames Licht. Es blieb zurück, verblasste im Nebel, der aus den Bergtälern kroch.
»Das muss dann beim nächsten Lokwechsel erledigt werden.« Er deutete zur Tür. »Die Chefetage wird sich freuen.« Frustriert winkte er ab. »Am Ende sind sowieso wieder wir schuld, egal was die Fahrgäste treiben.« Ein skeptischer Blick traf mich. »Sie sollten auch in ihr Abteil zurückgehen. Sie gefallen mir gar nicht, sehen krank aus. Schleppen Sie uns hier bloß keine Seuche ein. Sie sind Reporter, oder? Haben Sie sich zuletzt im Dschungel herumgetrieben?«
»Nur im Dschungel politischer Intrigen«, sagte ich. »Ich bin einfach müde. Keine Angst.«
»Na, okay. Ich werde mal meinen Bericht schreiben. Passen Sie auf, fallen Sie nicht aus dem Zug.«
Ich nickte und der Schaffner verschwand. Vorsichtig trat ich an das Loch, hielt mich an der Seitenwand fest und lehnte mich nach draußen. »Cannie! Sind Sie da oben?«, rief ich zum Wagendach hinauf.
Keine Antwort. Ich zog mich zurück, sammelte meine Kräfte, lehnte mich etwas weiter vor und rief noch einmal, aber der Fahrtwind riss meine Worte davon.
Ich hievte mich wieder zurück, lehnte mich an die Wand und schloss die Augen. Lousa erschien im Spiegel meiner Erinnerung, aber sie trug Cannies rotes Haar und auch ihre Augen. Langsam wandelte sich das Bild, wurde mehr und mehr zu der jungen Frau, deren Gesichtszüge ich erst so kurze Zeit kannte.
Ein Ruck ging durch den Zug und ich schreckte auf. Wir wurden langsamer. Begann bereits der Aufstieg zur Passhöhe? Auf der Hinfahrt war mir der Abstand zur Grenzstation wesentlich weiter erschienen. Das Bremsen verlief nicht gemächlich, sondern vielmehr erweckte der Zug den Eindruck, als wehre er sich gegen eine Kraft, die ihn an der Weiterfahrt hindern wollte. Wie ein bockiges Pferd ruckte der Waggon vor, die Räder jaulten und draußen kam Sturm auf. Die beschädigte Tür knallte gegen die Wand. Auch das Ganglicht flackerte wieder.
»Cannie?« Ich sah zur Decke und lauschte, ob ich vielleicht Trappeln über mir vernehmen konnte.
Der Schaffner schaute aus seinem Abteil. »Was ist denn nun schon wieder?«, rief er niemandem im Speziellen zu, wandte den Kopf nach links und rechts und verschwand wieder. Die Abteiltür fiel mit einem Krachen ins Schloss.
Wir wurden langsamer, während draußen scheinbar der Weltuntergang vorbereitet wurde. Ich sah eine Windhose über einen Acker neben den Schienen jagen, die eine Vogelscheuche mit sich riss, und mühelos damit spielte. Dreckklumpen, Äste und Abfall klatschten gegen die Scheiben, einige wirbelten auch zur hinteren Tür herein. Wie zum Hohn trieb ein einzelnes Zeitungsblatt der Tagesthemen an mir vorbei in Richtung der Gepäckabteile.
Schließlich stand der Zug und auch vor den Fenstern kehrte Ruhe ein. Plötzlich schien die gesamte Welt zu schweigen. So musste sich jemand im Auge eines Wirbelsturms fühlen. Ein Moment völliger Ruhe, ehe die Katastrophe erneut über ihn hereinbrach. Was war da nur los?
Ächzen. Eine Gestalt in Schaffneruniform erklomm den Waggon durch die Hintertür und sank kraftlos auf dem Boden zusammen. Cannie!
Ich eilte zu ihr und fühlte ihre Stirn. Eiskalt. Aber sie atmete und ihr Puls schlug, wie ich als Nächstes feststellte.
»Hey, was tun Sie da mit meinem Kollegen?«
Ich wandte den Kopf, der Schaffner war wieder aus dem Dienstabteil getreten und hatte mich über die junge Frau gebeugt entdeckt. Zum Glück verdeckte ich aus seiner Perspektive ihr Gesicht und ihre Haare. Aber das würde nicht helfen, wenn er näherkam, und er kam mit ausladenden Schritten näher. Schon stand er am letzten Gepäckabteil.
»Aber das ist ja eine Frau!«, rief er erstaunt.
Ich tätschelte Cannies Wange und rüttelte an ihrem Arm. »Wach auf!«, zischte ich. Ihre Lider flatterten. Nur mühsam fand sie in die Wirklichkeit zurück. Wenn sie für diesen Zwischenstopp verantwortlich war, gehörte sie zu den stärksten Bleibegabten, von denen ich je gehört hatte, dennoch musste diese Aufgabe all ihre Kräfte aufgesaugt haben.
»Das ist doch ihre Freundin, die ein Kissen von mir wollte. Was macht sie hier in einer Transtheah Dienstuniform?«
Ich musste mir dringend eine Erklärung einfallen lassen. Denk nach, Timothy, denk nach. Du bist doch sonst nicht so träge dabei. Oder wie mein Chefredakteur einmal sagte: »Bringen Sie mir eine Sensation, Rook, und wenn Sie keine finden, saugen Sie sich eine aus den Fingern. Das fällt Ihnen doch nicht schwer.«
»Sie kam angerannt, kurz bevor der Zug stoppte«, sagte ich. »Und ist hier zusammengebrochen.« Ich zeigte nach unten zu Cannie, die gerade die Augen endgültig öffnete und verängstigt von mir zum Schaffner und zurückblickte.
»Wo haben Sie diese Uniform her?«, schrie der Schaffner Cannie an.
Ich trat einen Schritt vor, damit er nicht noch näherkam und hielt beschwichtigend eine Hand ausgestreckt. »Schreien Sie nicht so, Sie machen ihr Angst.« Ich sah mich nach Cannie um, als wolle ich sichergehen, dass sie nicht lauschte. »Sie müssen doch sehen, dass das keine echte Uniform ist. Die Mütze fehlt und dieser Stoff … viel zu dünn. Kostümverleih, vermute ich.« Am Arm zog ich den Schaffner zwei Schritte von Cannie weg, die sich gerade aufsetzte. »Das arme Kind ist in sehr schwierigen Verhältnissen in Sidarap aufgewachsen. Vater trinkt, Mutter geht auf den Strich. Sie ist ein bisschen …« Ich machte eine kurbelnde Bewegung neben der Schläfe. »Sie war ein paar Tage bei Verwandten in Romaleon. Daher kenne ich das Mädchen.« Ich sah mich wieder nach Cannie um, als fürchtete ich eine Verrücktheit meiner Schutzbefohlenen. »Sie wäre gern etwas Besseres und spielt gelegentlich, sie wäre eine Tochter aus gehobenen Kreisen.«
»Ach!« Der Schaffner schielte an mir vorbei zu Cannie. »Sieht auch ein bisschen aus wie diese verschwundene Senatorengöre«, sagte er.
Mein Blutdruck schnellte in die Höhe. »Eine gewisse Ähnlichkeit – mag sein. Aber diese Miss Saradotti ist eindeutig hübscher«, antwortete ich mit aller Gelassenheit, die ich aufbringen konnte und stieß ihm jovial in die Seite, um seine männlichen Instinkte anzufeuern. Cannie sah im Augenblick mit zerzausten Haaren, dunklen Ringen um die Augen und Schatten im Gesicht tatsächlich eher wie ihre eigene kränkliche Schwester aus.
»Ja, da haben Sie recht«, sagte er.
»Und wie ich recht habe«, erwiderte ich. »Ich habe schließlich ihren Vater interviewt. Sehr vornehmer und netter Mann.« Verstohlen kreuzte ich die Finger hinter dem Rücken. »Und natürlich wurde ich der Familie vorgestellt.« Hinterher vermutlich, in Form von Flüchen und Kraftausdrücken.
Ich nahm ihn am Arm und führte ihn noch ein Stück weiter von Cannie weg, die sich endlich aufrichtete und ihr Jackett glattstrich. »Gehen Sie nur wieder an Ihren Bericht. Ich kümmere mich um die junge Frau. Sie wollen doch sicher nicht noch mehr Papierkrieg nur wegen einer armen Irren.« Ich deutete wieder die Kurbelbewegung an.
Er wandte sich noch einmal zu Cannie um. »Macht sie auch gewiss keinen Ärger? So was können wir im Transtheah nicht gebrauchen.«
»Ich versichere Ihnen, sie ist im Grunde ganz harmlos. Nur eine traurige Geschichte.«
In diesem Moment ruckte der Zug wieder an.
»Also gut, aber behalten Sie die Miss im Auge. Und sorgen Sie dafür, dass sie die Uniform auszieht. Sie kann die Dienstkleidung eines Transtheah-Beamten nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Verstehen Sie?«
»Voll und ganz.« Ich nickte eifrig. »Ich werde sofort ihre Straßenkleidung holen, aber erst muss ich sie ein wenig beruhigen.«
Der Schaffner trollte sich in Richtung seines Kabuffs und ich eilte zu Cannie zurück.
»Was haben Sie ihm erzählt?«, empfing sie mich.
»Dass Sie verrückt sind.«
»Dass ich … was? Sie sind doch …«
»Was sollte ich sonst sagen? Die Wahrheit vielleicht?«, fiel ich ihr ins Wort. »Mir schien Verrücktheit …« Ich deutete zur zerstörten Tür. »… außerdem eine sehr naheliegende Erklärung für Ihr Verhalten. Was, bei Adonai, haben Sie getan?«
»Ich musste verschwinden. Diese Grenzer hatten mich erkannt. Ist Ihnen das entgangen? Sie standen doch hinter denen.«
»Nein, das ist mir nicht entgangen. Aber mussten Sie deshalb … ich weiß nicht wo … herumturnen?«
Ich trat auf sie zu und wollte sie in die Arme schließen. Die Angst, die Sorge, ich könnte sie auf die eine oder andere Art verloren haben, wollte aus mir heraus. Aber sie schob mich energisch von sich. Ich schaute sie betroffen an. »Was habe ich nun wieder verbrochen?«
»Was hätte ich denn Ihrer Meinung nach machen sollen? Mich in Luft auflösen?«
Ich deutete auf das Gepäckabteil. »Da drin verschwinden. Wie Sie es schon mal getan haben. Als so eine Art Sack verkleidet.«
»Dafür war keine Zeit. Sollte ich erst ewig am Schloss …«
Ich unterbrach ihre Worte, indem ich krachend die Tür des Gepäckabteils öffnete, das ihren Rucksack barg. »Sie haben ganz offensichtlich Ihren Rucksack dort deponiert, wie ich es Ihnen gesagt hatte.«
»Ich war in Panik. Ich hatte das vergessen. Außerdem stand ich weiter vorn. Die Grenzer hätten mich zurücklaufen sehen.«
Ich griff mir an den Kopf in Frustration darüber, dass sie sich so gefährdet hatte. Aber weitere Diskussionen brachten uns nicht voran. Ich schnappte mir den Rucksack und schob das Gepäckabteil wieder zu. »Am besten wir lassen die Tür gleich offen. Wer weiß, wie oft wir da noch hineinmüssen.«
»Ist das ein Scherz?«
»Ich fürchte, nein.« Ich nahm sie wieder einmal am Arm. Vielleicht sollte ich mir irgendwo Handschellen besorgen und sie gleich an mich ketten. »Kommen Sie, Sie müssen endlich aus dieser Uniform raus.«
»Hat mir eigentlich ganz gut gefallen«, sagte sie.
Ich schüttelte lediglich den Kopf und schleppte sie bis vor den Waschraum. Dort drückte ich ihr den Rucksack in die Hand. »Ziehen Sie sich bitte um.«
Sie stapfte an mir vorbei, das Haupt so hoch erhoben, dass es ihr bei Regen in die Nase getropft hätte, ganz die beleidigte Senatorentochter, die sie hin und wieder immer noch war.
3. Cannie
Trampel! Unsensibler besserwisserischer Klotz! Arroganter … Ich seufzte kraftlos. Was solls? Ich warf meinen Rucksack in eine Ecke, sank zu Boden, zog die Knie heran und schlang meine Arme um sie. Der Schrecken der letzten halben Stunde hing mir tief in den Gliedern. Mir war eiskalt. Warum war mir so kalt? Ich rieb mir die Arme in dem Versuch, mich aufzuwärmen, aber konnte dadurch mein Zittern nicht lindern. Selbst Sitzen schickte tausend Reize der Anstrengung durch meinen Körper. Jede Nervenfaser fühlte sich wund an.
Und dann musste Timothy auch noch einen besonders heftigen Anfall von Timothy haben. Damit konnte ich gerade nicht umgehen. Ich lehnte den Kopf auf die Knie und schloss die Augen. Verdammt, ich könnte meinen einzigen Freund jetzt durchaus gebrauchen. War er wirklich mein Freund? Wäre er auch noch mein Freund, sobald wir in Sidarap ankamen? Oder ließ meine Naivität mich an etwas glauben, was gar nicht existierte?
Wie schön es doch wäre, jetzt zu heulen und völlig in meinem Elend aufzugehen, doch leider fühlte ich mich dermaßen ermattet, dass mir nicht einmal die bittersüße Befriedigung von Tränen blieb.
Ich hob den Kopf, atmete tief ein und stemmte mich ächzend auf die Füße. Wenn der Einsatz meiner Fähigkeiten mich wirklich altern ließ, dann wollte ich nicht wissen, wie viel meiner Lebensenergie ich durch diese kleine Vorführung verbraten hatte. Im Moment fühlte ich mich zweifelsohne, wie eine uralte Version meines Selbst. Daher konnte mich auch der Anblick meines Spiegelbildes nicht schockieren. Eher erleichterte mich sogar, dass mir unter dem zerzausten Haar, den Schrammen an der Schläfe und dem müden Blick doch noch ein halbwegs jugendliches Gesicht entgegenblickte. Ich warf mir zwei Handvoll Wasser ins Gesicht und machte mich anschließend daran, meine zerzausten Haare zu entwirren.
Wieder menschlicher aussehend überkam mich die Lust, ein Stück Schokolade zu essen. Vielleicht brachte mir das einen winzigen Teil meiner Kraft zurück. Ich öffnete die vordere Tasche des Rucksacks und wollte die Dose herausziehen, als mein Blick auf die weiße Rose fiel, die Timothy für mich gebastelt hatte. Gerade kam es mir so vor, als hätte ein völlig anderer Mensch dieses kleine Kunstwerk für mich angefertigt. Ich verzog die Lippen zu einem wehmütigen Lächeln, nahm die Dose und entschied mich kurzerhand zu einer kleinen freundlichen Geste. Langsam öffnete ich die Tür des Waschraums und spähte hinaus auf den Gang.
Timothy stand einige Meter entfernt, die Hände auf dem Rücken verschränkt und sah aus dem Fenster. Als ich den Kopf hinausstreckte, wandte er sich jedoch blitzschnell in meine Richtung und kam herbeigeeilt.
»Sie haben sich ja immer noch nicht umgezogen!«
Bei der Begrüßung hatte ich große Lust, meine Pläne in den Wind zu schießen, und ihm die Tür wieder vor der Nase zuzuschlagen. Doch ich hielt mich zurück und erinnerte mich an meine Worte vom ersten Abend unserer Reise: Aktion und Reaktion. Wenn ich diese Welt für alle angenehmer machen wollte, musste ich in meinem Umfeld beginnen. Und seltsamerweise hatte ich mir in den Kopf gesetzt, mir ausgerechnet an Timothy in dieser Hinsicht die Zähne auszubeißen. Deshalb atmete ich tief ein und streckte ihm die Schokoladendose entgegen. »Möchten Sie was?«
Er sah auf meine Hand hinab und für einen Augenblick befürchtete ich, er könnte mein Angebot ausschlagen, doch dann bewegte sich sein Arm und er nahm ein Stück heraus.
»Haben Sie jetzt die ganze Zeit da drin gesessen und Schokolade gefuttert?«, fragte er irritiert, als nähme er das tatsächlich an.
Ich zog die Dose zurück, schloss den Deckel und wandte mich wortlos ab. Ich ging zurück zum anderen Ende des Waschraums und steckte das metallische Behältnis an seinen angestammten Platz.
»Cannie?«, fragte Timothy, wahrscheinlich noch verwirrter, weil ich auf seine Frage hin einfach gegangen war. Er trat einen Schritt näher und schob die Tür weiter auf.
»Ich brauche Ihre Hilfe«, sagte ich.
»Wobei?«
»Könnten Sie dafür kurz reinkommen?«
Timothy tat, wie ihm geheißen, auch wenn er nach wie vor einen verständnislosen Gesichtsausdruck aufgesetzt hatte. Sobald er die Tür hinter sich geschlossen hatte, atmete ich geräuschvoll aus und schlang kurzerhand meine Arme um ihn.
Mich kümmerte nicht, ob er das nun als angemessen empfand oder nicht. Es war das, was ich nach dieser Tortur brauchte.
Erst warf er überrascht die Arme in die Luft und taumelte einen Schritt zurück, doch sobald er sich wieder gefangen hatte, senkte er langsam seine Hände auf meinen Rücken.
»Sie können mich für meine Leichtsinnigkeit und meine Torheit anmotzen, sobald ich den Waschraum verlassen habe, in Ordnung?«
»Ich will Sie gar nicht anmotzen, Cannie.«
»Dafür machen Sie das ziemlich gut.«
Darauf antwortete er nicht mehr und auch ich sah davon ab, noch weitere Vorwürfe in den Raum zu stellen. Zumal er auf wundersame Weise den Schaffner verscheucht hatte, der mich andernfalls wohl auf schnellstem Wege an der nächsten Station der Wacht übergeben hätte. Ich wusste nicht, wie lange ich auf diese Weise mit Timothy dastand, bevor ich mich wieder dazu bereit fühlte, auf eigenen Beinen zu stehen. Doch irgendwann löste ich mich von ihm und lächelte. »Danke.«
Timothys Lippen waren zu einem dünnen Strich zusammengepresst und er nickte knapp. Hatte ich was falsch gemacht?
»Brauchen Sie mich noch?«, fragte er.
Ich schüttelte den Kopf.
»Gut, dann warte ich vor der Tür.«
»Ja«, sagte ich halbherzig, als er bereits in der Tür stand. Immerhin ging es mir ein wenig besser.
Um nicht über den seltsamen Abgang meiner Reisebegleitung nachdenken zu müssen, entledigte ich mich der Uniform und schlüpfte in mein Nachthemd. Ich hatte für heute ausreichend Heldentaten vollbracht und wollte nur noch schlafen. Während ich die Uniform im Rucksack verstaute, bedauerte ich sehr, dass mir die Mütze abhandengekommen war. Ich hatte sie gemocht.
Ein weiterer Blick in den Spiegel verriet mir, dass ich schon fast wieder, wie ich selbst aussah. Nur ein wenig blass und mit sichtbaren Ringen unter den Augen. Aber um ehrlich zu sein, waren das milde Folgen in Anbetracht dessen, was mir hätte passieren können.
Ich konnte nicht fassen, dass ich den ganzen Zug zum Stillstand gebracht hatte. Bei Adonai, wenn ich das nicht gekonnt hätte …
Timothy verfügte über jedes Recht, wütend auf mich zu sein. Das war mehr als nur leichtsinnig gewesen. Aber was hätte ich tun sollen, nachdem ich einmal aus dem Waggon gesprungen war? Etwa ohne Proviant oder Ausrüstung in den Wald laufen? Da wäre ich nur das Abendessen irgendwelcher Raubtiere geworden. Außerdem stand ich nun hier, oder nicht? Ich lebte noch und ich war weiterhin auf dem Weg nach Sidarap. Ein breites Lächeln kroch auf meine Lippen. Ich befand mich noch immer auf dem Weg in die Hauptstadt! Der Gedanke sorgte für ein euphorisches Kribbeln in meiner Brust an. Das Schlimmste hatte ich überstanden oder nicht? Vielleicht sollte ich mit Timothy darauf anstoßen? Oder, wenn er noch zu verstimmt war, dann vielleicht mit Eusebia, die hatte mit Sicherheit nichts dagegen.
Ich erschrak über meine Gedanken. Daran hätte Canleycana Saradotti vor fünf Tagen nie und nimmer gedacht! Was war in der Zwischenzeit aus mir geworden? Wieder betrachtete ich mich eingehend im Spiegel. War ich noch die Tochter des Senators von Romaleon oder entwickelte ich mich zu einer neuen, einer fremden Person? Aber vielleicht … vielleicht war ich schlichtweg niemals die gewesen, die ich zu sein geglaubt hatte. Vielleicht wurde ich jetzt erst zu der Persönlichkeit, die ich geworden wäre, hätte meine Familie nicht jeden Schritt meines Lebens akribisch kontrolliert und vorausgeplant. Meine Eltern hatten mir nie die Möglichkeit gelassen, eigene Entscheidungen zu treffen. Ob es dabei um mein Aussehen ging, mein Verhalten, meine Ernährung oder gar meinen Ehepartner.
Wer würde ich werden, wenn ich selbst wählen konnte?
Ich war bereit, genau das herauszufinden.
Mit diesem Ziel vor Augen sammelte ich frischen Mut, schulterte meinen Rucksack und trat hinaus auf den Gang. Timothy stand wieder am Fenster, doch er wirkte nervöser als zuvor.
»Sind Sie fertig?«, fragte er.
»Ja.«
»Gut. Wir müssen reden.«
»Worüber?« Ich trat näher.
»Madam Scradelli weiß, wer Sie sind.«
Ich schluckte schwer. »Und nun? Was hat sie dazu gesagt?«, fragte ich mit gesenkter Stimme.
Er zuckte mit den Schultern. »Nichts und genau das macht mir Sorgen. Sie meinte, mit Geld könne man sie nicht locken.«
»Meinen Sie, es ist ihr egal?«
Er dachte eine Weile nach und wiegte den Kopf hin und her. »Nach meiner Erfahrung wollen Menschen immer irgendwas.«
»Hm.« Ich kaute auf meiner Unterlippe herum, dann wandte ich mich dem Gang zu. »Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.«
»Halt!« Ich hatte keine drei Schritte zwischen uns gebracht, als Timothy mir schon hinterherhechtete und mein Handgelenk ergriff. »Was soll das werden?«
»Na was wohl? Ich frage Eusebia.«
»Und was ist, wenn sie nur desinteressiert tut, Ihnen aber wortwörtlich das Messer in den Rücken rammt?«
»Sie meinen, sie könnte mich heimlich verraten und mir dabei ins Gesicht lächeln? Warum sollte sie das tun?«, fragte ich ungläubig.
»Ich nehme es auch nicht an, aber die Möglichkeit besteht.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Dann … behalten wir sie im Auge?«
Timothy sah nicht überzeugt aus, aber ich wurde allmählich ungeduldig.
»Was können wir schon anderes tun? Ich werde sie mit Sicherheit nicht an unserem nächsten Halt aussetzen und im Moment brauche ich vor allem meine Liege und eine Mütze Schlaf.«
Plötzlich blickte er schuldbewusst drein und ließ meinen Arm los.
»Ich weiß, dass Sie sich Sorgen machen«, sagte ich so sanft wie möglich. »Aber wenn Ihnen wirklich etwas an meinem Wohlergehen gelegen ist, dann lassen Sie mich jetzt bitte zu meiner Liege und gewähren mir meinen dringend notwendigen Schlaf.«
Ich hatte das Gefühl, nicht mehr klar denken zu können. Mein Kopf entsprach mittlerweile einer mit dichtem Nebel gefüllten Kugel, in der nur Schemen logischer Gedankenfolgen vor sich hin waberten. Vorhanden, aber kaum greifbar.
Timothy nickte.
»Danke.«
Wir gingen gemeinsam zurück zu unserem Abteil, in dem sich unsere Sorge als völlig unbegründet herausstellte, denn Eusebia schlief bereits tief und fest, als wir eintraten.
Ich warf den Rucksack auf meine Liege, doch erstarrte im nächsten Augenblick. »Wo ist meine Decke hin?«
4. Timothy
Eiswasser! Jetzt! Sofort! Über meinen Kopf und am besten auch gleich noch in meine Hose. Was machte diese Frau – Kind! – mit mir? Erst umarmt sie mich stürmisch, das war ja noch zu ertragen, aber dann wackelt sie in einem Nachthemd den Gang vor mir entlang. Zum Glück in einem hochgeschlossenen, eher kuschligen Nachthemd, nicht in so einem luftigen Teil, das mehr zeigte, als verbarg, aber immerhin durfte ich die ganze Zeit ihren verlängerten Rücken betrachten.
Tochter!
Sie ist nicht unsere Tochter.
Lousa, bitte, ich versuche gerade, mich von der größten Dummheit meines Lebens abzuhalten. Mach mir das nicht schwerer als es ohnehin …
»Wie bitte?«
Cannie hatte mich irgendwas wegen ihrer Decke gefragt. Sie stand hilflos vor ihrer Liege und schaute frustriert auf die verwaiste Liegefläche. »Meine Decke ist verschwunden.«
»Die wird der Schaffner weggeräumt haben«, sagte ich geistesabwesend.
Konzentrier dich! Sie braucht dich jetzt.
Danke Lousa, sehr hilfreich.
»Aber wieso?«
»Äh … ich musste doch irgendwas sagen, weil Sie nicht da waren«, brachte ich heraus. »Ich habe gesagt, Sie wären ausgestiegen. Der Schaffner aus der Zweiten war ziemlich wütend auf seinen Kollegen, weil Ihre Liege zerwühlt aussah. Er hat ihm bestimmt gleich befohlen, hier aufzuräumen.«
»Aber … bei Adonai …« Sie schlang die Arme um sich. »Mir ist kalt.«
Du könntest sie wärmen, meinst du nicht? Jetzt mischte sich auch noch Ann-Kathrein ein und die wollte immer nur das eine.
Ich griff nach meiner Decke und warf sie zu ihr hinüber. »Nehmen Sie die!« Meine Worte klangen ruppig. Selbst in meinen Ohren hörte ich mich an, als würde ich ihr demnächst den Hintern … Falscher Körperteil!
Eilig wandte ich mich ab. »Ich habe Hunger«, verkündete ich. »Soll ich Ihnen ein Hörnchen mitbringen?«
In meinem Kopf stiegen Bilder von Miss Cannie auf, die genüsslich in ein Hörnchen biss. Geht weg! Vorstellungskraft war sehr nützlich in einem Beruf, bei dem ich mit Worten Menschen Bilder in den Kopf zaubern wollte, aber manchmal war sie überaus lästig.
Ich wandte mich ab, ehe sie etwas sagen oder tun konnte, was mich noch mehr in heillose Verwirrung stürzte. Ich verschwand als Erstes im nächsten Waschraum und schöpfte mir Wasser ins Gesicht. Ah, besser. Langsam kühlte meine Stirn ab. Ich atmete tief durch. Wann hatte ich zuletzt so empfunden?
Wir waren siebzehn.
Ja, eben, Lousa. Mit vierundfünfzig legt man keinen Wert auf eine zweite Runde Pubertät.
Die Szene soeben hatte mich wahrhaftig aus der Bahn geworfen. Nur langsam wurde ich ruhiger. Der weltgewandte Journalist trat hinter der Säule in meinem Geist hervor, hinter der er sich versteckt gehalten hatte. Ich straffte mich, zog mein Jackett und mein linkes Hosenbein glatt. Wieder voll Herr meiner Sinne verließ ich den Raum. Ein Herr mit Kneifer schaute aus einem der Gangfenster. Wir begannen unseren Aufstieg zur Passhöhe. Über uns breitete sich ein sternenklarer Himmel, der Mond trat ins letzte Viertel vor Vollmond ein.
Morgen nach der Mittagsstunde erreichten wir Hakkerborn. Die Station existierte im Grunde nur, um eine Verbindung der Eisenbahnlinie mit den alten Passstraßen zu bilden, die früher den Übergang über dieses Gebirge ermöglicht hatten.
Nach dem Halt am Pass begann die eher lang gestreckte Talfahrt zur Linebene hinab, vorbei an Lindarap und Pöschdarap, wo der nächste Lokwechsel anstand, was einen weiteren längeren Aufenthalt bedeutete. Ich fragte mich, ob und wenn, wo wir Simmons wiedersehen würden. Mein Tipp fiel auf Pöschdarap, den größten Ort vor der eigentlichen Hauptstadt.
Im Speisewagen stand Paul am Tresen und schaute gelangweilt auf die beiden letzten verbliebenen Gäste des Abends, einen Mann um die Vierzig mit Schnurrbart, der mir noch nicht über den Weg gelaufen war, und die Dame mit der Katze. Sie saßen an entgegengesetzten Enden des Wagens jeweils vor einem Schnaps und starrten vor sich hin.
Ich trat an den Tresen und fragte nach dem Gericht des Tages.
»Lungenhaschee«, verkündete Paul und vermutlich wurde ich grün im Gesicht. Ich hatte in meinem Leben schon viel gegessen und bildete mir ein, einen robusten Magen zu besitzen, aber es gab ein oder zwei Gerichte, die mir, wenn ich nur ihren Namen hörte, die Säure die Speiseröhre hinauftrieben.
»Dann nehme ich lieber Reste«, sagte ich eilig. »Und einen …« Ich zögerte. Brauchte ich wirklich einen Schnaps? Nein, in meiner derzeitigen Verfassung war ein klarer Kopf wichtig. »… Kräutertee.« Am besten einen Hängolintee.
Paul brachte meine Suppenschüssel und den Tee. Ich setzte mich an einen freien Tisch in der Mitte und begann, zu essen.
Das Gericht des Tages erinnerte mich an die Zeit, da meine jüngere Schwester geboren worden war. Mein Vater hatte die Versorgung der Familie für drei Tage übernommen. Er war ein freundlicher Vater, ein fleißiger, ehrbarer und wohlmeinender Mann und ein grauenvoller Koch. An einem dieser Tage brachte er tatsächlich fertiges Lungenhaschee von der Freibank mit nach Hause, wo wir einfachen Leute günstig Fleisch aus Notschlachtungen bekamen. Das Zeug war schlabbrig und einfach eklig, aber dann entdeckte ich ein paar Nudeln darin und schöpfte Hoffnung. Bis mein Bruder eine der vermeintlichen Nudeln, die mir merkwürdig zäh vorgekommen waren, auf den Teller spuckte und rief: »Pfui, da sind ja noch die Adern drin!«
Mir fiel beinahe das Essen aus dem Gesicht, das ich bereits hinuntergewürgt hatte. Meine Mutter war einer Ohnmacht nahe, als sie aus dem Spital kam und von dieser Begebenheit hörte.
Ich aß gerade meinen letzten Löffel Reste, da trat die Katzenlady an meinen Tisch. »Für mein' Carver is' dös alles nix?«
Was wollte die jetzt von mir?
Sie setzte sich mir ungefragt gegenüber und deutete zum Tresen. »Wie kann man den Leuten etwas anbieten, was selbst meine Katz' nicht fressen tut, na?«
Ich sah sie nur stumm an und nahm einen Schluck Tee.
»Sie sind doch bei der Zeitung, na?«
Ich nickte.
»Wissens, ich schreib hin und wieder Geschicht’n …«
Ach, so eine. Von denen gab es für jeden Zeitungsmann eine Handvoll. Sie bestürmten einen, man möge irgendwas von ihrem Geschreibsel abdrucken. Sie träumten davon, berühmt zu werden.
»Ich bin bei der Nachrichtenredaktion«, sagte ich abweisend.
»Aber Sie kennen doch bestimmt jemanden, der sich mit so was beschäftigt.«
Ich kenne jemanden, der täglich zwei Papierkörbe voll davon zur Tür rausträgt. Ich leerte meine Teetasse und wollte aufstehen. Sie hielt mich am Arm fest. »Bitte, nur einen Blick draufwerfen.« Sie kramte in ihrer Handtasche und förderte einen Stapel Papier hervor, den sie vor mir auf den Tisch legte.
»Ich geb’s weiter.« Seufzend griff ich danach, ging zum Tresen und kaufte Cannie zwei Hörnchen. Der Abend war definitiv anstrengend verlaufen. Ich wusste nur nicht recht, ob der Teil an der Grenze oder der danach der härtere gewesen war. Ich nickte der Dame noch einmal zu und eilte aus dem Speisewagen.
Cannie lag in die Decke eingerollt auf ihrer Liege und schlief. Ma Scradelli schnarchte, aber zum Glück in moderater Lautstärke. Ich legte die Hörnchen behutsam neben Cannies Kopf, die Blätter der Katzenlady auf meinen Koffer und kroch auf meine Liege. Es war wirklich ein bisschen kühl ohne Decke, aber ich würde schon überleben. Ich hatte viel überlebt. Und morgen würde ich mir eine neue Decke besorgen.
Tag 6
REISEPLAN HAKKERBORN
5. Cannie
Ich erwachte durch das Kichern von Eusebia, die sich gerade kopfschüttelnd von mir abwandte, als ich die Augen öffnete.
»Hm?«, brummte ich verschlafen.
Sie kehrte zu mir zurück und deutete auf etwas neben mir. Da lagen zwei Hörnchen auf meiner Liege. Automatisch warf ich einen Blick zu Timothy, doch der schlief noch seelenruhig.
»Die muss Timothy gestern noch mitgebracht haben«, sagte ich, als sei völlig selbstverständlich, dass Essen auf meiner Schlafstatt herumlag.
»Seine Decke hat er Ihnen auch gleich noch gegeben«, bemerkte sie.
»Eher hingeschleudert«, grummelte ich.
»Hm«, machte Eusebia und tippte sich grinsend gegen das Kinn. »Ich glaube, für diese Reise hätte ich keinen besseren Platz bekommen können.«
»Was meinen Sie damit?«, fragte ich, drehte mich auf den Bauch und stützte die Ellenbogen auf. Mein Magen knurrte. Ich war gestern vor Erschöpfung eingeschlafen, bevor ich meinen Hunger hatte stillen können. Daher griff ich dankbar nach einem der Hörnchen und nahm einen großen Bissen. »Möchten Sie auch eines?«, fragte ich und deutete auf das zweite.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten, Cannie. So von Frau zu Frau.«
Ich nickte. »Das denke ich auch.« Was Eusebias Gründe für das Gespräch sein sollten, wusste ich nicht recht, aber ich wollte noch immer erfahren, wie sie zu ihrem Reichtum gekommen war.
»Wieso ziehen Sie sich nicht an und wir gehen gemeinsam frühstücken?«, schlug sie vor.
Ich warf einen Blick auf Timothy. »Eigentlich …«
Sie unterbrach mich mit einer Geste. »Ein Frühstück ohne Sie wird der Herr wohl verkraften.«
Noch einen Moment zögerte ich, doch dann stopfte ich mir den Rest des Hörnchens in den Mund und schlug die Decke zurück. Wer wusste schon, wann sich die Gelegenheit noch einmal ergab?
Ich kletterte von der Liege, nahm den Rucksack und wollte gehen, überlegte es mir aber anders, drehte um und breitete die Decke über Timothy aus. Dann flitzte ich zum nächsten Waschraum, um in Mieder, Bluse und Rock zu schlüpfen. Anschließend ging ich zum Speisewagen. Eusebia wartete bereits an einem Tisch auf mich. Vor ihr stand eine dampfende Tasse Tee, auf der Tischseite ihr gegenüber wartete eine Tasse Kaffee.
»Ist die für mich?«, fragte ich unsicher und deutete auf das dunkelbraune Getränk.
Sie nickte.
»Oh.« Sollte ich ihr sagen, dass Kaffee mir nicht besonders schmeckte? Besser nicht, ich würde einfach höflich hin und wieder an dem Gebräu nippen.
Während ich mich setzte, sah ich, wie Eusebia eine ihrer Vekflaschen aufdrehte und einen beherzten Schluck in ihren Tee gab.
Mit einem angestrengten Laut verschloss sie das Gefäß wieder und verstaute es irgendwo tief zwischen ihren Röcken.
»Warum wollten Sie mit mir reden?«
Sie legte den Kopf schief und betrachtete mich mit leicht verengten Augen, als sähe sie in mir eine Rechenaufgabe, die es zu lösen galt. »Wissen Sie, zu Beginn unserer Reise hoffte ich, Sie würden vielleicht für eine Weile in einem meiner Häuser unterkommen. Es ist nicht einfach, ausreichend hübsche, junge Mädchen zu finden.« Sie lachte kurz. »Eigentlich sind es nie genug.«
Ich räusperte mich. »Wie sind Sie eigentlich zu diesem … Geschäftsfeld gekommen, nachdem Sie Ihr Buch geschrieben hatten?«
»Wollen Sie jetzt wirklich diese alte Kamelle hören?«
»Es interessiert mich.«
»Zuerst müssen Sie wissen, Cannie, dass kein ordentlicher Verlag in ganz Sidarap mein Manuskript veröffentlichen wollte. Jeder wusste, auf was für ein Glatteis er sich mit der Publikation des Textes begeben würde. Bei einigen Verlagshäusern bin ich sogar von den Sicherheitsbeamten verjagt worden.«
»Und dann?«, fragte ich neugierig.
Sie lächelte breit und ich entdeckte, dass ihr einer der hinteren Backenzähne fehlte. »Die Frauen, die ich durch meine Arbeit an dem Text kennengelernt hatte, konnten mir den Namen und die private Adresse eines Verlegers besorgen. Der Mann war eigentlich Händler, importierte Tabak aus dem Süden, aber er verlegte hin und wieder ein paar Manuskripte. Nur so als Zeitvertreib.« Sie schien kurz völlig in ihrer Erinnerung aufzugehen. »Können Sie sich vorstellen, wie ich als junge Frau, die den ganzen Tag in einer Garküche schrubbte, vor diesem Haus stand, das nur so vor Reichtum strotzte? Beinahe hätte ich mich nicht getraut, zu läuten …«
»Was ist passiert?«
»Er war auf dem Weg zu einem Termin, doch gab mir die Gelegenheit, ihm zwischen der Türschwelle und dem Einstieg in seine Kutsche von meinem Buch zu berichten. Keine dreißig Sekunden seiner Zeit widmete er mir. Ich war völlig überfordert, stotterte vor mich hin und erwartete halb, dass der Mann mich angewidert in den Rinnstein schubsen würde. Zumindest machte er zu Beginn diesen Eindruck auf mich. Aber als er in seine Kutsche stieg, sah er noch einmal zu mir zurück und meinte: Den Text will ich sehen. Geben Sie meiner Bediensteten eine Kopie.« Eusebia schnaubte belustigt. »Ich hatte keine Kopie. Ich hatte nur die Blätter in meiner Hand und die gab ich mitsamt meinem Namen und der Anschrift meiner Arbeit an die Dienerin.«
»Sie haben das Original weggegeben?«, fragte ich erstaunt.
»Glauben Sie mir, Cannie, jede Erfolgsgeschichte hat auch ihren Anteil Glück. Allerdings …« Sie hob belehrend den Zeigefinger. »… macht dieser Anteil oft weit weniger aus, als die meisten behaupten.«
»Und er hat das Buch verlegt?«
»Zuerst tauchte er auf meiner Arbeit auf. Sie hätten ihn sehen sollen. Die Nase gerümpft, als würde die Existenz dieses Ortes seine Gegenwart beleidigen.« Während sie darüber redete, lag in ihren Zügen eine Jugendlichkeit und eine Freude, die ich während der ganzen Fahrt noch nicht an ihr gesehen hatte. »Er kam zu mir, fragte, woher ich von den Dingen in meinem Buch wusste, und was ich an einem Ort wie diesem tat. Dann machte er mir ein Angebot für meinen Text. Ein großzügiges Angebot. Warum? Weil er daran glaubte, dass harte Arbeit und Leidenschaft belohnt werden sollten, und weil er meine damalige Arbeit als eine Beleidigung meiner Fähigkeiten ansah. Er war der erste Mensch, der jemals an mich geglaubt hat.«
»Sie haben ihn geliebt«, stellte ich überrascht fest. Erschrocken zuckte ich zurück. Woher hatte ich das plötzlich mit einer solchen Gewissheit gewusst?
Lächelnd blickte Eusebia auf ihren Tee hinab. »Es ist schwer, jemanden nicht zu lieben, der an alles glaubt, was man sein könnte, der kompromisslos nur die beste Version von einem sieht.«
Ich senkte ebenfalls den Blick und trank einen kleinen Schluck Kaffee. Meine Wangen begannen dennoch verräterisch warm zu werden. Ja, das konnte ich mir vorstellen.
»Er brachte also mein Buch in die Welt und mich in sein Bett. Wie hätte es auch anders sein sollen?« Sie zuckte mit den Schultern. »Doch die Aussage meines Buches wurde zu unserer gemeinsamen Mission. Ohne ihn wäre ich niemals so weit gekommen. Er stellte mir persönlich die Kredite zur Verfügung, mit denen ich meine Häuser eröffnen konnte. Ich tat das, um die Zustände unter den Prostituierten zu verbessern, verstehen Sie? Ich wollte diese Mädchen schulen, aufklären und ihnen das Selbstbewusstsein geben, den Männern auch Grenzen aufzuzeigen.«
Mir war schier unvorstellbar, wie die Zustände in einem ihrer Häuser sein mussten.
»Ist das ein Leben?«
»Kommt drauf an«, sagte Eusebia und straffte die Schultern. »Nicht jeder ist zum Gärtner berufen oder nicht?«
»Wahrscheinlich«, antwortete ich recht halbherzig.
Ich konnte ihr ansehen, wie sie noch weiter über meine Frage nachdachte, während sie ihren Tee trank. »In all meinen Jahren in diesem Geschäft habe ich im Großen und Ganzen zwei Arten von Menschen kennengelernt, unerheblich, ob Mann oder Frau. Jene, die abstumpfen, hart werden und alles ausblenden können, und die Empfindsamen, die sich jeden Tag von Neuem überwinden, sich in Alkohol oder andere Drogen flüchten, um mit diesem Leben klarzukommen. Aber wenn es nur danach geht, gilt das für jede Tätigkeit, Cannie. Diese Welt, aber vor allem Sidarap, ist nichts für die Zaghaften.« Sie machte eine Pause, beugte sich vor und sah mir direkt in die Augen. So eindringlich, dass es unangenehm war. »Sie gehören zu den Zaghaften.«
Ich schnaubte und trank einen beherzten Schluck von meinem Kaffee. Hatte ich nicht gestern dieses Monstrum von einem Gefährt angehalten? Galt das etwa als zaghaft? Wollte Eusebia mir erklären, ich hätte keine Chance in Sidarap? Bei dem Gedanken kochte Wut in mir hoch. Sie täuschte sich!
»Cannie.«
Widerwillig sah ich zu ihr auf. Mein Unmut musste mir ins Gesicht geschrieben stehen.
»Zaghaft zu sein ist keine Schande, im Gegenteil. Die Harten sind wie Esel. Sie ertragen und sie machen und sie ändern sich nicht. Für sie ist die Welt klar, die Antworten eindeutig, ein Tag wie der nächste. Die Zaghaften sind es, die unsere Welt spannend machen. Für sie gibt es nur wenige Tätigkeiten, in denen sie sich wohlfühlen, aber dafür brillieren sie in ihnen wie niemand sonst. Wissen Sie, warum?«
Ich schüttelte den Kopf. »Weil sie mit ganzem Herzen dabei sind. Sie haben keine Angst davor, sich mit Haut und Haaren in eine Sache zu stürzen, wie aussichtslos sie auch erscheinen mag. Diese Achterbahn der Gefühle ist nicht immer angenehm, aber sie ist ein Schatz, den Sie sich bewahren sollten. Er weist Ihnen den Weg und gibt Ihnen die Kraft, aus Überzeugung zu handeln und vielleicht sogar die Welt zu verändern.«
Der Glanz in ihren Augen bei diesen Worten verriet sie. »Sie sind genauso«, sagte ich.
Sie grinste vielsagend und nahm einen großen Schluck von ihrem Tee. »Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Alles, was jetzt noch passiert, ist Zusatz«, sagte sie. Es klirrte leise, als sie die Teetasse zurück auf die Untertasse setzte. Dann breitete sie die Hände flach auf der Tischfläche aus und lächelte mich an. »Ich frage mich, was Sie erreichen werden, Cannie. Wo liegt Ihre Leidenschaft?«
Meine Leidenschaft? Ich hatte keine Leidenschaft. Das Wort gehörte kaum zu meinem Wortschatz. Bisher hatte ich ausschließlich in den Kategorien angemessen und unangemessen gedacht.
Als Antwort zuckte ich nach einer Weile ahnungs- und auch ein bisschen hilflos mit den Schultern. Ich fühlte mich niedergeschlagen. Irgendwie drängte sich mir der Eindruck auf, ich könnte eine einfache Frage nicht beantworten.
Ich sah, wie Eusebia einen Blick über meine Schulter warf. »Denken Sie drüber nach. Das ist wichtig.« Dann machte sie Anstalten, sich zu erheben, und ich sah mich irritiert um. Nach einer Antwort brauchte ich jedoch nicht lange zu suchen, denn hinter mir auf dem Gang stand Timothy. Er sah ein wenig verschlafen aus, aber sonst zumindest neutral gestimmt.
»Kein Grund zur Sorge«, sagte sie in seine Richtung. »Ich wollte Ihnen Ihre Freundin nicht streitig machen.«
»Ich habe eher Sorge, dass Sie ihr Flausen in den Kopf setzen.«
Eusebia lachte auf. »Ups.« Dann steuerte sie den nächsten Tisch an und ließ sich dort gemächlich mit ihrer Teetasse sinken. Timothy ging zum Tresen und kehrte wie immer mit Saft, Kaffee und Hörnchen zurück, bevor er Eusebias Platz mir gegenüber einnahm.
»Was hat sie gewollt?«, fragte er ohne eine weitere Begrüßung. Offensichtlich war Timothy noch immer sauer wegen meiner kleinen Showeinlage mit dem Zug. Oder war ihm etwas anderes über die Leber gelaufen? Auf jeden Fall verhielt er sich seit gestern noch miesepetriger als zu Beginn unserer Bekanntschaft.
Ich konnte mich gerade noch bremsen, ihm ein bissiges »Nichts, was für Sie von Interesse wäre« entgegenzudonnern. Nein, das wäre mit Sicherheit nicht förderlich.
»Sie hat mir erklärt, dass ich mich nicht als Hure eigne, wenn ich das richtig verstanden habe.«
Timothy, der gerade von seinem Hörnchen abgebissen hatte, hielt schlagartig in der Bewegung inne. »Oh«, machte er mit vollem Mund.
Ich trank von meinem Kaffee und griff auch nach einem der Hörnchen. Mittlerweile fand ich das Getränk gar nicht mehr so schrecklich. Lecker war dennoch was anderes. »Ich weiß nicht, ob ich mich davon entmutigt oder bestätigt fühlen soll«, erklärte ich. »Natürlich war es nie meine Absicht, in einem von Eusebias Häusern zu landen, zumal ich sowieso meine Fähigkeit habe, von der sie nichts weiß. Aber irgendwie fühlt es sich merkwürdig an, zu wissen, dass ich nicht einmal dort genommen werden würde.«
Frustriert biss ich in mein Hörnchen und trank erneut. Timothy hatte sich noch immer nicht gerührt, sodass ich kurz darauf stirnrunzelnd zu ihm aufsah. »Ist alles in Ordnung?«
Er zuckte zusammen und begann, hektisch weiter zu essen. »Ja. Ja, alles bestens.«
»Sicher? Sie verhalten sich merkwürdig.«
»Nur eine anstrengende Nacht gehabt. War ziemlich kühl.«
»Danke für Ihre Decke … und die Hörnchen.«
Er antwortete nicht mehr, sondern widmete sich weiter seinem Frühstück. Ich seufzte in mich hinein. »Worin liegt eigentlich Ihre Leidenschaft?«
»Meine … bitte was?«
»Ihre Leidenschaft, Timothy. Was ist denn mit Ihnen los?«
»Was meinen Sie damit?«, fragte er, als müsste er bei dem Thema besonders auf der Hut sein.
»Na«, ich fuchtelte mit den Händen durch die Luft, »Ihre Begeisterung, Ihre Berufung, Ihr Lebenssinn. Wofür brennen Sie?«
6. Timothy
Bei Adonai, und das zum Frühstück. Wofür brannte ich? Heute, jetzt, hier? Im Grunde für nichts mehr. Jedenfalls wäre das vor drei, vier Tagen noch meine Antwort gewesen. Hin und wieder bereitete es mir noch Freude, ein paar Großkotzen Stecknadeln in den Hintern zu piksen, aber ich war damit auch nicht viel mehr als eine lästige Mücke an ihrem Arsch. Aber inzwischen …
»Ich habe immer versucht, den Menschen das Denken beizubringen. Ich wollte, dass sie die graue Masse im Kopf zu etwas mehr benutzen, als um zu verhindern, dass zwischen den Ohren kein Durchzug ist. Ich wollte ihnen Wahrheiten nahebringen, auch wenn diese ihre heile Welt in Stücke schlagen, ihre Ideale beschmutzen und ihre Gefühle verletzen. Ich habe schon sehr früh begriffen, dass Worte mächtig sind. Vielleicht, weil ich auch als Kind in den Gassen des Bleibezirkes mehr noch durch Worte als durch Schläge verletzt worden bin. Aber manchmal muss man jemanden verletzen, um ihn aufzurütteln aus seiner Lethargie.« Ich trank einen Schluck Kaffee und biss in mein Hörnchen. Das verschaffte mir Zeit zum Nachdenken, um deutlicher zu machen, was ich meinte. Andernfalls könnte sie glauben, ich ergötzte mich einfach daran, mit Worten um mich zu schlagen.
»Stellen Sie sich jemanden vor, der irgendwo herumliegt. Er döst unter einem Baum und ein Gewitter zieht auf.«
»Ah, jetzt kommt wieder so eine abgedrehte Ablenkung.«
»Die keine Ablenkung ist, Cannie. Und das wissen Sie inzwischen.«
Sie nickte.
»Sie können sich zu ihm setzen, ihm sanft über das Haupt streichen und zusehen, wie er entschlummert. Und dann unter diesem Baum vielleicht vom Blitz erschlagen wird. Oder sie packen ihn an der Schulter, rütteln ihn auf und schreien ihn an, dass er verschwinden soll, bevor das Gewitter über ihm ist. Ich tendiere zu Letzterem. Bei manchen Menschen reicht sanftes Rütteln leider nicht. Die muss man in den Hintern treten.«
»Sie hätten in die Politik gehen sollen«, sagte sie. »Wäre die Welt nicht besser, wenn dort Leute wie Sie Entscheidungen träfen?«
»Kein Mensch wählt Leute wie mich«, sagte ich und wusste leider, dass das stimmte. »Und, na ja, was ich gerade gesagt habe, galt für einen Timothy Rook der wenigstens zehn Jahre jünger war, als ich jetzt bin.«
»Und heute?«
»Cannie, was wird aus Dingen, die brennen?«
»Asche?«
»Kalte Asche, richtig.«
»Sie meinen, Sie haben aufgegeben, etwas verbessern zu wollen?«
»Haben wir darüber nicht schon gesprochen?« Ich verzehrte den Rest Hörnchen, spülte mit Kaffee nach und sah sie einfach nur an. Sie hatte wunderschöne meerblaue Augen mit langen, geschwungenen Wimpern, die kräftigen Wangenknochen und das spitze Kinn ihres Vaters. Sie trug wieder ihre Mütze, aber säße diese nicht auf ihrem Kopf, fiele ihr das lockige Haar wie ein Wasserfall aus winzigen Rubinen bis über die Schultern.
Sie sollte nicht diese elende Mütze, sondern ein Diadem tragen, golden mit Diamanten als Kontrast zu ihrer Haarfarbe.
In diesem Moment wurde mir einmal mehr klar, dass unter der Asche noch immer Glut lag. In mehr als einer Beziehung. Ich schluckte.
»Aber lohnt es sich nicht, für seine Überzeugung zu kämpfen?«
»Meine Überzeugung ist inzwischen leider, dass da nicht viel ist, für das sich zu kämpfen lohnt. Es wird immer Gut und Böse, Arm und Reich, Oben und Unten geben. Sie können die Verhältnisse vielleicht zeitweise auf den Kopf stellen, aber dann wird eben nur aus dem einen das andere.«
»Sind Sie in Sidarap oder auf Ihren Reisen in andere Provinzen denn nie guten Menschen begegnet, die etwas zum Besseren wenden halfen?« Cannie klang wieder mal so, als wolle sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen. Sie hatte ihre Träume und Hoffnungen noch und es sollte nicht mein Ziel sein, sie zu zerstören. Die Zeit, da man sie besaß, war zu kurz und zu wertvoll. Und es war auch nicht besser, sie frühzeitig zu verlieren, denn es bedeutete nur, dass man eher alt war. Und wer wollte schon alt sein? Aber was sollte ich auf eine solche Frage antworten. Ich wollte sie nicht belügen.
»Sie werden in Sidarap reichlich Gutmenschen finden, aber nur wenige gute Menschen«, sagte ich.
»Ich sehe da keinen Unterschied«, erwiderte Cannie.
»Nein, den sehen die meisten leider nicht. Von Versini haben Sie noch nichts gelesen, oder?«
Cannie verdrehte die Augen. »Wieder einer Ihrer beliebten Themenwechsel. Und nein. Mein Vater wollte mich mal zu Dottore Cazzotto überreden. Aber dann hat er mir gesagt, es ginge um den Wert von Erkenntnis und das genügte, um mich abzuschrecken.«
»Vielleicht hätte es Ihnen gefallen. Es ist im Grunde eine fantastische Geschichte, denn es spielt ein Bizach mit mehr als einer Fähigkeit eine wichtige Rolle. Er bietet diesem Dottore aus dem Titel eine Art Handel an: Er will ihm alle Wunder der Welt zeigen, ihm jegliches Wissen vermitteln, wenn dieser ihm dafür am Ende seine sterbliche Hülle überlässt. Dieser Bizach besitzt unter anderem die Quecksilberfähigkeit. Aber er darf sich den Doktor erst nehmen, wenn dieser von all dem Lernen und Forschen satt ist, nicht mehr weiter Neues erfahren will. Dieser Bizach nun stellt sich dem guten Doktor als ein böser Geist vor, als einer, der bestehende Denkmuster einreißen will. Er sagt, er würde zu allem immer Nein sagen, dafür sorgen, dass Dinge sich wandeln, verschwinden. Er wäre ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.«
»Sehr interessant. Wir sind ein wenig vom Thema abgekommen, scheint mir«, fiel Cannie mir ins Wort.
»Keineswegs, Sie lassen mich nur nicht ausreden. Also, Gutmenschen sind für mich genau das Gegenteil von jenem Bizach. Sie sind Menschen, die stets das Gute wollen und nur das Böse schaffen. Sie sind der Grund, warum Leute wie Glanvalli immer mehr Zulauf bekommen. Denken Sie nur an Yektral.«
»Nie gehört. Was ist das?«
»Nach Romaleon dringen aber auch nur wenige Nachrichten durch, was?« Ich winkte ab. »Gut, dann erzähle ich Ihnen das auch noch.«
Cannie setzte sich aufrecht, als wolle sie eine gute Schülerin darstellen, die ihrem Lehrer lauscht.
Ich schmunzelte bei dieser Vorstellung und begann zu erzählen: »Yektral ist eine arme Provinz im Südwesten. Vor fünfzig Jahren hat sich noch kein Schwein für den Landstrich oder die Menschen dort interessiert. Aber es gibt dort Bodenschätze, die das moderne Sidarap dringend benötigt. Also entsandte man Ingenieure dorthin, die die Abbaubedingungen untersuchen sollten. Diese brachten nicht nur die nötigen Ergebnisse mit nach Hause, sondern erzählten auch von den Lebensbedingungen der Einheimischen. Die lebten sehr primitiv, Wasser war in Yektral ständig knapp, medizinische Versorgung kannte man praktisch nicht. Von zehn Kindern starben acht, bevor sie erwachsen wurden. Oh, war das ein Aufschrei unter den Gutbetuchten von Sidarap. Die armen Menschen, man musste ihnen helfen. Können Sie sich vorstellen, was man zuerst nach Yektral entsandt hat?«
»Brunnenbauer, Ärzte?«
»Daran sieht man, wie jung und unschuldig Sie noch sind, Cannie.«
»Man schickte Leute, die den Yektrali den Glauben an Adonai nahebringen sollten. Glaubt fest an Adonais Kraft und es wird euch besser gehen.«
»Das scheint mir wirklich nicht sehr gut zu sein«, sagte Cannie.
»Oh, in den Augen dieser Leute, war es das Beste, was man nach Yektral bringen konnte, denn ohne einen festen Glauben an Adonai wäre doch jede andere Hilfe vergebens, glauben Sie nicht?« Ich setzte meine unschuldigste Miene auf, aber Cannie durchschaute mich und streckte mir die Zunge heraus.
»Aber es kommt noch besser«, sagte ich. »Man schickte tatsächlich Brunnenbauer, Ärzte und noch andere Helfer. Und sie sorgten dafür, dass mehr Wasser zur Verfügung stand – zumindest anfänglich – und auch die Sterblichkeit der Kinder stark zurückging. Was für eine Katastrophe!«
»Wie bitte?« Jetzt klang Cannie tatsächlich erbost. »Wie können Sie so etwas sagen?«
»Weil es so ist«, sagte ich. »Was war denn die Folge? Die Familien hatten weiter zehn Kinder, die jetzt aber alle überlebten. Also brauchte man viel mehr Wasser und auch Nahrung. Und um diese Nahrung zu produzieren, noch mehr Wasser. Aber in einer Gegend wie dort in Yektral fällt nicht so oft Regen wie in Sidarap. Jedes Jahr gibt es über Monate hinweg überhaupt keinen. Mehr und tiefere Brunnen mussten her, aber das Land konnte irgendwann nicht mehr Wasser liefern. Und nun starben all diese Menschen an Hunger und Durst. Und wieder war der Aufschrei groß. Dabei hätte man diese erneute Katastrophe verhindern können.«
»Wie?«
Ich griff in die Tasche, zog den Intimschutz heraus, den ich noch herumtrug, und warf ihn auf den Tisch. »Damit. Und mit dem Wissen, wie und warum man so was anwendet.« Ich rang plötzlich die Hände, als wolle ich Cannie anbeten. »Verstehen Sie, Wissen muss man den Menschen bringen, Wissen. Nicht Dinge, nicht Glaube. Aber das begreifen diese so von Hilfsbereitschaft Besoffenen nicht, da sie so von ihrem eigenen guten Wirken beseelt sind.«
Cannie starrte erst mich und dann das Päckchen an, das ich auf den Tisch geworfen hatte. »Räumen Sie das bitte weg«, zischte sie.
»Oh, Verzeihung.« Eilig griff ich zu und steckte es dahin zurück, wo ich es hergenommen hatte.
»Sie sind unmöglich«, stellte sie fest.
»Wegen des Intimschutzes?«
»Nein, weil Sie alles, was Ihnen mal was bedeutet hat, unter diesem Berg aus Zynismus verschüttet haben. Sie reden, als wären Sie am liebsten tot.«
»Nein, Cannie, nein. Das ist verrückt, aber ich bin noch immer neugierig. Wäre das alles eine Geschichte, würde ich sagen: Ich will wissen, wie sie ausgeht. Auch wenn ich glaube, es ist eher eine Tragödie als eine Komödie, so ist da immer noch die Hoffnung, dass es zumindest hin und wieder eine Szene zum Lachen gibt. Die will ich erleben. Ich lache ganz gern. Meist über die Dummheit der anderen.«
»Überheblich sind Sie auch.«
»Stimmt. Das wird auf meinem Grabstein stehen: Er war ein überheblicher Zyniker ohne einen Funken Glauben.« Ich klatschte in die Hände und lehnte mich zurück. »Und was machen wir jetzt?«
7. Cannie
Entschuldigen Sie mich bitte«, sagte ich und stand auf.
Ich verließ betont gemessen den Speisewagen, ging zu einem der Waschräume und sperrte mich darin ein. Mal wieder. Verärgert wischte ich mir eine Träne aus dem Gesicht. Warum bewegte mich das überhaupt? Warum heulte ich über die verlorene Begeisterung eines überheblichen Zynikers, wie er sich selbst betitelte?
Hatte ich Angst um mich? Hatte ich Angst darum, dass alles, was ich mir für mein Leben in Sidarap erträumte, nur die romantischen Vorstellungen eines naiven Kindes waren? Nein, darum ging es nicht.
Weitere Tränen rannen mir über die Wangen. Bei Adonai, gott- verdammt! Wütend wischte ich mir wieder durchs Gesicht. Ich sollte nicht so verweichlicht sein, egal was Eusebia mir erzählte. Warum heulte ich jetzt?
Ich drehte den Hahn auf und warf mir eiskaltes Wasser ins Gesicht. Dann betrachtete ich mich im Spiegel. Was war los mit mir? Zu Hause hatte ich doch auch nicht solche Ausbrüche gehabt. Ich starrte mir in die blauen Augen, deren Ränder ein wenig gerötet waren, atmete tief durch und versuchte, mich zu beruhigen. Aufgewühlt würde ich keine Antworten auf meine Fragen finden. Also gut.