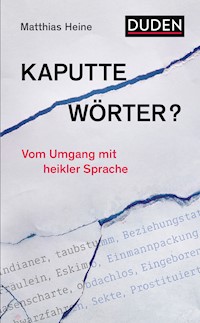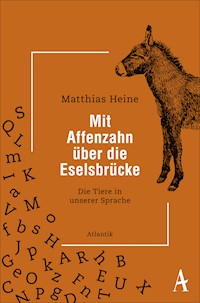9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sprache ist lebendig und verändert sich. Das mögen manche beklagen, wenn sich Anglizismen durchsetzen und aus Frankfurtern plötzlich Hot Dogs werden. Ein besonders gravierender Einschnitt in die Entwicklung der deutschen Sprache war jedoch der Erste Weltkrieg. Bis 1914 breitete sich Deutsch scheinbar unaufhaltsam aus – als führende Weltwissenschaftssprache ebenso wie als Amtssprache in den Kolonien oder in Osteuropa. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs gingen dem deutschen Sprachraum nicht nur slawische Nationen, Elsass und Lothringen oder Länder unter dem Äquator verloren, denen das Deutsche aufgezwungen worden war, sondern auch deutschsprachige Gebiete wie Südtirol. Der Erste Weltkrieg hat die deutsche Sprache in vielfältiger Hinsicht und bisher unbekannt großem Ausmaß für immer verändert. Hundert Jahre nach seinem Ende spürt Matthias Heine diesen weltweiten Folgen nach und entdeckt dabei Erstaunliches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Matthias Heine
Letzter Schultag in Kaiser-Wilhelmsland
Wie der Erste Weltkrieg die deutsche Sprache für immer veränderte
Hoffmann und Campe
Der verhängnisvolle Bindestrich der Deutsch-Amerikaner
Auf dem St.-Matthew-Friedhof der kleinen Stadt Collinsville im US-Staat Illinois, zwölf Meilen nordöstlich von St. Louis, steht ein erstaunlich neuer Granitgrabstein, in den der Name »Robert P. Prager« gemeißelt ist. Dann folgen die Lebensdaten des Toten, den auch eine Fotografie auf dem Quader zeigt, und schließlich ganz unten die Beschreibung seines Schicksals: »Victim of a Mob«. Man kann sagen, dass hier die deutsche Auswandererkultur der USA begraben liegt.
Der Mann, der unter dem Grabstein ruht, war ein Sachse, geboren wurde er am 28. Februar 1888 in Dresden. 1905 wanderte der 17-Jährige nach Amerika aus und arbeitete dann in verschiedenen Berufen, unter anderem als Bäcker und zuletzt als Kohlebergmann. In der Nacht vom 4. auf den 5. April 1918, ein gutes Jahr nach dem Eintritt der USA in den Krieg gegen Deutschland, wurde Robert Prager von einem Mob, zu dem zweihundert bis dreihundert Männer und Jungen gehörten, aus dem Gefängnis von Collinsville entführt. Man schleifte ihn an einem Seil, das man ihm um den Hals gelegt hatte, durch die Straßen, zerrte ihn zu einem Baum eine Meile westlich der Stadt und zwang ihn, die Flagge der USA zu küssen. Er durfte noch an seinen Vater Carl Heinrich Prager und seine Mutter in Dresden schreiben (in der Abendausgabe von »The St. Louis Globe-Democrat«, die über den Lynchmord berichtete, hieß die Stadt »Preston«): »Bitte betet für mich, liebe Eltern. Dies ist mein letzter Brief.« Dann zog man ihn an dem Seil um seinen Hals etwas drei Meter hoch und brach ihm das Genick. Der Mob hievte ihn noch zwei weitere Male hinauf, bevor man ihn bis zum nächsten Tag am Ast hängen ließ. Als Prager das erste Mal hochgezogen wurde, schrien seine Mörder: »One for the Red.« Beim zweiten Mal: »One for the White.« Beim dritten Mal: »One for the Blue.« The Red, White and Blue ist der in Deutschland weniger bekannte Name der US-Flagge, des Star Spangled Banner.
Robert Prager war das prototypische Opfer eines patriotisch aufgeheizten und besoffenen Lynchmobs: Registriert als »feindlicher Ausländer« (wie alle Deutschen, die nicht eingebürgert waren), ein Außenseiter mit einem Sendungsbewusstsein, das seinen Bergarbeiterkollegen auf die Nerven ging, unverheiratet und im Ruch der Asozialität stehend (er hatte auch Zeiten als Landstreicher hinter sich und war wegen Diebstahls in einer Besserungsanstalt gewesen), ein Freimaurer (seine Loge, die Odd Fellows, hat ihm den Grabstein spendiert und ihn 2006 auch noch einmal erneuert) und ein Mann mit abweichenden politischen Ansichten – er betätigte sich als linker Agitator, allerdings wohl nicht sehr geschickt.
Sein Verbrechen: Er hatte angeblich in einer Rede den Sozialismus propagiert und sich abwertend über Präsident Wilson geäußert. Als sich das herumsprach, machte erstmals ein Mob Jagd auf ihn und paradierte schließlich mit dem gefangenen Prager durch die Stadt. Die Polizei nahm ihn daraufhin in Schutzhaft und steckte ihn in eine Zelle des Gefängnisses, das sich im Keller des Rathauses befand. Den Polizisten gab Prager zu Protokoll, er habe keinerlei unpatriotische Dinge gesagt und er wolle amerikanischer Staatsbürger werden. Nach der Kriegserklärung hatte er sich die entsprechenden Papiere besorgt und sich freiwillig zur amerikanischen Marine gemeldet, die ihn allerdings nicht aufnahm.
Der Bürgermeister von Collinsville beruhigte die Massen, ordnete an, dass die Saloons an diesem Tage früher schließen sollten und ging dann nach Hause. Um 10 Uhr abends kam die Pogrom-Meute aber wieder, brach die Türen des Gefängnisses auf, drängte die Wärter beiseite und nahm den vermeintlichen Spion mit. Um Viertel vor eins wurde Prager gelyncht.
Es war nicht das erste antideutsche Pogrom in den Vereinigten Staaten. Doch bisher hatten sich die Mobs aufs Teeren und Federn ihrer Opfer beschränkt, eine Foltermethode, die in den USA Tradition hatte, seitdem man vor und während der Revolution Menschen, die lieber englische Untertanen geblieben wären, dieser Behandlung unterzog. Dem »St. Louis Globe-Democrat« ist zu entnehmen, dass in dem Jahr, in dem Prager gelyncht wurde, sechs Männer, darunter ein polnischer katholischer Priester in Christopher, einer anderen Bergbaustadt, 80 Meilen von St. Louis entfernt, geteert und gefedert wurden, weil sie im Verdacht standen, deutschfreundlich zu sein. Es gab in den Frühlingsmonaten zahlreiche Demonstrationen von »loyalen« Amerikanern, die zum Ziel hatten, »illoyale Personen aus dem südlichen Illinois« zu vertreiben.
Als der Illoyalität verdächtig galten spätestens seit dem Kriegseintritt nicht nur noch nicht Eingebürgerte wie Prager, sondern alle deutschstämmigen Amerikaner, die sich der Kultur ihres Heimatlandes nicht entfremdet hatten. Begonnen hatte diese bemerkenswerte Umkehrung der Verhältnisse schon 1915 nach der Versenkung des britischen Passagierdampfers und Munitionstransporters »Lusitania« durch ein deutsches U-Boot, bei der auch 124US-Bürger umkamen.
Deutsche waren bis zu dieser Zäsur die größte nicht Englisch sprechende Minderheit der USA. Bei Erhebungen gaben schon 1790 fast 277000 Amerikaner an, deutscher Abstammung zu sein – das waren immerhin 8,7 Prozent der Bevölkerung. In Pennsylvania existierte im frühen 19. Jahrhundert ein zusammenhängendes Gebiet, das größer als die Schweiz war und in dem etwa 200000 Deutschsprachige wohnten. Hier war Deutsch schon aufgrund der Zahl der Sprecher eine dem Englischen gleichberechtigte Sprache. Eine Amtssprache gab es dort nicht, und die USA haben bis heute keine offizielle Amtssprache. Bei der Volkszählung von 1910 wurden unter 92 Millionen Amerikanern mehr als 8,6 Millionen ermittelt, die Deutschamerikaner der ersten oder zweiten Generation waren. Darüber hinaus gab es natürlich noch eine ganze Menge amerikanischer Familien mit deutschem Migrationshintergrund, viele waren seit der Zeit im Lande, in der es noch eine britische Kolonie war. Die meisten Menschen, die das Deutsche beherrschten, lebten in den Staaten Ohio, Wisconsin und Minnesota.
Die Namen der Beteiligten und der Ort des Lynchmords an Robert Prager erzählen von dieser langen deutschen Siedlungsgeschichte: Der Bürgermeister von Collinsville trug den schönen deutschen Nachnamen Siegel und der Ort, an dem Prager gehängt wurde, heißt Mauer Heights. Zu den elf Männern, die im Juni 1918 wegen ihrer Beteiligung an dem Mord angeklagt und freigesprochen wurden, gehörten auch ein Joseph Riegel und ein William Brockmeier.
Da Zeiten gesellschaftlicher Unruhe auch solche wirtschaftlicher Unsicherheit sind, erreichte die deutsche Auswanderung im Revolutionsjahr 1830 und dann noch mal zwischen 1848 und 1854 ihr größtes Ausmaß. Allein in den 1850er Jahren kamen zwischen 900000 und einer Million Deutsche in die USA. Die deutsche Gesamtbevölkerung umfasste damals gerade mal 40 Millionen. Der Auswanderungsgrund war meist Not, zu drei Vierteln stammten die Immigranten aus Städten, zu 20 Prozent waren sie mittelständisch, nur höchstens drei Prozent suchten in den USA Asyl aus politischen oder religiösen Gründen. Bezeichnend ist, dass die Massenauswanderung ziemlich abrupt endete, als Deutschland sich in den 1890er Jahren zu einem hochindustrialisierten Land entwickelte.
Der Anpassungsdruck auf die Neuankömmlinge war gering: Deutschamerikaner kamen, wie es der Sprachhistoriker Peter von Polenz ausdrückt, »meist in relativ gute sozialökonomische Verhältnisse, als weitgehend Alphabetisierte, fachlich Ausgebildete in einem sich früh modernisierenden, politisch freiheitlichen Land«. Sie mussten ihre Wertvorstellungen deshalb selten ändern.
Deutschamerikaner beteten häufig in Kirchen, in denen Deutsch Liturgiesprache war. Sie lebten in Straßen oder Städten mit deutschen Namen. Und während eine ganze Menge von ihnen sich an die englischsprachige Kultur assimilierte, gab es auch viele, die ihre Kinder auf deutschsprachige Schulen schickten. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden Schulen, die bis dahin ausschließlich Deutsch unterrichtet hatten, zur Zweisprachigkeit gezwungen.
»Deutsch war die Lingua franca der Literaturszene, der Unterhaltungsbranche und der Theater«, sagte der Germanistikprofessor Richard E. Schade von der Universität Cincinnati in einem Beitrag des »Public Radio«, dem staatlichen Bildungsprogramm der USA, über die Zerstörung der deutschsprachigen Einwandererkultur im Ersten Weltkrieg. In dieses Milieu wurde der Künstler Lyonel Feininger 1871 in New York hineingeboren, als Sohn der beiden angesehenen deutschen Musiker Karl (später Charles) Feininger, eines Konzertgeigers, und Elisabeth Feininger, einer Pianistin und Sängerin. Feininger hatte keinerlei Anpassungsschwierigkeiten, als er mit sechzehn nach Deutschland kam, um die Kunstgewerbeschule in Hamburg zu besuchen.
Das Beispiel Feininger zeigt übrigens, dass damals die deutsche Herkunft eines Künstlers für die Amerikaner ein durchaus gültiges Kaufargument war (was heute nicht mehr unbedingt gesagt werden kann): Der Herausgeber der »Chicago Tribune«, James Keeley, reiste 1906 extra nach Deutschland, um Feininger und andere Zeichner für die Comicseite seines Blattes zu verpflichten. Dieser Großtransfer teutonischen Witzes hatte genau wie der deutsch klingende Titel von Feiningers Zeitungsserie, »The Kin-der-Kids«, einen doppelten Sinn: Zum einen sollte das alles die große deutschstämmige Gemeinde in Chicago anlocken, zum anderen galten die Deutschen damals dank Wilhelm Busch und einer langen Geschichte der politischen Karikatur als absolut exportfähige Humornation.
Im Allgemeinen war das Bekenntnis zur deutschen Kultur allerdings schon in der zweiten Generation oft ausgeprägter als die tatsächliche Beherrschung der deutschen Sprache. Die Zahlen derer, die bei Volkszählungen ihre deutsche Herkunft angaben, und derer, die das Deutsche wirklich noch benutzten, klafften schon vor dem Weltkrieg immer mehr auseinander.
Auch die Zahl der deutschen Zeitungen ging schon ab etwa 1900 zurück. Der Höchststand war kurz vor der Jahrhundertwende erreicht, als 800 verschiedene Blätter erschienen. Doch die Bindung an die alte Heimat blieb stark. Peter von Polenz schreibt süffisant: »Das rege nordamerikanische Vereinsleben Deutschstämmiger pflegte deutsche Geselligkeit und Folklore oft über das Ende wirklicher Beherrschung des Deutschen hinaus.« Treibstoff des sozialen Leben waren Biersorten, die nach den heimatlichen Traditionen gebraut und in Bierhallen german style getrunken wurden. Dazu wurde dann gerne frisches Hackfleisch verzehrt – mit fatalen Folgen: Deutsche waren neben Italienern die Bevölkerungsgruppe, die sich vor der Einführung der amtsärztlichen Trichinenkontrolle bei geschlachteten Tieren am häufigsten mit Trichinen infizierte.
Vor dem Ersten Weltkrieg war Deutsch gleichzeitig auch die meisterlernte Fremdsprache bei nicht deutschstämmigen Amerikanern. Ihr auch heute noch bekanntester Schüler war Mark Twain. Als er in »Bummel durch Europa« über »Die schreckliche deutsche Sprache« schrieb, konnte er aus intimer Kenntnis urteilen, denn er hatte einige Zeit in Berlin gelebt, wo es ihm so gut gefiel, dass er seine Töchter zum Studieren dorthin schickte. Noch länger lebte er in Wien, weil seine Tochter Clara bei Theodor Leschetizky Klavierunterricht nehmen wollte. Dort wurde er sogar zur Audienz bei Kaiser Franz Joseph eingeladen.
Noch 1915 lernten 25 Prozent aller Highschool-Studenten Deutsch. Innerhalb weniger Jahre veränderten sich die Zahlen drastisch: Am Ende des Krieges lehrte nur noch ein Prozent aller Highschools überhaupt die Sprache – so stigmatisiert war sie mittlerweile.
In 23 Staaten wurde Deutsch regelrecht kriminalisiert. Es war nicht erlaubt, die Sprache in der Öffentlichkeit zu benutzen, sie durfte im Radio nicht gebraucht werden und man durfte sie einem Kind unter zehn Jahren nicht in der Schule beibringen. Als der Supreme Court 1923 diese Gesetze außer Kraft setzte, war die Zurückdrängung des Deutschen in den USA längst nicht mehr aufzuhalten.
In dem genannten Public-Radio-Beitrag erklärt der Rechtshistoriker Paul Finkelman: »Es gab damals die Annahme, dass Sprache irgendwie organisch mit der Seele verbunden sei. Während des Kriegs fürchtete man, dass jemand, der Deutsch lernt, wie ein Deutscher dächte und alles zugunsten des Kaisers ausgelegt würde – er würde ein ›Hunne‹ werden.« Hunne war das Schimpfwort, das zunächst die englische und dann auch die amerikanische Propaganda für die Deutschen gebrauchte. Eingebrockt hatte es seinem Volk Kaiser Wilhelm II. mit der berüchtigten »Hunnenrede«, die er 1900 vor einem Expeditionskorps hielt, dass in China den Boxeraufstand niederschlagen sollte. Darin steigerte sich der Monarch in einen verbalen Blutrausch: »Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen! Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, daß es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!«
Aller Hunnenpropaganda zum Trotz waren die Amerikaner während der ersten drei Jahre uneins, ob das Land auf Seiten der englisch-französisch-russischen Entente in den Krieg eintreten sollte. Zu den Gegnern einer solchen Parteinahme gehörten keineswegs nur deutschstämmige Amerikaner, ihr prominentester Vertreter war der bis 1915 amtierende Außenminister William Jennings Bryan, der das Land um fast jeden Preis aus dem europäischen Konflikt heraushalten wollte.
Naturgemäß ergriffen gerade deutschstämmige Amerikaner oft für die Heimat ihrer Vorfahren Partei: Einer der prominentesten war der entfernt mit Bismarck verwandte, aber schon in Baltimore geborene Journalist und Satiriker Henry Louis Mencken, also ausgerechnet der Mann, der später zwischen den Kriegen mit einem grundlegenden Buch das amerikanische Englisch als eigenständige Variante der englischen Sprache propagierte. Manch einer ging sogar über den Atlantik, um für Deutschland zu kämpfen. Ernst Jünger erzählt in seinem Kriegsbuch »In Stahlgewittern« von einem Deutschamerikaner namens Brecht, der einen Engländer gefangen nimmt und ihn ganz zünftig angelsächsisch als »son of a bitch« beschimpft.
All das nährte das grundsätzliche Misstrauen gegenüber der Loyalität der deutschstämmigen US-Bürger. Sie wurden als »hyphenated Americans«, als Bindestrich-Amerikaner, verunglimpft. Als Präsident Woodrow Wilson das Land schließlich an der Seite der Entente in den europäischen Krieg geführt hatte, sagte er: »Jeder Mann, der einen Bindestrich mit sich herumträgt, trägt einen Dolch, den er in die lebenswichtigen Organe dieser Republik zu stoßen bereit ist, wenn er dazu kommt.«
Der Germanist Schade charakterisiert das Klima, das durch solche Äußerungen entstand, wie folgt: »Hans Kuhnwald, der Konzertmeister des Cincinnati Symphonieorchesters, wurde interniert, die deutsche Sprache war verboten, die deutsch-amerikanische Presse schärfstens zensiert, Büchereien mussten deutsche Bücher aus ihren Regalen nehmen, deutsch-amerikanische Organisationen gerieten unter Beschuss.«
In dieser Atmosphäre distanzierten sich auch Amerikaner, die ihre deutschen Wurzeln über Generationen gepflegt hatten, von der alten Heimat, um zu beweisen, dass sie gute, loyale Yankees waren. Der Historiker Frederick Luebke hat diese Kapitulation in seinem Buch »Bonds of Loyalty: German-Americans and World War I« beschrieben: »Sie versuchten, ihre ethnische Identität so schmerzlos wie möglich abzustreifen.«
Auch Robert Prager hat so etwas versucht, als er sich 1917 freiwillig zur Marine meldete. Gegenüber dem Mob, der ihn peinigte, beschwor er die Liebe zu seinem neuen Heimatland und küsste die Fahne, die man ihm hinhielt. Es half nichts. Sie schleiften ihn nackt durch die Straßen von Collinsville. Ihre Bierflaschen zerschlugen die sadistisch erregten Männer und Jungen vor Pragers Füßen, sodass er barfuß in die Scherben treten musste. Dann hängten sie ihn. In der Lokalzeitung stand später: »Die Lektion seines Todes hatte einen gesunden Effekt auf die Germanisten von Collinsville und anderswo.«
Das Ende der Ausdehnung
Bis 1914 war Deutsch eine expandierende Sprache. Jahrhundertelang hatte sie zuvor ihren Geltungsbereich vor allem im Osten Europas ausgedehnt. Aus den deutschen Stammlanden waren Menschen in einstmals rein slawische Siedlungsgebiete gewandert – es begann mit der Kolonisation des heutigen Sachsens, Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns und setzte sich fort mit der Besiedlung Schlesiens, West- und Ostpreußens sowie Böhmens und Mährens im Mittelalter. Aber es gingen auch ganze indigene Bevölkerungsgruppen dazu über, Deutsch als Erst- oder Zweitsprache zu sprechen, nachdem sie zu einer Minderheit im eigenen Land geworden waren – beispielsweise die Wenden in Mitteldeutschland, die Pruzzen in Ostpreußen, die Kaschuben in Westpreußen, ebenso viele slawische Bevölkerungsgruppen in Österreich. Das glich die Verluste im Westen, wo die einstmals deutschen Elsass und Lothringen unter französische Herrschaft kamen, mehr als aus.
Bis dahin hatten für gut hundert Jahre auch Städte und Gebiete in Übersee zum Geltungsbereich des Deutschen gehört. Migranten nahmen ihre Muttersprache mit in die USA und nach Kanada und nutzten sie dort weiter – bis die antideutschen Aufwallungen der Jahre 1914 bis 1918 die deutsche Auswandererkultur in Nordamerika entscheidend schwächten, wie im vorherigen Kapitel geschildert.
In den drei Jahrzehnten vor dem großen Krieg war das Deutsche auch an Orte vorgedrungen, an denen vorher bestenfalls mal ein verirrter Missionar, Walfänger oder Kaufmann Worte in der Sprache Luthers und Goethes hatte fallen lassen – ohne dass ihn jemand verstand oder gar ihm nachsprach. In den Kolonien in Afrika, China und im Südwestpazifik redeten Soldaten, Priester, Beamte und Kolonisten Deutsch und brachten so auch Einheimische dazu, sich immer häufiger Grundkenntnisse der Sprache des Tausende von Kilometern entfernten Landes anzueignen. Kurz vor Ausbruch des Krieges wurde die Ausbreitung des Deutschen auch durch eine systematische Schulpolitik gefördert.
Aber nicht nur räumlich expandierte das Deutsche. Ihm war auch Bedeutung zugewachsen durch die Machtstellung, die erst Preußen und dann das vereinigte Reich in der Welt erlangt hatten. Die Erfolge deutscher Wissenschaftler und der Glanz deutscher Kultur trugen ihres dazu bei, das globale Prestige der Sprache zu stärken.
Das alles endete mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Von da an schrumpfte der Geltungsbereich des Deutschen. Nicht nur, weil die Kolonien verloren gingen. In Osteuropa begann jener historische Prozess, der zum weitgehenden Ende jedes Deutschtums dort führte und den wir gemeinhin erst mit dem Jahr 1945 in Verbindung bringen. Im Süden wurde ein Gebiet, in dem tausend Jahre lang Deutsch gesprochen worden war und das nie zum romanischen Sprachraum gehört hatte, an Italien verhökert, das sofort begann, die Südtiroler linguistisch umzuerziehen.
Die alliierte Gräuelpropaganda, brutales deutsches Großkotzgetue, aber auch organisierte Boykotte verleideten vielen Menschen in anderen Ländern die Lust an der deutschen Sprache. Vielerorts waren nicht einmal mehr deutsche Namen geduldet. Dem gegenüber standen kleinere Zugewinne an der Heimatfront: ein paar Dutzend ganz neue Begriffe, die der Krieg geboren hatte, und etliche Verdeutschungen für Fremdwörter, die sich nun erst richtig durchsetzten.
Die Auswirkungen, die der Erste Weltkrieg auf unsere Muttersprache hatte, waren also vielfältig und massiv. Trotzdem ist dem Globalkonflikt in den vielen Büchern historisch arbeitender Linguisten kein eigenes Kapitel gewidmet. Selbst wenn sie so dick und ausführlich sind wie die dreibändige »Deutsche Sprachgeschichte« des Germanisten Peter von Polenz, gehen sie direkt vom 1871 gegründeten Kaiserreich zur Weimarer Republik über.
Dabei werden die genannten Auswirkungen ja von der germanistischen Sprachgeschichtsschreibung gar nicht verschwiegen. Man muss sie nur einzeln und mühselig überall zusammensuchen. Mein Buch ist ein Versuch, hundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs alle seine Folgen für das Deutsche zu skizzieren. Soweit ich sehe, ist es der erste.
Die Auswahl der thematischen Schwerpunkte ist dabei allein meine, und ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit im Sinne eines Handbuchs. Nicht jede Kolonie wird gleichermaßen ausführlich behandelt. Gerade das bekannteste Beispiel Deutsch-Südwestafrika beschreibe ich etwas knapper, weil das, was dort geschah, noch am ehesten vertraut ist. Die ferne und fremde Welt Neuguineas oder Chinas scheint mir interessanter. Auch in Europa betrauere ich nicht jedes abhandengekommene Gebiet ausführlich. Das Elsass und Lothringen kommen vor, aber sie waren ja erst 1871 zurück zum Reich gekommen, gehörten eigentlich schon viel länger zur französischen Sphäre und haben nicht erst 1918 aufgehört, deutsch zu sein. Im Osten beschränke ich mich beispielhaft auf Westpreußen, Österreich-Ungarn als Ganzes und den Sonderfall Böhmen und Mähren, die spätere Tschechoslowakei.
Am Ende all dieser Gedankenreisen wird die Frage stehen: Was wäre eigentlich anders gewesen, wenn die beschriebenen Entwicklungen nicht durch den Krieg und die Niederlage 1918 eingeleitet worden wären? Haben wir Grund zur Trauer, gibt es so etwas wie verpasste Chancen? Das titelgebende Kaiser-Wilhelmsland steht in diesem Spiel nicht nur für den alten Namen der Kolonie Deutsch-Neuguinea, sondern auch für eine Alternativwelt, in der die Sprachgeschichte einen ganz anderen Gang nimmt.
Der Verrat an Südtirol
Kaum einer, der im Supermarkt luftgetrockneten Speck mit der wohlklingenden, die Aura italienischer Delikatessen evozierenden Herkunftsbezeichnung Alto Adige kauft, ist sich bewusst, dass er damit unschuldig in den Bahnen der faschistischen Nationalitätenpolitik der zwanziger Jahre wandelt. Denn was in Italien Alto Adige heißt, heißt auf Deutsch Südtirol, und der italienische Name wurde erfunden, um den dortigen Deutschsprechenden ihre kulturelle Identität zu rauben. Propagiert und durchgesetzt hat ihn – wie viele hundert andere Bezeichnungen für Berge, Flüsse und Orte, die man vorher in fast einem Jahrtausend nie anders als mit deutschen Namen benannt hatte – ein Mann, der unter dem angemaßten Titel »Sprachwissenschaftler« das Geschäft Mussolinis und der italienischen Ultranationalisten betrieb: Ettore Tolomei.
Obwohl der Erste Weltkrieg vor allem von den 1917 in ihn eingetretenen USA und ihrem Präsidenten Woodrow Wilson zum Kampf für das Selbstbestimmungsrecht der Völker Europas stilisiert wurde, gelangte der südliche Teil des seit Jahrhunderten zu Österreich gehörenden Tirols 1919an Italien. Es war ein Beutestück, das die Italiener sich im Geheimvertrag von London 1915 hatten zusichern lassen. Dieser vom Londoner Botschafter mit dem sprechenden Namen Guglielmo Imperiali ausgehandelte Pakt mit den alliierten Mächten Großbritannien, Frankreich und Russland sah vor, dass Italien in den Krieg gegen Österreich, das Osmanische Reich und Deutschland eintreten sollte. Im Gegenzug wurden den Italienern im Fall des Sieges unter anderem Gebietsgewinne an ihren Grenzen, Teile der Türkei sowie Kolonien in Afrika versprochen.
Grundlage der italienischen Politik war der Irredentismus, eine Ideologie, die anstrebte, alle Gebiete, in denen Italiener lebten, unter der Herrschaft Roms im 1861 gegründeten Nationalstaat zu vereinigen. Dabei ging es zunächst vor allem um Triest und das Trentino, in denen tatsächlich ein großer Anteil der Bevölkerung Italienisch sprach und sich der italienischen Kultur zugehörig fühlte. Später wurden die Ansprüche auch auf ganz Istrien, Dalmatien und eben den Süden Tirols ausgedehnt.
In diesem Gebiet lebten seit dem sechsten Jahrhundert zunächst Bajuwaren, die eine Variante des Germanischen sprachen, dann Bairisch sprechende Menschen – auch die Dialekte des heutigen Österreichs sind Existenzformen des Bairischen. Zu Italien hatten nur Bozen und das südlich davon liegende Gebiet gehört, und das auch nur zwischen 1810 und 1813, als Napoleon es im Zuge seiner willkürlichen Aufteilung des eroberten Europas seinem kurzlebigen italienischen Königreich zuschlug.
Dennoch musste Österreich 1919 im Friedensvertag von Saint-Germain den Teil Tirols südlich von Brenner und Reschenpass an Italien abtreten. Die Bevölkerung wurde nicht befragt, ob sie diesen Staatenwechsel wünsche. Erst im Zuge dieses Verbrechens fingen seine Bewohner an, von Südtirol zu sprechen. Vorher war Tirol als eine Einheit betrachtet worden, für deren südlichen Teil man keine gesonderte Regionsbezeichnung brauchte. Den etwa 250000 deutschsprachigen Südtirolern wurde vertraglich die kulturelle Autonomie zugesichert.
Doch damit war es spätestens vorbei, als Benito Mussolini und seine Faschisten 1922 an die Macht gelangten und der Duce ab 1925 als Diktator unumschränkt herrschte. Der Traum von der Wiederkehr des Imperium Romanum sollte auch mit den Mitteln der Sprache verwirklicht werden. Eine möglichst hochkulturelle Nationalsprache hatte dabei Symbolfunktion, auf ihren Gebrauch verpflichteten die Faschisten alle Dialektsprecher und natürlich erst recht die nationale Minderheit, zu der die Tiroler plötzlich in einem fremden Land geworden waren. Obwohl sie in ihrem Gebiet die Mehrheit stellten, wurde ihre Sprache diskriminiert, zurückgedrängt und schließlich in der Öffentlichkeit und in den Schulen verboten.
Dazu kam eine planmäßige Ansiedlung von Italienern aus anderen Regionen des Landes, vor allem in den Städten und Tälern, die für den Verkehr wichtig waren. Der Anteil Italienischsprachiger wuchs von acht Prozent im Jahre 1910 auf etwa 35 Prozent in den dreißiger Jahren. In der Hauptstadt Bozen stieg er sogar auf vier Fünftel an. Zu Rückzugsgebieten der deutschen Sprache wurden die von Landwirtschaft und Fremdenverkehr geprägten Hochlagen.
Orts- und Familiennamen, ja sogar Grabinschriften mussten unter der Herrschaft des Faschismus italianisiert werden. Besonders einfallsreich war dabei der zu Beginn erwähnte Ettore Tolomei. Er glaubte, dass die natürliche Grenze seines Landes auf dem Alpenkamm, der Wasserscheide zwischen Nord und Süd, zu ziehen sei und die Ansiedlung deutschsprachiger Bajuwaren jenseits dieser Linie nur ein Irrweg der Geschichte sein könne. Er nahm sich vor, das zu korrigieren. Schon seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatte er die Einverleibung Südtirols ins italienische Staatsgebiet mit seiner Zeitschrift »La Nazione Italia« vorbereitet, indem er für Orte, die niemals italienische Namen getragen hatten, kurzum welche erfand. So sollte die Welt davon überzeugt werden, dass diese Gebiete eigentlich zu Italien gehörten. Den Berg mit dem knorrigen Tiroler Namen Klockerkarkopf taufte er in Vetta d’Italia (»Gipfel Italiens«) um. 1904 bestieg er den Gipfel und behauptete, er wäre damit der Erste gewesen. Noch eine Lüge. Der Berg war schon 1895 bezwungen worden – unpassenderweise von zwei Männern mit tirolisch-deutschen Namen. In Südtirol kursiert die Legende, dass der Name Vetta d’Italia den amerikanischen Präsidenten Wilson, der ja eigentlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker nach Kriegsende propagiert hatte, überzeugte, das Gebiet gehöre zum italienischen Königreich. So hatte er nichts dagegen, dass im Friedensvertrag von 1919 die Brennergrenze festgelegt wurde. Weil offenbar auch viele Italiener glaubten, sie hätten die Gebietserweiterung Tolomei zu verdanken, wurde dieser 1938 von König Vittorio Emanuele III. zum »Conte della Vetta«, also »Graf des Gipfels«, geadelt.
1916, ein Jahr nach dem Kriegseintritt Italiens, begann Tolomei in freudiger Erwartung der Kriegsbeute und im offiziellen Auftrag der römischen Regierung das »Prontuario dei nomi locali dell’Alto Adige« zu erstellen. Für dieses »Nachschlagewerk der Ortsnamen Oberetschs« übersetzte eine Kommission, die neben Tolomei aus dem Botanik- und Chemieprofessor Ettore De Togni und dem Bibliothekar Vittorio Baroncelli bestand, innerhalb von 40 Tagen ungefähr 12000 Namen von Orten und Fluren. 1923, vier Jahre nach der Einverleibung Südtirols in den italienischen Staat und ein Jahr nach der Machtergreifung der Faschisten, ordnete der König per Dekret die Italianisierung sämtlicher Ortsnamen an. Grundlage war Tolomeis Machwerk.
Die Methoden zur Namensfindung, die Tolomei anwandte, hat er in der Einleitung zu seinem »Prontuario« beschrieben. Manchmal gab es tatsächlich bereits italienische Namen wie Merano und Bolzano für Meran und Bozen. Manchmal griff er die Namen alter Römersiedlungen auf – so wurde aus Sterzing Vipiteno, weil dort in der Antike ein Ort namens Vipitenum existiert hatte. Dabei gab es hier sogar schon einen italienischen Namen: Sterzen – aber das klang wohl noch zu deutsch. Oft hängte Tolomei einfach nur ein O an, um die Namen zu italianisieren, so wurde aus dem Brenner der Brennero. Wo es möglich war, übersetzte er einfach wörtlich, beispielsweise Grünsee in Lago Verde. Gelegentlich benannte er die Orte nach dem lokal zuständigen Heiligen. Innichen wurde dabei etwa zu San Candido. Und zu schlechter Letzt formte er Namen aus einer Beschreibung der geografischen Lage. Aus Gossensaß wurde auf diese Weise Colle Isarco, also der Hügel am Eisack, nur weil sich eben die prachtvolle barocke Pfarrkirche auf einer Erhebung neben dem Fluss befand.
Mit den Ortsnamen wollte Tolomei, der seit 1919 Mitglied der faschistischen Partei war, sich aber nicht begnügen. Im Juli desselben Jahres, in dem der König sein diesbezügliches Dekret erließ, stellte Tolomei im Theater von Bozen sein vom faschistischen Großrat genehmigtes Programm vor, das die folgenden Punkte vorsah: Revision der Volkszählung von 1921, Einführung des Italienischen als Amtssprache, Auflösung der deutschen Verbände und Vereine, Einstellung deutscher Zeitungen, Entlassung deutscher Beamter und Polizisten, Unterdrückung der Kirche, Ummodelung des Schulwesens, wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen sowie die Änderung von Straßennamen, öffentlichen Aufschriften und Familiennamen.
Die »Vorarlberger Zeitung« berichtete darüber unter der Überschrift »Die Entnationalisierung Südtirols«:
Im Bozener Stadttheater entwickelte der italienische Senator Tolomei ein Reformprogramm für Südtirol. Führt die Regierung Mussolini dieses Programm durch, was nach der