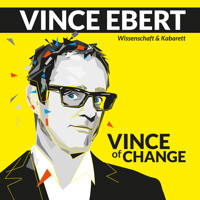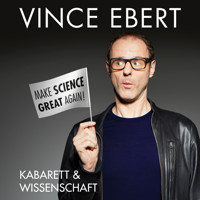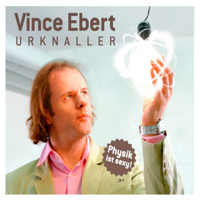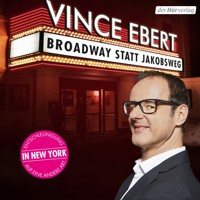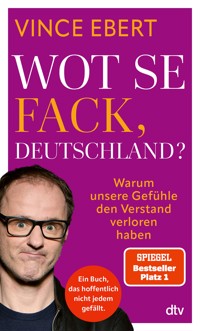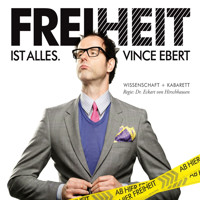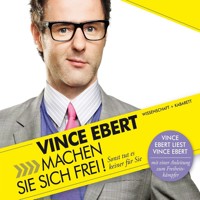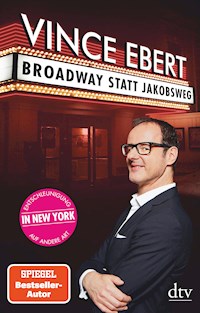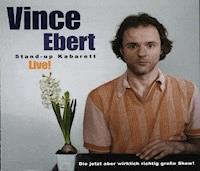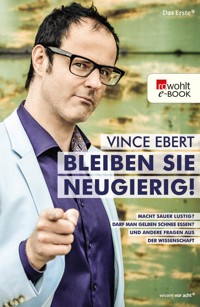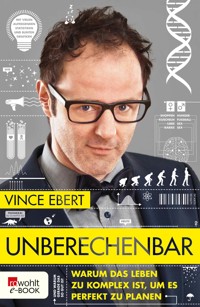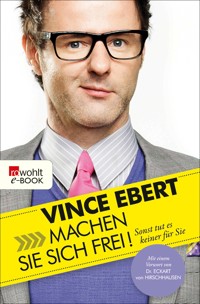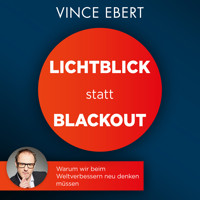
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HERBERT Management
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Gedankenblitze statt Blackout! Kann eine Nation, die mit dem Bau eines Flughafens überfordert war, wirklich das Weltklima retten? Und lässt sich die Erderwärmung reduzieren, wenn man das Eisfach offen lässt? Mit humoristischer Feder hinterfragt Vince Ebert unseren Ehrgeiz, die Welt zu retten. Klimaforschung ist objektive Wissenschaft. Klimapolitik dagegen ist verhandelbar. Wir tun möglicherweise aus den richtigen Gründen das Falsche. Dass sich unsere Erde erwärmt, ist klar. Fraglich sind die Konsequenzen, die wir ziehen. Könnte die Anpassung an den Klimawandel zielführender sein, als der Versuch, ihn zu verhindern? Was tun, wenn das 1,5-Grad-Ziel nicht zu halten ist? Müssen wir über Kernenergie neu reden? Eberts Plädoyer für eine Debatte ohne Scheuklappen ist überfällig.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Kann eine Nation, die mit dem Bau eines Flughafens überfordert war, wirklich das Weltklima retten? Und lässt sich die Erderwärmung reduzieren, wenn man das Eisfach offen lässt?
Mit humoristischer Feder hinterfragt Vince Ebert unseren Ehrgeiz, die Welt zu retten. Klimaforschung ist objektive Wissenschaft. Klimapolitik dagegen ist verhandelbar. Wir tun möglicherweise aus den richtigen Gründen das Falsche. Dass sich unsere Erde erwärmt, ist klar. Fraglich sind die Konsequenzen, die wir ziehen.
Könnte die Anpassung an den Klimawandel zielführender sein, als der Versuch, ihn zu verhindern? Was tun, wenn das 1,5-Grad-Ziel nicht zu halten ist? Müssen wir über Kernenergie neu reden?
Eberts Plädoyer für eine Debatte ohne Scheuklappen ist überfällig.
Vince Ebert
Lichtblick statt Blackout
Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen
Inhalt
Intro
1992 fand zum ersten Mal der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung statt – auch Erdgipfel genannt. Zehntausende Aktivisten, Bürokraten und Politiker ließen sich in Kerosin verbrennenden, Treibhausgase ausstoßenden Flugzeugen nach Rio de Janeiro transportieren, um sich in intensiven Gesprächen Gedanken über die ökologische Zukunft unserer Erde zu machen.
Bald danach erkannte auch die Industrie die Dringlichkeit des Umweltthemas. 2002 startete Krombacher sein legendäres Regenwald-Projekt, bei dem man mit jedem gekauften Kasten Bier einen Quadratmeter Grünfläche in Zentralafrika schützen konnte. Die Kampagne schlug ein wie eine Bombe. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit konnte man sich beim Junggesellenabschied mit ökologisch gutem Gewissen die Birne wegschießen. »Nein, nein. Ich mach das nicht zum Vergnügen. Es ist halt wegen dem Klima …«
Getoppt wurde die Idee nur noch von einem Hersteller für batteriebetriebene Vibratoren, die man mit einer ausklappbaren Handkurbel ganz nachhaltig wieder aufladen kann. 30 Minuten kurbeln für fünf Minuten Spaß. Ich glaube, Öko-Test hat damals das Prädikat »befriedigend« vergeben.
Inzwischen wird die Forderung, unsere Welt zu retten, immer vehementer vertreten. Bei der jüngsten Klimakonferenz in Glasgow wurde sogar zeitweise der Luftraum für normale Flugreisende gesperrt, damit ein Teil der umweltbewegten Eliten mit ihren 400 Privatjets anfliegen konnten, um zwei Wochen lang über Ressourcenverschwendung zu sprechen.[1] Konservativen Schätzungen zufolge verursachte alleine deren Anreise 13 000 Tonnen Kohlendioxid. Das entspricht der Menge, die etwa 1 600 Schotten in einem Jahr verbrauchen. Aber wenn’s um Weltrettung geht, darf man auf solche Kleinigkeiten keine Rücksicht nehmen.
Nichts wird in der westlichen Wohlstandsgesellschaft häufiger beworben als öko, bio und grün. Jeder Türstopper ist glutenfrei und fair gehandelt, jede Espressomaschine klimaneutral. Es gibt praktisch keinen Brotaufstrich, keinen Immobilienfonds und keine Fußcreme mehr, die nicht irgendwie nachhaltig daherkämen. Aldi verkauft Biogemüse, die Fluglinie Eurowings gibt ein Bordmagazin auf Umweltschutzpapier heraus, in dem vegane Taschen, Demeter-Käse im Glas und CO2-frei produzierte Fenster eines Herstellers angepriesen werden, der auf Naturstrom setzt.
Die Deutsche Bahn hat diesen Trend schon länger erkannt. Vor einigen Jahren wurde mir beim Fahrkartenkauf der Tarif »Umwelt-Plus« angeboten. »Damit können Sie mit dem ICE von Frankfurt nach Berlin ganz bewusst mit Ökostrom fahren«, sagte die freundliche Dame am Ticketschalter. »Und ohne diesen Tarif?«, entgegnete ich. »Naja«, meinte sie leicht verunsichert, »… ohne Umwelt-Plus fahren Sie dann wohl leider mit normalem Strom.«
Faszinierend. Die Deutsche Bahn hat es geschafft, die Stromversorgung in einem ICE so zu individualisieren, dass jeder Reisende abhängig von seinem Tarif seinen eigenen Strom bekommt. Das ist deutsche Ingenieurskunst.
Wenn man früher ein guter Mensch sein wollte, reichte es aus, seine Mitmenschen gut zu behandeln und den jährlichen Ölwechsel seines Golf nicht im Naturschutzgebiet durchzuführen. Heutzutage macht’s unter Weltrettung keiner mehr.
Jede noch so kleine Alltagsentscheidung muss inzwischen überdacht werden, um nicht als rücksichtsloser Umweltdämon zu gelten. »Plastiktüten? Bist du wahnsinnig? Den Fernseher auf Stand-by? Nee, geht gar nicht mehr! Ein Flug zu der Patentante nach Berlin? Aber nur, wenn du die Meilen kompensierst! Und bau endlich einen Spülstopp in deine Toilette. Weißt du nicht, dass in Eritrea Menschen verdursten …?«
Aber es nützt alles nichts. Konnten wir noch vor wenigen Jahren unsere Seele mit dem Bau von Krötentunneln oder einer monatlichen Spende für den WWF beruhigen, so leben wir derzeit in einer Spirale des immer stärker werdenden schlechten Gewissens. Tagtäglich wird uns vor Augen geführt, dass es weniger unser konkretes Verhalten ist, das den Planeten ruiniert. Nein. Es ist alleine schon die Tatsache, dass es uns überhaupt gibt. 2017 haben schwedische Wissenschaftler berechnet, dass es zehnmal mehr CO2 verbraucht ein Kind aufzuziehen, als ein Auto zu besitzen.[2]
In dieser Hinsicht bin ich wenigstens fein raus. Als kinderloser Kabarettist könnte ich vermutlich mit einem Leopard-2-Panzer auf Tour gehen und hätte gegenüber einer Kleinfamilie immer noch das Klima geschützt.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Als studierter Physiker bin ich weder ein Leugner des menschlichen Einflusses auf den Klimawandel, noch glaube ich, dass es keine großen ökologischen Probleme auf diesem Planeten gibt. Und ich glaube erst recht nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken sollten, um möglichst bequem weitermachen zu können.
Wie wahrscheinlich jedem von Ihnen liegt auch mir unsere Zukunft am Herzen. Doch gerade deswegen frage ich mich, ob unsere hochtrabenden Pläne, die Welt zu retten, die Welt wirklich zum Besseren hin verändern werden.
Der Klimawandel findet statt, und er wird in großem Maße von Kohlenstoffdioxid verursacht, das wir seit der industriellen Revolution durch das Verbrennen von fossilen Energieträgern freisetzen. Dadurch hat sich in den letzten 200 Jahren die Erde um etwa ein Grad Celsius erwärmt. Diese Entwicklung hält bis zum heutigen Tag an und stellt aus vielerlei Gründen ein zunehmendes Problem dar. Wir sollten also dringend etwas tun. Aber was genau?
Wie ich in diesem Buch darlegen möchte, spricht einiges dafür, dass wir Maßnahmen ergriffen haben, die zwar gut gemeint sind und edlen Beweggründen entspringen, aber die unterm Strich sehr wenige der Probleme lösen, ja sie mitunter sogar noch verschlimmern. Vielleicht tun wir aus den richtigen Gründen das Falsche?
Aus Sorge um unsere Zukunft haben wir begonnen, Kernkraftwerke abzuschalten, und wollen spätestens im Jahr 2030 auch auf Kohlestrom verzichten. Wir träumen davon, mit Elektroautos und Wärmepumpen den Planeten zu retten, und setzen seit Jahren mehr und mehr auf erneuerbare Energien, die unerfreulicherweise nur dann zur Verfügung stehen, wenn der Wind weht und die Sonne scheint.
Bis vor Kurzem wähnten wir uns noch auf dem richtigen Weg. Doch dann marschierte Putins Armee in die Ukraine ein, und schlagartig realisierten wir, dass wir uns mit unserer Konzentration auf Klimaschutz, Energiewende und Weltrettung energiepolitisch abhängig gemacht haben von einem Diktator, an dessen Gaslieferungen wir hängen wie ein Junkie an der Nadel.
Ironischerweise hatte 2018 Präsident Donald Trump bei der UN-Vollversammlung die deutsche Regierung vor genau einer solchen blauäugigen Abhängigkeit gewarnt. Die deutsche Delegation lachte ihn damals aus. Trump, den nach wie vor elf von zehn Deutschen unerträglich finden, sprach aus, was wir am 24. Februar 2022 alle schmerzlich feststellen mussten: Richtiges wird nicht falsch, nur weil es vom Falschen gesagt wird.
Putins Invasion zwingt uns, unsere Perspektive auf die Welt und unsere Strategien der Weltverbesserung wieder etwas gerader zu rücken. Plötzlich kollidieren unsere ambitionierten Pläne, das Land klimaneutral und kernenergiefrei umzubauen, mit der Realität. Es ist traurig, aber offenbar brauchen wir erst ein solch fürchterliches Ereignis, um zu erkennen, dass wir bei der Gestaltung einer lebenswerten Zukunft mehr Dinge berücksichtigen müssen als die Idee, als Weltrettungs-Weltmeister in die Geschichte einzugehen. Putins Invasion sollte uns wachrütteln und als Appell dienen, hin zu mehr Pragmatismus und weg von zu viel Naivität. Wenn wir also in Zukunft nicht auf einen Blackout zusteuern wollen, brauchen wir einen neuen, frischen, unverstellten Blick auf unser weiteres Vorgehen.
Wer glaubt, die ganze Welt retten zu müssen, kann ohnehin nur scheitern. Denn er verfällt einer Utopie. Und wie viele gesellschaftliche Utopien der Vergangenheit gezeigt haben, tritt am Ende meist das genaue Gegenteil von dem ein, was man ursprünglich angestrebt hat.
Weltretten ist also keine Lösung. Was natürlich keineswegs heißt, dass wir uns zukünftig nicht mehr um den Klimawandel, um saubere Energien und um die vielen anderen ökologischen Probleme kümmern sollten. Aber ich glaube, dass wir dazu dringend ein paar andere Ansätze verfolgen müssen. Nicht, um die Welt als Ganzes zu retten, sondern um sie ein Stückchen besser zu machen.
Alleine dieser Gedanke fällt uns Deutschen naturgemäß schwer. Denn im Zweifel gibt’s bei uns nur alles oder nichts. Mit halben Sachen geben wir uns nicht zufrieden. Mit unserer bekannt deutschen Gründlichkeit versuchen wir, die gesamte Gesellschaft ökologisch umzugestalten. Und wenn es hie und da trotzdem nicht gelingt, dann muss sich gefälligst die Realität besser an unsere Wunschvorstellungen anpassen. Was zum Beispiel spricht eigentlich dagegen, einen Solarpark unter Flutlicht zu betreiben? Dann nämlich könnte er sogar nachts Strom produzieren! Rein technisch wäre das heute schon machbar. Aber die großen Konzerne verhindern das leider.
Doch Scherz beiseite. Tatsächlich gibt es durchaus andere Wege, unsere ökologischen Probleme anzugehen. Ideen, die unkonventionell sind und die gänzlich außerhalb unseres derzeitigen grünen Tunnelblicks liegen. Kurzum: Wir müssen beim Weltverbessern neu denken.
Um Ihnen diese Ideen näherzubringen, muss ich allerdings ein paar Tabus angreifen. So werde ich zum Beispiel das Konzept der Nachhaltigkeit hinterfragen, ich werde die Realisierbarkeit der Energiewende anzweifeln oder das Mantra von der Knappheit der Ressourcen.
Ich werde also alles daransetzen, an ein paar Ihrer lieb gewonnenen Überzeugungen und Weltbilder zu rütteln. Manche Gedanken in diesem Buch könnten Ihnen daher Unbehagen bereiten oder Sie sogar in Rage versetzen. Einige Schlussfolgerungen werden Ihnen merkwürdig oder absurd erscheinen. Entweder weil sie dem üblichen Erklärungsmuster widersprechen, oder weil es Lösungsansätze sind, die wir nicht hören wollen.
Eines jedoch möchte ich gleich zu Anfang klarstellen: Bei aller Kritik geht es mir in diesem Buch definitiv nicht darum, die Anliegen der Umwelt- und Klimabewegung lächerlich zu machen. Als Wissenschaftskabarettist ziehe ich naturgemäß gern Dinge durch den Kakao und versuche mit den Mitteln des Humors, Widersprüche und Denkfehler aufzuzeigen.
Das gilt selbstverständlich genauso für die Gruppe der Klimaleugner und Verschwörungstheoretiker. Wenn ich auf den folgenden Seiten manche Maßnahmen zum Klimaschutz als nicht besonders zielführend ansehe oder darlege, dass die ein oder andere Behauptung von Umweltaktivisten wissenschaftlich nicht erwiesen ist, mache ich mich natürlich nicht gemein mit den unwissenschaftlichen Thesen der Gegenseite, die glaubt, der Klimawandel wäre eine Erfindung von Al Gore und Greta Thunberg. Ich erwähne das deshalb, weil einige Leugner des menschengemachten Klimawandels möglicherweise versuchen werden, einzelne Sätze meines Buches aus dem Zusammenhang zu reißen, um damit ihre Ideologie zu rechtfertigen. Und ich erwähne es auch, weil mich eventuell einige Journalisten oder Social-Media-Kommentatoren in diese dubiose Ecke stellen könnten. Beiden Gruppen sei gesagt: Lest euch das Buch durch und überprüft die beschriebenen Zusammenhänge anhand der Quellenangaben am Ende des Buches.
Denn bei allen satirischen Spitzen habe ich mich bemüht, die gesamte Thematik auf einer faktischen und analytischen Ebene zu behandeln. Als Naturwissenschaftler bin ich der Überzeugung, dass wir mit Rationalität und Nüchternheit die Herausforderungen unserer Zukunft viel sinnvoller und besser bewältigen könnten als mit zu viel Bauchgefühl und Emotionalität.
Ich habe dieses Buch geschrieben, um zum Nachdenken, zum sachlichen Disput und zum Austausch von Ideen einzuladen und nicht zum pauschalen Bashing von einzelnen Gruppen. Unsere Gesellschaft ist schon gespalten genug.
Seit 25 Jahren versuche ich, den Menschen wissenschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln. In dieser langen Zeit habe ich immer versucht, Fakten von Meinungen zu trennen. Das ist nicht immer leicht, aber ich bemühe mich. Denn die Wissenschaft erklärt nicht, was man denken soll, sondern, wie man denken soll.
Auch Topwissenschaftler können nicht auf jede Frage eine Antwort geben und müssen ihre Ansichten von Zeit zu Zeit revidieren, wenn sie Neues dazugelernt haben. Das ist keine Schwäche des Systems, sondern seine Stärke.
Jeder soll meinetwegen glauben und behaupten, was er will. Aber in der Wissenschaft müssen Behauptungen einer Überprüfung standhalten. Fakten tun das, Dogmen nicht.
Ich respektiere meinen Bauch und das, was er tagtäglich an Verdauungsarbeit leistet. Daher liegt es mir auch fern, seine Gefühle zu verletzen. Aber kein Darm der Welt hat je ein Schmerzmittel entwickelt oder einen Satelliten ins All geschickt. Die Wissenschaft tut das, und nicht selten führt sie uns vor Augen, dass wir mit unserem Bauchgefühl gehörig danebenliegen. Vielleicht tun wir uns gerade deshalb so schwer damit.
Und ja: Selbstverständlich habe ich zu vielen Aspekten, die ich auf den folgenden Seiten beschreibe, auch eine private Meinung. Aber die ist nicht relevant. Was ich persönlich von Kernenergie halte, von Tempolimits oder von Papierstrohhalmen, ist nicht wirklich entscheidend. Ich verfolge mit diesem Buch keine politische Agenda. Ich möchte Sie weder davon überzeugen, eine bestimmte Partei zu wählen, noch, irgendwelche gesellschaftspolitischen Maßnahmen gut oder schlecht zu finden. Unsere Gesellschaft ist ohnehin schon viel zu voll mit Vögeln, die einem erzählen wollen, was man gefälligst zu denken hat.
Ob Sie aus Überzeugung ein Lastenfahrrad fahren oder einen Lamborghini, geht mich nichts an. Ob Sie eher auf Christian Lindner stehen oder auf Annalena Baerbock, ist mir herzlich egal. Sie werden gute Gründe dafür haben.
Was mir mit diesem Buch wirklich am Herzen liegt, ist, Ihnen seriös recherchierte Fakten und wissenschaftlich fundierte Zusammenhänge aufzuzeigen, auf deren Basis Sie Ihre eigenen Einstellungen zur Weltrettung auf Stichhaltigkeit überprüfen können. Weiterhin möchte ich Ihnen alternative Lösungsansätze zu den Problemen der Welt aufzeigen, von denen Sie womöglich noch nie gehört oder gelesen haben. Denn trotz – oder wegen – der emotional und medial aufgeheizten Debatte gelangen viele gute Ideen einfach nicht ins öffentliche Bewusstsein.
Welche persönlichen Schlussfolgerungen Sie nach dem Ende dieser Lektüre ziehen, bleibt Ihnen überlassen. »Denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie« hieß mein allererstes Buch. Und exakt so sehe ich die Sache auch heute noch.
Doch ich muss Sie warnen: Selbstdenken verbraucht eine Menge Energie und ist demnach nicht unbedingt klimafreundlich. Vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb es derzeit so wenige tun.
Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Spaß beim Lesen und beim Darübernachdenken.
Mythen und Halbwahrheiten
Seit 1998 stehe ich auf der Bühne und erkläre meinem Publikum Wissenschaft auf humorvolle Art. In allen meinen bisherigen Programmen habe ich dabei auch immer wieder das Thema Ökologie angesprochen. So ernst dieses Thema zweifellos ist, so unfreiwillig komisch ist es nämlich auch. »Warum demonstriert ihr eigentlich immer nur gegen Pelzmäntel, aber nie gegen Lederbekleidung?«, fragte ich einmal einen Umweltaktivisten. Seine Antwort: »Weil man ältere Damen risikoloser anpöbeln kann als die Hells Angels.«
Wenn man sich auf einer nüchternen Faktenbasis mit ökologischen Zusammenhängen beschäftigt, stellt man verwundert fest, dass viele Zusammenhänge, die von der Allgemeinheit für wahr und wissenschaftlich nachgewiesen gehalten werden, lange nicht so klar und eindeutig sind. Das, was an die mediale Oberfläche dringt, ist zwangsläufig eine sehr starke Verkürzung dessen, was in der wissenschaftlichen Welt erforscht und diskutiert wird. Unterhält man sich zum Beispiel unter vier Augen mit Klimawissenschaftlern, dann sind deren Einschätzungen, Schlussfolgerungen und Äußerungen weit weniger alarmistisch, extrem und ultimativ als das, was wir in Zeitungs- und Onlineartikeln, Podcasts oder Fernsehreportagen über den Zustand unserer Welt lesen und hören.
Nicht nur Comedians, sondern auch Journalisten, Youtuber, Blogger – sogar die ganz seriösen – müssen erst mal die Aufmerksamkeit ihres Publikums gewinnen. Die Konkurrenz ist groß. Im Kampf um Marktanteile, Quoten, Likes und Abonnenten richten deshalb viele ihren Blick nur auf spektakuläre Ereignisse. »Mann auf Transatlantik-Flug an Olive erstickt«, ist eine stärkere Headline als die Meldung. »Heute schon wieder 25 000 Flugzeuge sicher gelandet!«. Doch gerade dieses Buhlen um flüchtige Leser und Hörer führt schnell zu einer verzerrten Wahrnehmung unserer Wirklichkeit.
Bei der Berichterstattung rund um das Thema Weltrettung, Umwelt- und Klimaschutz ist das nicht anders. Reißerische Nachrichten über den drohenden Klimakollaps, das nahe Ende unserer Ressourcen oder einen bevorstehenden Point of no Return prägen unsere Vorstellung von der Welt. Die britische Zeitung »The Guardian« oder die deutsche »taz« haben ihre Redakteure sogar angewiesen, bei diesen Themen eine drastischere Wortwahl zu verwenden. Statt von »Klimawandel« soll man besser von einer »Klimakrise« oder einem »Klimanotstand« sprechen. Der Begriff »Erderwärmung« ist den Blattmachern zu schwach und sollte durch das Wort »Erderhitzung« ersetzt werden.[3] Kaum eine Wissenschaftssendung im deutschen Fernsehen kommt inzwischen ohne mahnende Worte und Appelle aus, dass wir über unsere Verhältnisse leben, den Planeten ruinieren und dringend umsteuern müssen. Die Grauzone zwischen objektiver Wissensvermittlung und subjektiver Bewertung verschwimmt immer mehr.
Ich halte das schon länger für eine ungute Entwicklung. Denn die Kernaufgabe von Journalisten sehe ich darin, aufzuklären und nicht zu missionieren. Selbstverständlich gehören auch meinungsstarke Beiträge zu solch einer journalistischen Debatte. Ausgewogenheit entsteht dann durch die Vielfalt der Standpunkte. Wenn man aber immer nur den dramatischen Teil von wissenschaftlichen Szenarien präsentiert, wenn objektive Zusammenhänge ständig emotionalisiert und weltanschaulich aufgeladen werden, zeichnet man damit nicht das vollständige Bild einer Situation. Mitunter kommt es sogar vor, dass dadurch unwissentlich Falschmeldungen in die Welt gesetzt werden.
Nehmen Sie zum Beispiel das berühmte 1,5-Grad-Ziel, das 2015 beim Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen wurde, und seitdem von fast allen Medien wie eine wissenschaftliche Wahrheit präsentiert wird. Tatsächlich kam die Forderung, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht von Wissenschaftlern, weil sie herausgefunden hätten, dass beim Übergang dieser Temperaturgrenze etwas fundamental Katastrophales passiert. Es waren Aktivisten und Politiker, die sich auf diese recht willkürlich gewählte Grenze einigten. Als man daraufhin den Weltklimarat fragte, was man benötigen würde, um dieses Ziel zu erreichen, antworteten die Experten wahrheitsgemäß, dass dieses Vorhaben rigoroser, fast utopischer Anstrengungen bedürfe.[4]
In Teilen der Öffentlichkeit jedoch entstand daraufhin die Vorstellung, dass wir unter allen Umständen das 1,5-Grad-Ziel erreichen müssen, weil der Weltklimarat dieses Ziel ja angeblich als wissenschaftlich alternativlos vorgegeben hat.
Es wäre zweifellos journalistisch unseriös, die negativen Auswirkungen des Klimawandels kleinzureden oder sogar zu leugnen. Aber es ist ebenso unseriös, die Auswirkungen bewusst zu übertreiben, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen, zu dramatisieren oder Wissenschaftlern Worte in den Mund zu legen, die sie so nie gesagt haben. Und all das mit dem Ziel, Publikum oder Follower zu gewinnen.
Dadurch bleibt es leider nicht aus, dass im Medienkosmos von Twitter bis »Tagesschau« sehr viele Mythen, Halbwahrheiten, ja sogar Irrtümer herumgeistern, die sich auch deswegen so unerschütterlich halten, weil sie von uns so gerne geglaubt werden möchten.
Viele Menschen, die die Welt verbessern möchten, tappen in diese Falle. Sie machen sich oft nicht die Mühe, die Zusammenhänge wirklich zu verstehen, dramatische Meldungen kritisch zu hinterfragen, und fordern stattdessen Lösungen, die auf halb richtigen oder sogar falschen Grundannahmen beruhen. Das ist ziemlich heikel. Denn gute Absichten, die schlecht durchdacht sind, sind ähnlich fatal wie schlechte Absichten, die gut durchdacht sind.
Im ersten Teil versuche ich daher, ein paar der gängigsten Behauptungen in der aktuellen Debatte auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen.
Mythos 1:Wir müssen nur der Wissenschaft folgen
In den aktuellen Diskussionen über Umwelt- und Klimaschutz, über Ökologie und Weltrettung fällt immer wieder der Slogan: »Follow the Science!«. Damit wird suggeriert, dass man einfach nur der Wissenschaft folgen muss, um unsere ökologischen Probleme zu lösen. Dass also die Wissenschaft bereits alle Antworten und Maßnahmen parat hat, wie wir die Welt retten können. Aber ist das wirklich so?
Wenn Sie schon mal eines meiner Bücher gelesen oder eine Bühnenshow von mir besucht haben, dann werden Sie wissen, dass mir die Wissenschaft in der Tat sehr am Herzen liegt. Ich möchte vermitteln, was die Wissenschaft alles kann.
Zum Beispiel lässt sich aus der Urinspur eines Elefanten mithilfe eines mathematischen Verfahrens präzise die Länge seines Penis errechnen. Wussten Sie das? Sollten Sie also mal ein Date mit einer Mathematikerin haben, setzen Sie sich beim Pinkeln auf jeden Fall hin.
In den letzten 300 Jahren hat die Wissenschaft unfassbar viel herausgefunden. Wir wissen inzwischen, dass das Universum expandiert, dass unsere Welt aus Atomen besteht und dass der Mensch die Hälfte seines Erbmaterials mit einer Banane gemeinsam hat. Was übrigens nicht bedeutet, dass man aus zwei Bananen einen Menschen zusammensetzen kann. Auch, wenn man das bei manchen vermuten könnte.
Banal gesagt, geht es in der Naturwissenschaft darum, Phänomene zu beobachten, Hypothesen über mögliche Zusammenhänge und Mechanismen zu formulieren, und diese dann mithilfe von Experimenten und/oder Modellen zu überprüfen. Dadurch wird die aufgestellte Hypothese entweder bestätigt, verändert oder verworfen.
Genau das tun Naturwissenschaftler. Sie beschäftigen sich mit der Erforschung von messbaren, objektiven Zusammenhängen.
Noch interessanter ist, was die Wissenschaft nicht tut. Naturwissenschaft als Methode beschäftigt sich nicht mit eventuellen ethischen Folgen, mit humanistischen Dilemmata oder mit moralischer Verantwortung. Die Kernphysik zum Beispiel beschreibt sehr genau, wie viel Energie durch eine Kernspaltung frei wird. Aber sie macht keinerlei Aussagen darüber, ob Kernenergie gut oder schlecht ist. Im Kern (!) ist Naturwissenschaft vollkommen wertfrei und unideologisch. In der Wissenschaft versucht man nicht, die Welt zu bewerten, sondern man versucht, sie zu verstehen.
Das heißt natürlich keinesfalls, dass Naturwissenschaftlern ethische und moralische Fragen egal sind. Spätestens seit Einstein wird die Wertefreiheit der Wissenschaft immer wieder diskutiert. Denn mit seinen Erkenntnissen konnte die physikalische Welt revolutioniert, aber eben auch die Atombombe gebaut werden. Doch nicht er war derjenige, der über den Bau entschieden hat. Die Entscheidung über die Anwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen trägt letztendlich die Politik und/oder die Gesellschaft.
Wissenschaft sollte der Versuch sein, Wahrheiten zu finden, oder sich diesen zumindest anzunähern. Die Frage nach der Moral ist da erst mal sekundär. Würde man beispielsweise herausfinden, dass Porsche-Fahrer im Schnitt einen niedrigeren IQ hätten als die Besitzer eines Fiat Panda, so wäre diese Erkenntnis nicht diskriminierend oder unmoralisch. Statistische Daten – so sie denn seriös erhoben werden – sind wertneutral. Was man mit diesen Erkenntnissen dann anstellt, ist freilich eine ganz andere Frage.
Im Laufe der letzten Jahre fiel mir in Gesprächen mit Besuchern meiner Shows immer wieder auf, dass die Allgemeinheit von der Aufgabe der Wissenschaft ein teilweise falsches Bild hat. So erwarteten zum Beispiel beim Coronaausbruch viele Menschen, dass die Wissenschaft klar sagen müsste, was wir als Gesellschaft tun sollen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Als sich in dieser Frage die meisten Epidemiologen und Virologen sehr zurückhaltend, vorsichtig und diffus ausdrückten, reagierten große Teile der Bevölkerung mit Irritation und Enttäuschung. Doch der Grund für die unkonkreten Äußerungen der Forscher war nicht, dass sie schlecht in ihrem Job waren, sondern dass die Beantwortung solcher Fragen nicht Aufgabe der Wissenschaft ist.
Wissenschaft liefert eine Menge Erkenntnisse. Aber sie sagt nichts darüber aus, wie wir als Gesellschaft auf diese Erkenntnisse zu reagieren haben. Was natürlich nicht heißt, dass wir sie ignorieren sollen. Doch beim Umgang mit Zahlen ist Sachverstand gefragt. Gerade weil bekannt war, dass sich das Coronavirus exponentiell vermehrt, hätte man am Anfang die Zahl der Infizierten sofort halbieren können, wenn man diese Zahl einfach nur durch zwei geteilt hätte. Das ist ganz einfache Mathematik!
Aber ernsthaft. Meist sind wissenschaftliche Fragen nicht einfach zu beantworten. Was muss ich tun, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen? Wie kann ich die Vermüllung der Meere vermeiden? Was passiert, wenn ich beim Italiener Pasti und Antipasti zusammenbringe? Die meisten Zusammenhänge in der Wissenschaft sind hochkomplex und uneindeutig.
So existierten auch rund um das Weltrettungsthema eine Menge von gesicherten Erkenntnissen, die bei genauerer Betrachtung zu verstörenden Zielkonflikten führen.
Ein Beispiel: Im Jahr 2015 untersuchte das medizinische Fachjournal »The Lancet« in einer aufwendigen Studie die temperaturbedingten Todesraten.[5] Es liegt auf der Hand, dass aufgrund der Erderwärmung die Zahl der Hitzetoten im Laufe der nächsten Jahrzehnte zunehmen wird. »The Lancet« schätzte anhand von 384 Orten ab, dass alleine zwischen 1985 und 2012 etwa 140 000 Menschen pro Jahr aufgrund von hohen Temperaturen und Hitzewellen verstorben sind.
Wie aber sieht es in diesem Zeitraum mit der Zahl der Kälteopfer aus? Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Zahl der Kältetoten deutlich höher lag, bei etwa zwei Millionen pro Jahr. Diese Zahl ist wahrscheinlich deswegen weniger präsent im öffentlichen und medialen Bewusstsein, weil sie weniger mit punktuellen Umweltkatastrophen wie Dürren oder Hitzewellen verknüpft ist, die hohen Nachrichtenwert haben. Der Kältetod hingegen vollzieht sich meist schleichend jenseits medialer Ereignisse. Schlecht isolierte und unzureichend beheizte Unterkünfte oder Wohnungen führen über Tage und Wochen dazu, dass die Bewohner sukzessive auskühlen, bis ihr Kreislauf schließlich zusammenbricht. Und das nicht nur in nordischen Ländern, sondern auch in vermeintlich warmen Regionen wie zum Beispiel Zentralasien.
Wenn man dazu noch berücksichtigt, dass aufgrund der weitreichenden politischen Klimaschutzmaßnahmen Energie eher teurer als billiger wird, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich vielerorts auch die Zahl der Kälteopfer noch weiter erhöhen wird, weil es sich immer weniger arme Menschen im Winter leisten können, ihre Wohnungen ausreichend zu heizen. Das betrifft vor allem Schwellenländer, in zunehmendem Maß aber auch Industriestaaten.
Das heißt natürlich nicht, dass es besser wäre, auf Klimaschutzmaßnahmen zu verzichten, mit den Schultern zu zucken und einfach weiterzumachen wie immer. Das Beispiel zeigt lediglich eines auf: Es ist eine Illusion, zu glauben, dass uns wissenschaftliche Erkenntnisse automatisch aufzeigen, welcher Weg der richtige ist.
Räumt man in den vielen Diskussionen zum Thema Klimaschutz ein, dass man einige der geforderten Maßnahmen der Bewegung etwas skeptisch sieht, bekommt man sehr oft den Satz zu hören: »Du ignorierst Fakten! Denn immerhin kommen diese Forderungen von Wissenschaftlern. Und die müssen es ja nun wissen …«. Ist man also wirklich »gegen« die Wissenschaft, wenn man deren Forderungen hinterfragt? Am Ende gar ein Querdenker?
Noch vor wenigen Jahren waren die Begriffe »Querdenker« oder »Skeptiker« etwas Positives. Dann aber wurden sie von Faktenverdrehern und Verschwörungstheoretikern gekapert und öffentlich in einen komplett unseriösen Zusammenhang gebracht. Früher war man in jeder Forschungsgruppe froh und stolz, jemanden zu haben, der querdenkt und die Mehrheitsmeinung skeptisch hinterfragt. Die Querdenker von damals waren kluge, kritische Geister, die oftmals die nötigen Impulse für neue Erkenntnisse gegeben haben. Sie standen fest auf dem Boden der Wissenschaft und haben sich gerade nicht zu esoterischen oder verschwörungstheoretischen Spinnereien hinreißen lassen.
Sollten Sie sich also derzeit auch als Querdenker betrachten, dann fragen Sie sich selbstkritisch, zu welcher Sorte Sie gehören.
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Klimaforschung eine Menge wertvoller Erkenntnisse hervorgebracht. So ist es inzwischen wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen, dass menschliche Aktivität die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt. Daran gibt es keinen seriösen Zweifel mehr.[6]
Parallel dazu existieren jedoch noch eine Reihe meteorologischer Phänomene, bei denen noch nicht ganz klar ist, ob sie tatsächlich in eindeutigem Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel stehen. Zum Beispiel die globale Zunahme im Starkniederschlag. Darauf weist unter anderem Professor Jochem Marotzke hin, Direktor des Max Planck Instituts für Meteorologie. »Wir erwarten, dass er zunimmt. Aber wie sich das über die Erde verteilt, da tappen wir immer noch im Dunkeln«, erklärt er mir in einem längeren Telefonat. »Die Ungewissheiten über die Ursachen des zunehmenden Niederschlages sind riesig. Nicht alles, was sich derzeit auf der Erde verändert, ist der menschengemachte Klimawandel. Diese Unterscheidung ist wichtig.«
Auch die mediale Fokussierung auf die sogenannten »Klimakipppunkte« sieht Professor Marotzke skeptisch. Es stimmt zwar, dass verschiedene Klimamodelle zeigen, dass es bei einer weiteren Erwärmung zu mehreren möglichen Kipppunkten kommen könnte.
Um den Begriff »Kipppunkt« mal auf Stammtischniveau zu erklären: Stellen Sie sich ein volles Bierglas vor, das auf einem wackelnden Tisch steht. Da schwappt schon mal was über. Bis zu einem gewissen Punkt kann man das aber ganz gut verhindern, indem man aufpasst und hier und da etwas unterlegt. Stößt aber jemand derart heftig an den Tisch, dass das Glas umkippt und zerbricht, dann kann man noch so viele Bierdeckel unters Tischbein legen, die Chose lässt sich nicht mehr rückgängig machen. »Herr Ober, ein neues Bier bitte!«
Werden beim Klima solche Kipppunkte überschritten, dann geht es um mehr als Schaum und Scherben. Extremwetterereignisse wären fortan an der Tagesordnung. »Herr Gott, einen neuen Planeten bitte!«
Auch wenn das Szenario der kaskadierenden Kipppunkte von manchen Experten auf Internetseiten und gegenüber den Medien wie eine gesicherte Wahrheit verkauft wird – wissenschaftlich gesehen ist es laut Marotzke nach wie vor hochspekulativ. Auf die Frage, welcher von den Klimamodellen berechnete Kipppunkt ihm am meisten Sorgen macht, antwortet er mit einem lapidaren: »Keiner«.[7]