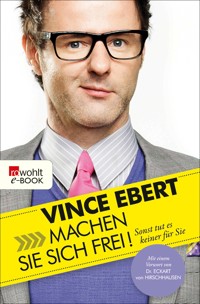Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HERBERT Management
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie haben Sie Ihren Partner kennengelernt? Wie Ihren Job gefunden? Ist das alles das Ergebnis genauer Überlegungen, harter Arbeit und strategischer Herangehensweise? Lässt sich Erfolg – in welchem Lebensbereich auch immer – planen und berechnen? Oder spielt der Zufall doch eine viel größere Rolle, als wir zugeben wollen? In Zeiten von Big Data entsteht der Eindruck, wir wären nur noch einen winzigen Schritt von der kompletten Berechenbarkeit unseres Lebens entfernt. Ständig werden wir angehalten, unsere Zukunft zu planen, die Work-Life-Balance zu optimieren, an unserem Erfolg zu arbeiten. Vince Ebert hält unserer planungsfixierten Gesellschaft den Spiegel vor, appelliert an Kreativität und Flexibilität und hinterfragt die typisch deutsche Überregulierung. Intelligent, spannend und lustig!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vince Ebert
Unberechenbar
Warum das Leben zu komplex ist, um es perfekt zu planen
Über dieses Buch
Wie haben Sie Ihren Partner kennengelernt? Wie Ihren Job gefunden? Ist das alles das Ergebnis genauer Überlegungen, harter Arbeit und strategischer Herangehensweise? Lässt sich Erfolg – in welchem Lebensbereich auch immer – planen und berechnen? Oder spielt der Zufall doch eine viel größere Rolle, als wir zugeben wollen?
In Zeiten von Big Data entsteht der Eindruck, wir wären nur noch einen winzigen Schritt von der kompletten Berechenbarkeit unseres Lebens entfernt. Ständig werden wir angehalten, unsere Zukunft zu planen, die Work-Life-Balance zu optimieren, an unserem Erfolg zu arbeiten. Vince Ebert hält unserer planungsfixierten Gesellschaft den Spiegel vor, appelliert an Kreativität und Flexibilität und hinterfragt die typisch deutsche Überregulierung. Intelligent, spannend und lustig!
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Andy Hartard, Herbert Management, Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung und Innenlayout ANY. Konzept und Design
Umschlagfoto Michael Zargarinejad/fotokain.de
ISBN 978-3-644-55661-4
Alle Seitenangaben beziehen sich auf die Seitenzahlen der Printausgabe
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
[Kapitel]
Prolog
Das erste Kapitel – Privatleben
Partnersuche
Partnerschaft
Familienplanung
Selbstoptimierung
Das zweite Kapitel – Arbeitswelt
Jobsuche
Karriere
Zukunftsprognosen
Perfektionismus
Das dritte Kapitel – Wissenschaft
Serendipity
Homo sapiens
Trial & Error
Universum
Das vierte Kapitel – Zukunft
Big Data
Irrationalität
Kreativität
Science-Fiction
[Kapitel]
Fazit
[Kapitel]
Anhang
Danksagung
Quellen
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
im Frühjahr 2015 moderierte ich in Berlin den Felix-Burda-Award. Er wird von der Felix-Burda-Stiftung an Menschen verliehen, die sich für die Bekämpfung von Darmkrebs einsetzen. Es war eine sehr glamouröse Veranstaltung mit Persönlichkeiten aus Forschung, Wirtschaft und selbstverständlich auch vielen Promis. Der Preis für das «Engagement des Jahres» ging an Petra Thomas, eine lebenslustige Frau Anfang dreißig, die im August 2013 die Diagnose Enddarmkrebs im vierten Stadium erhielt und daraufhin den Verein Rote Hose e.V. gründete, der sich für gesundheitliche Aufklärung einsetzt.
Eigentlich hätte Petra diese Krankheit gar nicht bekommen dürfen. Sie lebte gesund, es gab keinerlei familiäre Vorerkrankungen, und auch statistisch gesehen war sie zu jung, um an dieser Krebsart zu erkranken. Sie hatte schlicht und einfach biologisches Pech.
Als sie die Bühne betrat, um ihren Preis in Empfang zu nehmen, und mich dabei offen und fröhlich anlächelte, war ich plötzlich mit meinem Latein am Ende. Ich hatte mich inhaltlich gut gewappnet, war perfekt vorbereitet und dachte, ich wüsste, was auf mich zukommen würde – und trotzdem fiel es mir in diesem Moment unsagbar schwer, die Fassung zu wahren. Denn nichts an Petras Schicksal war logisch, nichts rational begründbar, und vor allem war nichts daran fair!
Ursprünglich habe ich Physik studiert, weil ich von der Berechenbarkeit der Welt begeistert war. Neben all den komplizierten Formeln und Gesetzen, die man in diesem Studium lernen muss, geht es im Kern darum, fundamentale Zusammenhänge zu verstehen. Naturwissenschaftler stellen Fragen, die sie mit Hilfe der Mathematik und dem Aufbau von cleveren Experimenten zu lösen versuchen: Wie schnell fällt ein Stein zu Boden? Wann gibt es die nächste Sonnenfinsternis? Drehen sich die Stripperinnen an der Stange auf der südlichen Hemisphäre andersherum als auf der Nordhalbkugel?
Im Laufe der letzten 300 Jahre haben wir durch die Wissenschaft eine Menge Dinge erkannt und erreicht. Inzwischen können wir die Eigenschaften der kleinsten Elementarteilchen bestimmen, schicken eine Raumsonde punktgenau auf einen Millionen Kilometer entfernten Kometen und sind sogar fähig, 13,7 Milliarden Jahre in die Vergangenheit bis kurz vor den Ursprung unseres gesamten Universums zu blicken.
Und trotzdem haben wir nach wie vor keinen blassen Schimmer, ob nächste Woche der ICE von Hamburg nach Frankfurt pünktlich abfahren wird, warum sich zwei Menschen verlieben oder wieso Petra Thomas aus dem Nichts heraus erkrankte.
Ein erheblicher Teil unseres Lebens besteht aus Unberechenbarkeiten. Dinge, die sich unserem Wunsch nach Voraussage, Kalkulation und Sicherheit entziehen. Wir können alles richtig machen und trotzdem falsch liegen. Manche Menschen machen nach objektiven Kriterien fast alles falsch und sind dennoch extrem erfolgreich. Der Zufall ist die physikalische Grauzone des Lebens. Im Positiven wie im Negativen.
In diesem Buch möchte ich mit Ihnen die vielen Zufälle und Unberechenbarkeiten unseres Lebens erkunden. Nicht zuletzt, weil für mich, als rationaler, zahlengeprägter Mensch, viele dieser Unberechenbarkeiten nur schwer zu ertragen sind.
Ich bin mir bewusst, dass das Thema «Unberechenbarkeit» nicht so recht in unser aktuelles Weltbild passt. In Zeiten von Big Data entsteht mehr und mehr der Eindruck, wir wären nur noch einen winzigen Schritt von der kompletten Berechenbarkeit unseres Daseins entfernt. Auch in anderen Lebensbereichen versucht man uns unablässig weiszumachen, dass wir lediglich klar definierte Schritte befolgen müssen, damit unser Leben funktioniert: die sieben Tibeter zum persönlichen Glück, die sechs Prinzipien für den beruflichen Erfolg, vier totsichere Flirtstrategien, um die Liebe des Lebens zu finden. Jetzt auch als App!
Wer all diese Ratschläge akribisch berücksichtigt, so suggeriert man uns, wird automatisch zum Winner. Und falls nicht, ist nicht etwa der Weg falsch oder gar das Ziel selbst, sondern wir sind den Weg einfach nicht konsequent genug gegangen. «Du musst deine negativen Gedanken abwehren, auf Kohlenhydrate verzichten, einen cleveren Businessplan aufstellen und das richtige Foto auf Parship hochladen», heißt es dann. Ständig werden wir angehalten, unsere Zukunft zu planen und unsere Work-Life-Balance zu optimieren. Mit dem Heilsversprechen, Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg zu erreichen.
Nur allzu gerne lassen wir uns von diesen hoffnungsfrohen, verführerischen Worten umgarnen – und zwar völlig unabhängig von Intelligenz und Bildung. Selbsthilfebücher, die ihren Lesern genaue Vorschriften und Regeln an die Hand geben, verkaufen sich nachweislich besser als Bücher, die betonen, dass bestimmte Ziele möglicherweise nicht erreicht werden können, weil sie schlichtweg nicht in unserem Einflussbereich liegen.
Sie merken schon, Sie lesen gerade ein Buch, das statistisch gesehen ein ziemlicher Flop werden könnte. Aber zumindest habe ich dafür dann eine eindeutig berechenbare Erklärung. Das ist doch schon mal was.
Und: Ich kann nicht anders. Ich habe eine natürliche Abneigung gegen jede Art von Selbsthilfe-Literatur. Ich traue diesen Autoren nicht. Ein paar von ihnen habe ich im Laufe der Jahre persönlich kennengelernt, und alles, was ich dazu sage, ist: If you don’t reach it, teach it.
Demzufolge ist das hier auch kein Ratgeber. Seien Sie froh, denn wenn Sie mich privat kennen würden, wären Sie sowieso nicht der Meinung, von mir Hilfe bekommen zu können. Ich bin definitiv nicht der Typ, den Sie nachts um drei Uhr anrufen wollen, um zu fragen, ob das Leben einen Sinn hat, während Sie sich ein Steakmesser an die Pulsadern halten. Ich schätze, Sie ahnen, in welche Richtung meine Antwort ginge. Wenn ich die Wahl hätte zwischen einem guten Rat und einer guten Pointe – ich wüsste, wie ich mich entscheiden würde.
Ich glaube nicht daran, dass man anderen Menschen Ratschläge in Buchform geben kann. Vielmehr glaube ich, dass man nur ganz selten jemandem überhaupt einen guten Ratschlag geben kann. Immer, wenn jemand zu mir sagte: «Ich geb dir jetzt mal ’nen guten Rat …», war das, was folgte, ziemlicher Blödsinn.
Der einzige Selbsthilfe-Spruch, mit dem ich etwas anfangen kann, ist ein Gebet: «Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.» Obwohl ich bekanntlich mit Gott wenig am Hut habe, trifft dieser Satz den Kerngedanken dieses Buches.
Die Vorstellung, dass es irgendwo da draußen eine Antwort gibt, die alles auflöst, erstreckt sich über nahezu jeden Lebensbereich: die Weltformel, den Traumberuf, den Traumpartner, sogar den Sinn des Lebens. Und irgendwann lautet die Antwort dann: 42. Aber wie lautete die Frage?
Wie hoch also ist der Einfluss des Zufalls? Welche Aspekte unseres Lebens können wir beeinflussen? Und welche nicht? Wo ist Planung sinnvoll, und in welchen Situationen geraten wir durch übermäßige Organisation womöglich in eine Sackgasse? Diesen Fragen versuche ich auf den Grund zu gehen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr
Prolog
Zufall oder Fügung?
In meinen Vorträgen frage ich die Zuhörer am Anfang immer: «Wer von Ihnen glaubt, dass der Zufall maßgeblich unser Leben bestimmt?» Meistens meldet sich nur eine Handvoll Leute. Und vielleicht haben auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, das Gefühl, dass die meisten Dinge in Ihrem Leben grundsätzlich geplant waren. Doch allein Ihre Existenz ist das Produkt eines unglaublichen Zufalls. Damit Sie entstehen konnten, mussten sich Ihre Eltern kennen- und – im Idealfall – lieben lernen. Dann mussten sie genau neun Monate vor Ihrer Geburt zusammen … – na ja, Sie wissen schon. Und selbst das war noch keine Garantie, dass genau Sie entstehen konnten. In welcher Weise sich das Erbmaterial Ihrer Eltern miteinander kombiniert, ist nämlich vollkommen willkürlich. Bei jeder geschlechtlichen Vermehrung vereinigen sich 23 zufällig zusammengewürfelte männliche Chromosomen mit 23 beliebig ausgewählten weiblichen Chromosomen. Statistisch gesehen können also aus der DNA Ihrer Eltern 223 verschiedene Kinder hervorgehen. Das sind etwa 70 Billionen Möglichkeiten. Eine Zahl, die selbst Senior Iglesias in die Verzweiflung treibt. Aber eine von diesen 70 Billionen Möglichkeiten sind genau Sie! Ein unfassbarer Zufall, oder?
«Papperlapapp», sagte neulich eine offensichtlich etwas esoterisch angehauchte Zuhörerin zu mir. «Es gibt keine Zufälle! Alles in unserem Universum ist mit allem verbunden, und deshalb hat auch alles in unserem Leben einen tieferen Sinn.» Ich blickte sie etwas irritiert an, woraufhin sie fortfuhr: «Jaja, Sie sind bestimmt ein Widder mit Aszendent Steinbock – und die glauben sowieso nicht an den Einfluss der Gestirne.» Das mag sein. Aber warum sollten gerade Himmelskonstellationen unser Schicksal bestimmen? Ein Lkw, der zum Zeitpunkt unserer Geburt am Krankenhaus vorbeifährt, übt eine zigfach stärkere Gravitationskraft auf uns aus als Jupiter oder Neptun. Meine Hebamme hat 120 Kilo gewogen. Was kümmert mich da mein Aszendent?
Die große Schicksalsgöttin Wikipedia schreibt über den Zufall: «Von Zufall spricht man dann, wenn für ein einzelnes Ereignis oder das Zusammentreffen mehrerer Ereignisse keine kausale Erklärung gegeben werden kann.»
Demnach treten Zufälle ziemlich häufig auf. Überlegen Sie zum Beispiel mal, wie Sie Ihren Partner kennengelernt haben. Oder wie Sie zu Ihrem ersten Job gekommen sind. Vielleicht steigen Sie schon morgen in die U-Bahn und setzen sich zufällig neben jemanden, der Ihr Leben entscheidend verändern wird. Vielleicht setzen Sie sich sogar neben Ihre zukünftige Traumfrau? (Was problematisch werden könnte, wenn Sie bereits verheiratet sind.) Oder Sie verpassen die Liebe Ihres Lebens, weil die Person, die Sie glücklich machen könnte, auf ihr Smartphone starrt oder Taxi statt U-Bahn fährt.
Zufälle wie diese beeinflussen unser Leben mehr, als wir uns das eingestehen wollen. Wäre nur eine klitzekleine Kleinigkeit in meinem Leben anders verlaufen, würde ich heute vielleicht Versicherungen verkaufen, hätte drei Kinder, ein Reihenhäuschen und steckte mir eines Morgens im Hobbykeller das Jagdgewehr meines Nachbarn in den Mund.
Am ehesten akzeptieren wir das Auftreten des Zufalls beim Glücksspiel. Zumindest solange sich das Glücksspiel an das hält, was wir unter «Zufall» verstehen. 1913 geschah jedoch im Spielkasino von Monte Carlo etwas höchst Verblüffendes. An einem Roulettetisch kam die Kugel 26-mal hintereinander auf einem schwarzen Feld zum Liegen. Wie man sich vorstellen kann, wurden daraufhin immer höhere Summen auf Rot gesetzt. Die Serie war unglaublich, und im Kasino entstand eine hektische Anspannung. Einige vermuteten sogar Manipulation. Doch in Wahrheit war es nur ein seltener Zufall, der für diese erstaunliche Reihung verantwortlich war. Ein Phänomen, wie es in dieser Form nur alle 67 Millionen Mal auftritt. Das ist nicht gerade oft, aber eben auch nicht unmöglich. Zum Vergleich: Ein Hauptgewinn im Lotto kommt nur alle 140 Millionen Spiele einmal vor. Und trotzdem wird regelmäßig der Jackpot geknackt, ohne dass man Manipulation, eine günstige Sternenkonstellation oder die Anwesenheit einer höheren Macht dahinter vermutet.
Der Zufall ist uns zuwider. Wir mögen ihn nicht. Besser gesagt: Unser Gehirn mag ihn nicht. Es ist vor allem darauf ausgelegt, permanent nach Mustern zu suchen, und filtert dafür riesige Datenmengen, die unablässig auf uns einströmen – und wenn dann plötzlich ein bekanntes Gesicht in der Menge auftaucht, sagt es uns: «Hey! Das ist doch der …, der Dings …»
Evolutionär ergibt dieser Mechanismus Sinn. Unsere steinzeitlichen Vorfahren haben überlebt, weil sie blitzschnell erkannten, ob der Typ, der da am Hügel auftauchte, der …, na ja, der Dings eben war oder der andere Typ, der letzten Winter die Höhle des Nachbarclans in Schutt und Asche gelegt hat. Erkennt unser Gehirn ein bestimmtes Muster, zieht es sofort Rückschlusse: Gesicht 1: der Dings aus der Buchhaltung – harmlos. Gesicht 2: der Schnösel von McKinsey – Gefahr!
Leider sucht unser Gehirn selbst dann verzweifelt nach Gründen und Erklärungen, wenn ein Muster überhaupt nicht sinnvoll ist. Oder wenn es überhaupt kein Muster gibt. Teilt man zum Beispiel bei der Cheops-Pyramide die Grundfläche durch die Höhe und multipliziert das Ergebnis mit der Anzahl der unteren Steinblöcke, dann ergibt diese Zahl genau die Telefonnummer des Vatikans. Das kann doch kein Zufall sein! Eben doch!
Aber da der Zufall kein für uns erkennbares Muster aufweist, macht er uns ein wenig hilflos. Und weil unser Gehirn nicht gerne hilflos ist, konstruiert es im Zweifelsfall Zusammenhänge, die es gar nicht gibt. Das ist der Grund, weshalb wir so empfänglich für Verschwörungstheorien sind. Wir picken uns einzelne, zufällige Ereignisse heraus und interpretieren dann ein geheimes Muster in sie hinein: «Ist doch klar, warum Mohammed Atta gerade in Hamburg studiert hat. Die deutsche Regierung hält bewusst Beweise zurück, die auf einen ganz anderen Grund für die Anschläge am 11. September hinweisen!» Das ist natürlich eine gewagte These. Denn das bedeutete, unsere Regierung wäre in der Lage, eine riesige Sache unter dem Deckel zu halten. Aber denken Sie daran: Es ist dieselbe Regierung, die den Berliner Flughafen baut.
Insgesamt können wir bis zu 300 Millionen verschiedene Muster unterscheiden, von einfachen geometrischen Mustern bis hin zu komplexen Inhalten. Während Sie diesen Text lesen, erkennt Ihr Auge zuerst einfache Muster wie Linien und Kreise. Daraus werden Buchstaben, Wörter, Sätze. In der höchsten Stufe der Mustererkennung wird Ihnen der Inhalt dieses Satzes bewusst. Das ist wirklich beeindruckend.
Normalerweise funktioniert diese Mustererkennung in unserem Gehirn sehr gut. Sie ermöglicht uns, unser Kind in einer riesigen Menschenmenge beim Sommerschlussverkauf wiederzufinden. Wenn sie allerdings zu gut funktioniert, dann erkennen wir in einem verschimmelten Käsesandwich das Porträt von Jesus Christus.
In den siebziger Jahren führte der amerikanische Psychologe Philip Tetlock ein faszinierendes Experiment durch. Er konstruierte einen T-förmigen Gang, an dessen Fuß eine Gemeine Wanderratte lauerte. Im T-Querbalken gab es jeweils links und rechts eine Futterluke, die sich nach einem bestimmten Zufallsprinzip öffnete: Auf der rechten Seite öffnete sie sich in 60 Prozent der Fälle, auf der linken Seite in 40 Prozent. Wenn es um Futter geht, muss man einer Ratte den Versuchsaufbau nicht groß erklären. Und tatsächlich lernte sie sehr schnell. Nach kurzer Zeit verstand sie das Prinzip, ging fortan IMMER nach rechts und erreichte damit eine Trefferquote von 60 Prozent.
Danach bat Tetlock seine Studenten zum Experiment: junge, intelligente Hochschüler der renommierten Yale-Universität. Denen war die Strategie der Ratte viel zu simpel. 60 Prozent Trefferwahrscheinlichkeit? Pah! Das würde ja bedeuten, in 40 Prozent der Fälle zu scheitern! Und Yale-Studenten scheitern nicht gerne. Also begannen sie, die ihnen unbekannte Futterverteilung zu analysieren. Wie war nochmal die letzte Sequenz? Zweimal rechts, einmal links, dann wieder rechts. Wie zum Teufel muss also die Verteilungsformel lauten? Nach welchem mathematischen Algorithmus öffnen sich diese verdammten Luken?
Ich mach’s kurz: Nach stundenlanger Rumrechnerei erreichten die Yale-Studenten eine Trefferquote von nur 52 Prozent.
Wir sehen, was wir erwarten, und dadurch interpretieren wir unsere Umwelt systematisch verzerrt. Wenn ich am Strand eine attraktive Frau in einem Tanga sehe, dann denke ich sofort an … – natürlich, die Stringtheorie! Tut mir leid, Ladys, da kann ich einfach nicht aus meiner Haut.
Aber so hat jeder Berufszweig sein Päckchen zu tragen. Zum Beispiel fällt es jungen Ärzten, die sich nach dem Klinikpraktikum in einer Großstadt als Landarzt niederlassen, am Anfang ziemlich schwer, bei ihren Patienten die richtigen Diagnosen zu stellen. Auch hier liegt der Grund in einer verzerrten Mustererkennung: Die Krankheiten, die häufig in der Berliner Charité diagnostiziert werden, unterscheiden sich massiv von den Erkrankungen der Patienten, die eine Hausarztpraxis im Odenwald aufsuchen. Der junge Arzt muss deshalb seine Mustererkennung an die neue Umgebung anpassen. Sonst läuft er Gefahr, eine Laktoseintoleranz zu diagnostizieren, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen Mähdrescherunfall handelt.
Tief in unserem Inneren lehnen wir den Zufall ab und versuchen, ihn stattdessen in ein Muster zu pressen. Wir spielen Lotto mit einem «todsicheren» Systemtipp und ignorieren die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit, auf dem Weg zur Annahmestelle von einem Mähdrescher überfahren zu werden, fünfmal höher ist, als den Jackpot zu knacken.
Paradoxerweise weisen wir bei Ereignissen, die wir für zufällig halten, bei denen aber zufällig Muster auftreten, diese Muster intuitiv zurück – siehe die Roulette-Episode von Monte Carlo. Auch die folgende Geschichte zeugt davon: Als im Jahr 2001 der iPod herauskam, war er unter anderem mit einer Shuffle-Funktion ausgestattet. Diese war anfangs mit einem idealen Zufallsalgorithmus programmiert. Das Gerät generierte somit eine vollkommen zufällige Playlist. Trotzdem wunderten sich viele iPod-Nutzer, dass manchmal mehrere Songs von ein und demselben Künstler hintereinanderliefen (was bei Künstlern wie Chris de Burgh oder David Hasselhoff tatsächlich eine ziemliche Zumutung ist).
Einige iPod-User hatten gar den Eindruck, das Gerät «denke mit» und stelle die Auswahl nach den persönlichen Vorlieben zusammen. So setzte sich nach und nach die dubiose Theorie durch, die Musikindustrie hätte einen mysteriösen Deal mit Steve Jobs abgeschlossen und manipuliere die Hörer durch den Shuffle-Modus auf perfide Art und Weise. Unter dem Druck der öffentlichen Spekulationen änderte Apple schließlich den Algorithmus des Gerätes. Steve Jobs kommentierte das mit dem paradoxen Satz: «We’re making the shuffle less random to make it feel more random.»
Offenbar ist der Zufall viel regelmäßiger, als wir glauben. Dazu ein kleiner Test:
3 2 4 2 6 4 5 5 5 3 3 5
4 1 6 3 1 2 5 4 1 6 2 4
Welche dieser Zahlenreihen wurde durch einen Würfel erzeugt, und welche hat sich ein Mensch ausgedacht, dem gesagt wurde: Schreibe eine zufällige Würfelreihe auf?
Die meisten sagen intuitiv: Die obere Reihe ist viel zu regelmäßig, um von einem Würfel erzeugt worden zu sein. Doch erstaunlicherweise ist genau das Gegenteil richtig. Wenn wir aufgefordert werden, Zufall zu simulieren, scheitern wir. Anscheinend ist der echte Zufall viel regelmäßiger als der ausgedachte.
In vielen Fällen unterschätzen wir tatsächlich, wie geordnet der Zufall daherkommt. Steuermogler zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass ihre «zufälligen» Schwankungen in Einnahmen und Ausgaben etwas «zu zufällig» sind. Für einen erfahrenen Steuerfahnder ist das ein sicheres Indiz, dass sie gefälscht wurden. Inzwischen existieren sogar leistungsfähige Computerprogramme, die schnelle und präzise Datenmanipulationen im Rechnungswesen, in wissenschaftlichen Studien oder bei Wahlergebnissen aufdecken. Ich will Ihnen nichts unterstellen – aber halten Sie beim Verfassen Ihrer nächsten Steuererklärung vorsorglich einen Würfel bereit.
Es ist also ein fataler Irrtum anzunehmen, dass der Zufall ein Wirrwarr ohne Struktur ist. Im Gegenteil. Auch er gehorcht Gesetzen. Das vielleicht spektakulärste Beispiel dafür ist die Radioaktivität: Wenn Sie in Ihrem Hobbykeller ein Kilo Plutonium rumliegen haben und aus diesem Klumpen einen einzelnen Kern herausnehmen, dann haben Sie keine Chance vorauszusagen, wann dieser Plutoniumkern zerfallen wird. Es ist unmöglich zu prognostizieren, ob er in der nächsten Sekunde, in vier Wochen oder erst nach 100000 Jahren zerfällt. Und zwar nicht, weil wir Physiker die Formel dazu noch nicht gefunden haben. Sondern weil es keine Formel gibt! Ein einzelner Plutoniumkern verhält sich komplett unberechenbar.
Ganz anders sieht die Sache aus, wenn es sich um eine Ansammlung von sehr vielen radioaktiven Kernen handelt. Dann können Sie nämlich exakt voraussagen, dass die Hälfte dieser Kerne in 24110 Jahren zerfallen sein wird (das ist die berühmte Halbwertszeit, die Sie auch aus der Kaffeeküche kennen: Nach zwei Wochen ist nur noch die Hälfte der Kaffeelöffel übrig).
Und diese Halbwertszeit gilt immer und überall. Egal, ob Sie das Kilogramm Plutonium aufheizen, es abkühlen, fester zusammenpressen, es ins Weltall schießen oder mit ihm nach Bielefeld fahren. Die Zerfallsrate bleibt in allen Fällen gleich. Immer und überall. Sogar in Bielefeld.
Und das, obwohl sich die einzelnen, zufällig zerfallenden Kerne gegenseitig nicht beeinflussen. Wie aber wissen sie voneinander? Haben sie gar ein kollektives Gedächtnis? Wir haben nicht die leiseste Ahnung!
Das ist der Grund, weshalb sich selbst Physiker mit dem Zufall schwertun. Einstein hat mal gesagt: «Gott würfelt nicht!» Aber Gott hat nur gelächelt und geantwortet: «Doch!»
Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben: Der deutsche Formel-1-Rennfahrer Graf Berghe von Trips stornierte 1961 kurzfristig eine Flugreise in die USA. Zum Glück für ihn, denn genau dieser Flug stürzte ab, und alle Passagiere kamen ums Leben. Nur wenige Tage später fuhr Graf Berghe nach Italien, startete in Monza bei einem Rennen und verunglückte tödlich. Er hatte ein Doppelticket in den Tod gelöst. Zufall oder Schicksal?
Unser Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von Zufällen. Und weil wir tagtäglich Tausende Dinge erleben, ist es unwahrscheinlich, dass nichts Unwahrscheinliches passiert.
In England gibt es einen jungen Mann, der während eines Purzelbaums auf dem Sportplatz einen leichten Schlaganfall bekam und danach homosexuell war. Kein Witz! Offensichtlich hatten sich durch den Unfall die Nervenbahnen neu vernetzt, sodass er ab diesem Zeitpunkt Männer attraktiv fand. Ein absurder Zufall der Neurologie. Bisher hatte ich Angst, nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen oder laufen zu können – jetzt weiß ich, dass der Zufall viel mehr bereithält. Du kippst um, wachst wieder auf und bist schwuppdiwupp Andrea-Berg-Fan. Oder noch schlimmer: Du hältst dich selbst für Andrea Berg.
Angenommen, jeder Deutsche träumt einmal im Leben vom Tod eines Bekannten. Das macht bei 80 Millionen Deutschen etwa 2000 Todesträume pro Nacht. Da in Deutschland pro Jahr etwa 900000 Menschen sterben, muss folglich aus rein statistischen Gründen etwa 30-mal pro Jahr das unglaubliche Ereignis eintreten, dass ein realer Todesfall von einem nahen Verwandten oder Freund im Traum vorweggenommen wird.
Sie sehen, wir brauchen also weder göttliche Fügung noch eine teuflische Verschwörung, damit in unserem Leben kuriose, sonderbare Dinge passieren. Der Zufall unterliegt nicht einem höheren Schicksal, sondern purer Statistik. Und sollte es tatsächlich einen Gott geben, ist er vermutlich der größte Zocker.
Partnersuche
Unsichtbare Gorillas im Nebel
In kaum einem anderen Bereich wird mehr über die Frage «Zufall oder Schicksal?» philosophiert als bei der Partnersuche. Einerseits versuchen wir mit Hilfe zahlreicher Datingportale, möglichst präzise potenzielle Traumpartner auszuwählen, andererseits betonen gerade Pärchen, die sich über Partnerbörsen im Internet gefunden haben, wie groß doch der Einfluss des Zufalls für ihr Zusammenkommen war. «Also eigentlich wollte ich an dem Abend meinen Rechner gar nicht mehr hochfahren. Aber dann ist Wanda, eine meiner Vogelspinnen, mal wieder ausgebüchst und hat meinen Nachbarn gebissen. Beim Googeln nach dem Allergologen-Notdienst habe ich mich dann ganz spontan bei Parship umgeschaut. So habe ich Brigitte kennengelernt.»
Viele Paare haben eine spannende Kennenlerngeschichte. Und ganz oft spielt darin der Zufall, das unberechenbare Moment, eine maßgebliche Rolle. Als ich 2005 eine Einladung zur Zehn-Jahres-Party des Quatsch Comedy Clubs nach Berlin erhielt, wollte ich erst nicht hin. Ich hatte davor und danach eine Menge Auftritte und plante, diesen Tag zum Entspannen auf der Couch zu nutzen. Doch meine Managerin insistierte: «Vince, geh da hin, das ist wichtig für deine Karriere!» Also buchte ich etwas widerwillig einen Flug, besuchte die Party und lernte dort Valerie kennen. Eine lustige österreichische Schauspielerin, die mich vom Typ ein wenig an Barbara Schöneberger erinnerte (die im Übrigen ebenfalls anwesend war). Valerie und ich verstanden uns prächtig, scherzten zusammen – und fanden uns irgendwann wild knutschend in einer schummrigen Ecke neben der Tanzfläche wieder. «Dein Künstler schleppt gerade die Schöneberger ab», zischten die Kollegen meiner Managerin zu, die sich zu dem Zeitpunkt im Foyer unterhielt. «Oh mein Gott!», dachte sie sich. «Der wird sich doch nicht etwa hochschlafen wollen? So war das mit der Karriereplanung nicht gemeint …» Aber mit Barbara lief nichts. Ehrlich! Mit Valerie jedoch bin ich inzwischen seit sieben Jahren verheiratet. Ich hoffte auf einen Vertrag bei RTL, bekam stattdessen eine Affäre mit Frau Schöneberger angedichtet und fand quasi im Vorübergehen die Frau fürs Leben. Im Nachhinein kein schlechter Deal – sieht man vom Finanziellen mal ab.
Der Paartherapeut Arnold Retzer glaubt, dass ein romantischer Gründungsmythos die Chance für eine lange, stabile Partnerschaft erhöht. Die Erinnerung an diesen einzigen, schicksalshaften Augenblick, der zwei Menschen zusammengeführt hat, belebt eine Beziehung immer wieder neu. «Weißt du noch, Schatz? Als wir damals Wanda einschläfern lassen mussten …?»
Laut Statistischem Bundesamt hat sich der Anteil der in Deutschland lebenden Singles in den letzten 20 Jahren stetig erhöht. Und parallel dazu stieg die Zahl der sogenannten Fisch-sucht-Fahrrad-Partys. Wahrscheinlich kommt der absurde Name daher, dass die Gäste mitunter genauso aussehen. Man bretzelt sich Wochenende für Wochenende auf in der Hoffnung, den großen Wurf zu landen. Dabei ist die Musik, die bei diesen Veranstaltungen gespielt wird, ein untrügliches Zeichen: Sie erinnert ein wenig an das Orchester der Titanic, das für die todgeweihten Normalo-Passagiere weitergespielt hat, während die 1. Klasse schon in den Rettungsbooten saß. Und die Übriggebliebenen prügeln sich bei «I will survive» um die Restplätze.
In Großstädten – also in den Regionen, in denen das Angebot an Suchenden am größten ist – nimmt der Singleanteil mit rund 30 Prozent einen Spitzenplatz ein. Offensichtlich nicht, weil es an Auswahl fehlt, sondern gerade, weil es zu viel Auswahl gibt. Auf der theoretischen Suche nach dem perfekten Partner merken viele Menschen nicht, wie sie praktische Lebenszeit verplempern.
In Zeiten des Internets ist Partnersuche zu einem wissenschaftlichen Analysetool geworden. CSI Harmony. Mit Hilfe von komplizierten Suchalgorithmen gaukeln die Anbieter der Datingportale den Beziehungswilligen nahezu hundertprozentige Liebesgarantie vor. Dafür muss man endlose Fragebögen ausfüllen und Psychotests über sich ergehen lassen, die selbst der NSA zu persönlich wären: Ist Liebe wie ein Muskel, der bei Gebrauch gestärkt wird, oder wie ein Gelenk, das sich schneller abnutzt, je mehr man es benutzt? Welche Charaktereigenschaften erwarten Sie von Ihrem Partner und welche von Ihrem Haustier – gibt es Übereinstimmungen? Angenommen, Sie treffen sich zu einem Blinddate und merken, dass es nicht funkt. Wann sagen Sie es der betreffenden Person: beim Essen? Am Morgen danach? Bei der Scheidung?
All diese gesammelten Daten und Informationen werden in eine Software eingegeben, die unsere Präferenzen und Charaktereigenschaften mit potenziellen Partnern abgleicht. Wenn der errechnete Übereinstimmungskoeffizient eine bestimmte Schwelle nicht überschreitet, bietet uns der Computer den Kandidaten erst gar nicht an. Doch selbst wenn wir laut Computeralgorithmus den «perfekten» Partner treffen, schauen wir uns insgeheim weiter nach einem noch perfekteren um. Nicht wenige in meinem Bekanntenkreis optimieren die Suche nach ihrem Traumpartner genau so, wie sie auf einem Buchungsportal nach dem besten Hotelzimmer Ausschau halten. Es kann kein Zufall sein, dass sie seit Jahren Singles sind.
Meist wird die elektronische Endlosschleife des Suchens auch noch mit dem exzessiven Gebrauch diverser Ratgeberliteratur kombiniert. Beinahe jede Zeitschrift überschüttet uns mit Tipps und Tricks, den «Richtigen» zu finden. Welcher Einstiegssatz ist für welchen Frauentyp der beste? Wie genau muss ich mir durchs Haar fahren, damit «er» anbeißt? Soll ich beim ersten Date lieber ein frisches Manilagrün oder ein dezentes Steingrau tragen?
Auch die Industrie zieht mit. Neulich las ich auf der Website von Teekanne: «Mit Teekanne lassen sich Herzen im Sturm erobern.» Und ob. Man hört ja permanent Frauen seufzen: «Erst hielt ich ihn für einen totalen Deppen, aber als er mir eine Tasse ‹Frecher Flirt› aufgebrüht hat, war es um mich geschehen.»
Übrigens: Laut einer repräsentativen Studie des Wissenschaftsmagazins Cosmopolitan haben Flirtumfragen ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit für einen heißen Flirt im Urlaub oder auf einer Party am größten ist. Irre, oder? Rein intuitiv hätte ich auf «Kanalarbeiten» getippt.
Aus der Wahrnehmungsforschung ist bekannt: Wer sich zu sehr auf Details konzentriert, dem entgeht oft das Entscheidende. Vielleicht haben Sie auf YouTube das Experiment mit dem «unsichtbaren Gorilla» gesehen? Der Clip zeigt sechs Studenten, die sich auf einem Flur zwei Bälle zupassen. Zu Beginn werden Sie als Zuschauer aufgefordert, genau zu zählen, wie oft sich die drei Teilnehmer mit den weißen Shirts den Ball zuspielen. Die Pässe der drei anderen, die schwarze Shirts tragen, sollen vernachlässigt werden. Während der 25-sekündigen Sequenz läuft plötzlich ein Student in einem Ganzkörper-Gorillakostüm durch die Szenerie, bleibt mitten in der dribbelnden Gruppe stehen, schaut frontal in die Kamera und trommelt sich mit beiden Händen auf die Brust. Dann verschwindet er wieder.
Wer vor dem Anschauen von dem Gorilla weiß, kann sich nie und nimmer vorstellen, dass man ihn übersehen kann. Und doch wird er von 50 Prozent aller Personen, die vorher nichts von dem Gorilla gesagt bekommen, nicht wahrgenommen! Sie sind so intensiv damit beschäftigt, die Pässe zu zählen, dass sie keinerlei Blick für das Offensichtliche haben.
Ein ganz ähnliches Experiment wurde an der Kasse einer Tankstelle durchgeführt. Während des Bezahlens bückt sich der Kassierer nach einem heruntergefallenen Kugelschreiber. Allerdings taucht nicht er selbst wieder auf, sondern ein anderer Mitarbeiter, der sich unter dem Tresen versteckt hielt. 80 Prozent aller Kunden bemerken nicht, dass ihr Gegenüber sich «verwandelt» hatte. Selbst wenn der zweite Mitarbeiter eine attraktive Frau war, wurden nur 38 Prozent stutzig. Dieses Experiment lässt erahnen, warum manche lebenslang Singles bleiben.
Vielleicht haben wir es bei der heutigen Form der Partnersuche tatsächlich mit einer Art Unsichtbarer-Gorilla-Phänomen zu tun: Eigentlich soll durch den unkomplizierten Zugang zu einer riesigen Anzahl potenzieller Partner der Zufall weitgehend eliminiert werden. In der Realität bleiben viele trotzdem Single, weil womöglich zu viele Informationen das Relevante verdecken.
Noch vor 40, 50 Jahren lief die Partnersuche völlig anders ab. In dieser Zeit lernte man im Laufe seines Lebens gerade mal ein paar hundert Kandidaten kennen. Wenn überhaupt. In meiner Heimat, dem bayerischen Odenwald, war man schon froh, wenn einem an Fasching oder dem jährlichen Bockbierfest eine Handvoll Mädels aus dem Nachbardorf über den Weg liefen. Da wurde nicht lange gefackelt. Wenn es irgendwie passte, kam man halt zusammen, und die unangenehmen Details des anderen wurden mit genügend Alkohol zurechtgetrunken. Heute ziehen wir bereits vor dem ersten Date das komplette World Wide Web auf links, um eventuelle Ausschlusskriterien zu entdecken. «Guck mal, der hat doch tatsächlich in den Neunzigern ein Freundschaftsbändchen von Wolle Petry getragen! Das geht ja wohl gaaar nich …»
Der hohe Single-Anteil ist jedoch keine Erscheinung der Moderne. Wenn wir uns heute über das Alleinsein beschweren, dann sollten wir hundert Jahre zurückblicken. Damals fand nur etwa die Hälfte der Bevölkerung überhaupt einen Partner. Unzählige Hausangestellte, schrullige Tanten, alte Jungfern, arme Bauern und Mägde bekamen nie jemanden ab. Die Ursachen dafür waren allerdings andere. Die meisten konnten es sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten zu heiraten. Und die, die es sich leisten konnten, taten es oft gezwungenermaßen: Bauer 1 verheiratete seine Tochter mit dem Sohn von Bauer 2, damit der Hof erhalten blieb. Sohn und Tochter wurden einander vorgestellt, hassten sich und lernten sich im Laufe der Ehe lieben. Heute lernt man sich kennen, verliebt sich und lernt sich im Laufe der Ehe hassen. Gesellschaftlich gesehen ein großer Fortschritt.
Hört man sich im Freundeskreis um, so ertönt meist der Satz, dass man sich in dem Moment gefunden habe, als man gar nicht auf der Suche war. Und dann habe das Schicksal zugeschlagen! Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wie romaaaantisch! Schaut man indes auf die unromantische Wissenschaft, nimmt der Zufall einen so großen Stellenwert gar nicht ein. Damit es zwischen zwei Menschen funkt, müssen beide dazu bereit sein und gerade nicht mit etwas anderem beschäftigt.
Der amerikanische Sozialpsychologe Stanley Schachter fand in den sechziger Jahren heraus, dass eine große Anzahl von Gefühlen durch simple körperliche Erregungszustände simuliert werden können. Spritzt man männlichen Versuchspersonen beispielsweise Adrenalin und bringt sie kurz darauf mit einer Frau zusammen, die sich nett mit ihnen unterhält, so geben viele Männer danach an, ein starkes Gefühl der Verliebtheit empfunden zu haben. Das Problem: Adrenalin wird auch bei Gefühlen wie Ekel, Abscheu oder Wut ausgeschüttet. Schachter konnte zeigen, dass (männliche wie weibliche) Probanden einen identischen körperlichen Zustand völlig unterschiedlich interpretieren, je nachdem, welche Erklärung ihnen den äußeren Umständen nach sinnvoll erscheint. Wenn Sie sich also zum ersten Date beim Italiener um die Ecke verabreden und glauben, es würde funken, dann könnte Ihr beschleunigter Puls auch an dem verdorbenen Pilzrisotto liegen, das Sie gerade gegessen haben. Es mag unromantisch klingen, aber manchmal sind Schmetterlinge im Bauch von einer handfesten Lebensmittelvergiftung kaum zu unterscheiden. Abends war er noch der tolle Typ, und am nächsten Morgen ist er zum Kotzen.
Gefühle können also trügerisch sein. Und genau das macht es schwierig, den oder die Richtige zu finden. Zweifellos kann man mit Hilfe von Datingportalen die Suche nach dem Traumpartner optimieren. Die Ironie dabei: Die nahezu grenzenlose Auswahl an unterschiedlichen Partnern führt nicht etwa dazu, dass in Partnerschaften gesellschaftliche und soziale Unterschiede nivelliert werden – tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Seit dem Aufkommen von Online-Partnerbörsen nimmt die Anzahl derjenigen Beziehungen zu, bei denen beide der gleichen sozialen Schicht entstammen. Unsere Beziehungen werden also immer homogener. Denn die Match-Kriterien sind auf Ähnlichkeiten der jeweiligen Kandidaten ausgelegt. Altersverteilung, Bildungsstand, aber auch Konfession, Herkunft und vor allem das Einkommen haben den Partnermarkt fest im Griff.
Männer tun deshalb gut daran, ein hohes Einkommen anzustreben. Genauer gesagt sollte das Einkommen des Mannes auf jeden Fall höher sein als das der Frau. Und damit Sie jetzt nicht denken, das wären blöde Macho-Sprüche: Es sind nicht die Männer, die ihr Ego mit dem Geld befriedigen wollen, in Wirklichkeit sind die Frauen der Grund, weshalb wir Typen auf Teufel komm raus Karriere machen. Statistiken zeigen eindeutig: Wann immer Frauen die Gelegenheit haben, frei unter mehreren Bewerbern zu wählen, entscheiden sie sich für den mit dem höheren Status. Ehefrauen, die mehr verdienen als ihr Partner, reichen doppelt so häufig die Scheidung ein wie diejenigen, die weniger verdienen.
Liebe Feministinnen, wir Männer sind an dieser ganzen Karriere- und Konkurrenznummer unschuldig. IHR habt uns zu dem gemacht, was wir sind! Oder wie es eine gute Freundin von mir ausdrückte: Wer einen reichen Mann kennenlernt und sich nicht augenblicklich in ihn verliebt, der hat kein Herz.
Der Songtitel «Money can’t buy me love» ist demnach also nicht ganz korrekt. Nennen Sie mir ein einziges Fotomodell, das mit einem Busfahrer oder einem Kioskverkäufer liiert ist. Warum, glauben Sie, ist der Formel-1-Boss Bernie Ecclestone wohl mit einer fast 50 Jahre jüngeren brasilianischen Schönheit verheiratet? Weil er so brillant aussieht, so sensibel ist und ein solch geduldiger Zuhörer?
Machen wir uns nichts vor: Geld und Macht wirken auf viele Frauen betörend. Da die Anziehungskraft eines Mannes mit seinem Vermögen steigt, gehen Männer zwischen 40 und 60 am meisten fremd. In dieser Zeit haben sie in der Regel beruflich ihren Zenit erreicht. Mit 50 ist ein Mann zeugungsfähig, erfolgreich und untreu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb sich Glatzenbildung bei Männern evolutionär durchgesetzt hat. So können junge Männer mit schütterem Haupthaar den Damen ein höheres Alter und damit einen höheren Status vorgaukeln. Meine hohe Stirn zum Beispiel ist nicht genetisch bedingt, nein, ich habe mir vor einigen Jahren den Haaransatz weglasern lassen.
In der Frühzeit war vor allem die körperliche Fitness ein wichtiges Kriterium für die Partnerwahl. Denn die Steinzeitfrau musste bei der prähistorischen Fisch-sucht-Fahrrad-Party sichergehen können, dass der nette Typ kein genetischer Vollpfosten war. Daher achteten unsere weiblichen Vorfahren bei der Partnerwahl auf sogenannte fälschungssichere Signale – Eigenschaften also, die man nicht faken kann und die einen gesunden, treusorgenden Vater versprechen: starker Muskelbau, gute Zähne, aber auch Persönlichkeitsmerkmale wie Mut oder Verantwortungsgefühl.
Das Konzept des fälschungssicheren Signals ist im Übrigen auch der Grund, weshalb der Homo sapiens von allen Primaten im Vergleich zu seiner Körpergröße den mit Abstand größten Penis entwickelt hat (worauf ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz bin). Der Penis eines Gorillas ist gerade mal drei Zentimeter lang. Also fast unsichtbar – selbst bei einem sichtbaren Tier! Länger muss er nicht sein, denn der Silberrücken ist sowieso der Pascha, der das Recht hat, alle Weibchen zu begatten. Folglich muss er sie nicht mit seiner Performance beeindrucken. Beim Homo sapiens dagegen haben die Weibchen die Auswahl. Und deswegen hat uns Mutter Natur einen großen Penis gegeben. Der die unangenehme Eigenschaft hat, versagen zu können. Und genau da schlägt das Pendel zurück: Bei drei Zentimetern steht das Ding mehr oder weniger immer. Bei dreizehn Zentimetern wird’s schon schwieriger. Die versagen bei Stress, bei schlechter Ernährung, bei geringem Selbstvertrauen. Und damit war der Penis für die Steinzeitfrau ein perfekter Indikator für körperliche und seelische Fitness. Für uns Männer dagegen ist ein großer Penis eigentlich ziemlich blöd. Er ist verletzbar – springt man über einen Zaun, können schlimme Dinge passieren. Aber die Frauen sagen sich: Ein Typ, der mit einem solch dämlichen Teil überlebt hat, der muss was auf der Pfanne haben!
Wobei wir im Vergleich zum Tierreich noch Glück gehabt haben. Der Penis der argentinischen Ruderente kann bis zu 40 Zentimeter lang werden. Und diese Ente ist nicht besonders groß! Wenn die kopuliert, ist das eine Fernbeziehung.
Noch extremer treibt es die Seepocke. Der kleine Krebs ist festsitzend und hat deshalb keine Möglichkeit, auf Brautschau zu gehen. Daher hat er im Verhältnis zur Körpergröße den längsten Penis aller Geschöpfe und gilt als «Long Dong Silver» des Tierreichs. Das Zeugungsorgan kann zehnmal (!) länger werden als der Körper. Übrigens stehen Seepocken üblicherweise auf ihren Köpfen und fressen mit den Füßen – ein eindeutiger Hinweis, dass ein übermäßig großes Gemächt zu schweren psychischen Störungen führen kann.
Auch wir Männer achten bei einer potenziellen Partnerin auf fälschungssichere Signale. Auf Symmetrie zum Beispiel. «Hat die Frau zwei Augen? – Passt!»
Tatsächlich ist die angeblich so oberflächliche Konzentration auf die weibliche Schönheit ein wichtiges evolutionäres Selektionskriterium. «Wäre Dornröschen nicht wunderschön, sondern einfach nur sympathisch gewesen – sie würde heute noch schlafen», lautet ein bekannter T-Shirt-Spruch. Und der ist deckungsgleich mit allen Forschungsergebnissen. Man konnte zeigen, dass die typisch weiblichen Schönheitsmerkmale durch einen hohen Östrogenspiegel ausgebildet werden. Es mag banal klingen, aber: Hübsche Frauen sind fruchtbarer. Weibliche Schönheit ist also kein überflüssiger Luxus, sondern ein Indikator für gesunden Nachwuchs. Kein Wunder, dass wir Typen eher auf Rundungen als auf Hirnfurchen abfahren.
Die Analysen von Partnerportalen zeigen eindeutig: Es braucht nicht allzu viel, damit ein Mann Interesse an einer Frau zeigt. Wenn das Foto der Kandidatin okay ist, ist das für uns Typen schon die halbe Miete. Oft sogar die ganze. Hohe Intelligenz ist ebenfalls ein Pluspunkt – solange die Frau sie einigermaßen verheimlicht. Viel wichtiger ist Männern jedoch die Frage: Ist sie nett zu mir? Wobei man sagen muss, dass ein Großteil der Herren unter «nett sein» versteht, dass die Frau grundsätzlich von ihnen begeistert ist und sich auch dann noch vor Lachen auf den Boden schmeißt, wenn er den müdesten Kalauer ever abfeuert. Doch Vorsicht, liebe Männer: Falls ihr glaubt, die Gabe zu besitzen, eine Frau zum Lachen zu bringen, stellt euch in einer stillen Stunde mit größtmöglicher Ehrlichkeit die Frage: Liegt es wirklich an meinem Witz oder bin ich womöglich selbst der Witz?
Das Problem bei den fälschungssicheren Signalen ist: Sie sind selbst beim detailliertesten Parship-Profil nur schwer erkennbar. Wesentlich vielversprechender ist eine Methode, die der Psychologe Samuel Gosling entwickelt hat. Gibt man einer Person fünfzehn Minuten Zeit, sich in einer fremden Wohnung umzusehen, und bittet sie danach, die grundsätzliche Persönlichkeit des Bewohners zu beschreiben, dann «kennt» diese Person den Bewohner genauso gut wie seine besten Freunde.
Sollten Sie also den Partner fürs Leben suchen, dann vergessen Sie fortan zeitaufwändige Kennenlernrunden und sündhaft teure Abendessen. Besorgen Sie sich unauffällig einen Zweitschlüssel von Ihrem Date, und schauen Sie sich ein wenig in seiner Bude um. Dort werden Sie Dinge bemerken, die das allwissende World Wide Web nicht im Entferntesten weiß.