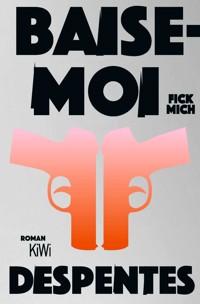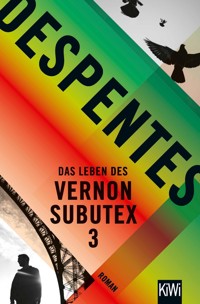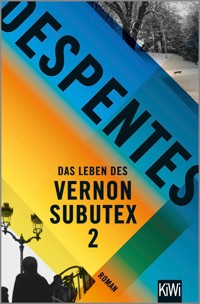11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit der ihr eigenen Verve und Sprachgewalt nimmt sich Despentes der Themen unserer Zeit an – #MeToo und Social Media, Drogen, Machtmissbrauch, Feminismus. Ungeschönt, aber nicht unversöhnlich hält Despentes unserer Gesellschaft den Spiegel vor. Rebecca, Schauspielerin, über fünfzig und immer noch recht gut im Geschäft. Oscar, dreiundvierzig, Schriftsteller, der mit seinem zweiten Roman hadert, und Zoé, noch keine dreißig, Radikalfeministin und Social-Media-Aktivistin. Diese drei, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen nach einem verunglückten Instagram-Post Oscars aufeinander. Wie? Digital. Und so entsteht ein fulminanter Briefroman des 21. Jahrhunderts, in dem alle wichtigen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit verhandelt werden. Rebecca, Oscar, Zoé, alle drei sind vom Leben gezeichnet, voller Wut und Hass auf andere – und auf sich selbst. Aber sie müssen erkennen, dass diese Wut sie nicht weiterbringt, sondern nur einsamer macht, dass Verständnis, Toleranz und sogar Freundschaft erlernbar und hin und wieder sogar überlebenswichtig sind. Mit dieser Tour de Force durch gesellschaftliche Debatten und Konflikte behauptet Virginie Despentes klar ihre Position als eine der wichtigsten Autor*innen Frankreichs, die Wut und Aggression gekonnt einsetzt, um Versöhnung zu predigen. Ganz große Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Virginie Despentes
Liebes Arschloch
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Virginie Despentes
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Virginie Despentes
Virginie Despentes, Jahrgang 1969, zunächst bekannt als Autorin der »Skandalbücher« »Baise-moi – Fick mich« und »King Kong Theorie«, hat sich spätestens mit ihren Vernon-Subutex-Romanen in den Olymp der zeitgenössischen französischen Schriftstellerei geschrieben. Despentes war mehrfach für den Prix Goncourt nominiert.
Ina Kronenberger übersetzt aus dem Norwegischen und Französischen, vornehmlich Belletristik. Zu den von ihr übersetzten Autor*innen gehören Per Petterson, Nina Lykke, Philippe Claudel und Anna Gavalda.
Tatjana Michaelis studierte Literaturwissenschaft und war Lektorin in einem literarischen Verlag. Heute arbeitet sie als freie Lektorin und Übersetzerin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Mit der ihr eigenen Verve und Sprachgewalt nimmt sich Despentes der Themen unserer Zeit an – #MeToo und Social Media, Drogen, Machtmissbrauch, Feminismus. Ungeschönt, aber nicht unversöhnlich hält Despentes unserer Gesellschaft den Spiegel vor.
Rebecca, Schauspielerin, über fünfzig und immer noch recht gut im Geschäft. Oscar, dreiundvierzig, Schriftsteller, der mit seinem zweiten Roman hadert, und Zoé, noch keine dreißig, Radikalfeministin und Social-Media-Aktivistin. Diese drei, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen nach einem verunglückten Instagram-Post Oscars aufeinander. Wie? Digital. Und so entsteht ein fulminanter Briefroman des 21. Jahrhunderts, in dem alle wichtigen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit verhandelt werden. Rebecca, Oscar, Zoé, alle drei sind vom Leben gezeichnet, voller Wut und Hass auf andere – und auf sich selbst. Aber sie müssen erkennen, dass diese Wut sie nicht weiterbringt, sondern nur einsamer macht, dass Verständnis, Toleranz und sogar Freundschaft erlernbar und hin und wieder sogar überlebenswichtig sind.
Mit dieser Tour de Force durch gesellschaftliche Debatten und Konflikte behauptet Virginie Despentes klar ihre Position als eine der wichtigsten Autor*innen Frankreichs, die Wut und Aggression gekonnt einsetzt, um Versöhnung zu predigen. Ganz große Literatur.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Widmung
Habe Rebecca Latté gesehen, in Paris. Sofort sind in meiner Erinnerung alle Frauenfiguren aufgeploppt, die sie gespielt hat, gefährliche, toxische, verletzliche Frauen, berührende, auch heroische – wie oft habe ich mich nicht in sie verliebt, wie viele Fotos von ihr habe ich nicht in wie vielen Wohnungen über wie vielen Betten aufgehängt, wo sie mich zum Träumen gebracht haben. Tragische Metapher einer Epoche, die den Bach runtergeht – diese göttliche Frau, die zu ihren besten Zeiten so viele Teenies in die Faszination der weiblichen Verführung eingeführt hat – heute zu einer Schlampe verkommen. Nicht nur alt. Sie ist auch auseinandergegangen, verlebt, schlechte Haut, ein schmuddeliges, lautes Weibstück. Eine einzige Katastrophe. Angeblich hat sie sich zur Ratgeberin junger Feministinnen aufgeschwungen. Die Internationale der Jammergestalten hat wieder zugeschlagen. Überraschungseffekt gleich null. Fix und fertig fläze ich mich auf dem Sofa und höre Hypnotize von Biggie in Dauerschleife.
Liebes Arschloch,
ich habe deinen Beitrag auf Insta gesehen. Du bist wie eine Taube, die mir im Vorbeifliegen auf die Schulter kackt. Das ist dreckig und sehr unangenehm. Fiep, fiep, fiep, ich bin ein kleiner Angsthase, für den sich niemand interessiert, und winsle wie ein Chihuahua, weil ich davon träume, dass man mich bemerkt. Ruhm den sozialen Netzwerken. Du hast deine Viertelstunde Ruhm gehabt. Der Beweis, ich schreibe dir. Ich bin sicher, du hast Kinder. Ein Typ wie du pflanzt sich fort, die Linie könnte sonst aussterben. Leute, je bescheuerter und nutzloser ihr seid, umso mehr fühlt ihr euch verpflichtet, die Linie fortzusetzen. Ich hoffe jetzt nur, dass deine Kinder von einem Lastwagen überfahren werden und du ihren Todeskampf mitansehen musst, ohne etwas tun zu können, und dass ihnen die Augen aus den Höhlen spritzen und ihre Schmerzensschreie dich jeden Abend verfolgen. Das ist das Einzige, was ich dir wünsche. Und lass Biggie aus dem Spiel, du Honk.
Das war heftig. Aber ich habe es provoziert. Meine einzige Entschuldigung: Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie meinen Account lesen. Vielleicht habe ich es insgeheim auch gehofft, ohne so recht daran zu glauben. Es tut mir leid. Ich habe den Beitrag und alle Kommentare gelöscht.
Trotzdem ist es heftig. Zuerst war ich geschockt. Dann aber, das gebe ich zu, habe ich sehr gelacht.
Ich will Ihnen erklären, warum. Ich saß nur wenige Tische von Ihnen entfernt im Straßencafé in der Rue de Bretagne – traute mich nicht, Sie anzusprechen, beobachtete Sie aber intensiv. Vermutlich fühlte ich mich gedemütigt, weil Ihnen mein Gesicht nichts zu sagen schien, aber auch wegen meiner eigenen Schüchternheit. Sonst hätte ich niemals derart gemeine Sachen über Sie geschrieben.
Was ich Ihnen an dem Tag sagen wollte – keine Ahnung, ob Sie sich daran erinnern –, ist, dass ich Corinnes kleiner Bruder bin, Sie waren in den Achtzigern mit ihr befreundet. Jayack ist ein Pseudonym. Meine Familie heißt Jocard. Wir wohnten am Square Maurice Barrès. Ich weiß noch, dass Sie aus dem Viertel Kali stammten, Ihre Wohnanlage hieß Donau. Damals kamen Sie oft zu uns nach Hause. Ich war nur der kleine Bruder, habe Ihnen beiden auf Abstand hinterherspioniert, Sie haben selten mit mir geredet. Aber ich sehe Sie noch vor meiner Carrerabahn, wo es Ihnen nur darum ging, mir zu zeigen, wie man die Autos aus der Bahn schleudert.
Sie hatten ein grünes Fahrrad, ein Rennrad, ein Jungenrad. Und haben säckeweise Schallplatten im Hall du Livre geklaut, irgendwann haben Sie mir Station to Station von David Bowie geschenkt, weil Sie es doppelt hatten. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich schon mit neun Jahren Bowie gehört habe. Die Platte habe ich heute noch.
Mittlerweile bin ich Schriftsteller geworden – und auch wenn ich bei Weitem nicht Ihre Berühmtheit erreicht habe, lief es bei mir nicht schlecht, und ich habe schon lange Ihre Mailadresse. Ich hatte sie mir besorgt, weil ich eigens für Sie einen Theatermonolog schreiben wollte. Ich hatte aber nie den Mut, Sie zu kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen.
Junge, behalt deine Entschuldigungen, behalt deinen Monolog, behalt alles für dich: Nichts an dir interessiert mich. Falls es dich beruhigt, noch wütender als auf dich bin ich auf den hirnlosen Idioten, der mir den Link zu deinem Beitrag geschickt hat, als müsste man mich über jede Beleidigung meiner Person auf dem Laufenden halten. Ich pfeife auf dein durchschnittliches Leben. Ich pfeife auf dein gesamtes Werk. Ich pfeife auf alles, was dich betrifft, außer auf deine Schwester.
Natürlich erinnere ich mich an Corinne. Ich hatte jahrelang nicht an sie gedacht, aber seit ich ihren Namen gelesen habe, ist alles wieder da, als hätte ich eine Schublade aufgezogen. Wir haben zusammen Karten gespielt auf einem Schlitten, der als Couchtisch in ihrem Zimmer stand. Wir haben die Fensterläden geöffnet und Fluppen geraucht, die ich meiner Mutter geklaut hatte. Ihr hattet vor allen anderen eine Mikrowelle, und darin haben wir Käse geschmolzen und auf Zwiebäcke gestrichen. Ich erinnere mich auch, dass ich sie in den Vogesen besucht habe – sie arbeitete als Betreuerin in einem Chalet mit Pferden. Mit ihr bin ich zum ersten Mal in eine Bar gegangen, wir haben so lässig Flipper gespielt, als hätten wir das schon ein Leben lang gemacht. Corinne hatte ein Motorrad – angesichts unseres Alters dürfte es ein frisiertes Mofa gewesen sein. Sie rauchte rote Dunhill und trank Bier mit Limo. Gelegentlich sprach sie über Ostdeutschland und Thatchers Politik, Dinge, mit denen sich damals in meiner Umgebung niemand beschäftigte.
Ich habe Nancy gehasst, ich denke selten daran und habe keine Sehnsucht nach der Kindheit – es überrascht mich selbst, dass mir wieder etwas aus dieser Zeit einfällt, und auch noch etwas Angenehmes.
Sag deiner Schwester, dass ich ihren Namen im Internet eingegeben und nichts gefunden habe. Ich vermute, sie hat geheiratet und einen anderen Namen angenommen. Umarme sie von mir. Und was dich betrifft, krepiere.
Corinne hat nie einen Social-Media-Account eröffnet. Nicht weil sie technikfeindlich wäre, sondern weil sie eine Soziopathin ist. Ich erinnere mich sehr genau daran, wie du zu uns nach Hause kamst. Später bist du ein Kinostar geworden, und es war für mich unfassbar, dass ein und dieselbe Person in unserer Küche sitzen und ihren Auftritt bei der Oscarverleihung haben konnte. Damals konnte noch nicht jeder berühmt werden. Ich fand es verrückt, dass es jemanden traf, der aus unserem Viertel stammt. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, mir einen Verleger für meinen ersten Roman zu suchen, wenn ich dich nicht gekannt hätte. Du warst der lebende Beweis dafür, dass meine Familie falsch lag: Ich hatte ein Recht darauf zu träumen. Es war wirklich bescheuert von mir, solche Gemeinheiten über dich zu schreiben. Du hast recht, es war ein erbärmlicher Versuch, deine Aufmerksamkeit zu erregen.
Ihr wart nicht auf derselben Schule, meine Schwester und du, und ich habe keine Ahnung, wie ihr Freundinnen geworden seid. In der Grundschule war eure liebste Beschäftigung, aus großen Pappkartons mehrstöckige Puppenhäuser zu basteln. Ein größeres Unterfangen, und sogar meine Mutter, die keinen Sinn für verrückte Ideen hatte, ließ euch gewähren und beschwerte sich nicht über das Chaos in Corinnes Zimmer. An einem schulfreien Tag hast du einmal eine Kühlschrankverpackung angeschleppt, in der ihr dann Schuhschachteln als Wohnungen übereinandergestapelt habt. Für Barbiepuppen war die Decke nicht hoch genug, also habt ihr die Sammlerpuppen meiner Mutter genommen, die auf einem Regal im Wohnzimmer angeordnet waren. Als sie ihre kleinen Bretoninnen, Sevillanerinnen und Elsässerinnen in eurem Mietshaus entdeckte, machte ich mich auf einen gewaltigen Wutausbruch gefasst. Die Situation ist mir unvergesslich, weil meine Mutter nicht einmal so tat, als würde sie sich aufregen. Die Freude war stärker als ihre Prinzipien. Sie sagte nur, »das geht jetzt aber zu weit«, doch bevor sie euch befahl, die Puppen wieder in ihre Plastikröhren zu packen und das Zimmer aufzuräumen, kauerte sie kopfschüttelnd vor eurem Turm, »nicht zu fassen«. Der Form halber schimpfte sie ein bisschen, aber sie war durchschaut. Wir, ihre Kinder, brachten meine Mutter nicht oft zum Lachen. Du hattest ihre schlechte Laune besiegt. Wenn sie dich später im Fernsehen sah, sagte sie immer: »Wisst ihr noch, wie Coco und sie meine Trachtenpüppchen aus dem Regal geholt haben, um ihren Pappkartonturm einzurichten … sie traute sich was, die Kleine. Und wie hübsch sie damals schon war.«
Noch bevor ich alt genug war, um »1000 Kilometer« spielen zu können, wusste ich, dass du hübsch warst, aber so richtig klar wurde es mir am Ende eines Sommers, wenige Tage vor Schuljahresbeginn, als du zu uns kamst und gleich beim Reinkommen sagtest: »Machen wir uns einen Kaffee?« Ab dem Tag war Schluss mit den Puppen. Du warst erwachsen geworden. Und nicht wiederzuerkennen.
Häschen, ich nehme an, du ahnst, dass du nicht der Erste bist, der mir sagt, ich bin eine Granate, und nicht der Erste, der merkt, ich bin berühmt …
Aber ich muss zugeben, du bist der Erste, der es wagt, mich wie ein Stück Dreck zu beschimpfen, und dann im gleichen Atemzug zu säuseln, »wir kommen aus demselben Viertel, wir haben gemeinsame Erinnerungen«.
An diesem Punkt des Wettstreits verlangt dein Schwachsinn Respekt. Das ändert nichts am Kern der Sache: Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Liebe Grüße an deine Schwester, die eine großartige Freundin war.
Ich weiß nicht, ob du kapiert hast, dass meine Schwester Mädchen liebt. Damals redete sie nicht darüber. Ich sah sehr wohl, wie trampelig sie war, stämmiger als ihre Freundinnen, und fand es unangenehm, dass sie nicht einmal versuchte, etwas dagegen zu unternehmen, aber ich zog daraus keine weiteren Schlüsse. Jahre später, meine Eltern verbrachten den August in Spanien, habe ich bei ihnen die Katze gehütet. Es herrschte eine Affenhitze, und Corinne, die da schon in Paris lebte, kam ebenfalls nach Hause, um den kleinen Garten zu nutzen. Sie legte ihr Handtuch in den Schatten des Pfirsichbaums und verbrachte den ganzen Nachmittag mit Lesen oder hörte auf ihrem Discman CDs. Manchmal fuhren wir mit dem Auto ins Schwimmbad. Wir hatten nie zusammen Urlaub gemacht. Wir ließen uns gegenseitig in Ruhe, jeder verbrachte den Tag nach seinem Gusto, und irgendwann fand sie in einer Kiste in der Garage die VHS-Kassetten der Mad-Max-Trilogie, also setzten wir uns ins Wohnzimmer, schlossen die Läden und zogen uns eisgekühltes Bier und Mel Gibson rein. Leicht angetrunken erzählte ich ihr zwischen zwei Filmen von der Frau, mit der ich zusammen war, von der ich aber die Nase voll hatte. Trotzdem brächte ich es nicht über mich, sie zu verlassen. Corinne hörte mir zu, ohne wie üblich dazwischenzufahren. Ich muss mich zwingen, sie anzurufen, sagte ich, sonst macht sie mir ein Riesentheater, aber eigentlich bin ich froh, dass sie arbeitet, weil sie mir die Luft abdrückt, mich langweilt, es ist ziemlich deprimierend. Mir war absolut schleierhaft, warum ich nicht mit ihr Schluss machte, wovor ich Angst hatte. Wir wohnten nicht zusammen. Im Grunde befürchtete ich wohl, dass ich nach der Trennung von ihr zu lebenslänglichem Zölibat verurteilt wäre, und dachte, besser eine Freundin, die dich nervt, als für immer allein. Das traute ich mich aber nicht, laut zu sagen, daher fragte ich meine Schwester, wie es bei ihr mit den Jungs so läuft. Sie hatte noch nie einen Freund gehabt. Was mich nicht überraschte. Sie war nicht besonders hübsch und auch nicht einfach im Umgang. Ich fürchtete mich vor ihr und nahm an, dass sie auch anderen Typen Angst einflößte.
Ohne Umschweife antwortete sie: »Ich habe was mit Frauen.« Das war ihr Outing. Sie wohnte seit drei Jahren in Paris. »Meine Schwester ist homosexuell«, dachte ich, und es kam mir völlig unwirklich vor. Lesbe existierte für mich nicht mal als Schimpfwort. Ich hatte für meine Schwester eine ganze Latte an abfälligen Ausdrücken auf Lager, aber »Lesbe« wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Ich hatte mich nie gefragt, ob es solche Frauen wirklich gab, ich kannte keine einzige. Corinne warnte mich, wenn ich es irgendwem erzählen sollte, würde sie mir die Fresse polieren – ich sagte, ich hätte noch nie gepetzt, und sie meinte, stimmt, du kannst gut deine große Klappe halten, das habe ich dir beigebracht. Sie musste lachen. Ich nicht. Als ich klein war, hagelte es Ohrfeigen, sobald ich in ihre Nähe kam, und es wäre mir lieber gewesen, sie hätte ihr Verhalten aufrichtig bedauert, als mich so vergnügt daran zu erinnern.
Wir legten den dritten Mad Max ein, und ich fühlte mich unwohl. Verrückt, dass dieses Schicksal ausgerechnet uns traf. Es mochte noch angehen, wenn man als Frau dick, hässlich und unattraktiv war – etwas völlig anderes war es, lesbisch zu sein. Sie tat mir leid – ich stellte mir ihr Leben in Paris vor, wie Leute sie mit Steinen bewarfen, wie ihr die Frauen ins Gesicht lachten und sie abstoßend fanden, Arbeitgeber sie angewidert entließen. Wenige Tage später stieg sie in den Zug nach Paris, und wir sprachen nicht weiter darüber.
Ich dachte, es sei ein peinliches Geheimnis, das wir ein Leben lang für uns behalten würden. Doch anderthalb Jahre später versammelte sich die ganze Familie an Weihnachten in den Vogesen, wir hatten zu viel gegessen und getrunken, und sie und ich machten einen Waldspaziergang. Ich sehe sie noch vor mir, orange Fäustlinge, von unserer Tante geliehen, die Nase rot vor Kälte, lächelnd zwischen den Tannen, wie sie bestens gelaunt und mit unendlicher Verachtung über Heteros herzog, die seien »allesamt Spießer«. Heute ist das Wort Hetero in aller Munde, damals hörte ich es zum ersten Mal. Ihr beiläufiges und würdevolles Coming-out lag weit hinter ihr. Nun war sie eine Butch, ein »politisches Subjekt«. Versteckt unter meiner Daunenjacke hatte ich einen Champagner mitgenommen, und ich sah, wie sie ihn direkt aus der Flasche trank, ihre Heiterkeit machte mich sprachlos. Eigentlich hätte sie zwischen den Tannen auf die Knie fallen und die Götter anflehen müssen, wieder normal zu werden, von einem anständigen Mann Kinder zu kriegen und im Rahmen einer familienkonformen Ehe einen Autokredit abzuschließen. Der Champagner gab mir den Mut, sie zu fragen, »könnten diese Frauengeschichten nicht einfach eine Phase in deinem Leben sein?« Sie steckte die Hände in die Taschen, »ich hoffe, nicht. Als Hetero bin ich eine Niete, auf dem Lesbenmarkt dagegen eine wahre Sharon Stone.« Ihre Antwort erschütterte mich. Von klein auf waren wir beide beim Flirten eher die Loser gewesen. An dem Tag kam es mir vor, als würde sie mir ihre Hand entziehen, um mich allein in der Dunkelheit zurückzulassen, während sie zu sonnigen Stränden davonhüpfte. Sie hatte ihr Ding gefunden, ich nicht.
Auf dem Rückweg haben wir uns verfranzt, und sie hörte nicht auf zu erzählen, wie froh sie sei, lesbisch zu sein. Eines konnte ich nachvollziehen: Auch ich hatte wenig Lust, den anderen Familienmitgliedern zu ähneln. Damals träumte ich davon, Journalist zu werden, was ich bei Tisch nie zugegeben hätte. Ich konnte die Reaktion der anderen regelrecht vor mir sehen, ihr Gelächter, die verdrehten Augen, »er hat sich schon immer für was Besseres gehalten«, »meinst du denn, die Welt hat auf dich gewartet?«, und die ganze Litanei der Mittelschicht, die zum Arbeitnehmerdasein verdammt ist, zu einem Job, den man des Geldes wegen macht und niemals aus Berufung. Seinen Platz zu kennen war wichtiger als alles andere. Während unseres Spaziergangs spürte ich intuitiv, dass ihr Verzicht auf den üblichen Weg der Frauen aus unserer Familie und der Nachbarschaft etwas mit genau diesem Wunsch nach Befreiung zu tun hatte.
Anschließend habe ich ihre Entwicklung für mich rekonstruiert. In ihrer Jugend hatte sie heimlich was mit ein paar Mädchen gehabt, die aber, sobald sich die Gelegenheit bot, sofort was mit Männern anfingen. Corinne, allein mit ihrem Liebeskummer, litt wie ein Hund, und ich kenne die Mädchen, sie haben null Mitleid mit den Verlierern. Und Lesben waren damals mehr als Verliererinnen – sie hatten keine Daseinsberechtigung. Sie brauchten gar nicht erst in den Ring der konventionellen Weiblichkeit zu steigen.
Sobald sie das Abi in der Tasche hatte, zog Corinne nach Paris, sie schrieb sich an der Uni ein und lebte von Gelegenheitsjobs, fand jedoch schnell eine Vollzeitstelle am Empfang eines Fitnessklubs und schmiss die Uni. Sie verliebte sich in eine Kollegin, ihre erste ernsthafte Liaison, die beiden unternahmen viel zusammen, Ausstellungen, Kino, Konzerte und Wochenenden in der Normandie. Eines Tages verkündete ihr die Frau, sie würde heiraten. Corinne war ihre Trauzeugin. Küsste sie ein letztes Mal im weißen Kleid. Sollte meine Schwester tatsächlich ein Herz haben, dann glaube ich, ist es an diesem Tag gebrochen. Danach wurde alles anders – der Fitnessklub machte dicht, sie rutschte für einige Monate in die Arbeitslosigkeit, hing in Kneipen ab. Dort lernte sie die Frau kennen, die alles verändern sollte, die zu ihr sagte, »meine Eltern wissen Bescheid, ich bin Lesbe, ob es ihnen gefällt oder nicht, und sie können mich mal, genau wie alle anderen, denen das nicht passt«. Sie zogen zusammen. Gingen in Frauen-Bars und Corinne politisierte sich. Sie veränderte ihr Aussehen, legte alle äußeren Anzeichen von Weiblichkeit ab, Schluss mit langen Haaren, Schmuck, schicken Schuhen, Schminke. Sachen, bei denen sie sich manchmal ungeschickt im allgemeinen Repertoire bedient hatte und die nicht zu ihrer Physiognomie passten. Wie kleine Transplantate, die ihr Körper abstieß.
Erst die Geburt meiner Tochter hat unser Verhältnis verändert. So wie meine Schwester jedem, der es hören will, entgegentrompetet, sie werde dieses Konzentrationslager fieser Neurosen, das die Kleinfamilie darstellt, niemals kopieren, und die Überlegenheit einer Lesbe über die heterosexuelle Frau bestehe genau darin, dass sie sich nicht verpflichtet fühlt, Mama zu werden – so erfüllt sie dennoch ihre Rolle als Tante mit einem Ernst, der an Beflissenheit grenzt.
Wir können uns zu jeder Zeit auf sie verlassen. Meine Tochter heißt Clémentine, und man kann nicht behaupten, sie sei einfach im Umgang. Sie ist im Gegenteil äußerst schwierig. Aber nie gibt es Protest, wenn wir ihr ankündigen, dass sie für zwei Wochen zu meiner Schwester soll. Léonore, die Mutter meiner Tochter, die niemandem über den Weg traut, überlässt sie ihr, ohne zu zögern.
Meine Schwester wohnt in der Nähe von Toulouse, in einem heruntergekommenen, aber weitläufigen Haus, wo die Kleine ihr Zimmer unterm Dach hat, und ich erinnere mich noch gut, wie wir sie das erste Mal für ein paar Tage allein dort zurückgelassen haben. Als wir im Auto davonfuhren, war ich mir sicher, wir müssten am Ende der Allee umkehren und sie wieder abholen. Aber Léonore hat nicht verlangt, dass wir das geplante Wochenende absagen. Sie vertraut Corinne vollständig. Zu Recht. Ich werde meiner Schwester liebe Grüße von dir bestellen, das wird sie freuen.
Hast du keinen Freund, mit dem du reden kannst? Noch bevor ich dich fragen kann, wie’s deiner Schwester geht, schickst du mir schon ihren ganzen Lebenslauf. Zum Glück finde ich das interessant, ich habe den ganzen Nachmittag für deine Mail gebraucht.
Nein, ich hatte nicht mitgekriegt, dass Corinne auf Mädchen stand, aber jetzt, wo du es sagst, frage ich mich, wie mir das entgehen konnte. Ich sehe sie vor mir im Jugendklub, in Shorts mit ihrem Ping-Pong-Schläger, wie sie alle plattmachte, und klar, sie war geradezu die Karikatur einer Lesbe. Aber darauf kam man nicht. Es gab einige Schwule bei uns. Aber die Mädchen in den Achtzigern, die waren für mich hetero, Punkt.
Sie hätte mir gefallen können. Wenn ich jetzt so daran denke. Sie hatte was, ich hätte sie nicht ausgelacht. Aber die Situation kam mir nie zweideutig vor. Rückblickend merke ich, dass sie es war. Corinne hat mich wie eine Prinzessin behandelt, damals nannte ich das eine sehr gute Freundin. Vielleicht bin ich manchmal nicht sehr taktvoll gewesen. Entschuldige mich bei ihr, falls es so war. Ich habe ihr ständig von Typen erzählt, die mir gefielen.
Unsere Mütter haben zusammen bei Geiger gearbeitet. Meine hat das Leben in der Fabrik nicht lange ausgehalten, aber so haben wir uns kennengelernt, Corinne und ich. Komisch, dass ich dich nicht mehr auf dem Schirm hatte, Oscar ist schließlich kein Allerweltsname. Dich habe ich vergessen, aber ich erinnere mich gut an euer Haus mit der kleinen Küche gleich links hinter dem Eingang und dem Wohnzimmer geradeaus, Corinnes Zimmer war am Ende des Flurs rechts. Über dem Square Maurice Barrès. Schon witzig, was sie den Vierteln damals für Namen gaben. Wir lebten in Kalifornien. Wenn das keine Verarsche ist, weiß ich auch nicht. Ich sehne mich nicht zurück, aber für ein Kind war es kein schlechtes Viertel. Ich litt unter dem wenigen Platz zu Hause, das schon. Ich hatte zwei große Brüder, da war ständig Alarm, und sie verströmten eine animalische Energie, die unsere Wohnung zu einem Käfig machte. Ich kam gern zu euch. Corinne hatte ihr eigenes Zimmer. Eure Eltern waren nie da. Es war ruhig. Ich habe das Viertel geliebt. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, es sei hässlich dort, wo wir wohnten.
Aber wenn ich heute meine Familie besuche, sehe ich die Häuser unserer Kindheit mit den Augen der anderen. Das ist keine Armut. Das ist noch etwas anderes. Verwahrlosung. Das heißt, man ist in einer Gegend aufgewachsen, für die sich kein Mensch interessiert.
Als ich in Nancy aufs Gymnasium ging, wohnten einige meiner Freunde in geräumigeren Wohnungen in der Innenstadt oder hübschen Häusern in den Neubauvierteln. Ich fand das genauso langweilig wie bei uns. Und ihre Eltern waren auch nicht besser. Die Mütter soffen, und die Väter waren dick, dumm und eingebildet. Es wäre mir nicht eingefallen, mich zu schämen. Damals war ich fünfzehn – es war mir scheißegal, dass meine Familie kein Nutella kaufte, sondern irgendeine bescheuerte Billigmarke. Ich hatte nur einen Gedanken im Kopf, aus dieser Provinzstadt wegzukommen und in Paris und London auf Konzerte zu gehen. Ich wollte unter Musikern leben. Da würde mich das Hermès-Tuch einer kurzbeinigen Tusse auf der Terrasse vom Le Commerce nicht aus der Bahn werfen. Das alles wollte ich hinter mir lassen.
Vielleicht war es dir auch deshalb egal, wie die Reichenkinder lebten, weil du so hübsch warst. Mit fünfzehn wiegt Schönheit schwerer als Geld. Das gilt für Jungs mehr noch als für Mädchen. Mag sein, dass ein Mädchen von seinem Eindruck auf andere überfordert ist oder wegen seines Triumphs heruntergemacht wird oder dass es einfach nicht weiß, wie es daraus Kapital schlagen kann. Einem gut aussehenden Jungen aber gehört die Welt. Als Teenager war ich, vielleicht aus Masochismus, immer mit sehr gut aussehenden Jungs befreundet. Die Überlegenheit, die ihnen das überall verschaffte, war absurd.
Ich selbst war gut in der Schule. Das war was für Hässliche und Arme. Etwas, das man sich verdienen konnte. Meine Eltern duldeten keine schlechten Noten. Weder bei meiner Schwester noch bei mir. Es war das Mindeste, gute Ergebnisse zu bringen, nachdem wir schon das Glück hatten, zur Schule zu gehen und die Aussicht auf einen guten Beruf zu haben. Ich gehöre zur letzten Generation, der man weismachen konnte, dass man durch harte Arbeit sozial aufsteigen kann. Die Krise 2008 hat unserem Eifer eine kalte Dusche verpasst.
Meine Mutter hat uns eingetrichtert, dass es uns an nichts fehle, und uns mit denen verglichen, die Grund hätten zur Klage. Ich hakte meine Privilegien schon ab, bevor ich lesen und schreiben konnte. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, mir einen Walkman von Sony oder eine Levi’s zu wünschen. Meine Eltern würden denken, ich hätte den Verstand verloren. Rap habe ich in der Schule entdeckt. Der Sohn meiner früheren Grundschullehrerin lief in einer schwarzen Lederjacke herum und war so ein Schlägertyp. Er hinkte ein Schuljahr hinterher, sein großer Bruder hatte im Gefängnis gesessen. Er beeindruckte mich sehr. Er war groß und blond, arrogant und rabiat und mochte mich gern. Er hatte sich das Album Rapattitude gekauft und spielte mir Public Enemy und Eric B. & Rakim vor. Die Musik hat mich total fasziniert, sechs Monate später spielte ich ihm die neuen Songs vor. Genau zu dem Zeitpunkt habe ich kapiert, dass Geld für mich wichtig ist.
Als ich meinen ersten Roman veröffentlichte und er gut lief, habe ich sofort nach deiner Mailadresse gesucht, weil ich davon träumte, für dich zu schreiben. Ich hatte Philippe Djian auf der Pariser Buchmesse getroffen. Er war sehr nett gewesen und hatte mir erzählt, dass es für einen Autor finanziell interessant sein könne, fürs Theater zu schreiben. Und ich dachte sofort an dich – die meisten Typen meiner Generation fuhren total auf dich ab, aber bei mir war es was anderes, weil ich dich schon als Kind gekannt hatte. Die anderen hielten mich für einen Angeber, und ich besaß kein Foto, um zu beweisen, dass ich die Wahrheit sagte. Ich träumte davon, dass du einen von mir verfassten Text sprichst, weil ich vor allem deine Stimme und deinen Sprechrhythmus mag. Schnell wurde mir klar, dass es unter meinen neuen Schriftstellerkollegen nicht viele gab, die wie ich in den Sommermonaten in der Fabrik oder im Supermarkt geschuftet hatten, um sich den Führerschein leisten zu können. Zusammen mit einem gleichaltrigen Regisseur, der einmal in seinem Leben im Sommer an der Rezeption eines Luxushotels gejobbt hatte, habe ich dann ein Drehbuch geschrieben – wenn er von dem Sommerjob sprach, klang es, als wäre er im Krieg gewesen. Eine außergewöhnliche Erfahrung, die sein Bewusstsein geschärft hatte, sodass er eher als andere in der Lage war, mich von innen heraus zu verstehen. Auch deshalb hatte ich Lust, für dich zu schreiben. Ich hatte das Bedürfnis, an Menschen heranzukommen, die mir ähnlich waren.
Ich kontaktierte deinen Agenten, um ihm von meinem Projekt zu erzählen. Er antwortete, wir sollten darüber sprechen, wenn der Text fertig wäre. Das war vor rund zehn Jahren. Ich hatte mein Debüt gegeben, schwebte auf Wolke sieben, weil ich es ins Fernsehen geschafft hatte. Seither sehe ich Typen auf YouTube, jünger als ich damals, mit derselben Arroganz. Das bisschen Berühmtheit steigt einem rasch zu Kopf. Was nicht heißt, dass man die Nase hoch trägt oder sich für besser hält, als man ist – aber man hat das Gefühl, überall erkannt zu werden, allgemeines Gesprächsthema und begehrt zu sein. Der gesellschaftliche Erfolg, und sei er noch so begrenzt, beherrscht deine komplette Gedankenwelt. Wie ein Elefantenbaby, das ständig gefüttert, umsorgt, ausgeführt und unterhalten werden muss. Ein sympathisches Monster. Eines Morgens wachst du auf, verlässt das Haus, und wie sagt Orelsan so schön: »Schon bist du fällig.« Alle wollen was von dir, man reißt sich um deine Telefonnummer, man will mit dir ausgehen, dir eine Pizza spendieren, ein Foto von dir machen, dich zu einem Konzert einladen. Das macht dich irre. Ich habe nicht viele erlebt, die es glücklich gemacht hat. Aber jede Menge Leute, die davon irre wurden. Als ich deinem Agenten von meinem Projekt erzählte, erwartete ich, dass er vor Freude Luftsprünge macht, weil ein junger Autor meines Kalibers sich für eine seiner Schauspielerinnen interessiert. Ich dachte, er würde auf der Stelle ein Abendessen mit dir organisieren und mir den Schlüssel zu seinem Landhaus geben, damit ich dort schreiben kann.
Er hat mich wieder auf den Boden der Realität geholt. Ich skizzierte ein paar Zeilen. Über eine Frau, die nach einer langen Gefängnisstrafe entlassen wird. Dafür habe ich einige Berichte von Frauen gelesen, die hinter Gittern saßen. Eine sagte, mich hat schwer getroffen, dass in Frauengefängnissen niemand zu Besuch kommt. Da wurde mir klar, dass noch nie ein Mann zu mir gesagt hat, »meine Frau sitzt im Knast, ich besuche sie jeden Monat«.
Den Text habe ich dann nie geschrieben. Ich gehöre zu der Sorte Schriftsteller – und davon gibt es viele –, die prokrastinieren. Das Internet macht die Sache nicht besser. Ich öffne ein Worddokument mit dem festen Vorsatz zu arbeiten, und keine fünf Minuten später ziehe ich mir einen Porno rein.
Aktuell verbringe ich ganze Tage damit, auf dem Smartphone bescheuerte Spiele zu spielen. Wenn ich Tage sage, meine ich auch Tage. Morgens um neun drehe ich mir meinen ersten Joint, ich lege eine Platte auf, mache das Radio an oder einen Podcast und spiele. Bis zum Mittagessen. Bis dahin habe ich schon ziemlich viel gequarzt, oft schlafe ich ein und werde gegen siebzehn Uhr wieder wach, dann ist es Zeit für das erste Bier. Entweder animiert es mich auszugehen und Leute zu treffen, um weiterzutrinken – und möglichst noch was anderes zu nehmen –, oder ich ziehe mir den nächsten Joint rein und bleibe vor einer Serie hängen. Ich spiele weiter, während die Serien vorbeiflimmern. Dafür gehen pro Tag sechs oder sieben Stunden drauf – mein Handy ist ein Verräter, es frisst unablässig meine Zeit. Wenn ich bescheuerte Spiele sage, meine ich auch bescheuerte Spiele. Gratisspiele auf dem Handy. Keine Superwelten mit Aufgaben und aufwendiger grafischer Gestaltung. Nein. Idiotenspiele. Sollte mir jemand mein Handy klauen, würde ich mich schämen, es identifizieren zu müssen, so erbärmlich sind die Levels, die ich erreiche. Bin jetzt bei Candy Crush gelandet. Natürlich zahle ich für neue Leben. Ich gehöre zu den Leuten, die sich wirklich verarschen lassen. Angeblich ist der Effekt im Gehirn der gleiche wie bei Kokain. Das glaube ich gern. Nichts bringt mich so sehr runter, wie wenn ich drei Stunden vor dem Display hänge.
Anscheinend arbeiten die klügsten Köpfe hartnäckig daran, wie man dich möglichst lange am Display hält. Eine Wissenschaft der Sucht. Leute, die ihre Zeit darauf verwenden könnten, unser Leben zu verbessern oder das Internet weniger destruktiv zu machen, die sich fragen könnten, wie sich das Web dafür einsetzen lässt, dass die Arbeit leichter wird und weniger unglücklich macht, und die ihr ganzes Talent dafür nutzen, dich solange wie möglich in einem Zombiespiel zu halten.
Ich prokrastiniere. Das ist etwas anderes als eine Schreibblockade. In meinem Kopf habe ich ganze Dialoge fertig, konkrete Szenen, ich weiß, was ich schreiben will. Aber ich beschäftige mich mit etwas anderem. Nichts Interessantem. Auch nichts Angenehmem. Es ist schwer zu erklären. Schriftsteller zu sein ist beschissen, weil deine Freunde glauben, dass du zwei, drei Stunden pfeifend irgendwelchen Blödsinn in die Tasten haust, und das war dann dein Arbeitstag. Wie soll man ihnen erklären, dass das Schreiben trotz der simplen Rahmenbedingungen so schwierig ist und deine ganze Zeit dafür draufgeht, es wenigstens zu versuchen.
Also habe ich diesen Monolog einer Frau, die aus dem Gefängnis entlassen wird und Paris nach fünfzehn Jahren neu entdeckt, nie geschrieben. Ich prokrastiniere. Aber zurzeit ist es anders, ich bin völlig blockiert. Ich habe gerade einen Roman herausgebracht, und alle reden über mich, nur nicht wegen meines Buchs. Ich bin ein Opfer von #MeToo. Das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht an den Hals. Mein Eindruck ist, alle wissen Bescheid. Daher sage ich es dir. Vielleicht wirst du mir jetzt nie mehr schreiben. Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich es verstünde, aber du wärst nicht die Erste.
Seit Jahren schreibe ich einen feministischen Blog. Ich bin an eure Hasstiraden, Todes- und Vergewaltigungsdrohungen gewöhnt, an eure Kommentare zur Größe meines Arschs und zum bedauernswerten Zustand meiner Intelligenz. Ich bin an euren männlichen Zorn gewöhnt.
Bisher habe ich aber niemals Namen genannt. Ein riesiger Aufschrei, seit ich den Namen Oscar Jayack ausgesprochen habe. Ich habe erzählt, was ich mit ihm erlebt habe. Meine Sichtweise ist Terrorismus. Ich schätze meine Gefühle falsch ein. Man sollte mir die Zunge herausreißen und ihn reden lassen. Ich sage: Wenn man monatelang gemobbt wird, erkennt man sich irgendwann nicht mehr wieder. Man braucht Jahre, um sich einzugestehen, dass man nicht mehr wird wie früher, dass die Frau, die man einmal war, für immer verschwunden ist. Dass man jeden Tag Angst hat und eine andere wird. Du schämst dich, dass jemand deinen Schwachpunkt gesucht und gefunden und dich vernichtet hat. Du schämst dich, dass es so einfach ist. Und dass es der Welt scheißegal ist. Ich habe gesagt, »ich hatte nicht die Mittel, mich zu wehren«. Und ich habe anderen empfohlen: Wenn euch das passiert, haut sofort ab. So schnell es geht. Und ich sage: Die Scham muss die Seite wechseln. Ihr macht daraus ein Drama. Nicht ich. Und eure Wut bestätigt mich in meiner Entscheidung.
Wenn ich sage, »es ist unerträglich«, kriege ich zu hören, »alles lief doch bestens, bevor du den Mund aufgemacht hast«. Alles lief doch bestens, solange man meinen Körper in diese Gleichung der Begierde pressen konnte, meinen Körper, nicht aber meine Worte. Man braucht mich für die Bühne, ich bin die junge Debütantin, die der Held begehrt. Aber man will nicht wissen, was ich empfinde. Nicht nur Männer sagen mir, dass ich die Klappe halten soll. Auch Frauen. Erklären mir, dass das, was ich erlebt habe, nicht neu ist und dass sie sich damit arrangiert haben. Jahrhundertelang hätten Frauen das alles mit Würde ertragen. Und ich sage, sie haben ihre Scham hinuntergeschluckt und ihre Schlaflosigkeit mit einem Lächeln kaschiert. Ich behaupte, jedes Mal, wenn ein Mann einer Frau seine Lust aufzwingt, unterwirft er sich instinktiv dem Gesetz des Patriarchats, und die erste Regel dieses Gesetzes lautet, dass man uns von der Domäne der Lust ausschließt. Uns schon in jungen Jahren zu nötigen ist Teil des Systems. Uns kleinzuhalten, Aufgabe der Soldaten des Patriarchats. Wenn sie uns in Ruhe unsere Sexualität genießen lassen, fürchten sie um die von ihnen erschaffene Weltordnung. Diese uralte, obskure Angst, das ist der dunkle Kontinent. Man hat die weibliche Sexualität den dunklen Kontinent genannt, weil die zugrunde liegenden Praktiken auf keinen Fall ans Licht kommen sollten. Nötigung, Mobbing, Inzest, Vergewaltigung. Die Verhinderungsmechanismen der weiblichen Lust mussten um jeden Preis verschwiegen werden. Was wir heute enthüllen, sind keine beiläufigen Missgeschicke. Man zerrt unseren Körper mit Gewalt aufs Schlachtfeld, um ihn zu verstümmeln. Dass wir Nein sagen, ist Teil des Spektakels. Wir sollten uns mit dem Stier in der Arena vergleichen: Genau wie er werden wir gehätschelt und herausgeputzt mit dem einzigen Ziel, in einer Zirkusdarbietung gnadenlos den Todesstoß versetzt zu bekommen. Das Patriarchat ist ein Schauspiel von Vitalität und Stärke, unter einer Dramaturgie, die den Mörder schützt und der Menge erlaubt, ihm zu applaudieren, wegen der Schönheit des Rituals. Wenn eine Frau vergewaltigt wird, so richtig vergewaltigt wird, zelebriert man das Wesen des Patriarchats: mit dummen, morbiden Techniken die Macht der Frauen in die Knie zu zwingen. Mit anderen Worten, zu beweisen, dass die schiere Gewalt bezwingt, was euch in Angst und Schrecken versetzt.
Aber heute gehöre ich zur Armee der misshandelten Frauen, die ihr Schweigen brechen. Ihr könnt mich finden, bedrohen, beleidigen. Es wird nichts ändern. Wir lüften den Bleideckel. Die Scham muss die Seite wechseln. Wenn ein Gymnasiast ein Foto von einem Mädchen postet, das ihm einen bläst, soll er wissen, dass man seinen Namen eines Tages veröffentlichen und ihn bloßstellen wird. Wir müssen jungen Frauen beibringen, auf ihren Blowjob stolz zu sein. Es ist absurd, dass junge Frauen an Selbstmord denken, weil es Bilder von ihnen gibt, auf denen sie sich mit einem Typen vergnügen, der ihnen gefällt. Wer sein Machoprivileg dazu benutzt hat, sie zu erniedrigen, der sollte überlegen, sich aufzuhängen. Die Gymnasiasten sollten zu Ehren der guten Blowjobberinnen Spalier stehen. Stattdessen wirft man uns ständig vor, wir wollten mit ihnen Sex haben. Und wenn wir uns weigern, macht es die Sache noch schlimmer.
Das Problem ist also, dass ich Klage erhebe inmitten Hunderttausender Klagen, wo eigentlich Schweigen und Auslöschung herrschen sollten. Meine Stimme ist eine Schneeflocke in der Lawine, die euch überrollt. Ich ergreife das Wort, ich sage, ich bin jeden Tag mit Bauchweh zur Arbeit gegangen. Weil es mich angeekelt hat, dass ich trotz meines großen Ekels hingegangen bin. Ich schämte mich für meine Wut und für meine Unfähigkeit, sie zu äußern. Nicht alle Männer in dem Laden waren Dreckskerle. Aber alle Männer waren Komplizen aufgrund eines ungeschriebenen Gesetzes – der öffentliche Raum ist Jagdrevier. Nicht alle jagen. Aber alle lassen den Jäger gewähren. Insgeheim war ich überzeugt, ein naives Dummchen zu sein.
Die Stelle im Verlag habe ich bekommen, weil ich die richtigen Diplome hatte, die richtigen Praktika und weil ich fleißig war, sorgfältig, pünktlich und schnell lernte. Und auch weil ich jung und schlank war, langes, glänzendes Haar, große blaue Augen, sehr helle Haut, weil ich mich geschmackvoll kleidete und mir die Fingernägel lackierte. Auch meine Jugend wurde eingestellt.
Ihm gegenüber wusste ich nie, wie ich mich verhalten sollte. Ich stotterte, wich zurück, wandte den Blick ab, verließ das Zimmer, drückte mich gegen die Taxitür, presste die Knie zusammen, errötete, rang mir ein gezwungenes Lächeln ab, brach früh auf, nahm seine Hand weg, schob mich an der Wand lang, trug flache Schuhe, rannte um einen Schreibtisch herum, als er besoffen war, und er fand das witzig, ich biss die Zähne zusammen, wenn er mich befummelte, und eines Abends bin ich aus dem Verlag gestürmt. Bin wie ein aufgescheuchtes Kaninchen davongaloppiert. Leute haben mich gesehen, in Tränen aufgelöst. Aber niemand sah das Problem. Sie sahen nur das Pittoreske an der Situation. Der Macho-Autor und die kleine Pressereferentin.
Oscar rief mich mitten in der Nacht an – und ich konnte vor Angst nicht wieder einschlafen. Er klopfte an die Tür meines Hotelzimmers, und ich konnte vor Angst nicht mehr schlafen. Bevor ich zur Arbeit ging, musste ich kotzen, aber ich trat lächelnd ins Haus, als wäre nichts gewesen, denn hätte ich geheult, wäre ich eine Hysterikerin gewesen, die sich nicht unter Kontrolle hat, hätte ich geschmollt, wäre ich unprofessionell gewesen, eine, die sich gehenlässt, es war wie in einem Albtraum, wenn du losschreien willst, aber kein Ton kommt. Mein Schrei blieb stumm, und die Situation amüsierte das Publikum – man wartete darauf, dass ich endlich nachgab. Er machte mir den Hof. Ich zierte mich. Jeder hatte seine Rolle.
Wenn er heute behauptet, er konnte ja nicht ahnen, dass die Sache mir so zugesetzt hat, meint er in Wahrheit, dass ich die Einzige war, die in ihm kein Genie sah. Der besoffene Macho-Autor, Sohn eines arbeitslosen Stahlarbeiters aus dem Osten des Landes, das Wunderkind, das sich genauso benahm, wie man es von einem verfluchten Proll seines Schlags erwartet. Er war der große Autor, der viele Bücher verkaufte. Als das Ganze ausgeartet ist und er sich dauernd beschwerte, hieß es, wir können die Pressereferentin austauschen, auf den großen Autor werden wir nicht verzichten. Und soweit ich weiß, hat sich Oscar Jayack zu keinem Zeitpunkt danach erkundigt, was aus mir geworden ist. Jetzt bin ich wieder da, um es ihm zu sagen. Niemand hat mich danach eingestellt.
Wir sind Hunderttausende auf der Welt, die das Gleiche erzählen, und es sind Hunderttausende Arbeitgeber, die nur darüber lachen. Die zu uns sagen, »wir verstehen nicht«. Es ist immer die gleiche Leier. Sie berufen sich auf tote und begrabene Feministinnen, um zu sagen, dass früher alles besser war. Denn ihnen gehört sogar der Feminismus. Die gute Simone de Beauvoir hätte sich nie über eine Hand auf ihrem Hintern beschwert, nein Simone, das war die Belle Époque – damals schwiegen die vergewaltigten Frauen, drückten sich die hässlichen an den Wänden entlang, versteckten sich die Lesben, jagte man die Dienstmädchen davon, die man mit einer schnellen Nummer geschwängert hatte. Die gute alte Zeit, in der die Beherrschten verstanden, was Herrschaft bedeutete.
Die männliche Emanzipation hat nie stattgefunden. Eure Fantasie ist gefügig. Sagt jemand »Herrschaft«, kriegt ihr einen Steifen allein um der Herrschaft willen. Sagt jemand, ihr sollt in den Krieg ziehen, antwortet ihr, Waffen sind wichtiger als die Luft zum Atmen oder das Wasser zum Trinken, Waffen sind das Salz der Menschheit. Wir fallen über die Arbeitgeber her, und das versetzt euch in Panik. Schnell steht ihr Gewehr bei Fuß, um die Chefs zu verteidigen. Genau das tut ihr – ihr steht Gewehr bei Fuß, um nachzuplappern, dass der Vorgesetzte das Recht hat zu machen, was er will. Wir hören genau, was ihr uns sagen wollt, befreit euch bloß nicht aus euren Ketten, am Ende sprengt ihr auch unsere noch dabei.
Bist du nicht ein bisschen bekloppt bei der Wahl, wem du auf die Pelle rückst? Wo die echten Soziopathen instinktiv das richtige Opfer finden, bist du als perverser Narzisst offenbar minderbemittelt. Von allen Frauen im Verlagswesen hast du dir die Einzige ausgesucht, die mit ihren feministischen Statements im Netz ein Riesending gelandet hat.
Beschwer dich nicht, sie ist nicht zu den Bullen gegangen. Bei den jungen Dingern heute hast du den Eindruck, das Polizeirevier ist ihr Zweitwohnsitz, so oft schauen sie dort vorbei. Zoé Katana erhebt ihre Stimme, es wird nicht ganz klar, was du ihr angetan hast, aber sie hat es übel genommen. Das ist nur fair, du hast ja überall gesagt, du bist links, eigentlich müsstest du es prima finden, wenn Frauen, die sich nie zu Wort gemeldet haben, endlich sagen, was sie denken.
Und Werbung ist in jedem Fall gut. Ziemlich retro, das zu sagen, und ich weiß aus Erfahrung, wie unangenehm es ist, wenn man eins auf die Fresse kriegt. Aber es stimmt. Als Personen des öffentlichen Lebens sind wir wie die Metallpfosten auf dem Trottoir. Die Leute benutzen dich, um etwas aufzuhängen, auf dich zu pinkeln, sich anzulehnen, auszuruhen oder zu kotzen. Sie machen, was sie wollen. Wichtig ist, dass dein Metallpfosten in einer belebten Straße steht. Und wenn du lange genug durchhältst, bist du ihnen irgendwann sympathisch. Das Problem im Netz ist bloß, dass die, die dich mögen, es nicht so laut von den Dächern schreien müssen wie die, die dich am liebsten hängen sehen würden.
Aber damit das klar ist, wenn du mir lange Briefe schreibst, weil du hoffst, dass ich dich öffentlich verteidige, vergiss es. Auf keinen Fall werde ich meine feministischen Fans verärgern, um einen Arsch wie dich zu verteidigen. Du bist Schriftsteller, du brauchst bloß zu schreiben. Ich habe gesehen, dass du dich in Interviews hier und da beklagt hast, aber nicht, dass du deine Version der Dinge veröffentlicht hättest, wo auch immer.
Zugegeben, diese Zoé ist ganz lustig, ich verstehe, dass sie Erfolg hat. Diese Generation ängstigt sich schnell. Und sie schämt sich nicht, es zuzugeben.
Warum auch. Meine Generation glänzte im Aushalten. Uns hat man gesagt, »keine feministischen Anwandlungen, sonst macht er schlapp«, und wir haben geantwortet, »kein Problem, Papa, ich werde niemandem mit meinen kleinen Nöten auf den Wecker gehen«. Aber ich habe gesehen, wie rings um mich die Frauen eine nach der anderen zerbrochen sind. Und dass es in würdevollem Schweigen geschah, hat uns auch nicht weitergebracht.
Ich fand, dass das Spiel zu meinen Gunsten lief, und habe es mit Begeisterung gespielt. Ich musste mich nicht anstrengen, um die Männer zu lieben, und sie haben das erwidert. Aber heute bin ich fast fünfzig. Und mein Problem ist nicht, dass sie mich weniger lieben als früher. Sondern dass ich sie weniger reizvoll finde. Ihr seid einfach nicht auf der Höhe. Man muss sich die ganze Zeit um euch kümmern, euch beruhigen, euch verstehen, euch unterstützen, euch pflegen. Das ist zu viel Aufwand. Sie haben recht, die jungen Dinger, eure Männlichkeit ist fragil.
Abgesehen davon fand ich die Geschichte von deinem Theatermonolog und deine Probleme als Schriftsteller, der nicht schreibt, ermüdend. Als ich zehn Jahre jünger war, hat sich jeder getraut, mich anzusprechen und mir etwas anzubieten. Und Typen wie du hatten keinerlei Hemmungen. Du brauchst mir nicht die Liste deiner Probleme herunterzubeten, um mir zu erklären, warum mir fast niemand mehr Arbeit gibt. Wenn es darum geht, mich zu entspannen, ich bin so was von entspannt, ich habe genügend Zeit zum Ausruhen. Ich könnte sogar eine tote Sprache lernen, so viel freie Zeit habe ich. Ich bin Schauspielerin. Ich lebe von der Aufmerksamkeit der anderen. Ich will gern mit Gleichmut reagieren, mir sagen, so läuft das eben. Aber komm mir nicht auf die Mitleidstour, dass du nur darum nicht mehr für mich schreibst, weil du Konzentrationsprobleme hast. Fünfzig ist vielleicht alt für eine jugendliche Liebhaberin, aber zu jung, um zu verschwinden. Ich will nicht jammern, und du weißt, dass ich es niemals in der Öffentlichkeit tue. Okay, so läuft das eben. Es ging, solange es gehen musste, ich kann mich nicht beklagen, zumindest war ich mal ganz oben. Aber du darfst mich nicht für blöd halten. Du hast deshalb nicht mehr für mich geschrieben, weil du weißt, dass jeder Theaterdirektor – privat oder öffentlich, das macht keinen Unterschied – dir raten wird, mit einer Schauspielerin zu arbeiten, die Größe 34 hat und nicht weiß, was ein Videorekorder ist. Es kümmert keinen, ob ich noch einen Saal füllen kann oder nicht. Es kümmert keinen, ob das Publikum mich noch sehen will. Es liegt nicht am Publikum, dass man für Frauen in meinem Alter nichts mehr schreibt. Das läuft nach einem anderen Gesetz.
Ihr bringt mich zum Lachen mit euren depressiven Klagen, »man kann nichts mehr sagen, man wird wegen jeder Kleinigkeit gecancelt, ein Unglück für unsere Zivilisation und unsere Kultur«. Willst du wirklich wissen, was es heißt, gecancelt zu werden? Dann sprich mit einer Schauspielerin in meinem Alter. Und dabei habe ich noch Glück gehabt, es war ein langsamer Abstieg. Für die meisten von uns beginnt diese Vorhölle schon ab dreißig. Und ich kenne keinen Schauspieler, der solidarisch wäre. Sie sind nicht schadenfroh, dass wir es so schwer haben. Wenn du ihnen im Restaurant begegnest, jubeln sie nicht, dass du ausgebootet wirst, während sie noch nie so viel gearbeitet haben. Aber es würde ihnen auch nicht einfallen zu sagen, »in diesem Film vögle ich ein junges Ding von zwanzig Jahren, ich bin fünfzig, engagieren Sie doch lieber eine gleichaltrige Kollegin, damit die nicht alle auf der Straße sitzen«. Sie wissen, dass sie in den Augen der Produzenten dann arme Loser wären. Ich habe meinen Agenten schon gefragt, »warum gibt man mir denn keine Männerrollen? Schau mal, ich bin glaubwürdiger in den männlichen Rollen als zwei Drittel der französischen Filmschauspieler …« Er hat bloß gelacht. Aber es war kein Scherz. Ich habe schon immer Ganoven geliebt – ich hatte mein ganzes Leben mit ihnen zu tun, ich weiß, worum es geht. Du kannst alles mit mir anstellen, in meinem Alter schreckt mich das nicht – wohingegen diese verweichlichten Herren Schauspieler … aber mich fragt keiner mehr. Weder mich noch die anderen. Als ich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, wusste ich, es lag an meiner Schönheit. Ich wusste, mit fünfzig würde man mich wegen der Nacktszenen fallen lassen, Szenen, in denen die Figur nackt auf dem Bett telefoniert oder ein Bad nimmt oder in einem Hamam diskutiert. Damals konnte ich es kaum erwarten, die Drehbücher zu lesen, ohne mit dem Regisseur diskutieren zu müssen, »aber warum zieht sie sich aus, bevor sie ihre Grünpflanzen gießt?« Ich ahnte nicht, wie egal es ihnen wäre, dass ich mein Leben am Set und auf der Bühne verbracht hatte, dass ich wusste, was ich tat, dass ich eine Beziehung zum Publikum aufgebaut hatte. Irgendwie stellte ich mir wohl vor, die Dinge würden sich mit mir entwickeln. Das war nicht der Fall. Das ist einer der Gründe, wenn ich Zoé Katana lese, dass ein Teil von mir denkt, was ist bloß in die gefahren, und ein anderer Teil von mir weiß, sie hat recht. Die Dinge entwickeln sich nicht, wenn du sie nicht dazu zwingst.
In deiner Generation neigt ihr dazu, private Nachrichten in den sozialen Netzwerken auszubreiten, und da ich mir nicht sicher bin, ob du es kapiert hast, schreibe ich es explizit: Ich werde dir die Augen auskratzen, wenn du das, was ich dir schreibe, irgendwo verbreitest. Schau dich um in der Yellow Press, dann siehst du, dass ich mit den meisten meiner Ex auf gutem Fuß stehe und die toxische Männlichkeit liebe. Wenn ich also sage, »ich werde dir die Augen auskratzen«,
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: