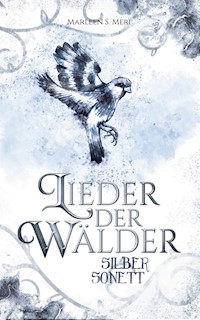
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lieder der Wälder
- Sprache: Deutsch
Severyn ist es gelungen, Frieden mit den Eschenelben zu schließen und die verwandelten Eshwen in ihre alte Gestalt zurückzuversetzen. Doch sein Abenteuer ist noch nicht vorüber. Der gefallene Prophet Teannan hat sich erhoben - bereit, die Wälder auszulöschen und selbst der neue Gott Daer Awyrs zu werden. Und nicht nur das: Er hat auch Severyns Geliebte Breya in seiner Gewalt. Um sie zu retten und Teannan Einhalt zu gebieten, entsendet eine prophetische Vision Severyn und die Spielleute ins verschneite Aradrov. Noch ahnt Severyn nicht, dass diese Reise ihn an seine Grenzen bringen wird - und auch seine Begleiter haben mit eigenen Problemen zu kämpfen. Dabei rennt die Zeit: Teannan ist auf Jagd nach den Wäldern und sinnt nach Vergeltung. Silbersonett ist der zweite Band einer fünfteiligen Dark Fantasy-Serie mit Natur- und Paganismusmotiven und zahlreichen mythologischen Anlehnungen. Insbesondere zeichnet der Roman sich durch die Vielzahl an Liedern und Gedichten aus. Das Buch ist hochwertig und liebevoll gestaltet und beinhaltet zahlreiche Illustrationen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marleen S. Meri
Lieder der Wälder II
Silbersonett
Lieder
der
Wälder
Band II
Silber
Sonett
Silber, das (n.): weißglänzendes Edelmetall,
das in der Mythologie häufig als Symbol für den Mond gilt
Sonett, das (n.): „Klinggedicht“, Gedichtform, die sich
aus einer These, Antithese und Synthese zusammensetzt
Dieses Buch ist auch als Print erschienen.
Copyright © 2022 Marleen S. Meri c/o Autorenglück
Franz-Mehring-Str. 1501237 Dresden
Lektorat: Balduin Goldenau
Umschlaggestaltung: Marlo Melian Mae
Satz: Marleen S. Meri
Illustrationen und Karte: Marleen S. Meri
Bild- und Zusatzmaterial, Contentwarnungen und mehr unter:
www.marleensmeri.com
ISBN: 9783756838769
Alle Rechte vorbehalten.
Für Lea,
weil du dieses Buch schon gemocht hast,
als nicht mal ich es getan habe.
Müsste ich mal mit einem Auserwählten herumreisen,
hätte ich dich gern mit dabei.
Die Protagonisten
Severyn Pádraig
Severyn ist der Prinz der Eshwen und seit kurzem ein Prophet der heiligen Wälder. Seinen Wert als Auserwählter zu beweisen fällt ihm noch schwer, was mit Sicherheit nicht an seinem besonderen Charakter liegt – sondern einzig an den nervigen Spielleuten, mit denen er sich auf seiner Reise herumschlagen muss. Severyn wurde in der Nacht seines einundzwanzigsten Geburtstags zum Propheten ernannt. Auf dem Ball kam es zu einem Angriff arglistiger Falter und sein Vater wurde in ein Monster verwandelt. Auf seiner Reise zu den Eschenelben, die er für die Übeltat verdächtigte, hat Severyn herausgefunden, dass hinter dem Mottenangriff tatsächlich der gefallene Prophet Teannan steckte. Nachdem Severyn Frieden mit den Eschenelben geschlossen und die Macht über Motten erhalten hat, ist er aufgebrochen, um seine Geliebte zu retten. Die da wäre …
Breya Pádraig
Breya ist ein Wechselbalg und wurde als Säugling gegen die Prinzessin der Eshwen ausgetauscht, als diese verstarb. Niemand außer Severyn und seinem Vater wissen von ihrer wahren Identität – alle halten sie für die Prinzessin und Severyns Schwester. Dass sie ein herzensguter Mensch ist, kann man vor allem daran erkennen, dass sie so viel Positives in Severyn sieht. Zurzeit befindet sie sich in der Gewalt von Prinz Azahr, einem Anhänger des finsteren Teannan. Er ist mit ihr in seiner Gewalt geflüchtet, als Severyn ihn beschuldigt hat, für den Mottenangriff verantwortlich zu sein. Azahr bestreitet das. Seltsam …
Rosalen Canaid
Rosie ist eine Onie, wie sie im Buche steht, und vor allem für ihre wunderschöne Honigstimme bekannt. Eigentlich singt sie für die Hellen Barden, hat die Gruppe aber gemeinsam mit Mattys verlassen, und zwar buchstäblich einen Tag vor deren Zusammentreffen mit Severyn. Rosie liebt ihr rastloses Leben und hat gar keine Lust, eine Hofsängerin zu sein, möchte es aber für Mattys trotzdem probieren – auch wenn ihr sonniges Gemüt seither ein bisschen getrübt scheint. Aktuell ist sie auf dem Weg nach Moorhaag, nachdem sie und Mattys durch eine auffällig ausschweifend umschriebene Heldentat an ein Paar goldener Haselnüsse gekommen sind. Angeblich sollen ihnen magische Kräfte innewohnen.
Mattys Teuvon
Mattys ist ein ehemaliger Heiler und war eine Art Anführer für die Hellen Barden, ehe er und Rosie der Gruppe den Rücke gekehrt haben. Eigentlich ist er nicht für das Leben als Spielmann gemacht, hat es aber für Rosie ein paar Jahre probiert. Jetzt möchte er ihr zu größerem Ansehen verhelfen und sie zur Hofsängerin der Gräfin de Beur machen. Mattys ist im Generellen nicht unbedingt von den Wäldern gesegnet und kämpft neben einer unheilbaren Krankheit auch mit traumatischen Erinnerungen, die es ihm verwehren, weiter seinen Heilerberuf auszuüben. Dafür hat er einen niedlichen Hund, der ihn meistens davon abhält, dumme Dinge zu tun.
Edeline Yseult
Einst war Edeline eine Keitha im Dienste der Eschenelben, wovon sie sich mit Naschas Hilfe jedoch vor einigen Jahren loslöste. Heute spielt Lene Geige wie keine Zweite und ist deswegen ein unersetzliches Mitglied der Hellen Barden. Irgendwie ist sie dann in dieses Abenteuer hereingeraten und musste Severyn gegen ihren Willen zu den Eschenelben führen. Um ihrer aller Überleben zu sichern, hat Lene sich Severyn im entscheidenden Kampf unterworfen und untersteht nunmehr seinem Befehl, den sie rasch wieder loswerden möchte. Aber zumindest konnte sie in dem ganzen Durcheinander Freundschaft mit Severyns Leibwächter Esmond schließen, also hatte es auch ein Gutes.
Nascha
Als Jungsagart träumt Nascha davon, bald in den inneren Kreis ihrer Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Sie möchte die erste Waldpriesterin werden, die nicht in ihrem geheimen Hort lebt, sondern den Wäldern als Bardin dient. Diesem Ziel ist sie näher als je zuvor, nachdem sie Severyn bei seinem Abenteuer unterstützt hat. Schließlich hat sogar ihre Hohepriesterin Sydra angekündigt, dass dies Naschas letzte Prüfung vor ihrer Aufnahme wird. Nascha sieht das Gute in jedem und wird dafür von ihren Freunden oft belächelt – vielleicht aber auch nur, weil sie gern auch ein bisschen so wie sie wären.
Caleb Bocore
Caleb ist ein begnadeter Spielmann mit einem gewinnenden Lächeln, das ihn vor allem in der Damenwelt sehr beliebt macht. Eigentlich ist er echt nett, hat aber ein ziemlich großes Mundwerk, flucht viel und trinkt gern einen über den Durst. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine kleine Schwester Olyvar zu beschützen, und bekommt das meistens so mittelmäßig gut hin. Über die gemeinsame Mutter der beiden ist nicht viel bekannt, Caleb bezeichnet sie aber gern als komplett durchgeknallt. Im Moment ist Olyvar ein bisschen sauer auf ihn, weil sie glaubt, sie sei ihm nicht wichtig genug. Aber das legt sich schon wieder.
Olyvar Bocore
Olyvar ist Calebs kleine Schwester und die süßeste Person auf der Welt. Oft erscheint sie erwachsener, als sie ist, und ist so manchmal eher diejenige, die auf ihren Bruder aufpasst und ihm einen guten Rat gibt, als andersrum. Sie scheint eine Verbindung zu den Wäldern zu haben, aber niemand kann so richtig sagen, was für eine das ist. Olyvar schwärmt ein bisschen für Severyn und ist deshalb bei einem heimlichen Waldausflug in die Fänge der Eschenelben geraten, denen sie glücklicherweise in letzter Sekunde entkommen konnte. Aktuell ist sie der Meinung, Caleb würde sie zu viel ignorieren, und bestraft ihn durch … Ignorieren.
Adeena Klingwahr
Adeena ist eine austrische Diplomatentochter. Die Fehlstellung ihrer Hüfte lässt viele glauben, sie sei ein bösartiger Wechselbalg. Adeena bezweifelt das, kann das Gegenteil aber bis heute nicht beweisen. Sie ist ein wenig sonderbar und stets von Melancholie umgeben. Zu ihrem Vater Jakob Klingwahr pflegte sie eine enge Bindung, ehe er einem Mottenangriff zum Opfer fiel und verstarb. Derzeit ist sie mit den Spielleuten zusammen und wartet darauf, nach Hause zurückzukehren. Mit Severyn hatte sie ihren eigenen Disput, nachdem er sie auf einem Turm ausgesperrt hat – das hat sie ihm mittlerweile aber so halbwegs vergeben.
Alraunen
Dunkelheit lag über den Straßen Dinas Rhedyns. Nebel wallte geisterhaft zwischen den Fachwerkbauten und dem Sandstein, malte Schatten an die Wände. Feuchtigkeit deckte die Stadt zu wie eine klamme Decke. Der seichte Wind ließ ein jeden Stadtbewohner frösteln, der sich noch auf den Straßen aufhielt.
»Wohin gehen wir?«
»Wir machen einen Ausflug.«
Hinter den Glockenbrücken, wo der Maraid eine Biegung machte, lag der alte Brighidpark. Grünend und ungebändigt thronte er im Mondlicht, nur bewohnt von wilden Tieren und körperlosen Gestalten. Hohe Kletterpflanzen hatten sich der alten Pavillons und Statuen bemächtigt, flochten Netze über Wege und Fischteiche. Einst hatte der Park gestrahlt, aber das war lange her. Fürstin Brighid hatte den ersten Setzling hier gepflanzt und veranlasst, dass Gärtner und Grüne Priester die Anlagen sprießen und gedeihen ließen. Der Brighidpark war das Lebenswerk der Monarchin, die ein jeder so abgöttisch geliebt hatte. Selbst Keyll Naomh, erzählte man sich.
Die Grünen Priester und Eshwengärtner hatten bewiesen, was für wunderbare Dinge sie mit der Natur anstellen konnten, wenn man ihnen freie Hand ließ. Ein Stück Palast hatte sich in der Stadt wiedergefunden und ein jeder, der auf den Pfaden schritt, durfte sich wie ein Fürst oder eine Gräfin fühlen. Die Pracht Dinas Rhedyns und der geliebten Herrscherin oblag jedem Baum, jeder Blüte, jedem Blatt.
»Sind wir auf dem richtigen Weg?«
»Es gibt hier keinen richtigen Weg.«
Dann kam der Tag, an dem ein Attentäter der geliebten Fürstin einen Dolch in die Brust trieb. Als Brighid auf den Marmorboden des Palasts sackte und ihr Blut die Fliesen besprenkelte, erwachte eine erste fremde Wurzel zwischen den fein angelegten Blumenrabatten des Brighidparks. Giersch zehrte von den jungen Pflanzen, Efeu fraß das Mauerwerk, Kletterpflanzen wanden sich um Bäume und Äste, erwürgten und erstickten die liebevoll angelegten Pflanzen. Die Gärtner versuchten der Übermacht der Wälder Herr zu werden. Doch kaum hatten sie einen Baum gefällt, eine Wurzel herausgerissen oder eine Pflanze ausgebrannt, spross eine neue an derselben Stelle.
Die Gärtner gaben auf. Irgendwann gaben sie alle auf. Und so erhob sich Keyll Naomh über den Brighidpark, hüllte ihn in Flechten, riss alles an sich und säte eine schleichende, kriechende Zerstörung. Denn er hatte Fürstin Brighid geliebt und die Eshwen hatten sie getötet. Sie verdienten dieses Geschenk nicht.
Heute blickten die Eshwen mit Ehrfurcht zu den gebrochenen Parkanlagen. Kaum jemand betrat diesen Ort mehr. Eltern erzählten ihren Söhnen und Töchtern von Gestalten, die die Anlagen heimsuchten, Banshees und die Angstgorta aus der Zeit vor Newid. Kinder erzählten anderen Kindern davon und sie unternahmen Mutproben, gingen über die Brücken und rannten Herzschläge später kichernd zurück.
Das Knirschen der Wurzeln unter seinen Stiefeln verstummte, als er stehen blieb. »Bitte sag mir, wo wir hingehen.«
Sie hielt inne. Zwischen den wuchernden Pflanzen und Ranken wuchsen kleine faltige Alraunen aus dem Boden – unscheinbar für das Auge Keylls Naomhs und das der Eshwen sowieso. Sie waren angekommen.
»Ich wollte ungestört mit dir sein, mein Bruder.«
Er hob das Kinn. Mond spiegelte sich in seinen Augen, als er sie direkt ansah. Wenn sie allein waren, schien er jünger, verletzlicher. Dann erinnerte sie sich, dass er allein nicht lang durchhalten würde.
Aber sie konnte ihn nicht länger mitnehmen.
»Ich will zurück.«
Amethyste klimperten an ihren schönen Gewändern, als sie näher zu ihm trat. »Du weißt, wie gern ich dich habe, nicht wahr?«
»Ja.«
»Dass ich dir kein Leid antun würde?«
»Sicher.«
Sie hatte viele Fehler gemacht, als sie ihn geschaffen hatte – war noch so jung und unerfahren gewesen. Viel zu sehr hatte sie sich mit Details beschäftigt. Hatte ihm einen spitzen Bart gegeben, ein schelmisches Funkeln in den Augen. Sie hatte ihn zu einem Frauenhelden und begnadeten Sänger gemacht. Dabei war sie vom Weg abgekommen, hatte das Wesentliche verpasst. Nächstes Mal würde sie klüger sein.
Sein Blick, so voller widersprüchlicher Gefühle, Sorge und Angst und Zuneigung, berührte ihr Herz, als wäre er wirklich ihr kleiner Bruder. Er war so voller Fehler. Sie hatte ihn so lieb.
Eine sachte Umarmung. »Kennst du das Lied von Dinas Rhedyn?«
»Welches?«
Suchend fuhr sie über seinen Rücken. »Komm, wir gehen«, sie lehnte die Wange gegen seine, »an den Ort, von dem die Dichter Lieder schreiben. Lass uns hingeh’n und lass uns für immer bleiben.« Er summte die Melodie und bemerkte nicht, wie sie weiter über seinen Rücken tastete, während sie sang.
»Dinas Rhedyn, meine Stadt,
wo die Felder golden stehen,
von der jeder gehört hat,
wo die Winde munter wehen.
Dinas Rhedyn, meine Stadt,
in des Eshwenfürsten Land,
unsrer Achtung niemals matt,
hält er uns in seiner Hand.«
Sie fand das Geflecht unter Kleidung und Haut, fuhr die Stränge nach und begann sie zu entwirren.
»Komm wir gehen«, wisperte er mit schwerer Zunge, »an den Ort, an dem wir unsren Pfad selbst wählen, von dem die Menschen voll Bewunderung erzählen.« Seine Stimme wurde leiser – er war zu schwach, um sie mehr zu heben.
Sie sang für ihn. »Dinas Rhedyn, meine Stadt, dahin gehen wir geschwind, man blickt warm hierher herab, weil hier alle glücklich sind.«
In ihren Armen wurde er schlaff und sank in sich zusammen. Mond tauchte ihn in silbernes Licht, als sie ihn zu Boden legte und das Geflecht Stück für Stück weiter entwirrte, Haut und Kleider und Haar von seinem Körper flocht.
»In Dinas Rhedyn, meiner Stadt, sagt man in jedem Lied, dass niemand Sorgen hat, und uns kein Leid geschieht.« Mond küsste seine Stirn und als sie sich aufrichtete, war er kein Mensch mehr, nur noch eine Pflanze, deren dicke Wurzeln anmuteten wie menschliche Gliedmaßen. Beinahe glaubte sie ein Gesicht zu erkennen. Ein friedliches Gesicht.
»Schlaf schön, Cadmus.«
Nun war sie allein. Aber das war in Ordnung – er hatte keinen Nutzen mehr. Hier war er sicher und gut versteckt.
Mond erhob sich und verließ den Park allein.
Teil eins Prophetengesang
In den Gärten, tief in den Gärten
zwischen den schönsten Blüten,
wo mich Mond und Sterne behüten,
dort werde ich heute sterben.
Fremde in der Nacht
Ein junges Bardenpaar machte in den Kiefernstuben Musik. Unaufdringlich, beinahe schüchtern drang die Melodie durch den mäßig gefüllten Schankraum, vor dessen Fenstern es dunkel geworden war. Die beiden Musiker saßen dicht beieinander auf der Tribüne, als müssten sie sich gegenseitig Sicherheit spenden. Der blonde Onie spielte Trommel und Flöte, der Narraph eine wunderschöne Harfe. Sie sangen zweistimmig – ein dunkler Bariton und ein hellerer Tenor, die gemeinsam Harmonien malten.
Edeline kannte einige der Stücke, weil die Hellen Barden sie auch gespielt hatten. Ein paar waren Anfängerlieder, aber die Sonnenklage, die der Narraph gerade mit der Harfe begleitete, bedurfte durchaus eines gewissen Mutes.
In ihrem Inneren nagte eine schwache Sehnsucht, während sie den beiden lauschte. Sie konnte nicht erklären, was sie so wehmütig stimmte. Womöglich fühlte sie sich einfach so erinnert an sich selbst.
»Kann ich heute bei euch schlafen? Zur Not geht auch bei Adeena.«
Nascha musterte Olyvar prüfend, die unschuldig einen Löffel Suppe schöpfte. »Immer noch wegen Caleb?«
»Ich hab doch gesagt, wir erwähnen seinen Namen nicht.« Eingeschnappt zog Olyvar die Nase kraus und hob den Löffel. »Ihr habt ihn heute übrigens gar nicht richtig ignoriert. Dabei habt ihr geschworen, ihr haltet zu mir.«
Das hatten sie nicht. Aber Edeline verkniff sich den Kommentar und wechselte stattdessen einen Blick mit Nascha, die nur ratlos die Schultern hob. Seit Olyvar sich in Maenblod in Lenes Bett verkrochen und ihnen von ihrem Streit mit Caleb berichtet hatte, war kaum ein Wort zwischen den Geschwistern gefallen. Das war mittlerweile eine Woche her. Die ganze Zeit, in der sie die Monster von Maenblod in Menschen zurückverwandelt hatten, hatte Olyvar Calebs Versöhnungsversuche ignoriert. Mittlerweile schmollte ihr Bruder offenbar auch – jedenfalls nahm er am Abendessen nicht teil.
Edelines Glieder schmerzten von dem langen Ritt und sie spürte noch die wohlige Sauberkeit des heißen Bads auf der Haut. Stundenlang hatte sie sich auf dem Weg hierher nach einer warmen Stube, gutem Essen und ein wenig Unterhaltung gesehnt. Sie wünschte nur, Caleb wäre da – dann würden die Lieder der beiden Spielleute womöglich nicht allzu bittersüß in ihren Ohren klingen.
Während Nascha ihre Tasse hinstellte, setzte sie zu einer diplomatischen Antwort an: »Es ist ein bisschen einsam ohne Caleb, finde ich. Keiner, der blöde Witze macht oder dumme Lieder singt …«
Olyvar strich sich die offenen Haare aus dem Gesicht und zog die Lippen ein. »Singt doch selber.«
»Olyvar«, sagte Nascha mit Nachdruck. »Vielleicht wäre es gut, wenn du mit ihm redest. Wir haben schon genug …«
»Ich will nicht mit ihm reden«, schnappte Olyvar. »Ich will auch nicht über ihn reden! Will ihn nicht sehen, am besten nie mehr. Und erst recht nicht mit ihm in einem Zimmer schlafen! Überhaupt, er ist ein Junge und ich bin ein Mädchen. Ich werde nicht mein ganzes Leben bei ihm im Zimmer bleiben!«
Lene rollte mit den Augen. »Propheten, von mir aus. Frag Adeena, ob sie einverstanden ist.«
Bei der Erwähnung von Adeena seufzte Nascha. »Ich wünschte, sie hätte sich dazugesetzt. Sie kommt mir so einsam vor.«
»Sie versteckt sich vor den Leuten.« Edeline brach ihr Brot und tunkte es in die Suppe. »Und nach dem Reiten muss ihre Hüfte echt Probleme bereiten. Hast du bemerkt, wie Junas Mutter geschaut hat, als sie Adeena hat humpeln sehen? Wie sie danach mit den Schankmädchen getuschelt hat? Adeena ist es auch nicht entgangen. Es wird wehgetan haben.«
Nascha schüttelte den Kopf. »Wir sind doch da. Da muss sie sich keine Sorgen machen.«
»Sie ist glaub ich einfach gerne alleine«, mutmaßte Olyvar, die die Brotrinde aufmümmelte. »In Maenblod wollte sie auch für sich sein. Vielleicht gefällt ihr das besser.«
Edeline war sich da nicht sicher. Adeena mochte das Alleinsein gewohnt sein – aber bloß, weil man etwas gewohnt war, musste einem das nicht gefallen. Wenn ihre eigenen Fehler so offen auf ihre Haut geschrieben wären, würde sie sich auch vor der Verachtung der Menschen verbergen. Aber Lene konnte das Blut abwaschen und die Klingen niederlegen. Adeena war so etwas nicht möglich. Und nicht mal ihr Vater bot ihr länger Schutz hinter seinem Rücken – denn ihn trug sie nun in einer Urne in ihrem Rucksack.
»Kann ich vor dem Nachtisch die Schwarznasenschafe besuchen?«, fragte Olyvar.
»Läufst du dann wieder weg?«, stichelte Edeline.
»Und wann war die Rede von Nachtisch?«, ergänzte Nascha amüsiert.
Olyvar biss sich auf die Unterlippe und lächelte treuherzig. Als die beiden ihrer Bitte mit einem Wink stattgaben, sprang sie auf und verließ die Schenke.
Lene umschloss ihre Tasse Apfelwein und zog die Beine an den Körper. Das heiße Getränk benetzte ihr Wangen und Kinn mit Wärme. Die Gäste lauschten der Musik der Barden, die mittlerweile das Lied der Wanderin angestimmt hatten. Weil die Kiefernstuben so tief in den Wäldern lagen, war es an diesem Abend nicht allzu voll im Schankraum. Die Atmosphäre war wunderbar entschleunigend – beruhigend im Angesicht der Geschehnisse der letzten Tage. Beständige Dinge in einer Welt, die nicht mehr dieselbe war.
»Wäre schön, wenn Rosie und Mattys jetzt hier wären«, seufzte sie.
Nascha lehnte sich auf der Bank zurück. »Wem sagst du das …«
»Ich wette, Severyn hätte sich gut mit den beiden verstanden«, mutmaßte Edeline. »Sicher hätte er Rosie freundlicher behandelt als uns.«
»Wenn nicht, dann hätte sie ihm schon gezeigt, wer das Sagen hat.«
»Und Mattys?«
»Mattys wäre so höflich zu ihm gewesen, dass Severyn überhaupt nicht bemerkt hätte, wie ihm das Wort im Mund herumgedreht wird.« Nascha schob die Lippen zusammen. »Und dann hätte er so subtile Spottlieder über ihn geschrieben, dass Severyn sie als Kompliment genommen hätte.«
Lene lachte herzlich. »O ja, das sähe ihm ähnlich.«
Nascha griff nach ihrer Honigmilch. Ihr Haar war noch feucht vom Baden und kringelte sich über den Rollkragen ihres Strickpullovers. Unwillkürlich lächelte Lene, als sie Naschas hübsches Gesicht mit der Knubbelnase und den moosgrünen Augen im Lampenschein musterte. Egal, wie sehr die Welt sich änderte, Nascha war an ihrer Seite.
In den letzten Wochen hatte sie oft an einst zurückgedacht und aufs Neue begriffen, wie dankbar sie ihren Freunden eigentlich war. Nascha hatte ihr die Welt eröffnet, als sie gemeinsam aus Eschenhort geflohen waren. Sie hatte Lene nicht nur Nächstenliebe und Warmherzigkeit gelehrt, sondern ihr auch die kleinen Dinge nahegebracht, die sie heute so schätzte. Gutes Essen, warme Kleider, zerlesene Bücher … und sogar die Musik. Als sie noch allein unterwegs gewesen waren, hatte sie ihr jeden Abend vorgespielt, ohne jemals müde zu werden. Und spätestens, als sie den anderen Hellen Barden begegnet waren, hatte Lene es begriffen: Sie wollte keine Klingen mehr. Sie wollte Klänge. Lieder. Musik.
»Wenn Rosie und Mattys hier wären, wäre ich dann noch frei?«, fragte Edeline nach einem Moment des Schweigens. »Ich meine – vielleicht hätte einer von ihnen besser auf Olyvar aufgepasst. Ich wäre nicht mit nach Eschenhort gegangen, um sie zu retten …«
Sie brach ab, als Nascha die Hand auf ihre legte. »Du bist frei«, sagte sie mit so viel Zuversicht, dass Lenes Kehle eng wurde. »Severyn ist vielleicht schwierig, aber er bemüht sich offenbar gerecht zu handeln. Und überhaupt – die letzten beiden Wochen hast du eng mit Eschenelben zusammengearbeitet, um die Menschen in Maenblod wieder zurück zu verwandeln. Und ihrem Willen hast du dich widersetzt, obwohl sie deine alten Meister waren.«
Nur, indem sie sich jemand anderem verschrieben hatte. Aber Nascha hatte keine Ahnung, wie sich das anfühlte, und dafür konnte Edeline sie bloß beneiden. Es gab keine Worte, um ihre Gefühle zu beschreiben. Die Art, auf die sich Severyns Wille beständig in ihr Bewusstsein wühlte. Der Wunsch, sich zu beugen. Wenn sie allein mit ihren Gedanken war, spürte sie die knöcherne Berührung der flann gwiddon auf ihren Schultern. Hörte das Flüstern. Das Locken. Jeder Befehl prangte wie ein unsichtbares Mal auf ihrem Körper.
Severyn konnte nichts dafür. Edeline war klar, dass der Auserwählte keine Ahnung hatte, was der Keithabefehl bedeutete. Sie hatte diese Entscheidung freiwillig getroffen – dabei brauchte sie weder ihn noch die Elben in ihrem Kopf.
Edeline ließ den Hinterkopf gegen die Wand sinken. »Wenn wir ihn wiedersehen, werde ich ein ernstes Wort mit ihm wechseln. Nicht nur wegen der Keithasache, auch wegen seines Tons in diesem Brief.«
»So schlimm fand ich den im Nachhinein gar nicht«, meinte Nascha.
Ungläubig rümpfte Lene die Nase und griff in die Innentasche ihrer Jacke. Sie musste den Brief glattstreichen, irgendjemand – mit Sicherheit nicht sie – hatte ihn kurzzeitig zu einer Kugel zerknüllt. »Darf ich dir das noch mal vorlesen?«
An die Hellen Barden
Erwarte eure Anwesenheit in Dinas Rhedyn umgehend. Benötige Unterbringung für uns bei einem Handelskonvoi, der über die Korolstraße nach Nowrisk zieht.
Bitte nicht meinen echten Namen verwenden, sondern: Adeon Derwen, niederer Adel von Dalenna, Jägermeister. Die Papiere werden nachgereicht, wenn relevant. Alles Weitere in Person.
Ihr braucht gar nicht zu behaupten, dass ihr so was nicht könnt. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass ihr Kontakte habt.
(Und wagt es nicht, mich als Barden auszugeben.)
Trödelt nicht. Die Lage ist ernst.
S. Pádraig
Kronprinz der Eshwen, der Jäger, siebter von Keyll Naomh auserwählter Prophet, Herr über die Keitha, Meister der Motten
»Was daran klingt für dich nicht unverschämt?«
Nascha zuckte bloß mit den Schultern. »Der letzte Satz?«
»Du meinst den, in dem er uns alle seine Ehrentitel um die Ohren haut?« Mit einem bösen Grollen knüllte Lene den Brief wieder zusammen. »Warum geht er überhaupt davon aus, dass wir ihn bei so was einschleusen können? Soll er sich doch selbst reinschmuggeln!«
»Nun, es ist nicht so, als hätten wir das noch nie gemacht«, warf Nascha ein. »Aber mein Bedürfnis, wieder nach Aradrov zu reisen, hält sich in Grenzen.«
Darauf konnte Lene ebenso verzichten. Sie griff nach ihrem Wein. »Er soll damit wegbleiben. Severyn hat genug durcheinandergebracht.«
Ein paar Herzschläge schwieg Nascha. »Hey, du?«, fragte sie dann leise. »Ich glaube, ich hab für so was auch gar keine Zeit.«
»Hab ich was verpasst?«
»Na ja«, Nascha verlagerte ihr Gewicht, »Sydra hat gesagt, die Reise mit dem Auserwählten ist meine letzte Prüfung. Und da die erfolgreich abgeschlossen ist …«
Prompt setzte Edeline den Krug ab. »Wie? Sie nehmen dich in den engeren Kreis auf! Du wirst eine richtige Priesterin! Nascha, das ist … das ist fantastisch!« Dass die Worte in ihrer Brust stachen, begrub sie unter einem Strahlen. Nascha die Weihung nicht zu gönnen war furchtbar ungerecht. Lene hatte immer gewusst, dass dieser Tag einmal kommen würde, und sich stets ein wenig davor gefürchtet. Ein eifersüchtiger Teil von ihr wollte Nascha für sich behalten, selbst wenn sie dann keine Priesterin würde – aber sie schärfte sich ein, dass jeder missgünstige Gedanke in diese Richtung falsch war.
Nascha strich sich verlegen das Haar hinters Ohr und rieb über die Stelle, an der ihr drittes Auge lag. »Ich habe mich gefragt, ob ihr mich zum Hain der Sagart begleiten wollt. Er liegt bei Hem Sommar und man kann es mit den Lammastagen verbinden. Und … selbst wenn Rosie und Mattys nicht mehr mit uns reisen, werden sie vielleicht dort sein. So sind wir noch einmal alle zusammen.«
Die Klauen um Lenes Herz ließen locker. »Das … heißt, du wirst weiter bei uns bleiben?«
Verblüfft schüttelte Nascha den Kopf. »Dachtest du etwa, ich verlasse euch deshalb?«
»Na ja«, raunte Lene, während das Gewicht von ihr sackte und nur kühle Reue zurückblieb. »Es erschien mir naheliegend.«
Nascha musterte sie aufrichtig. »Lene, ich werde immer eine Bardin bleiben. Und deine beste Freundin.«
Bereitwillig nahm Edeline hin, dass Nascha die Arme um sie legte, und vertrieb die Abgunst aus ihren Gliedern. Sie hoffte inständig, dass Nascha sich wirklich niemals zwischen Bardin und Geweihter würde entscheiden müssen.
Die beiden umarmten einander, während das Treiben in der Taverne um sie herum weiter anhielt. Beständige Geräusche in einer Welt, die nicht länger dieselbe war. »Danke«, murmelte Lene.
Nascha lächelte. »Wenn wir bloß noch wüssten, wo Caleb ist.«
»Hm. Da ich Juna auch schon länger nicht mehr gesehen habe, kann ich es mir ausmalen.«
Juna schlang die Beine um seine Hüften und bog den Rücken durch. Sie fuhr seine Wirbelsäule und die Schulterblätter nach, strich über die arbeitende Muskulatur, während Caleb einen heißen Kuss auf ihren Hals drückte. Mit einer Hand stützte er sich neben ihrem Kopf ab, die andere lag an ihrer Taille. Schweiß glänzte auf ihren Brüsten, im Halbdunkel nur ein Schimmern.
Mit einem letzten kraftvollen Stoß und einem tiefen Knurren verharrte Caleb und genoss das süße Beben seines Unterleibs. Juna reckte ihm die Hüfte entgegen, räkelte sich mit lustvollem Seufzen, fuhr federleicht die Beuge zwischen seinem Nacken und den Schultern nach. Die beiden sahen einander in die Augen, ihr Atem schwer. Dann strich Caleb ihre Hände fort und entzog sich ihr.
»Hab dich selten so gesprächig erlebt«, bemerkte Juna, während sie sich aufsetzte und ihren Haarknoten richtete. Als er sich das Handtuch umwickelte, entwich ihr ein unwilliges Seufzen. »Gehst du schon?«
»Jap.«
»Warum? Wir haben alle Zeit der Welt.«
Caleb stieß die Tür auf und atmete tief ein. Kalte Luft drang an seine von der Hitze dampfende Haut und füllte seine Lungen. Damit die Wärme nicht aus der Sauna entwich, ließ er die Tür rasch hinter sich zufallen und trat stattdessen auf das Wasserbecken zu. Er hatte weder Probleme mit der Wärme in der Sauna noch der Kälte des Beckens im Anschluss. Caleb war ein Narraph – sein Körper war nicht in der Lage zu frieren und sog Hitze mit begieriger Freude in sich auf.
Caleb hat ein gutes Herz. Der beste Bruder. Und außerdem ist er immer warm.
Mit einem Ruck ließ er das Handtuch aufgehen und zu Boden fallen. In seinem Gesicht zuckte kein Muskel, als er sich in das eisige Wasser gleiten ließ. Sinnlos. Die Kälte belebte ihn ebenso wenig wie sich mit Juna zu vergnügen. Ließ ihn das Geschehene nicht vergessen, wusch die Ereignisse nicht fort.
Missmutig schöpfte er etwas Wasser und spritzte es sich ins Gesicht.
»Wenn du meinst, ich laufe dir hinterher – das tue ich nicht.«
Juna trat vor das Becken, als er sich umwandte. Die Sauna lag geschützt zwischen den hohen Kiefern, sodass niemand Zeuge davon wurde, wie sie das Handtuch hinuntergleiten ließ und ihren nackten Körper der nächtlichen Kälte aussetzte.
»Du bist rausgekommen und denselben Weg gegangen wie ich.« Caleb kehrte ihr den Rücken zu. »Und nun reden wir wieder miteinander. Ist das nicht Hinterherlaufen?«
»Ich bin nicht bloß hier, damit du dich mit mir vergnügen kannst«, sagte Juna ärgerlich. »Es wird dich überraschen, aber ich schätze dich nicht nur, während du mit mir schläfst.«
»Nicht? Ich wüsste nicht, dass je mehr zwischen uns war.«
Als er sich umwandte, schloss sie die Hände fest um den Rand des Beckens, die Miene steinern. Rotbraune Strähnen, die sich aus ihrem Haarknoten gelöst hatten, fielen ihr in die Stirn und ließen sie bedrohlicher aussehen. »Wenn du meinst, dich eklig benehmen zu müssen, war das das letzte Mal, dass ich meine Sauna mit dir geteilt habe. Solchen Scheiß kannst du dir für wen anders aufheben.«
Bei ihrem Tonfall bekam Caleb ein schlechtes Gewissen. Es war nicht Junas Schuld, dass er sich dreckig fühlte, und seinen Ärger an ihr auszulassen war nicht gerecht. »Schuldige. So war das nicht gemeint. Ich hab einen schlechten Tag … schlechte – Tage. Um ehrlich zu sein, ich hatte eine Menge schlechter Tage in letzter Zeit.«
Juna musterte ihn misstrauisch, ehe sie dem Beckenrand losließ und auf den Hocker stieg. Caleb wich an den Rand, als sie ins Eiswasser eintauchte – erst nur ein Knöchel, dann ein Bein, schließlich der ganze Körper. Die Wasseroberfläche umschloss ihre helle Haut bis zur Taille und kräuselte sich, als sie mit einem unterdrückten Seufzen eintauchte. Caleb beobachtete jede ihrer Bewegungen, jede Emotion. Er sah sie gern an. Wenn Juna seit seinem letzten richtigen Besuch zugelegt hatte, dann hatte sie das zum Besten verändert.
»Willst du mir irgendwas über deine schlechten Tage erzählen?«, fragte sie, als sie sich ausreichend an das kalte Wasser gewöhnt hatte.
Wollte er das? Caleb hatte mit Juna geschlafen, um sich abzulenken. Aber wenn Ausblenden nicht half, musste er womöglich einen anderen Weg einschlagen.
»Stell dir vor, du lässt deine Mutter bei etwas im Stich«, begann er, »sagen wir, als die Drovi hier waren und um einen Schlafplatz gebeten haben. Du wimmelst sie ab, sie drohen dir und du wirft ihnen ein paar böse Beleidigungen an den Kopf. Deine Mutter … sie hält dich nicht auf, beteiligt sich aber auch nicht an dem Streit. Eigentlich gefällt ihr das alles nicht. Schließlich ziehen die Drovi ab und du denkst, dass sie nicht mehr wiederkommen.«
»Und ich bleibe nicht wachsam?«
»Nein. Weil ich da bin und dich ablenke. Mit ziemlich gutem Sex.«
Sie schmunzelte. »Von mir aus. Weiter.«
Caleb strich sich ein wenig Wasser durch den Nacken. »Die Drovi kommen nachts wieder. Sie überfallen euch und du bist nicht da, um deine Mutter zu beschützen … weil du gerade ziemlich guten Sex hast.«
Juna lachte, aber er hob die Hände.
»Deine Mutter ist ganz alleine mit denen. Nur ein paar mutige Gäste aus Dinas Rhedyn bewahren sie davor, ganz übel zusammengeschlagen zu werden. Wäre es gerecht, wenn deine Mutter … dann wütend auf dich wäre?«
»Weil ich sie da reingeritten habe?«
»Vielleicht. Und weil du ihr nicht geholfen hast.«
Juna schöpfte eine Handvoll Wasser und ließ es durch die Finger tröpfeln. »Sie wäre wahrscheinlich in erster Linie froh, dass ich nicht auch in Gefahr geraten bin.«
»Weil sie die Autoritätsperson ist. Sie hat dich großgezogen und will dich beschützen. Aber jetzt stell dir vor, du hättest eine kleine Schwester und es würde ihr passieren.«
Eine Weile schwieg sie. »Ich wäre wütend auf mich. Und würde mir unnötig viele Vorwürfe machen.«
Caleb atmete aus.
»Unnötig oder nicht«, fuhr Juna fort. »Ich würde unbedingt verhindern wollen, dass es noch mal passiert. Damit ich denselben Fehler nicht zweimal begehe.«
Stumm blickten sie einander an, sahen am bloßen Körper des anderen hinab. Schließlich wandte Caleb das Gesicht ab. Er war so ein Idiot.
Juna spritzte ein paar Tropfen in seine Richtung. »Du hast ein gutes Herz. Hab ich zumindest in den Liedern so gehört. Du bist nur furchtbar dumm. Aber vielleicht kapierst du irgendwann, dass manche Menschen es wert sind, sich weniger stur aufzuführen.«
»Immer wenn ich denke, dass du etwas Aufbauendes sagen wirst, ist es doch nur eine Moralpredigt«, sagte Caleb unwillig.
»Ein und dasselbe.« Sie schloss so dicht zu ihm auf, dass ihre Oberkörper einander berührten. Sanft verschloss sie seinen Mund mit einem Kuss, weitaus erlösender als all die anderen, die sie heute geteilt hatten. Als er die Arme um ihren Körper legte, spürte er, dass sie eine Gänsehaut hatte. Eingehüllt in seine Narraphwärme entwich ihr ein beruhigtes Seufzen.
»Ich glaube, ich geh rein«, raunte sie.
»Dann mache ich die Sauna aus. Als Entschuldigung, weil ich so ein Depp war.«
»Das ist der richtige Weg.« Zufrieden ließ Juna die Hände von seiner Brust gleiten und watete aus dem Becken.
Caleb blieb noch eine Weile im Wasser und verfolgte, wie sie ihren Bademantel überzog und zum Gasthaus zurückging. Mit geschlossenen Lidern ließ er sich gegen den Beckenrand sinken, atmete die Nachtluft ein und aus. Ausnahmsweise empfand er die Ruhe als wohltuend. Womöglich würde sie ihm helfen wieder mit sich selbst übereinzukommen. Die Stille wurde nur vom leisen Plätschern des Wassers, dem Knistern der Kiefern und dem Krächzen der Käuzchen dann und wann durchbrochen.
Caleb war sich bewusst, dass Olyvar nicht ganz gerecht war. Er sollte sich darauf verlassen können, dass sie nicht weglief – schließlich war sie zwar ein kleines, aber kein dummes Mädchen. Aber letztlich war sie eben nur ein Mädchen. Er hatte sie zugunsten einer hübschen Frau ignoriert, obwohl er gewusst hatte, dass sie bei ihm hatte bleiben wollen. Überhaupt musste er sich eingestehen, dass er seiner kleinen Schwester mitunter sehr wenig Aufmerksamkeit schenkte. Weniger, als zu verantworten war.
Mit einem Seufzen watete er an den Beckenrand. Tropfen fielen ins Gras, als er sich aus dem Wasser zog, Halme kitzelten an seinen Sohlen. Caleb las sein Handtuch auf und nahm den geliehenen Morgenmantel vom Haken, um ihn überzustreifen. Mit einem Blick zum Hauptgebäude der Taverne vergewisserte er sich, dass ihn niemand beobachtete.
Vor der Gaststätte lief eine zierliche, dunkelhaarige Gestalt auf und ab. Caleb musterte sie zögernd. Die Person stellte sich auf die Zehenspitzen und spähte durch die Fenster. Sie war klein und von weiblicher Statur – sie wirkte unauffällig, doch Caleb wusste, dass das manchmal täuschte. Eine solche Gestalt konnte alles sein: eine Pferdediebin, eine Huldra auf der Suche nach einem Opfer, eine Hexe im Menschenkleid. Ihr unauffälliges Verhalten zeugte jedenfalls davon, dass sie heimlich hier war.
Rasch band Caleb den Gürtel, löschte das Feuer und kontrollierte, dass die heißen Steine sicher lagen und keinen Brand verursachen würden. Die Fremde stand noch immer am Fenster, als er auf das Gebäude zusteuerte, ihre Silhouette halb in Gold getaucht.
Caleb runzelte die Stirn. Die Luft war von einem merkwürdigen Geruch erfüllt. Moschus, und auch ein wenig … Eisen. Eine Erinnerung regte sich, als er den Gestank einatmete, und zuerst konnte er sie nicht einordnen. Es war zu lang her. Er hatte es zu sehr verdrängt.
Die Gestalt war in einen erdfarbenen Stoffumhang gehüllt – oder nein, kein Stoff, das war Tierfell.
Abrupt hielt Caleb inne. Die Erkenntnis traf ihn ohne Vorwarnung, hart wie ein Schlag. Er schoss auf die Fremde zu, packte sie beim Arm und riss sie herum. »Was bei den Wäldern tust du hier?«
Große Augen blickten ihm unter dunklen Haarsträhnen entgegen. Ihre blasse Haut war mit Farbe bepinselt – rote und schwarze Bemalungen, die die obere Hälfte ihres Gesichts schmückten und Linien senkrecht über die Lippen und die Wangenknochen zeichneten. Sie roch widerwärtig. Nach nassem Tierfell, Schmutz, Blut. In ihrer Haltung lag etwas Erwachsenes – in ihren Augen derweil funkelte noch der kindliche Trotz, den auch Olyvar manchmal an sich hatte. Der Gedanke, dass diese Person etwas mit seiner Schwester gemeinsam hatte, stieß Caleb so sehr ab, dass er sie instinktiv losließ.
»Oh«, sagte die junge Frau. Sie hatte eine klare Stimme, beinahe schnurrend. »Du bist doch ihr Bruder! Ich habe dich nicht kommen sehen …«
Er ließ sie nicht ausreden. »Verschwinde«, fuhr Caleb sie an. »Hau ab!« Als sie sich nicht regte, packte er sie doch wieder und stieß ihren Körper gegen die Fassade des Gasthauses.
»Caleb.« Obwohl ihr der Atem aus den Lungen gepresst wurde, lächelte sie ihn unverfroren an. Sicher hatte sie sich alles von den Älteren dieser Kultisten abgeschaut – ihre Haltung, ihre Stimmfarbe, ihren Blick. »Das war … dein Name. Ca-leb. Ich bin Maral, hallo.«
Es war ihm vollkommen einerlei, wie sie hieß oder was sie zu sagen hatte. »Schickt sie dich?«
»Lass mich los. Dann sag ich’s dir … vielleicht.«
Caleb dachte nicht daran. »Damit du Olyvar holen gehst?«
»Wie es uns zusteht.«
»Sie gehört euch nicht!« Mit aller Kraft dämpfte er seine Stimme. Caleb war von so tiefsitzendem Zorn ergriffen, dass er sich kaum beherrschen konnte.
»Aber dir? Dafür … passt du aber nicht gerade gut auf deine … Schwester auf. Ist sie alleine?«
»Sie ist in bester Gesellschaft.«
»Diese Spielleute? Deine Freunde?« Sie lächelte grimmig. »Die ersten Jahre wart ihr schwer aufzufinden, aber nachdem eure Gruppe so bekannt geworden ist, war es keine Herausforderung mehr. Dumm von dir, echt. Man musste nur … die richtigen Leute fragen. Ich hab gehört, ihr seid momentan in Eshwen. Wir sind ausgeschwärmt, haben uns aufgeteilt und nach euch gesucht. Tada – da bin ich.«
Sie keuchte, als er sie mit neuer Wucht gegen die Fassade presste. »Ist sie auch hier?«
»Hast du … da drunter eigentlich was an?«
»Ob sie auch hier ist, habe ich gefragt!« Sein Griff war so fest, dass kurz Angst in ihren großen Augen aufflackerte und er beinahe einen Funken Mitleid verspürt hätte.
»Keine Ahnung.« Maral lächelte, was mit der Kriegsbemalung aussah, als freute sich ein Wolf über ein besonders dickes Stück Fleisch.
»Noch mehr von euch?«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Wenn du nicht sofort damit rausrückst, werde ich dir ernsthaft wehtun«, drohte er. »Glaub ja nicht, dass ich dafür zu weich wäre.«
»Du würdest viel für sie machen, ja?« Maral holte Luft, so nah an seinem Gesicht, als würde sie ihm die Seele aussaugen. »Das hat deine Mutter immer gesagt. Caleb … würde eine Menge für Olyvar machen. Träumt sie schon, Caleb? Sie träumt doch, oder?«
»Sie. Ist nicht. Was ihr wollt«, beharrte Caleb.
»Darüber weißt du nichts. War schön – dich wiederzusehen. Und herauszufinden, dass du ebenso mutig wie dämlich bist.«
Ein blitzender Schmerz fuhr seine Seite hinauf, als sie ihm ein Knie in die Niere rammte. Caleb ächzte und gab Maral frei, als er zu Boden sackte. Die junge Frau fing sich auf den Knien ab. Keuchend rieb sie sich den Hals. Ihre Füße waren nackt, das erkannte Caleb verschwommen, als er sich hochhievte. Er sah alles nur undeutlich – der Schmerz, der seine Seite hinaufgefahren war, brannte schlimmer als ein Schlag in die Magengrube und trieb ihm Tränen in die Augen.
»Hab gerne mit dir geredet«, flötete Maral. »Wenn das mal keine Ablenkung gewesen ist. Aber Olyvar war ja zum Glück bei deinen Freunden.« Damit verschwand sie in der Dunkelheit.
»Ma- warte!« Caleb ächzte wütend, doch ehe er auf die Beine gekommen war, war sie schon im Wald untergetaucht. Er kniff die Augen zusammen, schlug mit geballten Fäusten in die Luft. Dann krampfte sich jähe Panik in seinem Herzen zusammen, er machte kehrt und stürzte auf die Tür zum Gasthaus zu. Maral war die Ablenkung gewesen! Während er sich von einer Halbstarken verhauen ließ, geriet Olyvar in die Fänge dieser Wahnsinnigen. Seine Schwester!
Roch es nach Blut? Nach Metall, genauso abstoßend wie damals?
Caleb hastete durch den Gang, schubste einen Angestellten aus dem Weg und stieß die Tür auf. Die Menschen hoben die Köpfe, als er im Morgenmantel in den Schankraum wehte und auf den Tisch zuhielt, an dem Edeline und Nascha saßen. Nur Edeline und Nascha.
»Propheten, was ist los?«, fragte Lene.
»Wo ist sie?« Er packte eine Stuhllehne. »Wo ist Olyvar?«
»Caleb?«
Als er herumwirbelte, stand sie da, unversehrt und in ihrem grünen Umhang, das blonde Haar hing ihr in die Augen. Caleb seufzte und stürzte auf sie zu, um sie in die Arme zu schließen. So fest er konnte, selbst wenn sie sich gegen seinen Griff wehrte.
Er gab sie nicht frei. Sie würden sie ihm nicht wegnehmen. Niemand würde sie ihm jemals wieder wegnehmen.
Kein Leid
Severyn, flüsterten die Wälder.
Es war der finsterste und schönste aller Träume.
Severyn, dies ist dein Weg.
Olyvar schlief nicht bei Adeena. Und das schien ihr ausgesprochen recht zu sein. Calebs Bericht von seiner Begegnung mit Maral war abgehackt und dürftig – doch alle begriffen, wie ernst die Lage war.
Seine Schwester erinnerte sich kaum daran, wie sie einander damals begegnet waren. Sie erinnerte sich noch weniger an das, was geschehen war, ehe er sie aus den Fängen des Kults befreit hatte. Anders als er selbst war sie sich nicht bewusst, was Marals Freunde mit ihr hatten anstellen wollen – und Caleb war das ganz recht. Olyvar war ein Kind. Ihr Zuhause war ihr Planwagen, ihre Familie die Barden. Das war alles, was sie wissen musste. Alles, was sie wissen sollte.
Propheten, es war ihm so leichtgefallen, all das zu vergessen. Anfangs war er wachsam gewesen, hatte ihre Spuren verwischt und sich bemüht unauffällig zu bleiben. Er hatte sich sogar einen Bart wachsen lassen und die Haare kurzrasiert. Niemals waren sie eine Nacht länger als nötig an einem Ort geblieben. Bis sie irgendwann in dieser Taverne in Skoggen gestrandet waren, in der sie mit zwei jungen Frauen an einen Tisch geraten waren, während ein Bardenpärchen auf der Bühne wunderbare Lieder gespielt hatte.
Caleb hatte es Mattys und Rosie nie erzählt, aber sie hatten ihn an jenem Abend sehr sentimental gestimmt. Sein Vater war ein Barde gewesen – er hatte ihm das Spielen aller Instrumente beigebracht, die Caleb heute beherrschte. Mit der Musik hatte es sich angefühlt, als befände sich sein Vater mit ihm im Raum. Als würde seine Stimme in seinem Herzen widerhallen – gib nicht auf, was du so gut kannst, Junge. Und als Olyvar ihn angestupst und gewispert hatte, dass sie auch eine Bardin sein wollte, hatte sich alles gefügt.
An diesem Abend waren sie die Hellen Barden geworden. Und damit waren die Ereignisse davor verblasst. Mit jedem Tag, jedem Auftritt und jedem Quäntchen Ansehen, das hinzukam, wich die Erinnerung an sein erstes Zusammentreffen mit Olyvar weiter in den Hintergrund. Es verschwand hinter ihrem heiteren Kichern, wenn Mollie ihr übers Gesicht schleckte, hinter jedem geschriebenen Lied und dem Applaus in Calebs Ohren. Hinter den heißen Küssen der Mädchen, die seinen Körper hinabwanderten. Damals gab es nicht mehr.
Nur die Art, auf die Olyvar hin und wieder verklärt ins Nichts starrte, erinnerte ihn daran, dass sie einmal keine Bardin gewesen war.
Vielleicht hatte Caleb gehofft, dass die Kultisten Olyvar vergessen würden. Vielleicht hatte er gehofft, dass sie auf jemand Besseren stießen. Oder vielleicht war er einfach beschissen dumm. Wahrscheinlich war er beschissen dumm.
Was die anderen von seiner Vergangenheit wussten, genügte, damit alle sofort reagierten. Juna beauftragte zwei Angestellte, die Umgebung abzusuchen. Edeline warf sich ihren dunkelgrünen Mantel über, versteckte das rote Haar unter der Kapuze und begleitete sie. Eigentlich wäre Caleb ebenfalls gern mitgekommen – aber als er sich erhob, fuhr ein so scharfer Schmerz seine Seite hinauf, dass er nicht mal richtig auf die Beine kam. Edeline und die Angestellten verschwanden ohne ihn und Nascha stellte ihm stattdessen ein Glas Rum vor die Nase und legte eine Decke um seine Schultern.
Sie fanden niemanden.
»Caleb?« Olyvars Stimme war so leise wie das zaghafte Schnuppern einer Maus. Ihr Bett lag auf der anderen Seite des Raumes, der vom fahlen Sichelmond beleuchtet wurde. »Was wollen diese Leute von mir?«
Caleb saß im Bett, den Rücken gegen die Seitenwand gelehnt und die Decke über den Knien. In der anderen Raumecke machte er Olyvars Silhouette aus – seine Augen hatten sich längst an die Dunkelheit gewöhnt. Er war seit Stunden hellwach.
»Wieso schläfst du nicht?«
»Kann nicht. Du?«
»Auch nicht.«
»Ich hab beschlossen, dass ich wieder mit dir rede.«
»Das ist lieb. Hab dein Generve vermisst.«
Sie richtete sich auf und schob die Decke von den Schultern. Auf leisen Sohlen tapste sie auf ihn zu. »Kann ich mit drunter?«
»Ja, aber vorsichtig. Mir tut immer noch alles weh. Au! Du hast voll gegen die Stelle getreten, mit Absicht!«
»Geschieht dir recht«, nuschelte Olyvar, während sie sich neben ihn kuschelte. Dabei zog sie allerdings die Beine an den Körper, damit es nicht noch mal passierte. Das Laken raschelte. Caleb stützte den Kopf mit einem Arm ab und vergewisserte sich, dass sie richtig zugedeckt war. Der Geruch seiner Schwester und ihr Haar, das auf seiner Haut kitzelte, waren wunderbar vertraut.
»Du hast mir das nie erzählt.« Sie drehte den Kopf, um zu ihm hochzusehen. »Was das für ein Ort war, von dem du mich weggeholt hast.«
»Ich hab nicht gedacht, dass das irgendwann wichtig sein würde.«
»Verrätst du es mir jetzt? Was war das für eine Frau und wieso verfolgt sie mich?«
Caleb antwortete nicht gleich. Vor seinem inneren Auge rannte Olyvar durch Weizenfelder, knabberte an Marzipantalern und streichelte blökende Schwarznasenschafe. Er wollte, dass es so blieb – dass sie weiter glücklich war und keine Erinnerung ihr Lächeln jemals trübte. Aber nun war der Schaden angerichtet und es nicht zu erzählen, hätte es bloß schlimmer gemacht.
Sacht strich er mit dem Daumen an ihrem Kiefer entlang. »Du weißt, was Nascha über die Sagart erzählt. Dass sie Keyll Naomh dienen und er ihnen aufträgt, was sie zu tun haben, ja?«
»Klar.« Olyvar nickte.
»Du weißt auch, dass es lange keinen Propheten gab – nicht mehr, seit Teannan vor dreihundert Jahren oder so diese Scheiße gebaut hat. Es gab also niemanden, der den Menschen verrät, was der Wald sagen will.«
»Ja. Aber Nascha meint, der Wald spricht ständig zu uns, nur nicht mit Worten. Er ist mit allem verbunden und wenn man sich anstrengt, kann man seine Stimme überall hören. Sogar im Wind. Oder in den Quellen oder den Blüten.«
»Kannst du das hören? Wie er spricht?«
Olyvar schwieg eine Weile. Mit dem Zeigefinger fuhr sie das Muster auf seinem Arm nach. »Manchmal.«
Caleb holte leise Luft und versuchte nicht zu zeigen, wie schwer sein Herz wurde. Sein Daumen fuhr über ihre weiche Wange. »Die meisten Menschen hören diese Stimme nicht«, fuhr er flüsternd fort, »aber einige wollen die Botschaft der Wälder trotzdem vernehmen. Sie verzweifeln, weil Keyll Naomh sie nicht anhört und ihnen keine Nachricht zukommen lässt. Sie wollen ihm dienen, aber …«
»Aber das geht nur, wenn er ihnen verrät wie.«
»Genau.« Ihre Lider wurden schwerer, je öfter er über ihren Kiefer fuhr. »Diese Menschen denken, dass Keyll Naomh … jemanden braucht, durch den er sich offenbaren kann. Jemanden, durch den er spricht. Keyll Naomh hat keinen Körper, aber sie wollen ihm einen geben.«
»Und dieser Körper … das ist meiner?«
»Zumindest glauben sie das.«
»Aber als ich bei diesen Leuten war, war ich noch ganz klein.«
»Sie haben es erst mit anderen probiert«, erklärte Caleb. Er hatte dabei zugesehen, einmal – das gehörte zu den Dingen, die er am dringendsten vergessen wollte. »Mit Alten und Erwachsenen. Sogar mit Grünen Priestern. Aber nichts hat funktioniert – sie dachten, dass sie mit dir mehr Erfolg haben.«
»Wieso?«
»Weil du was Besonderes bist.«
Olyvar kuschelte sich müde in seinen Arm. »Und warum bin ich was Besonderes?«
»Na, du bist die Schwester von Caleb, dem besten Sackpfeifenspieler von hier bis nach Lyttnar.«
Er ächzte gespielt, als sie ihm in die Seite knuffte. »Du bist ein Angeber, sonst nichts. Ein doofer Angeber.«
»Aber ich spiele ziemlich gut Sackpfeife.«
»Mittelmäßig vielleicht.« Olyvar unterdrückte ein Gähnen. Sie war zu müde, um nachzuhaken, was sie besonders machte, und das war ihm nur recht. In dieser Nacht war genug geschehen – er musste ihr nicht alle aufwühlenden Geheimnisse auf einmal offenbaren.
»Du dyl-luan«, murmelte Olyvar. »Weiße Eule. So nennen sie sich, oder nicht?«
»Daran erinnerst du dich?«
»Ganz schwach. Und … Caleb?«
»Ja?«
»Unsere Mutter hat was damit zu tun, oder?«
Sein Daumen an ihrem Kiefer strich beständig weiter. »Jap.«
»Dann ist sie nicht meine Mama«, beschloss Olyvar. »Und ich weiß nicht, wer mein Vater ist, aber er ist auch nicht mein Papa. Eine Mama oder ein Papa hätten nicht zugelassen, dass ich benutzt werde, obwohl ich so klein war. So was machen Mamas und Papas nicht.«
»Du bist ein schlaues Ding, Rehkitz.« Als sie nicht antwortete, holte Caleb tief Luft. Womöglich sollte er auf Juna hören und nicht so stur sein. »Tut mir leid«, raunte er, »nicht das, was in Maenblod passiert ist, sondern alles. Wenn du so schlaue Sachen sagst und so erwachsen bist … dann rede ich mir immer ein, dass du mich gar nicht als Beschützer brauchst. Ich denke mehr an Mädchen als an dich, und manchmal trinke ich zu viel, um auf dich aufpassen zu können – und ich bin genusssüchtig und blöd. Aber vor allem bin ich zu stolz, um zu sagen, dass ich was falsch gemacht habe.«
Eine Weile war sie still. »Du bist ja nicht meine Mama … oder mein Papa. Du bist mein Bruder. Und Brüder sind normalerweise nicht ganz alleine mit ihren Schwestern.«
»Nein … aber trotzdem. Ich sollte alles drei für dich sein. Nicht nur dein Bruder.«
Olyvar regte sich und Caleb erwiderte das schwache Lächeln, das sie ihm schenkte. »Alles in Ordnung. Wenn ich dich brauche, bist du ja da.«
»Das bin ich.«
Sie kuschelte sich an ihn. »Tust du noch was als Wiedergutmachung?«
Sacht fuhr Caleb ihr übers Haar. »Was denn?«
Aber Olyvar antwortete nichts. Sie war eingeschlafen. Caleb gab ihr noch ein bisschen Decke ab und küsste seine Schwester auf den Scheitel. »Schlaf gut, Rehkitz.«
Er blieb fast die ganze Nacht wach.
Severyn, flüsterten die Wälder.
Ein kaltes Land. Sein Mädchen und ein abtrünniger Prinz, unerreichbar. Ein Konvoi, eine Reise, seine Wegbegleiter treu bei ihm. Sie blieben an seiner Seite.
Severyn, dies ist dein Weg.
Eine Hexe, die die Gestalt wechselte. Ein Geschenk, eine List, ein Sieg.
Hände in seinen, ein goldenes Geweih, stahlgraue Augen. Euer Wort in meinem Ohr, Hoher Jäger.
Hohe Zwiebeltürme und dunkler Himmel. Faules Obst und Gemüse, funkelnde Masken – Geheimnisse von Jägern und Füchsen.
Ein Herrscher, der vor ihm niederkniete.
Es war der finsterste und schönste aller Träume.
Adeena hätte den Spielleuten sagen sollen, dass sie keine Reiterin war. Als sie sich am Morgen aus dem Bett in den Kiefernstuben schälte und auf die Beine stemmte, gaben ihre Knie beinahe unter ihr nach. »Heiliger Amadeus«, zischte sie und hielt sich die ziepende Hüfte. Ein paarmal atmete sie durch den Schmerz, ehe sie hochkam und das Zimmer mit steifen Gliedern durchquerte. Durchhalten. Es würde nicht lang wehtun. Dies hier war nicht anders als der Ausflug, den sie und ihr Vater in die Lausass gemacht hatte. Oder ihr Besuch in Erlendam, als er ihr gezeigt hatte, wo das Marzipan angeblich herkam. Adeena hatte sich damals eher dafür interessiert, wo sich sein Elternhaus befunden hatte und wo er als kleiner Junge die Stiege herabgesprungen und die Straße hinab zur Schule gelaufen war.
Damals waren sie so viel unterwegs gewesen, dass sich Adeena am nächsten Morgen kaum hatte bewegen können. Aber das legte sich mit der Zeit. Dieser Schmerz ging vorüber.
Mittlerweile war Adeena geübt darin, allein zurechtzukommen. Sie flocht ihr Haar und bedeckte die leicht spitz zulaufenden Ohren mit ebenholzfarbenen Strähnen. Auf dem Stuhl neben ihrem Bett lagen die Kleider, die die Spielleute ihr überlassen hatten. Sie zog Calebs Hemd und Edelines Hosen über und unterdrückte ein Ächzen, als sie Naschas Stiefeletten zusammenschnürte. Ohne die vertrauten Satinschichten der Seidenkleider, unter denen sie ihre Hüfte verbergen konnte, fühlte sie sich noch immer entblößt.
Seufzend griff sie nach dem Rucksack neben ihrem Bett und schob das dunkelgraue Tongefäß hinein, das sie auf dem Schreibtisch hingestellt hatte. Es kam ihr merkwürdig vor, ihren Vater in der dunklen Tasche zu lassen, wenn es nicht unbedingt sein musste. Nach dem Massaker der Mottenmonster waren ihr nur wenige andere Habseligkeiten geblieben, die sie noch ihr Eigen nannte. Die Reiselektüre ihres Vaters, ihr Kamm, ein Parfumflakon, der wie durch ein Wunder heil geblieben war, etwas Geld. Und die Schmuckschatulle, in der sie ihre leblose Motte verbarg. Leamhan severyn war nicht der richtige Name, hatte sie mittlerweile erkannt. Leamhan teannan hätte es besser getroffen, doch jetzt war ihr der Begriff zu präsent, um ihn zu ändern.
Unten in der Stube duftete es nach Kaffee und Frühstück. Adeena entdeckte keinen der Barden, hörte jedoch Calebs Bariton von draußen.
»Ein Milchkaffee bitte«, sagte sie zu dem Schankjungen, der ihr den Rücken zugekehrt hatte.
»Kommt sofort«, murmelte er, ohne sich dafür umzudrehen.
Adeena ließ eine Haarsträhne durch die Finger gleiten, während er mit den Speisen und Getränken hantierte. Ihr war nicht nach Frühstück, aber einem Kaffee konnte sie schlecht widerstehen – selbst wenn er nicht so gut wie der aus ihrer Heimat war. Ihr Vater war ein wahrer Kaffeegourmet gewesen und Adeena hatte ein paar Eigenheiten von ihm übernommen. Dass die Kieferstuben Austradar das Wasser reichen konnten, erwartete sie nicht – aber Caleb schwor auf Junas Kaffee und sie wollte ihm zumindest eine Chance geben.
Kurz berührten Adeenas Fingerspitzen die feuchte Hand des Schankjungen, als sie die Tasse mit dem fertig gebrühten Kaffee an sich nahm. Der junge Mann hatte ein durchschnittliches Gesicht, ein Wechselspiel aus Sommersprossen und Aknenarben.
»Wir haben schon bezahlt«, erklärte sie.
»Klar. Bitteschön.« Der junge Mann verschwand hinter der Theke.
Auf dem Weg hinaus schloss Adeena die Hände um das Porzellan. Der verführerische bittersüße Kaffeeduft füllte ihre Nase, zusammen mit einer Note Haselnuss, wenn sie sich nicht täuschte. Vielleicht kam der Kaffee hier ja tatsächlich an den aus Veena heran.
»Ich bin fertig«, fluchte Caleb, als sie nach draußen humpelte. »Mit allem. Wenn mich heute einer dumm anmacht, werde ich gewalttätig. Und das, obwohl ich ein friedfertiger Mensch bin.«
»Beruhige dich.« Naschas Miene hellte sich auf, als sie Adeena entdeckte. »Entschuldige, Caleb hatte eine harte Nacht.«
»Nicht auf die gute Art«, spezifizierte Caleb. »Und ich hatte nichts zum Frühstück.«
»Du wolltest doch früh los«, protestierte Edeline.
Auf dem Platz vor dem Gasthaus waren die Pferde der Barden angebunden. Olyvars kleines Brocpony knabberte an dem Holzpflock, an dem Edeline den Strick befestigt hatte. Gerade zog Lene die Trense über die Ohren ihrer eigenen Stute. Sie hatte die roten Haare im Nacken zu einem Pferdeschwanz verknotet und trug Hosenträger über dem hellen Hemd. Adeena hätte sie für einen Mann gehalten, wenn sie die junge Frau nicht gekannt hätte.
Neben Naschas und Calebs Tieren befanden sich zwei weitere am Anbindebalken – ein hübscher Fuchs und ein rauchgraues Tier. Lene wies auf die beiden. »Du kannst für die restliche Reise ein eigenes Pferd haben. Ich empfehle Esmonds.«
»Welches gehört ihm?«, fragte Adeena.
»Das da. Dieses ist ganz klar Severyns.« Caleb wies auf den Fuchs. »Guck dir an, wie es tänzelt. Dieser arrogante Ausdruck. Das kann nur seins sein.«
Nascha stieß ihn an. »Jetzt sag doch einmal etwas Nettes.«
Adeena tätschelte Esmonds Pferd begrüßend den Hals, während die Barden sich weiterneckten und Nascha zur Aufheiterung ein paar Liedfetzen anstimmte. In ihren Mundwinkeln verbarg sich ein Lächeln, als sie die Kaffeetasse an die Lippen setzte.
Erst da wurde ihr klar, dass sie in eine Falle getappt war.
Etwas Kleines, Spitzes grub sich in ihren Rachen und ließ sich nicht hinunterschlucken. Als sie versuchte es zu zerbeißen, gab der raue Splitter nicht nach. Adeena schüttete sich den Inhalt der Tasse beinahe über die Hände, da ihr der Kaffee wieder hochzukommen drohte. Als sie die Flüssigkeit bewegte, schwammen weiße Splitter darin.
Der Schankjunge hatte eine leere Eierschale in ihre Tasse gebröselt.
Adeenas Blick zuckte zu den Barden, doch die waren aufeinander konzentriert. Hastig schluckte sie und straffte die Schultern, obwohl sich Tränen in ihren Augen sammelten. Viele Menschen hatten schon damit gedroht, ihr Eierschalen aufzutischen – oder Schuhsohlen, deformierte Früchte, kleine Löffel. Tricks, um Wechselbälger zu enttarnen. Die Legenden hatte sie unzählige Male gehört: Wenn der Wechselbalg bei Entdeckung der Schalen gackerte wie ein Huhn oder die Stimme tief wie bei einem alten Weib wurde, hatte man ihn enttarnt, hieß es.
Adeena biss die Zähne aufeinander. Unzählbar oft hatte man in Erwägung gezogen, sie einem solchen Test zu unterziehen. Aber noch nie hatte es jemand gewagt.
Wieso traf sie das so sehr?
»He, was ist los?«, fragte Nascha, die sofort bemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte.
Adeena ließ die Tasse sinken. »N-nein, alles gut.«
»Willst du den nicht mehr?« Caleb wies auf den Kaffee. »Darf ich ihn dann haben? Ich schlafe sonst ein.«
»Nein!« Adeena schnellte vor und knickte beinahe weg, als er ihr die Tasse aus der Hand pflückte. »Der schmeckt ganz furchtbar«, stammelte sie, was Caleb mit einem befremdeten Kopfschütteln quittierte.
»Hä? Der Kaffee hier ist klasse. Halt –« Adeena war wie erstarrt, als er die Tasse hob. Seine Miene verfinsterte sich. »Was zum …«
»Zeig’s mir auch!«, drängelte Olyvar und stellte sich auf die Zehenspitzen. Auch Nascha und Edeline kamen näher.
»Was soll das denn? Wieso packt jemand …« Lene verstummte mit einem knappen Blick auf Adeena, die reglos dastand. Nascha betrachtete sie voller Mitleid und das tat am meisten weh.
»Das reicht.« Caleb stapfte los, zurück zum Hauptgebäude.
»Was macht er denn jetzt?«, fragte Adeena mit aufwallender Panik.
Nascha wandte sich an Edeline. »Sollten wir ihn aufhalten?«
Sie hob die Schultern. »Eigentlich will ich sehen, was er macht.«
»Caleb!«, rief Nascha. Als er nicht reagierte, schnalzte sie mit der Zunge und lief ihm nach. Da folgten sie ihm alle.
Schon aus einigen Schritten Entfernung hörte Adeena Caleb rufen: »Wo ist der Hosenscheißer, der das gemacht hat, he?« Scheppern erklang aus dem Hinterzimmer und gerade als sie im Türrahmen stehen blieb, drang ein unglücklicher Ruf an ihr Ohr. Caleb zerrte den Schankjungen am Kragen aus dem Hinterzimmer und stieß ihn grob genug von sich, dass er stolperte. Unbeholfen richtete der junge Mann sich auf.
»Was meinst du eigentlich, wer du bist!«, tobte Caleb. »Glaubst du, du kannst hier tun und lassen, was du willst? Die Leute wie Dreck behandeln?! Deine Eltern werden dir wohl beigebracht haben, wie man ein anständiger Kerl ist! Wer hat dir in dein Gehirn geschissen, ihre Kaffeetasse mit dem Abfalleimer zu verwechseln?«
»He?«, machte der Schankjunge.
»Was hat sie dir getan?« Caleb knallte die Tasse auf den Tresen, sodass der Kaffee hochspritzte und Eierschalenstückchen auf dem Tresen landeten. Adeena war überrascht, dass das Porzellan heilblieb. »Was ist dein Problem?«
»M-mein Problem?« Der Junge musterte Caleb unschlüssig, ehe sich seine Miene verhärtete. »Na, sie bringt Unglück! Sie ist boshaft, ein Wechselbalg!«
»Hast du sie danach gefragt?«, bohrte Edeline nach. »Hast du ein Wort mit ihr gewechselt oder nur ihr Äußeres für sie sprechen lassen?«
»Das … ist doch offensichtlich«, erwiderte der junge Mann.
»Sie ist kein Wechselbalg«, sagte Nascha mit so viel Wahrhaftigkeit, dass selbst Adeena ihr glaubte.
»Sondern unsere Freundin«, setzte Olyvar dahinter und nun stiegen Tränen in ihre Augen.
Der junge Mann wollte etwas antworten, irgendwas, aber er brachte nichts hervor.
»Wir sind hier gern gesehene Gäste«, warnte Caleb. »Und wer mit uns unterwegs ist, wird nicht wie Dreck behandelt. Also kannst du jetzt deinen Arsch zu ihr bewegen und dich bei ihr entschuldigen, ansonsten sind die Frühstückseier die einzigen, die du bald noch deinen Besitz nennen kannst!«
Als Caleb ihm einen Stoß gab, stolperte der Schankjunge auf Adeena zu und kam vor ihr zum Stehen. Sein Ausdruck war unwillig, aber die Barden, die sich bedrohlich um ihn aufgebaut hatten, schienen ihn einzuschüchtern. Widerstrebend sah er Adeena in die Augen. »Tut mir leid, dass ich Euch Unrecht getan habe.«
Adeena nickte steif. »Ist in Ordnung.«
»Jetzt mach diese Sauerei weg«, befahl Caleb. »Und denk darüber nach, wer du sein willst. Sie ist eine Frau gehobenen Standes.«
»Ja«, piepste der Kerl und zog ab. Caleb machte eine rüde Gebärde in seinem Rücken.
»Du machst echt keine halben Sachen, oder?«, fragte Nascha.
Olyvar grinste. »Ich fand es gut.«
»Diese minderbemittelten Eshwen sollen an ihrer Arroganz und ihren Vorurteilen ersticken«, zürnte Caleb. »Selbst ihr bescheuerter Auserwählter hat das besser auf die Reihe bekommen. Alles in Ordnung?« Er taxierte Adeena. »He, nicht weinen bitte.«
Adeena blinzelte eilig und schüttelte den Kopf. »M-mir geht es gut. Ich … bin gerade nur …« Sie konnte den Satz nicht vollenden. Ihr Vater fehlte ihr so sehr, dass es körperlich wehtat. Sie hatte geglaubt, ohne ihn ganz allein zu sein. Und diese Menschen, die sie erst seit wenigen Wochen kannten, behandelten sie aus reiner Selbstlosigkeit so wunderbar.
»Wir verstehen schon«, versicherte Edeline.
Adeena wischte die Tränen fort, die ihre Wangen hinabrollten. »Ihr hättet das nicht machen müssen.«
»Die Dinge in Austradar müssen ganz komisch laufen, wenn du meinst, dass das keiner Richtigstellung bedarf«, befand Caleb.
»Solange du mit uns unterwegs bist, bist du eine von uns«, pflichtete Edeline ihm bei.
Nascha legte Adeena die Hand auf den Rücken und ausnahmsweise war das gar nicht unangenehm.
»Du meintest, ich bin kein Wechselbalg«, raunte sie, »als wäre das selbstverständlich. Dabei kann nicht mal ich das mit Sicherheit wissen.«
Tröstend strich Nascha über ihre Schultern. Und dann sagte sie etwas, was noch lang in Adeena widerhallen würde. »Ich habe eben das Gefühl, dass du wirklich die Tochter deines Vaters bist.«
Adeena fand keine Worte, die angemessen gewesen wären.
»Außerdem hast du keine Reaktion auf die Eierschalen gezeigt.« Nascha zwinkerte ihr zu. »Test bestanden.«





























