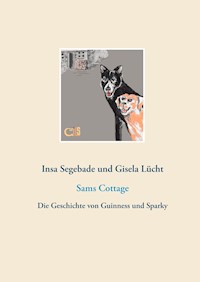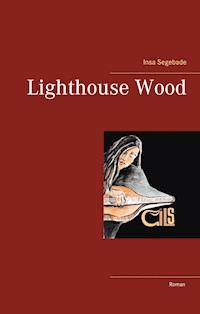
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abend für Abend steht er auf der Bühne, von seinen Fans und der Presse bejubelt. Der irische Bluesrock-Musiker Evric Ory hat erreicht, wovon andere träumen: Er ist ein Star. Der Erfolg und der volle Terminkalender täuschen ihn jahrelang über das hinweg, was ihm fehlt: Geborgenheit, Liebe, Familie. Eine Ahnung davon erhält Evric, als er Manon trifft, die Frau des Fotografen Jean-Luc. Dabei müsste Manon Evric doch eigentlich bestätigen. Sie hat ihre Karriere als Professorin für deutsche Literatur an der Sorbonne aufgegeben, um ihr Glück in der Ehe zu finden, die sich für sie allerdings längst als Gefängnis erwiesen hat. Mit Evrics Hilfe gelingt es Manon, den gewalttätigen Jean-Luc zu verlassen und ein selbstbestimmtes Leben zu beginnen - an Evrics Seite. Langsam gibt auch Evric mehr von sich preis. Er erzählt Manon von seiner Kindheit in dem Dorf Lighthouse Wood an der irischen Nordwestküste. Von seiner lieblosen, streng katholischen Mutter Gráinne, seinem Vater Jim, der die Familie früh verließ, und von der Musikerin Rose, die in dem Leuchtturm an der Atlantikküste wohnte. Aber Manon erkennt, dass Evric ihr nicht alles erzählt und dass es ein Geheimnis in seinem Leben gibt, das er selbst nicht lüften kann und das wie ein Schatten über ihm hängt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Teil: On the road
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Teil: Homeward
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
1. Teil
On the road
Kapitel I
Die Jalousien halb heruntergelassen, die Gedanken vergraben in einem Buch, das Sofa nur verlassend, um abends eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben – so hatte Manon sich die vier Tage vorgestellt, die Jean-Luc für seinen Fotoauftrag im Mercure verbringen würde. Sie hätte es besser wissen müssen. Nie würde er sie vier Tage lang aus den Augen lassen. Er bestand drauf, dass sie ihn begleitete.
„Aber warum müssen wir überhaupt im Hotel wohnen und können nicht einfach zu Hause bleiben? Schließlich tritt er in Paris auf“, versuchte sie, wenigstens einen Kompromiss auszuhandeln.
„Muss ich dir erzählen, wie groß Paris ist?“, machte Jean-Luc diese Hoffnung gleich zunichte. „Unser Haus ist am anderen Ende der Stadt. Glaubst du, ich fahre mitten in der Nacht nach Hause, womöglich mit ein paar Gläsern Wein intus? Und glaubst du, ich fahre nach Hause, wenn es im Hotel interessant wird? Es geht hier um Rock´n´Roll, Schatz.“
Und glaubst du vor allem, dass ich auf die Gelegenheit verzichte, dir zu zeigen, dir wieder einmal zu zeigen, was für ein toller Kerl ich bin?, ergänzte Manon in Gedanken die Aufzählung ihres Mannes. Schließlich hatte er als Fotograf des France Soir den Auftrag ergattert, den irischen Bluesrockmusiker Evric Ory während seines viertägigen Aufenthalts in Paris zu begleiten. Er sollte nicht nur Fotos von den zwei Auftritten in der Bercy Arena im Osten der Stadt machen, sondern war vom Management des Musikers auch dazu eingeladen, mit der Crew im Mercure zu wohnen, „Gerne auch mit Ihrer Frau“, wie ihm der Manager, Evrics Bruder Ethan, versicherte. Am ersten Abend hatten sie Evric Ory jedoch nicht einmal zu Gesicht bekommen.
„Er war heute Nachmittag, gleich nach unserer Ankunft, in den Botanischen Gärten spazieren und hat sich danach hingelegt“, entschuldigte Ethan seinen Bruder.
Jean-Luc machte ein langes Gesicht, war jedoch besänftigt, als Ethan ihn nach dem Essen ins Casino einlud.
„Sorry, Evric frühstückt nie“, hieß es am nächsten Morgen. Jean-Luc wurde auf den Abend vertröstet, wo er während des Konzerts in Bercy fotografieren sollte. Anschließend würde man gemeinsam im Mercure essen.
„Es sei denn, Mr. Superstar überlegt es sich wieder anders und begibt sich nach dem Auftritt direkt zur Ruhe“, schimpfte Jean-Luc, als sie nach dem Frühstück die Jacken aus ihrem Zimmer holten.
„Vielleicht wusste er auch nichts von der Verabredung zwischen dem France Soir und seinem Management“, überlegte Manon.
„Ja und?“, fuhr Jean-Luc sie an. „Der France Soir hat mich hergeschickt, und voilá, hier bin ich. Da kann ich ja wohl das Gleiche von Orys Management verlangen oder etwa nicht?“
Manon ließ die Frage im Raum stehen, zuckte nur mit den Schultern und fragte sich, wie um alles in der Welt sie den Tag mit dem mies gelaunten Jean-Luc verbringen sollte – als sein Mobiltelefon klingelte.
„Ah, Philippe“, hörte sie ihn in diesem ganz bestimmten Tonfall sagen, den er immer anschlug, wenn er mit dem Chefredakteur sprach.
„Hast du ein gutes Buch eingepackt?“, fragte Jean-Luc sie wenig später, als das Gespräch beendet war. Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort: „Ich muss zum Élysée-Palast. Da ist irgendetwas im Busch, und ich muss natürlich vor Ort sein.“
... und das Land retten, ergänzte Manon in Gedanken und lächelte leicht, als Jean-Luc nach seiner Kameratasche griff und gleich darauf die Zimmertür hinter sich zuknallte.
Wie selbstverständlich er davon ausgeht, dass ich den ganzen Tag das Zimmer nicht verlasse und lese, während er nicht da ist, sagte sich Manon und ertappte sich gleich darauf dabei, wie sie tatsächlich nach ihrem Maupassant griff. Unentschlossen schaute sie auf „Bel Ami“ und schüttelte den Kopf. Das Lesen, es war das Einzige, was sie noch mit ihrem früheren Leben verband – und ihre einzige Möglichkeit, sich aus dem Hier und Jetzt davonzustehlen. Darauf würde sie nicht verzichten, darauf konnte sie nicht verzichten – auch wenn es für Jean-Luc ein Triumph war.
Aber nein, sie musste ja nicht in ihrem Zimmer lesen, wo sein Geruch nach Tabak und After Shave in der Luft hing. Merkwürdig, dass sie ihn noch immer so bewusst wahrnahm – merkwürdig und beruhigend zugleich. Bedeutete letzteres doch, sich nicht komplett abgefunden zu haben. Manon schüttelte den Kopf, ärgerte sich über ihre nutzlosen Gedanken und griff dann, da die sich nicht so leicht vertreiben ließen, nach ihrer Jacke und dem Buch und verließ rasch das Zimmer.
Sie kehrte erst am späten Nachmittag zurück, zehn Minuten vor Jean-Luc. Natürlich erzählte sie ihm nicht, dass sie die vergangenen Stunden im Gare de Lyon verbracht hatte, nur ein paar Meter weiter. Aber dort hatte sie träumen können. Sie hatte am Bahnsteig gestanden, auf dem der Nachtzug aus Venedig einrollte. Hatte die zum Teil noch schlaftrunkenen Menschen beobachtet, die ihm entstiegen, und ihnen hinterher geblickt, als sie, ihren Koffer hinter sich herziehend, davoneilten. Sie hatte sich vorgestellt, wohin sie gingen und warum sie nach Paris gekommen waren. Bei manchen war das nicht schwer. Da, die junge Frau mit dem roten Mantel, sie fiel einem Mann um den Hals, der mit einer langstieligen, roten Rose auf sie wartete. Oder der Mann mit den graumelierten Haaren und dem Nadelstreifenanzug. Er hatte nur eine schwarz glänzende, flache Aktentasche bei sich und war gewiss auf dem Weg zu einem Geschäftstermin. Aber was war mit der vielleicht fünfzig- oder fünfundfünfzigjährigen Frau? Manon sah, dass der Kragen ihres dunkelgrauen Mantels abgewetzt war, als die Frau direkt an ihr vorbeiging. Wollte sie hier jemanden besuchen? Hatte sie Familie in Paris? War jemand krank geworden? Oder hatte sie lange auf diese Reise nach Paris gespart, um sich wenigstens einmal im Leben den Eiffelturm und Montmartre anzusehen? Vielleicht hatte sie auch einst eine schöne Zeit in Paris erlebt, war verliebt gewesen und wollte nun einen Hauch des Glücks von damals einfangen. Damals, als sie glücklich und unbeschwert gewesen war.
Auch Manon verließ nun den Bahnsteig. Sie fühlte eine Traurigkeit in sich aufsteigen, von der sie nicht wusste, ob sie ihr gewachsen war. Sie musste sich bewegen, versuchen, dieses Gefühl abzuschütteln, und ließ sich im Strom der Reisenden treiben, bis sie sich im Restaurant Le Train Bleu wiederfand. Sie fand einen Tisch im großen Saal, ganz in der Nähe des Gemäldes von Francois Flameng, und bestellte eine Flasche Perrier und eine Zwiebelsuppe, als ein Kellner an ihren Tisch trat.
Anstatt gleich den Maupassant aufzuschlagen und sich in ihre Lektüre zu vertiefen, starrte Manon auf den Flameng über ihrem Kopf. Auch die Sorbonne hatte den Maler einst für ein Wandgemälde verpflichtet, gleich bei den Ruhmestreppen. Zusammen mit Théobald Chartran malte Flameng im Peristyl einige Stationen der Universitätsgeschichte.
Täglich war Manon daran vorbeigegangen auf dem Weg zu ihrem Büro oder den Vorlesungssälen. Sie schüttelte den Kopf. Wie dumm von ihr, sich so in die Vergangenheit fallen zu lassen und diese leichte Wehmut zuzulassen, die dabei in ihr aufstieg. Dankbar lächelte sie den Kellner an, der ihr die Suppe und das Wasser servierte und für einen Moment ebenfalls lächelte, ihr ein warmes Lächeln schenkte, das nichts mit der routinierten Freundlichkeit zu tun hatte, die er vorher zur Schau gestellt hatte.
Jean-Luc war zu sehr mit sich beschäftigt, um zu bemerken, dass ihre Wangen vom Wind gerötet waren. Wie sie vermutet hatte, ging er tatsächlich davon aus, dass sie den Tag lesend auf ihrem Zimmer verbracht hatte. So sicher war er ihr und ihrem Handeln, das sich inzwischen auf ein überschaubares Minimum beschränkt hatte, dachte Manon und hörte nur beiläufig der Aufzählung der Politiker zu, die Jean-Luc während der letzten Stunden im Élysée-Palast fotografiert hatte.
„Hast du mich verstanden?“, riss Jean-Lucs lauter gewordene Stimme sie plötzlich aus ihrer Grübelei. „Wir müssen in einer Stunde zur Konzerthalle. Ich habe mit Evrics Management abgeklärt, dass du seitlich von der Bühne stehen kannst, während ich vom Fotografengraben aus Aufnahmen mache.“
Manon nickte. Links von der Bühne, rechts von der Bühne, an einem Seil von der Hallendecke baumelnd – das war ihr im Grunde einerlei.
„Natürlich werde ich zwischendurch auch auf der Bühne Fotos machen, während die Kollegen unten bleiben müssen“, fuhr Jean-Luc fort, während er den Akku seiner Nikon austauschte.
Meine Augen werden nur auf dich gerichtet sein, sprach Manon allein für sich die Worte aus, die Jean-Luc doch so gern hätte hören wollen – wenn auch ohne jeglichen Sarkasmus. Endlich hatte er einmal wieder einen Auftrag bekommen, bei dem er nicht, eingepfercht zwischen Dutzenden anderer Fotografen, darum kämpfen musste, eine halbwegs gute Aufnahme zustande zu bringen. Kein Wunder, dass er sie bei diesen Terminen nicht dabei haben wollte – den Ellenbogen eines Kollegen im Gesicht, die Kamera verzweifelt über die Köpfe der anderen haltend, dabei immer wieder von Polizisten hinter die Absperrung zurückgedrängt, als wäre er Vieh.
„Nach dem Konzert essen wir dann zusammen – mit Evric, seinem Bruder, der Crew, ...“
„Ich geh duschen“, erwiderte Manon.
Zu mehr konnte sie sich nicht durchringen.
„So willst du gehen?“, kommentierte Jean-Luc ihr Aussehen, als sie eine halbe Stunde später das Zimmer verlassen wollten.
Manon zuckte mit den Schultern und sah an ihrem schwarzen Rollkragenpullover und der dunkelblauen Cordhose herunter.
„Ich will nicht von dir ablenken“, erklärte sie dann und entlockte Jean-Luc, der die Ironie in ihren Worten nicht verstand, damit ungewollt ein Lächeln.
„Egal, was du anziehst – du bist immer wunderschön“, zeigte er sich versöhnt und fuhr ihr mit der Hand durch die blonden Locken, die sich auf ihrer Schulter zu Korkenziehern kringelten. Sie fuhren in Ethans Limousine das kurze Stück zur Konzerthalle. Während Jean-Luc sich seine Akkreditierung gut sichtbar an die Weste heftete und zum Presseeingang eilte, reichte Ethan Manon einen Ausweis, der sie berechtigte, sich an der Bühne aufzuhalten, und führte sie dann wortlos durch den Hintereingang und zahlreiche düstere Gänge zu ihrem Platz.
„Okay?“, fragte er und pfiff, ohne ihre Antwort abzuwarten, nach einem der Bühnenarbeiter, der gerade eine Gitarre an einen Verstärker stöpselte.
„Bring der Lady einen Stuhl und etwas zu trinken“, ordnete Ethan an und eilte davon.
Rasch hob Manon abwehrend die Hände, worauf der Bühnenarbeiter mit den Schultern zuckte und weiter mit dem Kabel hantierte, das er noch gar nicht aus der Hand gelegt hatte. Nein, sie wollte niemandem weitere Umstände machen. Es war schon peinlich genug, dass Jean-Luc sie mit hierher geschleppt hatte, wo sie doch gar keine Funktion hatte.
Früher war das anders gewesen. Als sie ihre Stelle an der Sorbonne gekündigt hatte, arbeitete sie mit Jean-Luc zusammen; er machte die Fotos, sie schrieb die Artikel. Sie hatten nicht nur in Paris gemeinsam Termine gemacht, sondern waren für ihre Reportagen rund um die Welt gereist – bis Jean-Luc dies nach einigen Monaten unterbrach. „Es ist zu gefährlich“, sagte er, ohne dass es einen besonderen Grund, eine spezielle Situation gegeben hätte, die diese Behauptung unterstreichen konnte. Sie waren keine Kriegsberichterstatter. Sie bereisten Naturparks, Kulturdenkmäler, ... nichts war daran gefährlich; jedenfalls nichts, was ihr Leben hätte bedrohen können.
Aber Jean-Luc wurde anderes gefährlich. Etwa dass Manons Texte mehr Aufmerksamkeit erhielten als seine Fotos. Bereits zweimal war sie für ihre Artikel ausgezeichnet worden, während Jean-Luc leer ausging. Und es mochte ihm außerdem nicht passen, dass ihre Gesprächspartner, ihre männlichen Gesprächspartner, ihr mitunter mehr Interesse entgegenbrachten, als es sich ziemte. So jedenfalls hatte Jean-Luc es ausgedrückt, nachdem er in einem Café vom Nachbartisch aus das Gespräch zwischen Manon und einem Museumsdirektor belauscht hatte, der Jean-Lucs Meinung nach viel zu jung und zu attraktiv für seine Stellung war.
Damals hatte Manon über solche Einwände gelacht, sie nicht ernst genommen. Als sie sich häuften, war sie zunehmend genervt, so genervt, dass sie aufhörte, mit Jean-Luc zu reisen, der es nun vorzog, überwiegend in der Stadt zu arbeiten. Sie hätte zurück an die Sorbonne gehen können, hätte sich andere Zeitungen suchen können, für die sie schrieb. Allein ... sie tat es nicht und kümmerte sich stattdessen um die Aufträge, die Jean-Luc ihr erteilte.
„Ach Schatz, das Wohnzimmer müsste dringend renoviert werden, und die Balkontüren müssten ebenso erneuert werden wie das Treppengeländer. Und schau nur, das Sofa, ganz abgewetzt ist es an den Armlehnen. Das Haus wurde arg vernachlässigt in den letzten Monaten.“ Nein, er sagte nicht, dass sie das Haus arg vernachlässigt hätte. Er wusste genau, bis zu welcher Grenze er gehen konnte. Er ließ Manon schalten und walten, wie sie wollte, und, ja, sie musste zugeben, dass es ihr Spaß machte, das Haus zu renovieren, neue Möbel zu kaufen, neue Vorhänge auszusuchen. Jean-Luc musste dafür ein Vermögen ausgegeben haben.
Aber das war es für ihn wert gewesen, der Plan ging auf. Sie war raus; raus aus ihren Berufen, drin in einem Alltag, der aus Tapetenmustern, Farben und Stoffen bestand, woran sich auch nichts änderte, als das Haus fertig war, als nichts mehr zu tun war, außer es instand zu halten und die Gäste zu bewirten, die Jean-Luc regelmäßig einlud; allesamt Ehepaare, glücklich verheiratete Ehepaare. Die Frauen luden Manon zu sich ein, wollten mit ihr shoppen, in die Sauna, ins Fitnessstudio – und Manon ließ es zu, kümmerte sich, ging hierhin, ging dorthin – und wunderte sich, wenn schon wieder ein Tag vorbei war, wenn schon wieder ein Tag verplempert war, bis sie sich nicht mehr wunderte und in eine Art Winterschlaf fiel – ihre Gefühle für Jean-Luc, wie auch immer die einmal gewesen sein mochten, eingeschlossen.
Manon hatte auf den schwarzen Samt der Vorhänge gestarrt, von denen rund ein Dutzend zu beiden Seiten der Bühne in einem Abstand von zwei, drei Metern aufgehängt waren und dadurch kleine Refugien schufen, in denen Bühnenarbeiter bereitstanden, wenn es während des Konzerts etwas aufzustellen oder zu reparieren gab, Koffer und Taschen für die Instrumente lagerten – und wo Manon stand, so in Gedanken versunken und auf den Stoff starrend, ohne ihn wirklich wahrzunehmen, zumal er viel zu dunkel war, um darauf auch nur ein Muster erkennen zu können, dass sie zusammenfuhr, als der gleichmäßige Lärm aus dem Zuschauerraum, ein Brei aus Rufen, Schreien und Lachen, plötzlich vom Klang einer E-Gitarre übertönt wurde.
Sie schaute auf, schaute auf den Mann, der seitlich vor ihr in der Mitte der Bühne stand. Unscheinbar in Jeans, Turnschuhen und einem rot karierten Hemd, auf dessen Kragen seine dunkelbraunen Haare fielen. Unscheinbar und doch so präsent, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren, obwohl er doch noch nicht mehr getan hatte, als mit den Fingern der rechten Hand über die Saiten seiner Gitarre zu fahren, um zu prüfen, ob sie gestimmt war.
Evric Ory – nein, Manon hatte den Namen nie gehört, bevor Jean-Luc ihr von diesem Auftrag erzählt hatte. Von der Westküste Irlands kam er ursprünglich, hatte sie in einer Ankündigung gelesen, und Bluesrock spielte er, wofür sie sich nie interessiert hatte. Während ihrer Studienzeit hatte sie ein paar Musikkurse belegt, auch Gesangsunterricht genommen und mit einem Pianisten Chansons von Edith Piaf interpretiert; doch mehr um verstehen zu können, was Literaten und Philosophen meinten, wenn sie von Musik schrieben und sie als höchste Form menschlichen Seins und künstlerischen Ausdrucks priesen.
Aber war das Bluesrock, was Evric Ory da spielte? Manon hatte diesen Musikstil immer als eintönig, ja einfallslos empfunden. Aber was dieser Mann da auf der Bühne, nur begleitet von Keyboard, E-Bass und Schlagzeug, seiner Danelectro entlockte, war verblüffend. Seine Musik hatte nichts gemein mit den Klängen, die aus den Radios dudelten, war keinem Modetrend unterworfen, folgte keinem Diktat. Nein, da war etwas Altes, fast Archaisches in ihr, das doch stets immer dann überraschte, wenn man glaubte, etwas wiederzuerkennen; nicht bewusst, intuitiv nur.
Sein Spiel war ein Sprungbrett mitten hinein ins unendliche Meer der Harmonien und Rhythmen, mal nah dran, dann wieder weit entfernt von ihren Regeln und Mustern. Sein Spiel war ... ganz er; wer oder wie auch immer das exakt war – es war nicht nötig, das konkret zu hinterfragen, zu analysieren.
Manon fühlte es. Instinktiv. Es ließ sie aufhorchen, mehr noch, es rührte an ihrem Inneren, ohne dass sie es in Worte hätte fassen können; sie, die Wissenschaftlerin, die doch stets die richtigen Worte, die präzisesten Definitionen gefunden hatte – nur, dass es um die hier gar nicht ging. Evrics Musik, sie war so tief, war einfach so ehrlich, so leidenschaftlich, so voller Freude, schnörkellos und spontan, so offen und unbeschwert, dazu sein jungenhaftes Lachen, wenn er ins Publikum blickte, frei von Argwohn und Berechnung.
Verborgen, ja verschluckt von der Schwärze ihres Standorts, erlaubte es sich Manon, Evric Ory eingehend zu betrachten; wie ihm sein dichtes Haar ins Gesicht fiel, wenn er auf das Griffbrett seiner Gitarre sah; wie er seinen Kopf zurückwarf, wenn die Dynamik in der Musik zunahm, und den Blick auf seine überraschend feinen Gesichtszüge freigab, denen die langen Koteletten zugleich etwas Verwegenes, ja, überaus Männliches verliehen.
Manon spürte, wie sie errötete, wie ihr Gesicht brannte. Aber egal, hier an diesem geschützten Ort ließ sie ihren Gedanken freien Lauf. Ja, Evric Ory war sehr männlich; ein dummes Wort, wie sie fand; Jean-Luc, er tat stets männlich und war es doch nicht – genau wegen seines Bemühens, Evric hingegen ... er legte es nicht darauf an, vermittelte ihr zumindest den Eindruck, es nicht zu tun; er war es einfach. Durch sein Äußeres, gewiss, aber auch durch seine Unbekümmertheit, seine Lässigkeit, seine Genialität, die ihm einfach als Ausdruck seines Innersten diente; nicht dem Zweck, eine Show abzuliefern.
Gut, die Frauen und Mädchen in den ersten Reihen kreischten, fielen zum Teil sogar in Ohnmacht und mussten von den Sicherheitsleuten aus der Menge gezogen werden; aber das war nicht geplant; Evric legte es auf diese Wirkung nicht an, sie kümmerte ihn auch gar nicht. Oder etwa doch? Gerade sang er einen klassischen Blues. Sein raues Timbre, dem in manchen Textzeilen etwas Laszives anhaftete, dann gepresst klang, aber immer voller Kraft und Ausdruck war, dass es in Manon nach vibrierte, erzählte von seinem „Baby“, das ihn verlassen hatte, und er bat und bettelte, dass es zurückkommen sollte.
Ja, sicher, es war ein typisches Bluesthema, und doch ertappte Manon sich dabei, wie sie die Reihen der Frauen absuchte. War eine, die eine unter ihnen, für die er sang, über die er sang? Eifersucht stieg in Manon auf. Was war nur los mit ihr? Sie atmete auf, als der Song zu Ende war und tosender Applaus losbrach. Evric verbeugte sich, ging, als das Jubeln kein Ende nehmen wollte, nach vorne an den Bühnenrand und streifte die Hände, die sich ihm entgegenstreckten, und Manon fragte sich, wie es wäre, von seinen Händen berührt zu werden. Nicht so flüchtig wie hier, nicht einfach nur ein Streifen, kürzer als ein Windhauch, nein, sie fragte sich, wie es wäre, wenn diese Hände ihr Gesicht berührten, seine Linien nachzögen, über ihre Lippen strichen, ...
Manon schluckte und wünschte sich, sie hätte es nicht abgelehnt, dass man ihr ein Getränk brachte. Ihre Kehle war plötzlich so schrecklich trocken und kratzig. Wahrscheinlich war es hier hinter der Bühne einfach sehr staubig, setzte sie zu einer Erklärung an, über die sie selbst lächeln musste. Nein, verdammt, es lag nicht an dem Staub. Sie hatte eine trockene Kehle, weil dieser Mann da vor ihr auf der Bühne, der Mann, den sie überhaupt nicht kannte, sie auf eine Art und Weise erregte, wie sie es noch nicht erlebt hatte.
Wie frustriert muss ich sein?, fragte sich Manon, musste aber gleichzeitig lächeln. Ach, was soll´s?, sagte sie sich. Es wird keiner erfahren, und warum soll ich es nicht genießen? Dass sie zu solchen Gefühlen überhaupt noch fähig war, ... sie würden ohnehin wieder versanden, dessen war sie sich gewiss. Sobald das Bühnenlicht erloschen war, würden ihre Gefühle sich wieder verflüchtigen. Aber sie war dankbar, dieses Feuer wieder in sich aufflackern zu fühlen, wenn auch nur für einen Moment, für die Dauer dieses Konzerts, und es sollte ihr kleines Geheimnis bleiben. Dass sie sich an Evrics Magie, an seiner Genialität und Schönheit, seiner Kraft und Hingabe berauschte, die sie auch an die Hingabe erinnerte, die sie einmal selbst verspürt hatte. Damals, als sie in ihren Texten versunken war und neben dem eigenen Schreiben alles andere bedeutungslos geworden war.
Wie hatte sie das aufgeben und verraten können? Ihre Arbeit, ihre Leidenschaft, ihre Persönlichkeit. Was war aus ihr geworden? Jemand, der regungslos im Dunkeln stand und zu denen aufsah, die im Licht waren; einfach deshalb, weil sie taten, was sie tun mussten, wofür sie geboren waren. Und sie selbst, sie trieb einfach nur so dahin. Da war nichts, woran sie sich festhalten konnte, und sie wusste auch gar nicht, ob sie das noch wollte, ob sie das noch konnte. Sie war so müde, so gänzlich ohne Kraft.
Was machte sie hier? Sie sollte nicht hier sein und über all das nachdenken. Sie sollte gehen, zum Hotel zurückfahren, oder auch laufen, es war nicht weit. Sie musste nur ihren Blick von ihm reißen, von ihm, der alles war und ihr vor Augen geführt hatte, was sie entbehrte. Als ob das so einfach wäre, ... den Blick von ihm zu reißen, wie er mit geschlossenen Augen vor dem Mikrofon stand, jetzt auf einer Martin spielend. Eine Haarsträhne, nass und schwer von seinem Schweiß, hing ihm ins Gesicht, und Manon wusste nicht, ob sie der Grund war, warum er gerade in dem Moment die Augen öffnete, als sie endlich soweit war, zu gehen, sich abzuwenden. Allein der Gedanke war lächerlich, ... aber er öffnete nicht einfach nur die Augen, sondern wandte dabei den Kopf, sah in ihre Richtung, blickte sie an; blickte sie an, als hätte er sie erkannt, als hätte er ihre Gedanken gelesen.
Nein, das war unmöglich, dachte Manon. Er konnte sie nicht sehen; hier im Dunkeln, wo sie stand. Oder doch? Er hatte nicht irgendwo hingesehen, nicht seitlich von ihr oder darüber, sondern direkt in ihre Augen, die auch ihn ansahen. Nein, sie sollte sich nichts einbilden, es musste eine optische Täuschung sein; wie bei den Gemälden der großen Meister, bei denen der Betrachter stets meinte, von dem Porträtierten angesehen zu werden; egal, ob man rechts oder links oder direkt vor ihm stand.
So, und jetzt alle Kraft zusammennehmen und abwenden, befahl sich Manon. Und tatsächlich, es funktionierte. Dabei war es, als sähe sie sich selbst dabei zu, wie sie sich mit einem Ruck umdrehte und mit steifen Knien die düsteren Gänge entlang stakste, durch die sie gekommen war, während ein Teil von ihr noch immer an der Stelle seitlich von der Bühne verharrte, da er sich nicht lösen konnte ... von ihm.
Mechanisch wie eine Puppe, die jemand aufgezogen hat, ging sie zurück zum Hotel, ging hinauf in ihr Zimmer und setzte sich auf einen Stuhl am Fenster, ohne Licht zu machen. Die Augen hielt sie geschlossen und versuchte, sich einzig auf die Geräusche um sich herum zu konzentrieren. Auf das Rauschen des Verkehrs, vereinzeltes Hupen. Nach einer Zeit gelang es ihr sogar, aus der Geräuschkulisse das Quietschen der bremsenden Züge herauszuhören, wenn sie in den Bahnhof einfuhren, und manchmal auch Fetzen von Lautsprecherdurchsagen, ohne jedoch einzelne Wörter herausfiltern zu können.
Sie wusste nicht, wie lange sie dort saß und hätte vermutlich die ganze Nacht dort am Fenster gesessen, wenn nicht Jean-Luc irgendwann ins Zimmer gepoltert wäre und die grelle Deckenbeleuchtung angeknipst hätte.
„War es nicht sagenhaft“, hörte sie seine viel zu laute Stimme, die sich regelrecht überschlug, während Jean-Luc ihr berichtete, wie er während des Konzerts Fotos geschossen hatte, auf den Lautsprecherboxen und auf dem Schlagzeugpodest herumgeturnt und zu Evrics Füßen herumgekrochen war, um sensationelle Aufnahmen zu machen.
„Aber das hast du ja auch alles selbst gesehen“, ging er ganz selbstverständlich davon aus, dass sie jede einzelne seiner Bewegungen verfolgt hatte, dabei hatte sie ihn nicht einmal bemerkt.
Auf ihre Beteuerungen, keinen Hunger zu haben und sich hinlegen zu wollen, ging Jean-Luc gar nicht erst ein, legte stattdessen einfach seinen Arm um ihre Schultern, als sie aufstand, um ihren Worten mehr Ausdruck zu verleihen, und führte sie zum Fahrstuhl, während er permanent redete, und Manon nur zu hoffen blieb, dass Evric nach seinem Auftritt zu müde war, um mit allen anderen unten im Hotel noch etwas zu essen.
Dass er nicht da war, lag einzig daran, dass sie zu früh waren, was jedoch zu Jean-Lucs Plan gehörte. Gelang es ihm so, durch sicheres Taktieren die zwei Plätze zu ergattern, die Evrics genau gegenüberlagen, dabei Überraschung zu heucheln, als der Musiker schließlich eintraf und sich setzte. Manon hörte es an Jean-Lucs Stimme; an seiner lauten Stimme, die sich über die Gespräche der anderen legte, sie zum Teil zum Verstummen brachte. Aufzuschauen, nein, das wagte Manon nicht. Es war sowieso nicht ihre Art, schon gar nicht, wenn Jean-Luc neben ihr saß. Und jetzt kam die Angst hinzu, sich zu verraten, ihre Gedanken, ihr Geheimnis zu verraten.
Wobei ... wen interessierte schon ihr kleines, dummes Geheimnis?, fragte sie sich. Evric Ory? Der Mann, dem gerade über sechzehntausend Menschen in der ausverkauften Bercy Arena zu Füßen gelegen hatten? Kaum. Und doch ... jemand blickte sie an, das spürte sie. Nein, sie würde nicht aufschauen, um herauszufinden, wer es war. Aber dann, gerade als die Suppenteller abgeräumt wurden, tat sie es doch; sah auf, wie auch Evric gerade aufsah, sie, direkt sie anblickte.
Was war geschehen? Hatte einer der anderen etwas gesagt, das einen geheimen Code in sich barg? War einem der Kellner einfach ein Glas oder ein Teller heruntergefallen, wodurch sowohl sie als auch er aus ihrer Versunkenheit, aus diesem Verharren in sich selbst gerissen wurden? Denn, Manon war sich sicher, auch Evric Ory hatte bislang geschwiegen. Seine Stimme, gewiss hätte sie die aus den anderen herausgehört, ganz automatisch.
Was war der Grund für dieses Lächeln, mit dem er sie ansah? Dieses schüchterne, dabei offene und sanfte Lächeln, das das ganze Gesicht erfasste – die dunklen, strahlenden Augen, die sie aufmerksam ansahen und verhinderten, dass sie sofort wieder wegschaute, wie sie es gewöhnlich tat. Aber stattdessen erwiderte sie sein Lächeln, wenn auch nur für einen Augenblick. Die Muskeln in ihrem Gesicht schmerzten, als sie ihre Mundwinkel nach oben zog. Zumindest empfand sie es so. Sie wusste, dass es zulange her war, seit sie zuletzt gelächelt hatte.
Und dann war es auch schon wieder vorbei. Jean-Lucs Stimme durchtrennte diesen Moment, schnitt ihn mit irgendeinem geistlosen Spruch ab, wie mit einem scharfen Messer. Und Manon war klar, dass sie dieses Lächeln bereuen würde, das nicht ihrem Mann gegolten hatte. Aber das war es wert gewesen.
Evric Ory verabschiedete sich, kurz bevor der Hauptgang serviert wurde.
„Er ist müde“, übernahm es Ethan, den frühen Aufbruch seines Bruders zu erklären und zu entschuldigen. „So ein Auftritt ist äußerst kräftezehrend.“
„Na, da haben die anderen sich wohl nicht genug angestrengt“, entgegnete Jean-Luc und lachte dröhnend über seinen eignen Witz, während er mit dem Zeigefinger auf den Schlagzeuger, den Keyboarder und den Bassisten deutete, die sich gerade ihre Weingläser nachfüllen ließen.
Ethan schwieg und schien für einen Moment zu überlegen, ob er Jean-Luc zurechtweisen oder seine Bemerkung einfach nicht ernst nehmen sollte.
„Vielleicht haben sie noch Wichtiges vor“, entschied er sich für Letzteres.
„Das nenne ich Rock´n´Roll“, wieherte Jean-Luc und wollte gerade sein Glas an den Mund führen, als er merkte, dass es ebenfalls leer war. Anstatt darauf zu warten, dass der Kellner auch ihm nachschenkte, griff er nach Manons halbvollem Glas und stürzte seinen Inhalt in einem Zug hinunter.
Er schlug direkt zu. Holte mit der rechten Hand, an der er seinen dicken, goldenen Ring mit dem Familienwappen trug, weit aus und traf sie mit dem Handrücken seitlich über dem linken Auge. Manon taumelte, konnte sich aber mit einer Hand an der Wand abstützen, bevor sie fiel. Sie starrte auf die honiggelben Bienen, die auf dem dunkelblauen Teppich dutzendfach aus weißen Blütenkelchen krochen, immer im gleichen Abstand, immer einzeln. Doch hatten sich die Umrisse der Blüten nun verdreifacht. Aber Manon gab nicht auf; starrte und starrte auf die verschobenen Formen, bis sie sich nach einer Weile wieder aufeinander zu bewegten und miteinander verschmolzen. Wenn er nur kein zweites Mal, ... dachte Manon den Satz nicht zu Ende und konzentrierte sich auf das gleichmäßige Pochen oberhalb ihres linken Auges.
„Wie konntest du mich so demütigen?“, hörte sie Jean-Luc sagen; glücklicherweise nicht direkt an ihrem Ohr, sondern ein paar Meter entfernt.
Ohne den Kopf zu heben, warf sie einen kurzen Blick auf ihn, wie er am Fenster stand, sich mit beiden Händen das weißblond gefärbte Haar raufend. Es war das erste Mal, dass er sie geschlagen hatte. Entsetzen und Fassungslosigkeit lagen in dem Blick, mit dem Jean-Luc sie ansah. Und noch etwas lag in ihm. Etwas, das Manon aus ihrer Starre riss, in die sie gefallen war. Es war noch nicht vorbei. Raus, sie musste raus aus diesem Raum; musste gegen das Zittern in ihren Beinen ankämpfen, das es ihr unmöglich machen wollte, auch nur einen Schritt zu gehen. Sie musste dagegen ankämpfen. Dagegen und gegen die Übelkeit, die in ihr aufstieg, als sie Jean-Luc ansah. Sie musste woanders hinblicken, befahl sie sich. Auf die Garderobe, wo ihre Jacke hing. Geh hin!, befahl sie sich und stieß sich von der Wand ab. Das Pochen schwoll an. Etwas wollte ihren Kopf sprengen, die Haut aufreißen und seinen Unmut, seinen Schmerz, seine Überraschung hinausschreien.
Manon ignorierte es. Ein paar Meter waren es nur bis zur Tür. Die würde sie schaffen, sie musste es einfach. Sie musste sich nur darauf konzentrieren, alles andere ausblenden – die Angst, die Verzweiflung, den Schmerz. Da, die Jacke. Der Aufhänger riss, als sie sie vom Haken zog. Eigentlich brauchte sie sie doch gar nicht, ihre Jacke. Aber sie war eine Station auf dem Weg nach draußen. Eine erreichbare Station, von der aus es nicht weit war bis zur nächsten, bis zur Tür. Weiter, weiter!, trieb sie sich an. Die Tür, sie war nur angelehnt. Jean-Luc hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie richtig zu schließen, nachdem er hinter ihr ins Zimmer gestürmt war. Sie musste sie nur aufstoßen und hinaus taumeln, auf den Gang, der schwach beleuchtet war von kleinen, runden Lampen, die auf niedrigen Tischchen standen.
Kein Mensch war zu sehen, nichts war zu hören außer ihrem eigenen Keuchen. Würde sich eine der verschlossenen Türen mit den vergoldeten Zimmernummern öffnen, wenn sie zu schreien begann? Würde ihr jemand helfen, wenn Jean-Luc versuchte, sie zurück ins Zimmer zu zerren? Sie würde sich nicht dagegen wehren können. Er war so viel größer, so viel breiter, so viel stärker als sie, vor allem jetzt. Aber nein, er folgte ihr nicht. Ein einziges Mal erlaubte es sich Manon zurückzuschauen, als sie zum Fahrstuhl strauchelte. Nein, der Gang hinter ihr war leer. Nur ein greller Lichtstrahl fiel aus dem Zimmer hinaus in das dämmrige Licht des Flures.
Der Fahrstuhl wartete noch auf ihrer Etage. Mit einem „Pling“ öffneten sich die Türen und schlossen sich gleich wieder hinter Manon, nachdem sie auf die Taste gedrückt hatte, die sie hinunter ins Erdgeschoss bringen sollte. Viel zu schnell endete die Fahrt. Mit einem leichten Ruck kam die Kabine zum Stehen. Vorsichtig spähte Manon hinaus, als sich die Türen wieder öffneten.
Auch das Licht in der Eingangshalle war inzwischen gedämpft. Nur der Tresen der Rezeption vorne rechts war hell erleuchtet. Der Portier blickte nicht auf, als sie aus dem Fahrstuhl trat, doch Manon wusste, sie würde seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie an ihm vorbei hinaus auf die Straße trat. Er würde fragen, ob sie einen Unfall gehabt hatte und ob er einen Arzt rufen sollte.
Manon blickte zur anderen Seite in Richtung des Speisesaals, aus dem noch immer laute Stimmen drangen; nicht viele, aber doch waren hier noch Menschen, die die Anstrengungen des Abends nicht mit Schlaf und Ruhe bekämpften, sondern mit ein paar Drinks und Gesprächen. Drinks – ab und zu trank Manon ein Glas Rotwein zum Essen, mehr nicht. Aber jetzt, jetzt brauchte sie etwas Stärkeres, um dieses Zittern niederzuringen, das sich ihres ganzen Körpers bemächtigt hatte – das Zittern und die Angst.
Die Hotelbar, sie lag von ihr aus gesehen hinter der Rezeption, an der sie somit nur seitlich vorbeigehen musste. Auch in der Bar brannte nur ein schwaches Licht, das leicht flackerte wie das Licht von Kerzen im leichten Luftzug. Manon eilte, so schnell ihre Verfassung es zuließ, diesem flackernden Licht entgegen, kämmte dabei vorsorglich mit der Hand ein paar Haarsträhnen über die linke Schläfe, damit der Portier die Verletzung nicht sah, sollte er aufschauen. Aber auch der Barkeeper sollte sie nicht sehen, der hinter der Theke Gläser polierte und aufsah, als sie eintrat – ebenso wie Evric Ory, der lesend an einem Tisch gesessen hatte, etwas verborgen in einer Nische.
Evric sprang auf, stand vor ihr, Manon sah ihn an und senkte den Blick gleich wieder zu Boden, ließ es aber zu, dass er ihre Hand ergriff und sie zu seinem Tisch führte, auf dem neben einem halb geleerten Glas Orangensaft ein Buch lag, dessen Rücken so oft geknickt war, dass er an einigen Stellen aufgeplatzt war und einige Fäden der Heftung freigab. „Der Zauberberg“ konnte Manon dennoch den Titel entziffern. Lass uns über Thomas Mann diskutieren, dachte sie und kämpfte gegen den Schwindel an, der sich ihrer bemächtigen wollte und es zu einem großen Unterfangen machte, sich auf den Cocktailsessel zu setzen, zu dem Evric sie gebracht hatte. Wieso schwankte der Sessel? Er wich ihr aus, neigte sich mal nach links, dann nach rechts wie ein störrisches Pferd, das den Reiter am Aufsitzen hindern wollte. Die Hand, mit der sie nach einer Lehne griff, fasste ins Leere. Wie peinlich war diese Situation. Und doch ... wie gut tat es, dass Evric noch immer ihre Hand hielt und auf sie acht gab.
„Einen doppelten Espresso und ein paar Eiswürfel“, sagte er dem Barmann, der seinen Platz hinter der Theke verlassen hatte und froh war, dass man ihm sagte, was zu tun war.
„Es tut mir leid“, hörte Manon Evric sagen.
Sie sah auf, sah wieder in diese dunklen, sanften Augen.
„Was?“, fragte sie. „Was tut dir leid?“
Ganz selbstverständlich kam ihr das „Du“ über die Lippen. Dieser Mann war von Anfang an kein Fremder für sie gewesen. Wortlos strich Evric ihr mit der freien Hand die Haare aus dem Gesicht, die sie über ihre linke Schläfe gestrichen hatte.
„Das tut weh“, sagte er dann, „ich weiß das. Nicht die Stelle direkt, das vergeht. Hier tut es weh.“ Evric legte seine Hand auf die Stelle, wo sein Herz schlug. „Es ist meine Schuld.“
Manon schüttelte den Kopf.
„Nein, es ist seine Schuld. Und meine. Weil ich es zugelassen habe.“
„Dann hör auf, es zuzulassen.“
Sie schwieg.
„Hat er es schon häufiger getan?“ fragte Evric.
Manon schüttelte den Kopf, wollte etwas sagen, allein ... ihr fiel nichts ein. Erbärmlich, war das Wort, das ihren Kopf ausfüllte. Sie fühlte sich so schrecklich erbärmlich, weil sie es zugelassen hatte; den Schlag, aber vor allem den langen Weg, der dorthin geführt hatte und den sie Jean-Luc hatte gehen lassen, als ob es sie gar nichts angehen würde.
„Ein doppelter Espresso.“
Geräuschlos stellte der Barkeeper die Tasse auf die gläserne Tischplatte und reichte Evric ein kariertes Handtuch, in das er einen Plastikbeutel mit Eiswürfeln eingeschlagen hatte. Schweigend rührte Evric viel Zucker in den Espresso, bevor er Manon die Tasse reichte, die sie mit einem Schluck leerte.
„Gut“, bemerkte Evric und stellte die Tasse zurück, bevor er ihr mit der einen Hand abermals an der linken Seite das Haar zurück strich und mit der anderen dann vorsichtig das Eis gegen die geschwollene Stelle drückte.
Manon zuckte zusammen, ließ aber keinen Schmerzenslaut über ihre Lippen kommen.
„Ich will gar nicht wissen, wie ich gerade aussehe“, murmelte sie und musste plötzlich grinsen. Fast gleichzeitig quollen dicke Tränen aus ihren Augen.
„Schsch“, machte Evric und tupfte die Tränen mit dem Ärmel seines schwarzen Kapuzenpullovers ab. „Es wird sich verfärben, ein wenig, aber so geht wenigstens die Schwellung zurück.“
Manon rührte sich nicht. Sie spürte, wie die Kraft in ihren Körper zurückkehrte, was am Zucker und am Koffein liegen mochte, vielleicht aber auch an Evrics zärtlicher Fürsorge, allein an seiner Nähe; vermochte doch seine Berührung, die Wärme seiner Hand, den Schmerz und das Pochen in ihrem Kopf zu verdrängen.
„Das Eis ist schon geschmolzen“, stellte er fest und nahm das Handtuch von ihrer Schläfe, um es auf den Teller zu legen, den der Barkeeper, der sie nicht aus den Augen gelassen hatte, rasch brachte.
„Danke“, sagte Manon, sich ohne seine Berührung plötzlich wieder schutzlos fühlend.
Ein Geräusch, ein Klacken wie von Absätzen auf dem marmornen Boden, ließ sie herumfahren. Jean-Luc! Suchte er sie? Kam er, um sie ... nein, es war der Portier, der hereinkam, mit einer leeren Teetasse in der Hand. Manon schloss erleichtert die Augen.
„Wollen wir woanders hingehen? Vielleicht einen kleinen Spaziergang machen?“, erriet Evric mühelos ihre Gedanken.
„Ja, gerne, sehr gerne.“ Manon zögerte. „Aber geht das? Ich meine, hast du keine Angst, dass man dich erkennt? Hier in dieser Gegend ist auch jetzt noch einiges los.“
Auch jetzt noch ... sie hatte keine Ahnung, wie spät es war.
„Wenn ich mir keine Sonnenbrille aufsetze, werde ich keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen“, war sich Evric gewiss. „Können Sie das bitte auf mein Zimmer bringen lassen?“, wandte er sich dann an den Portier, der gerade mit einer gefüllten Teetasse zur Rezeption zurückkehren wollte. Evric reichte ihm den „Zauberberg“, den der Portier mit einem „Gewiss doch“ an sich nahm.
„Komm“, sagte Evric zu Manon, die zwar aufgestanden, aber unschlüssig stehen geblieben war, nun aber seine rechte Hand ergriff, die er nach ihr ausstreckte.
Tatsächlich herrschte reges Treiben auf dem Place Louis Armand. Lachend und sich laut und angeregt miteinander unterhaltend, liefen Passanten an ihnen vorbei. Manon fragte sich, ob nicht einige von ihnen am Abend Evrics Konzert in der Bercy Aren gesehen hatten – aber sie stellte erleichtert fest, dass die Menschen wohl zu sehr mit sich selbst beschäftigt sein mussten, um Evric zu erkennen oder wenigstens auf ihn zu schauen – was sie überraschte. Denn auch wenn er auf jegliches Stargehabe wie das Tragen einer Sonnenbrille bei Nacht verzichtete und privat genauso unauffällige Kleidung trug wie vorhin auf der Bühne, ging doch eine Faszination von ihm aus, die längst nicht nur in seiner Attraktivität, ja, Schönheit begründet lag. Allein ... Manon war erleichtert, dass sie unbehelligt von den anderen die Rue van Gogh hinunter zur Seine bis zum Quai de la Rapée gehen konnten. Erst dort hielten sie an, schauten auf das dunkle Wasser des Flusses, in dem sich einige Lichter spiegelten.
„Du heißt Manon, nicht wahr?“, durchbrach Evric die Stille.
„Ja“, antwortete sie und fragte sich, woher er das wusste. Mochte sein, dass Jean-Luc es in seinem Stolz, sie zu besitzen, beim Essen hinausposaunt hatte.
„Ich habe dich gesehen, vorhin beim Konzert“, fuhr Evric fort. „Du hast seitlich von der Bühne gestanden. Ich habe Ethan nach dir gefragt ... und dann bin ich zu diesem Essen ins Hotel gegangen, was ich sonst nie tue, aber ... ich wollte dich wiedersehen. Du warst so schnell verschwunden. Und dann sah ich dich, und ich war glücklich ... und zugleich entsetzt, dich mit ... ihm zu sehen. Was rede ich da bloß“, unterbrach er seinen Redefluss. „Das ist gar nicht meine Art, ich ...“
Seine Stimme erstarb, er sah sie an. Und dieses Mal sah sie nicht fort, erwiderte seinen Blick, ja, hielt sich an ihm fest.
„Normalerweise lese ich, um nach einem Konzert zur Ruhe zu kommen“, sprach Evric weiter, „aber heute ... kam sie einfach nicht – auch wenn der ´Zauberberg´ eine Menge Ruhe ausstrahlt. Ich hielt es nicht mehr aus und ging hinunter in die Bar ...“
„ ... wo ich dich vom Lesen abgehalten habe“, ergänzte Manon, als er wieder stockte.
Evric lachte leise, wurde aber gleich wieder ernst.
„Du solltest heute Nacht nicht in einem Zimmer mit ihm sein“, sagte er leise. „Nicht, dass er ...“
Manon schüttelte den Kopf.
„Nein, er wird mir nichts tun, nicht heute, nicht mehr. Und schau ...“, sie zeigte nach Osten, „die Sonne wird bald aufgehen. Die Nacht ist fast vorbei.“
Sie drehte sich zurück zu Evric, als er darauf nichts erwiderte, sie nur ansah. Verachtete er sie?, fragte sie sich. Ja, er musste sie verachten. Aber spielte das eine Rolle? Ja, das tat es. Aber er würde nur noch ein Konzert in Paris geben, dann reiste er weiter, und sie würde ihm nie wieder begegnen. Sie sollte erleichtert sein, und doch ... Sie kämpfte gegen das Verlangen an, sich einfach nach vorne fallen zu lassen, von seinen Armen gehalten zu werden, ihre Wange an seine zu legen. Evric öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, überlegte es sich anders, bis er Manons fragenden Blick bemerkte. Er lächelte entschuldigend und schüttelte leicht den Kopf.
„Ja, bald wird die Sonne aufgehen. Aber noch steht der Mond am Himmel und wirft sein Licht auf dich. Und das ist so wunderschön, du bist so wunderschön.“
Jetzt lächelte auch Manon und ließ sich nun doch in seine Arme sinken, die er für sie ausbreitete. Er war nur ein wenig größer als sie, und es ergab sich von selbst, dass ihre Wange seine berührte. Sie hielt den Atem an, genau wie er, und als sie wieder Luft holten, war es, als wüchsen sie mit jedem Atemzug enger zusammen.
„Mein Mondmädchen“, flüsterte er ihr ins Ohr.
Die Sonne stand am Himmel und tauchte das Wolkenmeer, in dem sie schwamm, in ein leuchtendes Rot, als sie ins Hotel zurückkehrten. Lange waren sie am Seineufer entlanggelaufen und hatten schließlich ein Taxi zurück zum Mercure genommen. Manon versprach Evric, am Abend zum Konzert zu kommen.
„Ich lasse an der Rezeption einen Pass für dich hinterlegen, mit dem du überall hineinkommst“, sagte er, bevor er im dritten Stock aus dem Fahrstuhl stieg.
„Ich werde da sein“, versprach Manon, bevor die Türen sich schlossen, und der Fahrstuhl sie weiter nach oben brachte.
Sie empfand keine Angst, als sie an ihre Zimmertür klopfte und Jean-Luc öffnete. Er hatte sich bereits rasiert und seine Weste angezogen, in der er Ersatzakkus, Objektive, Kugelschreiber und Notizblöcke aufbewahrte.
„Ich fahre zum Élysée-Palast“, erklärte er und versuchte, unauffällig auf die Stelle oberhalb von Manons linkem Auge zu schauen.
Sie tat, als hätte sie es nicht bemerkt und nickte nur. Nein, Jean-Luc würde ihr nichts tun, nicht heute. Am Abend würde sie zu Evrics Konzert gehen. Nichts und niemand würde sie davon abhalten. Und was danach kam, nun, das zählte nicht, nicht jetzt.
Wieder war die Halle ausverkauft, wieder stand Manon auf dem Platz seitlich von der Bühne, von wo aus sie Evric sehen konnte, ohne selbst vom Publikum gesehen zu werden. Auch sie sah die Konzertbesucher nicht, warf nicht einmal einen Blick auf sie, hörte nur, wie sie die Luft anhielten, als wären sie ein einziger, riesiger Körper, als das Bühnenlicht erlosch, hörte, wie sie ausatmeten, als der Strahl eines Scheinwerfers auf den Mikrofonständer in der Mitte der Bühne gerichtet wurde, hörte, wie sie tobten, wie sie kreischten, wie sie applaudierten, mit den Füßen trampelten, als Evric, die Gitarre schon umgeschnallt, aus dem Dunkel ins gleißende Licht trat, „Bonsoir“ rief und dann ohne Umschweife mit der ersten Nummer begann. Und sofort war er versunken in seiner Musik, wurde eins mit ihr, empfand sein ganzer Körper nach, was er selbstvergessen auf der Gitarre spielte; die bekannten Harmonien bald verlassend, immer weiter improvisierte, mit den Akkorden jonglierte, bis er plötzlich aufblickte, seinen Bandkollegen allein dadurch ein Zeichen gebend, dass sein Solo beendet war und sie wieder die Melodie aufgreifen sollten, die er anschlug.
Manon holte tief Luft. Erst jetzt, als Evric zur Ausgangsmelodie zurückgekehrt war, bemerkte sie, dass auch sie die Luft angehalten hatte. Als er schließlich zu singen begann, schloss sie kurz die Augen und fasste nach dem Vorhang hinter ihrem Rücken. Seine Stimme, durch jede Pore ihres Körpers drang sein raues Timbre in sie ein, wo es etwas zum Schwingen, zum Vibrieren brachte, das ihr Herz schneller schlagen, das ihr Blut schneller durch die Adern fließen ließ, einer rasanten Achterbahnfahrt gleich. Noch nie hatte Musik solch eine Wirkung auf sie gehabt, dachte Manon, als das Lied beendet war und Evric eine Verbeugung andeutete. Aber anstatt gleich den nächsten Song anzustimmen, wie er es tags zuvor getan hatte, blieb er regungslos, den Blick auf die Saiten seiner Gitarre gesenkt, stehen. Erst als der Applaus nach mehreren Minuten abflaute, sah er auf, sah in Manons Richtung, ein fast spitzbübisches Grinsen im Gesicht, dann aufs Publikum.
„Den nächsten Song“, begann er, „habe ich erst vor wenigen Stunden geschrieben. Er heißt ... Mondmädchen.“
Während die Konzertbesucher seine Worte mit lautem Jubel quittierten, rührte Manon sich nicht von der Stelle, bewegte keinen Muskel, konzentrierte sich allein auf Evric, wobei es ihr problemlos gelang, alles andere auszublenden – die Schreie der Fans, den Kameramann, der zu Evrics Füßen kniete, nachdem er mit dem Ellenbogen Jean-Luc zur Seite geschubst hatte, der dort ebenfalls herumkroch.
„Mondlicht – kalt und schön, mein Begleiter einsamer Nächte, unzähliger einsamer Nächte“, sang Evric, nur begleitet von seiner Gitarre, während der Keyboarder, der Bassist und der Schlagzeuger sich in den Rhythmus hineinzufinden versuchten und bei der zweiten Textzeile zaghaft begannen mitzuspielen.
„Mondlicht – so warm, seit ich dich sah, seit ich dich fand, mein Mondmädchen. Einsam warst du, dein Gesicht, so voller Traurigkeit. Ich möchte sie fortwischen, möchte dich zum Lachen bringen. Ich weiß, dass ich es kann – wenn du mich lässt.“
Manons Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln, ganz von allein, ohne Anstrengung, kein Muskel protestierte diesmal gegen die ungewohnte Bewegung. Ja, er brachte sie zum Lächeln. Das hatte sie doch längst zugelassen. Das hatte sie sich doch gewünscht. Auch wenn es nur für diesen einen Abend war, auch wenn es nur wenige Stunden dauern sollte – sie lächelte und spürte diese Ahnung von Glück in sich, die alles andere einfach hinwegfegte, es verblassen ließ – jedenfalls bis zu dem Moment, als die Schlussnummer ausklang, der letzte Akkord endgültig in einer Woge der Begeisterung, ja, Ekstase des Publikums unterging. Ausufernd waren die Soli gewesen; immer weiter hatte Evric sie getrieben, sie ausgebaut, die Melodien komplett verlassen und doch stets wieder einen Anknüpfungspunkt zu ihnen gefunden, bis zum furiosen Finale, nach dem er hinter der Bühne verschwand.
Ja, er würde wiederkommen, noch ein oder zwei Zugaben geben und dann wäre Schluss. Die Spannung wich aus Manons Körper. Vorbei, war das Wort, das sich in ihre Gedanken schob, in immer größeren, in immer fetteren Lettern. Ja, bestimmt würde sie „Mondmädchen“ hin und wieder im Radio hören, und die Kopie dieses Lächelns, das es vorhin auf ihr Gesicht gezaubert hatte, würde über ihre Züge huschen, aber sonst ... Vielleicht würde sie Evric noch einmal sehen, kurz wenigstens, im Hotel, morgen, bevor er abreiste, weiterzog.
„Er möchte mit dir sprechen“, brüllte jemand durch den Lärm hindurch in ihr Ohr.
Manon zuckte zusammen, drehte sich zur Seite, wo sie nur den dunklen Stoff eines T-Shirts sah, der sich über einen gewaltigen Brustkorb spannte.
„Ich bring dich in seine Garderobe“, sagte der Hüne und lief bereits voran.
Manon sah nur von hinten seinen rotblonden Schopf, den er zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, und sie glaubte, einen der Roadies in dem Mann wiederzuerkennen. Sie beeilte sich, ihm zu folgen und ihn nicht aus den Augen zu verlieren, denn er ging recht rasch an aufgeklappten Instrumentenkoffern und Kabelrollen vorbei, zwei kurze Treppen hinunter, durch einen verwinkelten Gang, bis er zu einer metallenen Tür kam, die er aufstieß, wobei er selbst im Gang stehen blieb.
„Er kommt gleich. Ich bin übrigens Patrick“, sagte der Mann, wobei sein Mund durch das Gestrüpp rotblonder Haare kaum zu erkennen war.
Manon nickte und trat ein. Sie wollte etwas sagen, aber da war die Tür schon hinter Patrick krachend ins Schloss gefallen. Manon zuckte mit den Schultern. Es war sowieso nicht wichtig gewesen, was sie zu sagen beabsichtigt hatte. Sie sah sich um; sah Hosen, Pullover, Jacken, die über Stühlen, Tischen, einem Sofa lagen, darunter auch den schwarzen Kapuzenpullover, den Evric getragen hatte. Manon strich zart mit der Handfläche über den Stoff, nahm ihn schließlich hoch und legte ihn kurz an ihre Wange, bevor sie den Pullover wieder zurücklegte.
Zwei Zugaben erklatschten sich die Konzertbesucher. Manon hörte die Musik dumpf durch die Decke und die Wände. Die Rufe nach weiteren Zugaben waren noch längst nicht verstummt, als die Tür aufgerissen wurde und Evric hereinstürzte. Ein paar Haarsträhnen hingen ihm schweißnass ins Gesicht. Unwirsch schüttelte er sie zurück, während er auf sie zutrat, ihre Hände in seine nahm und sie mit der Frage überraschte: „Da, wo du wohnst – ich sage absichtlich nicht dein Zuhause – hast du dort noch irgendetwas, das dir wichtig ist, das du brauchst?“
Manon schüttelte den Kopf; fragte nicht, warum er das wissen wollte, wie sie auch bisher noch gar nicht darüber hatte nachdenken können, was sie überhaupt an diesem Ort sollte. Evric schien nicht daran zu denken, ihr etwas erklären zu wollen. Er sah sie nur an, bis er endlich nickte und sagte: „Gut, ich möchte nämlich nicht, dass du dorthin zurückkehrst. Genauso wenig, wie du heute Nacht ein Hotelzimmer mit ihm teilen sollst.“
Immer noch schwieg Manon. Doch war die Frage, die allein in ihrem Blick lag, laut genug.
„Ich kann dich nicht zu ihm zurückgehen lassen“, wurde sie von Evric beantwortet. „Er hat dich geschlagen, als ich dich nur angesehen habe. Was wird er nach diesem Song tun, den ich für dich geschrieben habe?“
„Er weiß nicht, wen du damit gemeint hast“, erwiderte Manon; noch immer nicht fähig, die Situation mit ihrem Verstand aufzunehmen.
„Oh doch, das weiß er“, erklärte Evric. „Das weiß er.“
Manon schüttelte den Kopf. Nicht, um Evric zu widersprechen, nein, diese Geste war allein Ausdruck ihrer Verwirrtheit. Ja, Evric mochte recht haben. Ja, Jean-Luc mochte wütend sein, und vielleicht würde er sie wieder schlagen, würde es zumindest versuchen, aber diesmal war sie vorgewarnt. Allein ... spielte das eine Rolle? Es ging nicht darum, weitere Blutergüsse abzuwehren. Es ging darum, etwas zu ändern, grundsätzlich etwas zu ändern. Aber traute sie sich das zu – neu anzufangen? Ja, beantwortete etwas in ihr die Frage. Das tat sie, das musste sie, das hätte sie schon längst tun müssen.
„Ja“, sagte sie nun auch laut. „Ich weiß zwar noch nicht, wo ich hin soll und ob ich in meinen Beruf zurück kann, ... aber das wird sich finden. Ich bestelle mir ein Taxi und fahre erst einmal in den nächsten Ort, vielleicht nach Chartres, um ...“
„Nein!“, unterbrach Evric sie und ließ ihre Hände los; aber nur, um mit beiden Händen zwar zart, aber doch entschlossen ihr Gesicht zu umfassen. „Das wollte ich dir damit nicht vorschlagen. Du sollst nicht allein sein, nicht heute, nicht morgen, nie mehr. Bleib bei mir! Ich weiß, dass das alles sehr schnell geht. Aber es geht nicht anders. Morgen sind wir schon in Bordeaux, übermorgen in ... keine Ahnung. Doch die Hauptsache ist, ... ich weiß, dass es richtig ist. Ich werde mich wie ein Gentleman benehmen und auf dem Sofa schlafen, während du das Bett bekommst. Aber bitte ... bleib!“
Warum? Warum willst du das?, wollte Manon fragen, brachte aber keinen Ton heraus, nur ein leises Schluchzen, als Evrics Lippen sich auf ihre legten, vorsichtig und zärtlich, und ihren Mund mit einem Kuss verschlossen.
Kapitel II
Ja, sie wollte bei ihm bleiben. Hatte sie das nicht schon gewollt, als sie ihn zum ersten Mal auf der Bühne sah und von seinen Händen berührt werden wollte? Ihre rechte Hand lag zwischen seinen Händen, als sie in seinem Bett lagen. Sein Angebot, das Sofa zu benutzen, hatte sie mit einer Handbewegung abgetan; lächelte, als er in T-Shirt und knielangen Shorts mit dem Emblem vom FC Liverpool aus dem Badezimmer kam, bevor sie selbst in eines von Evrics T-Shirts schlüpfte und sich die Zähne mit der Zahnbürste putzte, die sie kurz vorher an der Rezeption bekommen hatte.
Außer ihrer Handtasche, in der sie ein wenig Geld, ihre Kreditkarte und sonstige Papiere sowie ein paar Schminkutensilien aufbewahrte, und den Sachen, die sie trug, hatte sie nichts mitgenommen aus ihrem alten Leben. Es war ihr zu riskant erschienen, noch einmal in das Zimmer zu gehen, das für Jean-Luc und sie gebucht worden war. Und zu umständlich war es, etwas aus ihrem Haus am anderen Ende der Stadt zu holen. Sie genoss das Gefühl, mit so wenig Gepäck, so unbeschwert in einen neuen Lebensabschnitt gehen zu können. Mit dem Geld, das sie noch auf ihrem Konto hatte, würde sie erst einmal bequem über die nächsten Wochen kommen. Wenigstens diese kleine Unabhängigkeit hatte sie sich bewahren können: ein eigenes Konto.
Sie sprachen nicht mehr viel in dieser Nacht; lagen auf der Seite, die Gesichter einander zugewandt, sahen sich an, bis Manon ihre Augen nicht mehr offen halten konnte und zuerst einschlief.
„Woher kommst du?“, fragte sie, als sie in der Morgendämmerung aus einem tiefen, ruhigen Schlaf erwachten, ihre Hand noch immer zwischen seinen Händen.
„Aus einem kleinen Ort im Westen Irlands namens Lighthouse Wood“, antwortete er.
„Und gibt es dort beides – einen Leuchtturm und einen Wald?“
„Beides stand noch, als ich das letzte Mal dort war – aber das ist schon eine Weile her.“
„Weil du immer unterwegs bist?“
„Weil ich immer unterwegs bin“, wiederholte Evric ihre Worte, wobei er mit einem Finger zart über ihre Lippen strich, die sich dabei zu einem Kuss formten.
„In einer halben Stunde ist Abfahrt!“, dröhnte plötzlich Patricks Stimme, begleitet von einem dreifachen, kurzen Klopfen, durch die Tür.
Evric stöhnte auf und ließ sich auf den Rücken fallen.
„Die Schattenseiten meines Vagabundendaseins, das in Wahrheit ein Sklavendasein ist, habe ich dir natürlich absichtlich verschwiegen“, erklärte er dabei dramatisch. „Ich hoffe nur, dass du jetzt, da du so direkt damit konfrontiert wirst, nicht die Flucht ergreifst.“
Manon drehte sanft sein Gesicht zu sich.
„Es ist nicht wichtig, was man macht und wo man lebt – solange man den richtigen Menschen an seiner Seite hat.“