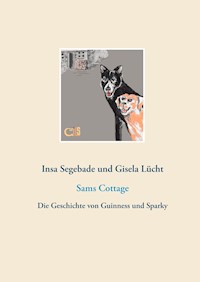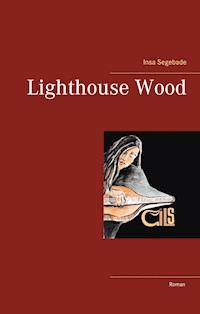Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach Inspiration verbringt die Schriftstellerin Esme einige Monate in einem Kloster im Harz. Bald ist es nicht mehr ihr größter Wunsch, ihr Leben weiter wie bisher auf den Seiten zwischen zwei Buchdeckeln zu platzieren, sondern sich der Wirklichkeit zu stellen. Ein Roman über die Macht des Schreibens und die noch größere Macht der Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für R
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
I
Der Zug rollte aus dem Oldenburger Hauptbahnhof. Ratternd, holpernd, stolpernd. Bremsen quietschten. Hatte etwas auf den Gleisen gelegen? Musste sie wieder aussteigen? Noch ehe ihre Reise überhaupt begonnen hatte? Die erste seit … Esme beugte sich vor und runzelte die Stirn. Nein, sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie die Stadt zuletzt verlassen hatte. Wann es einen Grund dafür gegeben hatte, die vertraute Gleichförmigkeit ihrer Tage zu verlassen. In den vergangenen Jahren hatte sie es geschafft, sich vor Lesungen zu drücken. Und so lange die Verkaufszahlen stimmten, war das kein Problem gewesen. Es ruckte, der Zug stand. Aber nur, um gleich wieder anzufahren. Glatt, geschmeidig, entschlossen diesmal. Esme lehnte sich in ihrem Sitz zurück.
Entschlossenheit. Geradlinigkeit. Genau das fehlte ihrem Leben. Von Anfang an hatte es gefehlt. Ihr Name, Esme, war ein perfektes Symbol dafür. Sowohl Männer als auch Frauen konnten so heißen. Der Name war nicht konkret. Ihre Eltern hatten sich vermutlich nichts dabei gedacht, als sie ihn ihr gaben. Damals, vor sechsunddreißig Jahren in Lerwick. John, ihr Vater, stammte von den Shetlands. Genau wie sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater und all die Generationen davor. Bis ins 17. Jahrhundert hinein, als ein niederländischer Heringsfischer die Fanggründe vor den Shetlands für sich entdeckte. Und dort blieb.
Johns niederländische Wurzeln waren längst vergessen. Im Gegensatz zu den deutschen Wurzeln ihrer Mutter. Vor vier Jahrzehnten war Kerstin aus Hamburg-Harburg nach Fair Isle gereist, um Strickmuster zu sammeln. Zurück in Hamburg wollte sie ein Wollgeschäft eröffnen, selbstgestrickte Pullover verkaufen. Jeder, den sie kannte, hatte damals einen dieser kratzenden, gemusterten Wollpullover, die nach Schaf rochen, im Schrank. Kerstin hatte acht. Den neunten strickte sie sich selbst, weil sie keinen mehr fand, dessen Muster sie noch nicht hatte.
Als sie dann am Ende des Sommers mit einer dicken Mappe voll mit Mustern am Hafen von Lerwick auf die Fähre nach Aberdeen wartete, traf sie John. John, der seine Eltern zum Schiff brachte. John, der Kerstin anstieß, als er einem Bekannten zuwinkte, wobei ihre Mappe zu Boden fiel, um die sie nur ihren Schal geschlungen hatte, den der Wind, zusammen mit den Strickmustern von Fair Isle, hinaus aufs Meer trug. John entschuldigte sich. Trocknete Kerstins Tränen. Lud sie zu einem Kaffee ein, als die Fähre mit seinen Eltern an Bord abgelegt hatte, während Kerstin sich nicht von der Stelle rühren konnte. Sie war erstarrt. Zu Eis erstarrt, das erst zu schmelzen begann, als John nach dem vierten Kaffee seinen Arm um sie legte und ihr sagte, es sei doch viel praktischer, gleich an Ort und Stelle zu bleiben, anstatt nach Deutschland zurückzukehren. Und Kerstin blieb. An Johns Seite. Als seine Frau. Das genügte ihr. Das war ihr Schutzschild, an dem all die skeptischen Blicke und bösartigen Tuscheleien der anderen abprallten. Sie baute sich und John ein Nest in einem kleinen Cottage am Meer, in dem sie ihre eigenen Strickmuster entwarf, Wolle spann, strickte und ihre Pullover bald hinaus in die ganze Welt verschickte.
Esme blickte auf, als der Zug sanft abbremste und langsam in den Bremer Hauptbahnhof einfuhr. Den vorigen Halt in Delmenhorst hatte sie gar nicht mitbekommen. In Bremen strömten die meisten der Leute aus dem Zug, die mit ihr in Oldenburg eingestiegen waren. Ungeduldig warteten diejenigen am Gleis, die weiter in Richtung Hannover fahren wollten. Für ihre Eile gab es keinen Grund. Es waren nur ein paar Dutzend Reisende, der Zug war nicht voll. Die Herbstferien waren gerade beendet, und jetzt am späten Vormittag saßen die Pendler längst in ihren Büros. Die Chancen standen also gut, dass Esme das Abteil, in dem sie seit Oldenburg allein saß, auch weiterhin mit niemandem teilen musste.
Ein älterer Mann, die Krempe seines Huts tief ins Gesicht gezogen und eine zusammengerollte Ausgabe der FAZ unter dem Arm, blieb, kurz bevor der Zug anfuhr, unschlüssig vor ihrer Abteiltür stehen und ging nach ein paar Sekunden weiter. Esme hörte, wie sich die Schiebetür nebenan schmatzend öffnete und kurz danach energisch wieder geschlossen wurde. Ja, sie war froh, auch weiterhin ihre Ruhe zu haben, ungestört ihren Gedanken nachhängen zu können. Gleichzeitig, ja, war es auch wieder klar. Es war so wie immer. In ihrer Gesellschaft hielten die Leute es nicht aus. Mieden sie, sofern es ging. Und das hatte nichts damit zu tun, dass man ihr Gesicht aus der Zeitung kannte. Unsicher war, wie man sich ihr gegenüber verhalten, was mit ihr reden sollte. Nein, es war etwas anderes. Etwas, das Esme nicht genau benennen konnte, obwohl das als Autorin doch ihr Beruf war. Aber sie war wohl vor allem gut darin, über Menschen zu schreiben, die in einer anderen Realität lebten. In der ihrer Bücher. Der einzigen, die wirklich zählte.
»Ihr ist es wichtig, ihren Leser*innen Raum für die eigenen Gedanken zu lassen«, hatte ein Mitglied der Jury lobend hervorgehoben, die ihr den letzten Literaturpreis zuerkannt hatte. Esme schüttelte den Kopf. Menschen, die ihre Bücher lasen, waren das Letzte, woran sie beim Schreiben dachte. Und schon gar nicht kümmerte sie sich dabei um einen Raum, in dem sich die Gedanken anderer austoben konnten. Aber … dass andere sie und das, was sie tat, anders wahrnahmen, als sie selbst es tat, war nichts Neues. Dass sie sie wahrnahmen als … irgendetwas. Etwas, das fremd war. Das außerhalb stand. Nicht der Norm entsprach. Nicht dazugehörte. Als Künstlerin stand ihr das gut, als Mensch hielt es andere auf Abstand.
Anders als Kerstin, die sich in ihrer Strickhöhle am Meer ganz einigeln konnte, musste Esme damals hinaus. Hinaus in die kleine Welt Lerwicks, in der sich wohl erst ihre Enkelkinder einen Platz hätten erobern können. Sie jedoch war die Fremde, mit der man nicht spielte. Die beim Schulsport in keine Mannschaft gewählt, sondern als Übriggebliebene einer Gruppe zugeteilt wurde. Die im Musikunterricht die ungeliebte Fiddle nehmen musste, weil es von den Gitarren, die alle spielen wollten, nicht genügend gab. Über Esmes Tränen konnte Kerstin hinwegsehen, nicht aber über die Briefe der Lehrer, die sie in die Schule bestellten, um ihr klarzumachen, dass ihre Tochter ein hoffnungsloser Fall war. Ihre Idylle, die Kerstin wie eine Käseglocke über ihr Leben gestülpt hatte, bekam Risse, die breiter und breiter wurden. So breit, dass John irgendwann durch einen hinausschlüpfte und nicht mehr zurückkehrte. Längst hatte er das Hotel seiner Eltern in Scalloway übernommen, in dem er nun selbst ein Zimmer bezog anstatt Abend für Abend nach Lerwick zurückzufahren.
Kerstin ging zurück nach Deutschland. Zusammen mit unzähligen Wollknäuels in allen Farben, Strickmustern und ihrer zwölfjährigen Tochter. Nicht nach Harburg, sondern nach Oldenburg, wo eine Freundin eine Schneiderei hatte, von der sie ein Eckchen für Kerstin abtrennte. In dem saß sie nun tagein, tagaus, strickte, entwarf und blickte kaum noch auf von ihren Pullovern, Wollknäuels und Musterbögen. In das Reihenhaus, das sie am Stadtrand für sich und ihre Tochter gemietet hatte, kehrte sie nur zum Schlafen zurück. Wenn sie es schaffte. Oft schlief Kerstin auf dem Stuhl, auf dem sie arbeitete, einfach ein, zwischen den Fingern die Stricknadeln, die sie weiterklappern ließ, noch ehe sie bei Morgengrauen richtig erwacht war. Bis sie zu schwach war, um sich aus den Armen des Schlafes zu befreien. Auch im Tod hatte sie ihre Stricknadeln nicht losgelassen. Allein das Rückenteil des Pullovers, an dem sie in dieser Spätsommernacht gearbeitet hatte, war ihr halb vom Schoß gerutscht. Kerstins Strickecke in der Schneiderei der Freundin wurde von einer anderen Frau übernommen. Samt aller Wollknäuels, Pullover und Musterbögen.
Esme wohnte zu der Zeit bereits in Hannover. Nach der Beerdigung ihrer Mutter ging sie langsam durch die Zimmer des Reihenhauses, zog hier und da eine Schublade heraus, öffnete Schränke und schloss sie wieder, ohne etwas herausgenommen oder angesehen zu haben. Nein, hier war nichts, mit dem sie sich verbunden fühlte, was sie behalten wollte, was sie brauchte. Ein soziales Kaufhaus räumte das Haus. Lediglich einen Schuhkarton mit Papieren und Schmuck fand Esme danach auf der Fensterbank in der Küche. Die Strahlen der untergehenden Sonne fielen durch die Äste der Holunder- und Haselnussbüsche, die den rechteckigen Garten hinter dem Haus umgaben, auf den hellen Laminatboden, als sie das leergeräumte Wohnzimmer betrat. Esme musste an den alten Nachbarn zu ihrer Linken denken. Jahrelang hatte er sich über die Büsche beschwert, die im Herbst ihre Blätter auf sein Grundstück warfen. Überhängende Zweige hatte er abgeschnitten und in ihren Garten geworfen. Kerstin bekam von alledem nichts mit, Esme trat jedes Mal mit Herzklopfen aus der Tür, wenn sie zur Schule musste, und ging rasch mit gesenktem Kopf den schmalen Weg zur gusseisernen Pforte, die auf den Gehweg führte. Erleichtert, wenn der Nachbar dort nicht bereits mit Besen, Eimer und Kehrblech stand und ihr mit seiner fistelnden Stimme erklärte, er werde das Ordnungsamt informieren, wenn sie nicht endlich die Büsche schneiden würden.
Der Nachbar war längst tot. War von der Leiter gefallen, als er die oberen Äste von einem ihrer Haselnusssträucher kappen wollte, in dem gerade ein Amselpärchen brütete. »Wenigstens hat er sich nicht in unserem Garten das Genick gebrochen, sondern ist auf sein eigenes Grundstück gefallen«, hatte Kerstin bemerkt und geschaut, ob das Amselnest unversehrt war. Die neuen Besitzer, die im Frühjahr darauf einzogen, pflanzten ebenfalls Holunder- und Haselnusssträucher an der Grenze ihrer Gärten. Inzwischen hatten sich die Pflanzen von beiden Seiten ineinander verwoben und verflochten und eine massive, grüne Wand gebaut.
Die dicht belaubten Zweige warfen Schatten an die weiß getünchten Zimmerwände. Sanfte Windstöße spielten mit den Blättern und den zarten Verästelungen, ließen die Schatten tanzen. Esme setzte sich im Schneidersitz auf den Boden, schloss kurz die Augen und atmete tief ein, als sie spürte, wie es hinter ihren Lidern feucht wurde. Bevor die erste Träne fallen konnte, öffnete sie die Augen und heftete den Blick auf den Schatten eines dicken, knubbeligen Astes eines Holunderstrauchs, der sich trotzig der Einladung des Windes zum Schaukeln widersetzte. Im Gegensatz zu den dünneren Zweigen, die ihm wie drahtige Haare am oberen Ende aus dem Holz wuchsen.
Sie waren unterschiedlich lang. Die größten ragten dem König schlank und gerade aus dem Kopf, die kleineren drängten sich an der Seite und versuchten, etwas von dem Sonnenlicht zu erhaschen, das durch die Blätter fiel. Einige mussten sich bereits so oft nach allen Seiten gedreht und gewendet haben, dass sie aussahen wie Spiralen. Moment, dachte Esme und hielt inne. Hatte sie den dicken, knubbeligen Ast gerade König genannt? Dann wären die Zweige ebenso seine Kinder wie die schwarzen Holunderbeeren, die in Dolden an ihm hingen, von ihm genährt und beschützt wurden. Jedenfalls bis sie herabfielen und ein eigenes Leben begannen, was den Zweigen verwehrt war. Sie waren mit dem dicken Ast, mit dem Vater, verbunden und konnten nur neidisch auf die prallen Beeren blicken, die freier waren als sie. Es sei denn … ein Vogel kam, um sich an ihnen satt zu essen.
Die Zweige grinsten schadenfroh. Längst hatten sie Gesichter bekommen. Nicht nur zufällig gesetzte Wurmlöcher, die als Augen interpretiert werden konnten, nein, es waren richtige Augen mit Pupillen, Wimpern und Augenbrauen, die sich bewegen konnten. Ganz genau beschrieb Esme es wenige Wochen später der Illustratorin, mit der sie ihr erstes Kinder- und Jugendbuch machte: Der Holunderkönig und seine Kinder. Fünf Bände umfasste die Reihe inzwischen. Eine Reihe von insgesamt sieben und die einzige, die sie für Kinder und Jugendliche schrieb. Diesen Stempel jedenfalls hatte der Verlag der Reihe aufgedrückt. Dazu noch ein Pseudonym. Schließlich schrieb sie sonst nur für Erwachsene. Eine andere Zielgruppe, ein anderes Genre unter demselben Autorennamen – nein, das sei verwirrend, argumentierte Sven, ihr Lektor. Ihre Zielgruppe, was die Leser verwirrte, … Esme war es egal. Solange sie nur schreiben konnte, was in ihr war, in ihr entstand und wuchs und hinauswollte.
Beim Holunderkönig hatte sie einfach über das geschrieben, was die Schatten in der leergeräumten Wohnung ihrer Mutter ihr erzählten. Erzählten sie ihr auch, dass sie bleiben sollte? Es ergab sich einfach. Sie gab ihr möbliertes WG-Zimmer in Hannover auf und zog zurück nach Oldenburg. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett, eine Kommode – Esme stattete das Haus nur mit dem Notwendigsten aus. Als befürchtete sie, jedes Möbelstück, das sie hereintrug, könnte die Fantasie, die hier Einzug gehalten hatte, beschweren, am Ende gar erdrücken.
Die fast leeren Räume – sie hatten so gar nichts mehr gemein mit den vollgestopften Zimmern, in denen sie hier einst mit ihrer Mutter gelebt hatte. Als sie eine Außenseiterin war. Wieder einmal. In Deutschland wegen ihrer schottischen Wurzeln. Im Englischunterricht lachte man über ihren harten Akzent. Nur die Deutschlehrerin, die die Shetland-Krimis von Ann Cleeves liebte, unterhielt sich in den Pausen mit ihr. Fragte, ob das Haus von Jimmy Perez am Hafen tatsächlich grüne Wände habe und ob der Leuchtturm von Sumbugh wirklich ein Hotel sei. Esmes Antworten beschränkten sich nicht auf ein einfaches Ja oder Nein. Ausführlich beschrieb sie der Lehrerin den Blick durch die großen Fensterscheiben des Cafés unten im Leuchtturm. Den Blick auf die dunklen, scharfkantigen Felsen, die weiß gesprenkelt vom Kot der Möwen waren. Sie schilderte ihr, wie der Stein erzitterte, wenn sich die Wellen bei Sturm an ihm brachen und das Gesicht mit Gischtfetzen benetzten.
Die Lehrerin ermunterte Esme, all das aufzuschreiben. Sich an jedes Detail zu erinnern. Nicht nur an das, was sie gesehen, sondern auch an das, was sie gehört, geschmeckt, gerochen, gefühlt hatte, wenn sie das Salz der Gischt von ihren Lippen geleckt, mit den Fingern durch das feuchte Haar gefahren war. Die Bilder und Figuren, die Geschichten kamen von allein. Die Frau im nachtblauen Gewand, die im silbernen Licht des Mondes auf dem Fels am Meer stand, dem Schiff nachblickte, obwohl es längst im Nebel verschwunden war. Der Mann, den seine goldene Rüstung mit dem silbernen Drachen darauf zwang, die Insel zu verlassen.
Esme sah ihnen zu. Erlebte die Schlachten, in die der Mann zog. Hörte das Klirren der Schwerter, die Wut-, später die Schmerzensschreie, das Todesröcheln der Männer. Das Weinen der Frau im blauen Gewand, die schon bald nicht mehr eine andere war, der sie zuschaute, sondern zu der sie selbst wurde. Der Kummer der anderen war ihr Kummer. Die Tränen der anderen waren die Tränen, die sie weinte, die ihr Kissen durchnässten. So erfüllend war dieses Leben. Von Anfang an, Jahr um Jahr. So viel mehr als das, was sie führte, wenn sie nicht schrieb. Wenn sie sich mit jemandem traf, auf einen Kaffee oder ein Glas Wein. Wenn Abende mit einem Kuss endeten, den sie zuließ, weil sie dachte, damit eine Lücke in sich füllen zu können, die sie manchmal verspürte … und die sich doch nur schloss, wenn sie wieder in ihren Geschichten war. Sie aufschrieb, über sie nachdachte, schließlich von ihnen träumte. Das Träumen – diesen Bereich musste sie sich erst als weiteren nutzbaren Quell ihrer Fantasie erschließen.
In der ersten Zeit war da zunächst nur ein Gefühl gewesen, wenn Esme morgens erwachte. Der Trauer, der Freude, der Erleichterung. Die Bilder, die diese Gefühle in ihr wachgerufen hatten, waren längst fort. Aber Esme war hartnäckig. Sie kämpfte um die Bilder. Erhaschte sie eines am Zipfel, hielt sie es fest und zog es mühsam näher und näher an sich heran, bis sich die Konturen deutlich herausschälten. Der Alltag, er war ihr egal, spielte keine Rolle, auch nicht in ihren Träumen. Was allein zählte, waren die Figuren, die in ihr waren und die sie nur herauslassen musste, damit sie in sie schlüpfen und mit ihnen, durch sie lebendig werden konnte. Nichts anderes fand Eingang in ihre Gedankenwelt, die nur ihr gehörte und die mit jedem Tag reicher und reicher wurde.
Sie fing an, die Bilder und Geschichten ihrer Träume in Worten festzuhalten. Aus Angst, das Wenige, das sie bewusst wahrgenommen hatte, wieder zu vergessen. Aber vor allem weil sie merkte, dass die Schemen während des Schreibens deutlicher und farbiger wurden, sich zu bewegen begannen, andere Bilder, andere Figuren anzogen, schließlich ganze Welten entstehen ließen. Sie musste gar nicht darüber nachdenken. Nur darauf achten, dass ihre Hand den Stift schnell genug übers Papier gleiten ließ.
Der Zug fuhr langsamer, würde bald Hannover erreichen, wo sie umsteigen, weiter nach Goslar fahren musste. Hannover, wo sie vier Jahre lang gewohnt, von wo sie vier Jahre lang weiter nach Hildesheim gefahren war, fünfmal die Woche. Zur Universität. Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus hatte sie studiert, wobei ihr sehr schnell klar geworden war, dass der Journalismus nichts für sie war. Zu viele Menschen, zu viele Gespräche, zu viel Unterwegssein, Fortsein, zu viele Gedanken über die Arbeit anderer, was sie stets brutal aus der eigenen Arbeit herauskatapultierte.
Wobei … Arbeit. Nein, als Arbeit hatte sie das Schreiben nie gesehen. Eher als Privileg, als Luxus. Als Möglichkeit, das zu tun, das zu sein und dort zu sein, wo sie ganz sie selbst sein konnte, ganz entschieden sie selbst. Jedenfalls für die Länge eines Romans. Was ihr genügte. War der Roman beendet, konnte sie ihn loslassen, daraus verschwinden, weshalb sie auch keine Probleme damit hatte, wenn andere Monate später ihre Texte lasen. Monate später, wenn sie bereits in ganz anderen Umgebungen, mit ganz anderen Figuren weilte.
Dass sie mit dem Schreiben ihr Geld verdiente, nun, das war nicht geplant gewesen, hatte sich ergeben. »Ich glaube, deine Fragen werden allmählich zu speziell für mich«, hatte ihre Deutschlehrerin ihr in der Oberstufe gesagt. Lange war sie die Einzige gewesen, der Esme ihr Geschriebenes gezeigt, es mit ihr besprochen und diskutiert hatte. Esme war dankbar dafür und doch … sie wusste, sie war noch nicht dort, wo sie sein wollte. Dort, wo sie die Wirklichkeit zu hundert Prozent hinter sich lassen konnte. »In Hildesheim, an der ehemaligen Pädagogischen Hochschule, gibt es einen Studiengang, der genau das Richtige für dich ist«, fand die Lehrerin im Januar vor Esmes Abitur heraus. Als sie ihrer Schülerin davon berichtete, hatte sie bereits ein paar Kurzgeschichten von Esme als Bewerbung eingereicht und eine Einladung der Universität erhalten. »Ein ganz zwangloses Gespräch über dein Schreiben«, beruhigte die Lehrerin ihre Schülerin und begleitete sie nach Hildesheim. Sie wartete vor der Tür, hinter der Esme mit drei Professoren sprach und durch die sie nach einer halben Stunde mit der schriftlichen Bestätigung herauskam, sie eigne sich für den Studiengang. »Das ist ja keine Überraschung, aber notwendig. Komm, gleich weiter zum Immatrikulationsamt, damit du dich für das nächste Wintersemester einschreiben kannst.« »Aber ich habe doch noch gar kein Abitur.« »Reine Formsache. Bis Semesterbeginn hast du es.«
Und so war es. Die Deutschlehrerin sorgte dafür, dass Esme das Stipendium einer Stiftung bekam, damit sie nach Hannover in ein möbliertes WG-Zimmer auf der Lister Meile ziehen und sich ganz aufs Schreiben konzentrieren konnte. »Wer weiß, ob deine Mutter dich nicht sonst eines Tages mit ihren Pullovern und Strickmustern erstickt«, war die praktische Erklärung. Das Stipendium brauchte Esme nach dem vierten Semester schon nicht mehr. Sie hatte ihren ersten Roman veröffentlicht, ging auf Lesereisen, besuchte Buchmessen und starrte staunend auf ihre monatlichen Verlagsabrechnungen.
Nein, um Geld musste sie sich keine Gedanken machen, konstatierte Esme, als sie wenige Minuten später im Zug nach Goslar saß. Wie wichtig, welch stabiles Fundament das für ihr Schreiben war, hatte sie sich aber wohl erst vor einigen Monaten klargemacht. Der Vorschuss für ihren neuen Roman war vom Verlag längst überwiesen, allein … sie fand nicht in ihr neues Buch hinein. Die Figuren verharrten trotzig in einer Höhle, ließen sich nicht blicken. Der Handlungsort war grau, verschwommen, ließ nicht erahnen, was sich an ihm abspielen könnte. Sie träumte auch nicht mehr. Oder wenn doch drang nichts davon in ihr Bewusstsein.
Überhaupt war ihr der Sinn fürs Schöne verloren gegangen. Immer war sie mit offenen Augen umhergegangen. Wissend, dass sie neue Anregungen für ihre Geschichten brauchte. Aber auch deshalb weil es ihr Spaß machte. Weil sie es genoss, im Schlossgarten oder im Botanischen Garten umherzuschlendern. Immer auf den Moment wartend, dass eine Pflanze, ein Vogel oder ein Windstoß, der durch die Gräser fuhr, sie dazu brachte, sich auf eine Bank zu setzen, ihren Notizblock hervorzuholen und das Gesehene mit Worten zu skizzieren. Auf diese Momente wartete sie inzwischen vergebens. Wenn sie denn überhaupt noch auf sie wartete und nicht längst kapituliert hatte.
Wie war es sonst zu erklären, dass sie ihre ersten Rezensionen geschrieben hatte? Über Kinofilme, Fernsehserien. Mit Schaudern dachte sie an die englische Serie, die sie zuletzt besprochen hatte. Eine Mutter, drei Töchter, allesamt Singles, unabhängig, mit guten Jobs. Und doch … am Ende, dem Happy End, waren alle unter der Haube, hatten sie alle ihren Männern verziehen. Den Egoismus, die Untreue, die Lieblosigkeit. Denn allein durchs Leben zu gehen, ist die größte Strafe, die einem zuteil werden kann, so die Quintessenz. Ja, Esme hatte sie herausgefiltert. Was blieb ihr anderes übrig. Aber sie hatte die Moral in satirische Worte gefasst. Sie konnte einfach nicht anders. Auch wenn sie in Zukunft auf den Job angewiesen sein sollte. Noch formulierte sie diesen Satz im Konjunktiv. Noch hatte sie die Hoffnung, dass die Leidenschaft in ihr Leben zurückkehren würde. Tag für Tag, wann immer sie ihren Stift in die Hand nehmen würde.
Aber das würde nicht von allein geschehen. So weit war sie inzwischen. Sie musste etwas tun. Zu ihrem Rhythmus, der ihren Tag, der ihr Schreiben stabilisiert hatte, zurückfinden. Ganz verloren hatte sie ihn noch nicht. Noch immer stand sie um acht Uhr auf und zog sich an. Duschen tat sie immer abends vor dem Zubettgehen. Morgens sollte so wenig Zeit wie möglich fürs Alltägliche draufgehen. Ja, das Alltägliche – jetzt überrollte es sie. Anstatt wie früher um halb neun mit einem frisch aufgebrühten Kaffee am Schreibtisch zu sitzen, gab es nun immer etwas, das sie davon abhielt: Die Künstlersozialkasse brauchte Einkommensnachweise. Das Finanzamt forderte eine Nachzahlung, da Belege fehlten.
Zuerst versuchte sie, sich selbst zu überlisten, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben, indem sie sich bewusst dem Alltäglichen widmete, noch mehr davon absichtlich in ihren Tag einbaute. Sie begann, ihre Wohnung zu renovieren und ihr ohnehin schon sparsames Mobiliar noch weiter auszudünnen. Sogar an ihre Bücher wagte sie sich heran. Tausende waren es, die sie an die Wände gestapelt hatte. Sie hatte sie alle gelesen. In die meisten von ihnen würde sie nie wieder hineinschauen. Die packte sie in Umzugskisten und ließ sie als Spende von der Stadtbibliothek abholen. Ich radiere mich selbst aus, war ihr erster Gedanke, als sie nach getaner Arbeit durch die nach Tapetenkleister, Farbe und Lack riechende Wohnung ging. Sie wartete auf das Entsetzen, das dieser Feststellung doch folgen müsste. Aber alles, was sie empfand, war Erleichterung. Ja, so fühlt sich Freiheit an, dachte sie.
Und die ließ sich noch steigern. Durch eine weitere Aufräumaktion. Esme klappte ihren Laptop auf, rief ihr Facebook-Profil auf, das der Verlag vor Jahren für sie angelegt hatte und pflegte. Mit Ankündigungen von Neuerscheinungen, Zitaten aus ihren Büchern, Rezensionen, Terminen für Lesungen. Hier musste sie nichts ändern, einfach alles laufen lassen. Anders sah es im Adressbuch ihres Mailaccounts aus. An manche Namen konnte sie sich nicht einmal erinnern, geschweige denn ein Gesicht damit verbinden. Bei anderen tauchten wenigstens Erinnerungsfetzen auf. Ein Essen unter einem nächtlichen Sommerhimmel, der auch um zwei Uhr morgens noch nicht dunkel war. Das Klirren gefüllter Gläser, mit denen sie anstießen. Auf was? Stimmen, Lachen. Wessen Stimmen? Wessen Lachen? Es schwoll an, dröhnte in ihren Ohren. Wie damals. Wo? Sie wusste es nicht. Wusste nur, dass sie aufgestanden, weggegangen war, den Lärm nicht mehr hatte ertragen können. Sie löschte die Namen im Adressbuch. Einen nach dem anderen.
Bereits am ersten Abend nach der abgeschlossenen Entrümpelungs- und Renovierungsaktion war es mit dem Hochgefühl vorbei, erfuhr die entdeckte Freiheit ihre Einschränkung durch Geräusche aus den Nachbarhäusern. Das Geknalle von Türen, Hundegebell, die tiefen Frequenzen eines laut aufgedrehten Fernsehers, der kräftige Urinstrahl im Pissoir des IT-Fachmanns zu ihrer Rechten wollten nicht passen zur kontemplativen Stimmung ihrer gereinigten Räume, die den Lärm verstärkten, ihn in Echos zurückwarfen, in deren anschwellendem Kanon Esme glaubte, den Verstand zu verlieren. Sie musste die Stadt verlassen. Eine neue Umgebung wäre hilfreich. Ruhig sollte sie sein. Wenige Menschen nur, am liebsten gar keine. Kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen. Den Kopf wieder auf Null stellen und neu starten. Ohne Problemanalyse. Was auch immer sie dahin gebracht hatte, wo sie sich jetzt befand, würde nach einem Reboot verschwunden sein. An diesem Gedanken hielt sie sich fest.
Nachdem sie in Goslar ein letztes Mal umgestiegen war, versuchte Esme, die Flut der Gedanken einzudämmen, die sie wie Treibholz auf den Wellen hin- und herwarf, seit sie Oldenburg verlassen hatte. Sie musste die Kontrolle zurückgewinnen, dem Wirrwarr in ihrem Kopf Einhalt gebieten und versuchen, sich einzig auf das zu konzentrieren, was sie draußen sah. In Oldenburg war der Himmel wolkenverhangen gewesen, erinnerte sie sich. Jetzt am frühen Nachmittag stahl sich hin und wieder ein schwacher Sonnenstrahl durch die Wolken. Das, worauf er fiel, wäre jedoch besser im Dunkeln geblieben, dachte Esme. Früher einmal musste der Schienenweg idyllisch gewesen sein. Er führte durch ein Waldgebiet. Einen Nadelwald, Fichten überwiegend. »Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit«, ging Esme die Zeile des Weihnachtslieds durch den Kopf. Wie zynisch, dachte sie. Ihr Grün hatten die Fichten hier längst verloren. Sie waren abgestorben, von einem verwaschenen Graubraun. Ein Wunder, dass der Wind sie nicht längst wie Mikadostäbe hatte fallen lassen.
Esme seufzte und schloss die Augen. Hoffentlich sah der Nationalpark Harz nicht überall so aus. Der Wald. Sie hatte so viel Hoffnung in ihn gesetzt. Stressabbau. Energie tanken. Den Kopf leer bekommen. Das waren die Stichworte, die ihr geblieben waren, als sie einen Artikel über das Waldbaden gelesen hatte. Mit einem Spaziergang wären diese Ziele nicht zu erreichen. Sich nach Thoreauschem Vorbild eine Blockhütte im Oldenburger Stadtwald zu bauen und dort als Einsiedlerin zu hausen – allein die Vorstellung war naiv. Aber sie hatte etwas Besseres gefunden: das St. Johannes Kloster. Ein aktiver Franziskanerkonvent mit Gästehaus. Umgeben von einem naturbelassenen Wald, Felsgestein und Mooren. Weit genug entfernt vom Brocken, der Jahr für Jahr Tausende von Touristen anzog. Nein, sie wollte sich nicht auf dem Goetheweg, dem Harzer Hexenstieg oder einem der anderen populären Wanderwege drängen, sondern Pfade finden, frei von Zeichen menschlicher Zivilisation. War auch das naiv?, fragte sie sich. Vielleicht im Sommer, auch noch in den Herbstferien, beantwortete sie sich die Frage selbst. Aber vielleicht nicht jetzt im Herbst. So zumindest die Hoffnung.
Ein halbes Jahr hatte sie sich gegeben und so lange das Reihenhaus in Oldenburg untervermietet. Bis Mitte März wollte sie im Kloster bleiben und abreisen, bevor die Urlaubssaison wieder begann. Meditation, Yoga, Gesang, Gottesdienste, … die Liste der Aktivitäten, die für die Gäste angeboten wurden, war lang. Aber sie war nicht bindend, nur ein Angebot. Sie würde es nicht wahrnehmen, nur zu den Mahlzeiten erscheinen. Vielleicht könnte sie sich diese auch auf ihr Zimmer bringen oder einpacken lassen. Für unterwegs. Auf ihren Wanderungen.
Wanderungen. Esme musste lächeln. Sie würde mit Spaziergängen beginnen. Die Umgebung erkunden. In kleinen Runden, deren Radius sie vergrößern würde. Allmählich, ganz langsam. Nein, als sportlich würde sie sich gewiss nicht bezeichnen, auch wenn sie sich in verschiedenen Disziplinen versucht hatte. So richtig gepackt hatte sie keine. Zu eintönig, zu öde fand sie vieles. Anders versprach es mit Karate zu werden. Eine neue Gruppe beim Sportverein um die Ecke, zwanzig Aktive. Mit jeder abgelegten Prüfung wurden es weniger. Nach der Grüngurtprüfung waren außer ihr nur noch diejenigen da, die am Wochenende durch die Straßen zogen und hofften, dass sich irgendwo eine Prügelei ergeben würde. Bis zum Blaugurt hielt Esme es dort nicht mehr aus.
Jetzt war sie schon wieder mit ihren Gedanken abgeschweift anstatt sich, wie geplant, allein auf die Umgebung draußen vor dem Zugfenster zu konzentrieren, schalt sich Esme. Vielleicht mangelte es ihr einfach an der nötigen Disziplin. Das Schauen aus dem Zugfenster musste sie ohnehin auf die Rückreise verschieben, da der Zug in den Zielbahnhof Wernigerode einrollte. Von hier aus würde sie die Fahrt mit dem Taxi fortsetzen.
II
Esme wusste nicht, wie sie sich ein Kloster genau vorgestellt hatte. Trotzdem, oder auch deshalb, hatte sie bewusst darauf verzichtet, sich Fotos vom St. Johannes Kloster im Internet anzuschauen. Die Bilder, die ihr durch den Kopf gingen, waren immer düster. Von schweren Gewitterwolken oder einer mondbeschienen Nacht. Düster war auch das Gebäude selbst in ihren Vorstellungen. Aus schwerem, klobigem Stein gebaut, dunklem Stein selbstverständlich, inmitten eines undurchdringlichen Waldes. Wenigstens den gab es, wenn auch in angemessener Entfernung, registrierte sie, als das Taxi mit elegantem Schwung vor dem Eingangsportal des weiß getünchten, hufeisenförmigen Baus hielt, dass der sorgfältig geharkte Kies aufspritzte. Das schlichte Gebäude mit einem Quadrat unter einem roten Spitzdach an der Stirnseite und zwei Rechtecken an jeweils einer Seite bot kaum etwas, woran sich das Auge festhalten konnte. Als Esme ausstieg und ihr Gepäck aus dem Kofferraum wuchtete, den der Fahrer von innen öffnete und gleich wieder schloss, ließ sie ihren Blick über den Parkplatz streifen, auf dem ein knappes Dutzend Autos standen, allesamt SUVs. Sie verloren sich auf dem gepflasterten Platz, waren aber doch, nach Esmes Empfinden, noch immer zu viele.
Esme stieß die in Indigoblau gestrichene Holztür auf und trug ihren Koffer über den frisch gebohnerten Parkettboden dahinter. Sie wagte es nicht, ihn hinter sich herzuziehen. Nicht auszudenken, wenn die zwei Rollen schwarze Schlieren auf dem Holz hinterlassen würden. Außerdem schreckte sie vor dem Lärm zurück, der dadurch entstanden wäre. Nachdem die Tür hinter ihr krachend ins Schloss gefallen war – zu schnell, als dass Esme eine Chance gehabt hätte, sie selbst zu schließen, und zwar leise – drang kein Laut in den Eingangsbereich mit seinen schmucklosen, verputzten Wänden. Vielleicht diente er der ersten Kontemplation, dachte Esme, verwarf den Gedanken aber sofort wieder, als sie nach wenigen Minuten eine zweite Holztür öffnete, die sie weiter ins Innere des Hauses führte. Und das hatte weniger etwas gemein mit der inneren Einkehr, die man in einem sakralen Raum empfindet, als mit dem geschäftigen Treiben einer Hotellobby.
Auch einen Empfangstresen gab es hier, über dem ein metallenes Schild mit der Aufschrift »Rezeption« an zwei Messingketten von der Decke baumelte. Und es war kein Mönch in braunem Habit, der dahinter stand und die Gäste begrüßte, sondern ein Mann in den Zwanzigern, in dunkelblauer Livree, die Haare oberhalb der Ohren abrasiert, das kurze Deckhaar mit Gel zu einer orangefarbenen Bürste aufgestellt. Esmes aufkeimende Enttäuschung wurde rasch von der Erleichterung darüber verdrängt, dass die sechs Leute, die vor ihr an der Rezeption standen, allesamt auschecken und abreisen wollten, auch wenn sich das bei dem letzten Gast in die Länge zog. Kurz hörte Esme ihn von zu kaltem Duschwasser, lichtdurchlässigen Vorhängen und zu hellen Sternen, die die Nachtruhe empfindlich störten, gluckernden Abflüssen im Nebenzimmer und Vogellärm vor den Fenstern reden.
Dann gelang es ihr, die Stimme auszublenden und sich auf ein in dunklen Farben gehaltenes Ölgemälde rechts vom Empfangstresen zu konzentrieren, das Porträt eines Mannes im seitlichen Profil. Obwohl der schmallippige Mund an den Seiten leicht nach oben gezogen war, wollte der Mann nicht so recht freundlich wirken. Woran lag das? An dem stark ausgeprägten Kinn, der schmalen Raubvogelnase, den hohen Wangenknochen, die zwei tiefe Furchen ins Gesicht des bartlosen Mannes gemeißelt hatten?
»Und womit kann ich Ihnen helfen, Frau …? … Hallo?« Esme zuckte zusammen. So tief war sie in den Anblick des düsteren Porträts versunken gewesen, dass sie nicht bemerkt hatte, längst an der Reihe zu sein. »Entschuldigen Sie«, sagte sie und bemühte sich um ein Lächeln. »Esme Lang. Ist das der Namensgeber?« Sie wies mit dem Kopf zum Bild. »Von was?« »Na, vom Kloster.« Die Schultern in der dunkelblauen Livree wurden nach oben gezogen und gleich wieder fallen gelassen. »Ich weiß nicht, was Sie meinen.« »Vom Sankt Johannes Kloster«, half Esme nach. »Äh, ja, vermutlich. Das müsste der heilige Johannes sein.« »Und welcher Johannes? Von denen gibt es in Ihrer Kirche ja viele.« »Also, ehrlich gesagt ist das nicht meine …« »Das ist Johannes, oder auch Johann, Geiler von Kaysersberg«, beendete eine Baritonstimme in ihrem Rücken den abstrusen Dialog.
Esme drehte sich um. Ein großer, schlanker Mann in weißer Hose und weißem T-Shirt blickte von einem Stapel Papieren auf, den er in einer Hand trug und mit der anderen durchblätterte. Er hatte feine, ja, asketische Gesichtszüge, die streng gewirkt hätten, wären da nicht die dunkelgrauen Augen gewesen. Von dichten Wimpern umkränzt, unter dem feinen Bogen der Augenbrauen, die von einem tiefen Schwarz waren, wie es vermutlich einst auch die kurzgeschnittenen Haare gewesen waren, durch die sich nun ein paar graue Strähnen zogen. An der rechten Seite gleich oberhalb der Stirn war ein Wirbel, der einen Scheitel andeutete und zugleich die Haare an der Stelle hochstehen ließ. Hielte der Mann nicht die Papiere, hätte Esme vermutet, er käme direkt vom Tennisplatz. Seine Gesichtshaut hatte einen Bronzeton, der auf einen häufigen Aufenthalt im Freien schließen ließ. Aber er schien hier zu arbeiten, trug jedoch keinen Habit.
Esme versuchte, einen verstohlenen Blick auf seinen Hinterkopf zu werfen. War da eine Tonsur? Der Blick war nicht verstohlen genug, da der Mann das Rätsel um seine Identität nun selbst löste. »Bruder Antonius«, stellte er sich vor, »zuständig für alles Medizinische.« Ein Satz, den er wohl ausschließlich Gästen gegenüber sagte, vermutete Esme. Einfach gehalten, frei von klösterlichem Vokabular. Noch ehe sie dazu kam, sich selbst vorzustellen, war Bruder Antonius hinter den Empfangstresen gegangen, wo er seinen Papierstapel ablegte und einen dicken Aktenordner durchschaute, der in einem offenen Schrank an der Wand lag. Dabei wandte er ihr den Rücken zu, und Esme konnte erkennen, dass keine Tonsur in seinen Haarschopf rasiert war. Dafür schienen die grauen Strähnen in seinem Haar auf einmal zu leuchten, so dass Esme unwillkürlich nach oben schaute und nach einer Lichtquelle an der Decke spähte, jedoch nichts entdeckte.
»Haben Sie sich bereits unser Programm angeschaut?«, meldete sich der Rezeptionist wieder zu Wort und fuhr, ohne eine Antwort abzuwarten, fort: »Weil die Hauptsaison bereits vorbei ist, ist es nicht mehr ganz so umfangreich, bietet aber doch noch so viel, dass dass Sie sich in den kommenden sechs Monaten, die Sie bei uns sind, nicht langweilen müssen.« »Da sehe ich keine Gefahr.« »Müssen Sie auch nicht. Unser Yoga- und Meditationslehrer ist das ganze Jahr über hier. Die Töpferkurse finden ebenfalls weiter statt. Zwar nicht hier im Kloster, aber unten im Dorf, nur fünf Kilometer entfernt, das …« »Nein, nein«, unterbrach Esme den Redefluss. »Ich möchte nichts von alledem. Ich möchte einfach … Ruhe. Schön wäre allein, wenn ich hin und wieder die Klosterbibliothek benutzen könnte, um …« »Bedaure«, unterbrach der Rezeptionist nun seinerseits ihren Redefluss, »die ist allein den Brüdern vorbehalten. Aber es gibt einen Leseraum für unsere Gäste. Mit aktuellen Zeitschriften, der Tagespresse, allerlei leichter Lektüre und …«
»Okay, schon gut«, bedauerte Esme ihre Frage, unterschrieb rasch das Anmeldeformular, das schon auf dem Tresen bereitlag, und griff nach dem Zimmerschlüssel gleich daneben. In den Messinganhänger, an dem er hing, war eine Neun eingestanzt. Das Gästehaus und alles andere, was sie benötigte, würde sie schon ohne Hilfe finden. Für den Moment wollte sie einfach nur eines: So schnell wie möglich diese Hotellobby verlassen. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie zuletzt so lange mit jemandem gesprochen hatte, der ihr gegenüberstand. Am Telefon, ja, mit ihrem Lektor Sven, der fragte, an welcher ihrer Serien sie gerade schrieb. Ob sie eine neue anfangen wollte, einen Krimi vielleicht. Diese Fragen am Telefon zu beantworten, war anstrengend genug. Aber den Gesprächspartner vor Augen zu haben, seinen Blicken ausgesetzt zu sein, nein, das war etwas anderes.
Das Gästehaus befand sich hinter dem linken Flügel, durch eine metallene Pforte mit diesem verbunden. Und bestens ausgeschildert. Es war definitiv jüngeren Datums als das Hauptgebäude und besaß den Charme einer Jugendherberge, wie Esme sie aus ihrer Schulzeit kannte. Oder doch eher eines Krankenhauses? Eines Sanatoriums? Esme versuchte, sich von der bedrückenden Stimmung abzuschirmen, die sie befiel, als sie den langgestreckten Gang betrat, von dem die Zimmer der Gäste abgingen. Wieder trug sie ihren Koffer. Wieder hatte sie Angst, die Rollen könnten schwarze Schlieren auf dem Boden hinterlassen, hier hellgrauer Linoleumboden. Zu den verblichenen Kunstdrucken an den weiß getünchten Wänden sah sie nicht auf, bemerkte nur van Goghs Sonnenblumen in rotem Rahmen gleich neben ihrer Zimmertür mit der Nummer neun.
Rasch schloss Esme auf, ging in den Raum, der in den kommenden Monaten ihr Zuhause sein sollte. Sie lehnte sich mit dem Rücken gegen die Tür, die leise ins Schloss schnappte, stellte ihren Koffer ab und sah sich um. Rund fünfzehn Quadratmeter maß der Raum, von dem ihr eigenes kleines Bad mit Toilette, Waschbecken und Dusche abging. Der Boden war mit einem azurblauen Teppich belegt, der etwas zu groß für das Zimmer war und sich an den Längsseiten jeweils ein paar Zentimeter die rauchgrau gestrichenen Wände hochschob. Das Mobiliar bestand aus einem Tisch mit Stuhl, einem Kleiderschrank, einem Bett und einem Korbstuhl mit dazu passendem Tischchen, auf dem eine gläserne Obstschale mit fünf rotwangigen Äpfeln stand.
Esme nahm es zur Kenntnis. Allein der Tisch aus glänzend rotbraunem Holz, der unter dem großen, dem einzigen Fenster stand, ließ sie ihre Mundwinkel leicht nach oben verziehen. Ja, das war der perfekte Arbeitsplatz. Noch in ihrer Jacke, zog sie den Stuhl, der aus dem gleichen Holz gefertigt war wie der Tisch, hervor, setzte sich, die Ellenbogen auf die Tischkante gestützt, und schaute hinaus. Hinaus auf den Kräutergarten des Klosters. Eingezäunt war er mit ineinander verflochtenen Haselnussruten, die den Wald zurückzudrängen versuchten, der bereits mit einzelnen Ästen und Zweigen nach den Kräutern griff, die ein Mönch in braunem Habit gerade wässerte. Esme hielt es nicht länger in ihrem Zimmer. Sie musste hinaus. Das Klostergelände mit all seinen Menschen und Eingrenzungen verlassen und hinein in den Wald gehen. Sich ein geschütztes Fleckchen suchen, wo sie sich hinlegen und das Blätterwerk und die Wolken beobachten konnte, die ihr vielleicht wie früher ihre Geschichten anvertrauten, damit sie sie aufschrieb.
Ein guter Plan, dessen Umsetzung zunächst ernüchternd war. Was sich vom Fenster aus als Wildnis dargeboten hatte, entpuppte sich von Nahem als von Menschenhand gebändigt. Den mit Haselnussruten eingezäunten Kräutergarten, den sie von ihrem Fenster aus gesehen hatte, konnte sie nicht betreten. Wahrscheinlich taten die Mönche dies durch eine geheime Tür oder einen unterirdischen Gang. Aber egal, sie wollte sowieso in den Wald. Wie spät mochte es sein? Später Nachmittag? Sie hatte nicht daran gedacht, auf die Uhr zu schauen. Aber es sah nicht so aus, als würde es bald dunkel werden. Der schwache Sonnenstrahl, der sich hinter Goslar durch die Wolkendecke geschoben und sie bis an ihr Ziel begleitet hatte, war zwar nicht stärker geworden, machte aber Mut für einen längeren Spaziergang Richtung Wald. Der war, wie sie jetzt sah, zumindest für die Gäste durch eine hohe Mauer vom Klostergebäude getrennt. Allein zwei schmiedeeiserne Pforten entließen jene, die sich im Wald ein wenig die Beine vertreten wollten, auf einen gepflasterten Weg, der nach ein paar hundert Metern in einen geteerten Pfad überging. Die Bäume und Sträucher erschienen von dort weit weg. Waren zurückgedrängt worden, waren zurückgewichen. Kein Tier war zu sehen oder zu hören. Kein Vogel hüpfte auf einem Zweig, kein Eichhörnchen huschte einen Stamm hoch, nichts raschelte im Unterholz, das hier zudem sehr licht war.
Esme seufzte und musste an eine Busfahrt in die Nähe von Aurich denken, die sie vor ein paar Wochen in der Hoffnung unternommen hatte, sich dort für eine Geschichte inspirieren zu lassen. Ein Kloster sollte es dort einst gegeben haben, das zum Teil rekonstruiert worden war. Mit Stahl und Efeu bewachsenen Metallwänden auf rotem Kies. Der Wald, immerhin gab es ihn noch, wirkte aufgeräumt. Keine vom Sturm gefällten Stämme oder abgerissenen Äste lagen herum. Die Bäume – gleich sahen sie aus, wie gezüchtet und mit dem Lineal gepflanzt – standen ordentlich und brav wie Soldaten in Reih und Glied. In der Hoffnung, dass sich dieses Bild vielleicht verändern würde, war Esme weitergegangen … und rasch an einer Straße gelandet.
Aber nein, hier musste es anders sein. Es musste einfach, sagte sie sich und ging weiter. Da, eine Biegung, dahinter musste doch … nein, der geteerte Weg setzte sich fort, bröckelte an den Rändern nur hier und da ab, war manchmal zur Mitte hin aufgerissen, wenn eine Wurzel die Oberfläche gesprengt hatte. Für Esme war das eine Spur, die sie gierig aufnahm. Sie beschleunigte ihren Schritt, zog bald ihre Jacke aus, die sie sich über die rechte Schulter warf. Die Äste und Zweige der Bäume tasteten sich derweil heran, hießen sie zaghaft willkommen. Auch jetzt noch, Mitte Oktober, waren sie dicht belaubt, nur die Blattränder manchmal leicht gekräuselt und gelbbraun verfärbt. Esme vermutete, dass der Sommer hier im Harz genauso verregnet gewesen war wie in Oldenburg, was das Laub nun im Herbst länger an den Bäumen hielt. Ganz unterschiedliche Bäume waren es. Eschen, Eichen, Kastanien, die ihre Früchte provozierend auf den geteerten Weg geworfen hatten. Als wollten sie sagen: Seht her, nicht mehr lange und wir haben unser Terrain zurückerobert.
Und dann hatte sie sie endlich erreicht. Die Stelle, an der die meisten in ihrer Pause zwischen Mahlzeit und Kursbeginn spätestens wieder umkehrten. Die Stelle, die Esme lockte, sie rief, sie zog. Die Stelle, vor der Bagger und Motorsäge Halt gemacht hatten. Ein geradliniger Weg war hier nicht mehr zu erkennen. Aber die uralten, knorrigen Bäume ließen zwischen sich gnädig demjenigen Platz, der über ihre moosbewachsenen Wurzeln stieg, die aus der Erde ragten und sie wie einen schützenden Wall umgaben. Sie und ihre Kinder. Setzlinge, die die Hülle der abgeworfenen Früchte des vergangenen Jahres gesprengt hatten. Rasch und ehrgeizig wuchsen sie. Keine Zeit verlierend, um etwas von dem wenigen Licht zu erhaschen, das die ineinander verflochtenen Baumkronen zu ihnen durchließen.
Esme blieb stehen und schloss die Augen. Nach wie vor war es still. Aber es war eine andere Stille als noch vor wenigen Minuten in der gezähmten Natur. War die erste dünn und leblos gewesen wie ein Tuch, das man hatte fallen lassen, war diese hier fühlbar und verheißungsvoll. War samtig, weich, umfloss sie in sanften, unsichtbaren Schleiern. Lächelnd öffnete Esme die Augen, tastete sich vorsichtig an den Bäumen entlang. Nicht aus Angst zu stolpern oder auszugleiten, sondern weil sie befürchtete, etwas zu zertreten, zu zerstören.
Die Moose waren wunderschön und von unterschiedlicher Art, sah man genauer hin. Mal gleichmäßig wie ein Kissen geformt, dann wieder mit einzelnen Stängeln, die sich über das kleinwüchsige, gekräuselte Grün erhoben, vereinzelt sogar mit winzigen violett- oder gelbfarbenen Blüten. Sie musste sich ein Bestimmungsbuch besorgen, dachte Esme, um alles benennen zu können. Die Moose, die Sträucher, die Bäume, die Pilze, die vereinzelt an den Stämmen oder zwischen den Wurzeln wuchsen. Es war so viel mehr, als der Garten hinter dem Reihenhaus in Oldenburg beherbergte. Ein großes Unterfangen, war sie sich bewusst, mit dem allein sie sich in den kommenden sechs Monaten gut beschäftigen könnte. Aber nein, sie wollte ja keine Botanikerin werden. Aber es zeugte von Respekt, etwas mehr über die Wesen des Waldes zu lernen, die ihr ihre Geschichten erzählen sollten. »Die Wesen des Waldes«, wiederholte Esme laut, als wollte sie diese direkt ansprechen und in ihre Gedanken einbeziehen. Sie lächelte. »Nun, wir werden sehen, wer oder was mir hier tatsächlich begegnet oder meiner Fantasie entspringt.« Was am Ende aufs Gleiche hinauslief, vielleicht auch dem Gleichen entsprang.
Immer weiter ging sie, bis sie sich vom Wald vollkommen eingehüllt fühlte, seine Kasteiungen in Form von Wegen und abgesägtem Holz auch nicht mehr sah, wenn sie sich umblickte. »Buchen sollst du suchen, vor Eichen sollst du weichen«, fiel ihr ein alter Spruch ein, den man ihr als Kind eingeprägt hatte, wenn sie bei Gewitter draußen spielte. Es musste ihre Mutter gewesen sein, die diese Weisheit ihrerseits von ihrer Mutter übernommen haben musste. Eine Weisheit, die auf den Shetlands lächerlich war, wo der Wind den Bäumen – egal ob Buche oder Eiche – kaum eine Chance ließ, so hoch und so breit zu wachsen, als dass der Blitz in sie fahren könnte.
Und jetzt war es eine Eiche, die ihre Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Alt musste sie sein, mehrere Menschenleben. Ihr Stamm ließ sich nicht einmal ansatzweise mit beiden Armen umfassen, und ihre Krone ragte weit über die der anderen Bäume hinaus. Doch nicht nur das. Die Krone war so weit und so dicht, dass sie Esme wie die Kuppel einer Kathedrale erschien. Sie legte ihre Handflächen auf die rissige, graubraune Rinde und glaubte, ein Pochen zu spüren. Wahrscheinlich das ihres eigenen Pulsschlags. Vielleicht aber war da mehr, was sie spürte. Die Lebenskraft des Baumes. Seine Wurzeln hatten sich weit aus dem Erdreich erhoben, bildeten Hügel und Täler, die mit Moosen bewachsen waren, einladend wirkten.
Esme ließ sich auf die Knie nieder, schmiegte sich erst seitlich in eine Mulde, die sie beschützend empfing, lehnte sich dann mit dem Rücken dagegen, wie auf einem Sofa, und zog schließlich das kleine, in dunkelgraues Leinen gebundene Notizbuch und den Bleistift heraus, die sie immer in der rechten Innentasche ihrer Jacke bei sich trug. Aber sie streifte nicht das schwarze Gummiband ab, das die Seiten zusammenhielt. Nicht, dass ihr nichts eingefallen wäre, was sie hätte aufschreiben können. Nein, es ging um den Schritt davor. Sie spürte ihn einfach nicht. Diesen Drang, ihre Gedanken in Worte, in Buchstaben zu übertragen. Auch keine Enttäuschung darüber, dass die Seiten leer bleiben sollten.
Sie war ganz ruhig. Nur müde wurde sie jetzt. Ihr Kopf, sie hatte ihn längst an die rissige Borke gelehnt. Die Augen fielen von alleine zu. Sie wehrte sich nicht dagegen, vom Schlaf fortgetragen zu werden. Im Gegenteil. Das Moos, auf dem sie lag, wurde weicher und weicher. Nachgiebig. So nachgiebig, dass ihr Körper eine Kuhle hineindrückte, die tiefer und tiefer wurde, endlich riss. Esme fiel und ließ es geschehen. Sie versuchte nicht, sich irgendwo festzuklammern, den Fall aufzuhalten, wenigstens abzuschwächen, sich wieder nach oben zu ziehen. Dabei hätten die armdicken Wurzelenden, die weißlich schimmernd aus dem Tunnel ragten, durch den sie senkrecht nach unten raste, ihr durchaus Halt geben können. Aber Esme überließ sich der Schwerkraft, ließ sich fallen, verspürte keine Angst dabei, nein, nur eine große Neugierde darauf, wann der Tunnel enden würde und wohin er sie bringen würde
Und der Fall war angenehm. Nirgends stieß sie an, die Geschwindigkeit war nicht so hoch, dass ihr übel wurde oder dass sie Ohrensausen bekam. Nein, da war kein Druck, kein Pfeifen auf ihren Ohren, nur ein Rauschen, ein gleichmäßiges Rauschen, das allmählich lauter wurde, aber nicht dröhnte, nicht unangenehm war. Ein Rauschen, das von außen kam. Von Wellen, die im sanften Rhythmus am Strand ausliefen. Und, ja, diesen Rhythmus hörte sie nicht nur, sie spürte ihn auch, war allerdings nicht im Wasser, ihre Kleider waren trocken, sondern wurde in einem kleinen Boot auf ihnen gewiegt. Auf und ab, auf und ab. Die Bewegungen waren nicht wild. Und selbst wenn, herausfallen würde sie nicht. Etwas hielt sie, gab ihr Sicherheit, war an ihrer Seite. Sie konnte es nicht sehen, aber hören. Eine Stimme, auch wenn sie nicht verstand, was sie sprach. Tief war sie, aber mehr Bariton als Bass, samtig, manchmal mit einem leichten Kratzen, das sich durch die Poren ihrer Haut einen Weg ins Innere bahnte, es zum Vibrieren brachte, stärker und stärker, bis sie doch die Augen aufschlug, dieses dunkle Grau sturmgepeitschter Wellen sah, die näherkamen, über ihr zusammenschlugen, aber sie dann doch beharrlich an die Oberfläche zogen.
»Esme, Frau Lang, wachen Sie auf. Fehlt Ihnen etwas?«, verstand sie die ersten Worte, ohne sie einordnen zu können, bis sich das dunkle Grau entfernte, Form annahm, zu zwei Augen wurde, beschattet von dichten Wimpern, sie ansahen. Besorgt, forschend, amüsiert. Von allem etwas und alles zugleich. Esme setzte sich auf. »Alles gut, danke der Nachfrage«, antwortete sie, wieder ganz im Hier und Jetzt. »Ich bin einfach ein wenig weggenickt, Bruder Antonius«, erinnerte sie sich an den Namen des Mönchs, dem sie in der Empfangshalle, an der Rezeption begegnet war, »zuständig für alles Medizinische«. Jetzt, in seinem Habit aus grobem, dunkelbraunem Stoff, sah er tatsächlich aus wie ein Mönch. »Dann bin ich beruhigt«, sagte er nun, richtete sich aus seiner knienden Stellung auf und reichte dann Esme die Hand, um ihr aufzuhelfen.
»Wie galant«, kommentierte sie. »Nun, auch das kann ein Mönch durchaus sein.« »Ist es Ihre Aufgabe, vor Einbruch der Dunkelheit vermisste Gäste einzusammeln?« Der Mönch lachte. Auch das war offenbar erlaubt. »Nein, nein«, sagte er, »für diesen Posten besteht kein Bedarf. Bisher jedenfalls«, fügte er hinzu. »Aber im Ernst. In diesen Teil des Waldes verirrt sich sonst auch kaum jemand. Als ich Sie da liegen sah, fürchtete ich, Sie seien gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Und nachts kann es bereits recht kalt werden.« »Danke, dass Sie sich davon überzeugt haben, dass ich wohlauf bin«, sagte Esme und hätte danach gehen können. Aber etwas lag ihr noch auf der Zunge, auch wenn sich der Mönch dafür vielleicht gar nicht interessierte. »Ich habe mich übrigens nicht hierher verirrt, sondern war – im Gegenteil – froh, als ich diesen Teil des Waldes fand. Ohne geteerte oder gepflasterte Wege, ohne zurückgedrängte Bäume.«
Bruder Antonius sah sie an, sagte aber nichts. Seine Gesichtszüge verrieten nicht, was er dachte. »Nun«, fuhr Esme fort, griff nach ihrer Jacke und wollte nun tatsächlich gehen. Sie hatte sich bereits umgedreht, als der Mönch sie zurückrief. »Moment, Sie haben etwas vergessen.« Sie wandte den Kopf und sah, dass er ihr Notizbuch in der Hand hielt. »Danke«, sagte sie, als sie es entgegennahm. »Dann muss ich heute Nacht nicht wiederkommen, um es mit der Taschenlampe zu suchen.« »Nachts ist es hier besonders schön«, erwiderte der Mönch. »In den Ästen der Eiche etwa, unter der Sie geschlafen haben, hat eine Eule ihr Nest, eine Waldohreule. Die finden Sie eher am Waldrand. Na, Sie werden in den kommenden Monaten noch genug Gelegenheit haben, die Bewohner der Waldes kennenzulernen und über sie zu schreiben. Und wer weiß – vielleicht ergibt sich auch eine weitere Folge für die Wiedergänger-Reihe.« Und bevor Esme ein »Ach nee« oder etwas ähnlich Geistloses ausstoßen konnte, hatte Bruder Antonius sich umgedreht, die Kapuze seines Habits über den Kopf gezogen und war rasch zwischen den Bäumen verschwunden.
Die Wiedergänger-Reihe. Esme lächelte und blickte dabei noch immer auf die Stelle, wo sie Bruder Antonius zuletzt gesehen hatte, bevor er zwischen den Bäumen verschwand. Wie ein Gespenst. Dass ausgerechnet ein katholischer Mönch sie auf die Wiedergänger-Reihe ansprach, setzte sie ihre Gedanken fort, als sie sich auf den Rückweg machte. Ohne dabei ein Kreuzzeichen zu schlagen. Erstaunlich genug, dass er sie überhaupt kannte. Den ersten Band dieser Reihe hatte sie geschrieben, als sie noch in Hannover gewohnt und in Hildesheim studiert hatte. Oft, wenn sie genug Zeit hatte, war sie vom Hildesheimer Bahnhof durch die Fußgängerzone zur Schuhstraße gelaufen, um von dort den Bus zur Marienburger Höhe zu nehmen, wo die grauen Betonblöcke der Universität aufragten. Dabei war sie auch stets an der Skulptur vorbeigekommen, dem Huckup, der einem jungen Mann im Nacken saß, weil der gerade Äpfel geklaut hatte.
Doch einen Huckup gab es nicht nur in der Hildesheimer Sagenwelt. Und längst nicht immer sprang er nur den Schlitzohren auf den Buckel, um sich von ihnen tragen zu lassen, bis sie erschöpft, manchmal auch tot zusammenbrachen, fand Esme heraus, als sie mehr darüber las. Und nicht mehr aufhören konnte. Sich mehr und mehr Literatur besorgte. Über Untote, über Wiedergänger, denen die Huckups zugeordnet wurden. Unerlöste Seelen, die nicht zur Ruhe kamen. Weil sie zu Lebzeiten nicht geschafft hatten, was sie hatten schaffen wollen. Weil sie sich rächen wollten. An ihren Mördern oder an denen, die ihnen Unrecht angetan hatten. Auch weil sie zu sehr betrauert wurden. Zu sehr geliebt worden waren und dieses Band auch nicht vom Tod durchschnitten werden konnte.
Zu sehr geliebt. Kann man zu sehr lieben? Haftet nicht jeder tiefen, aufrichtigen Liebe ein »zu sehr« an, das die Weigerung umschließt zu akzeptieren, dass der Tod das Ende ist? Dass der gemeinsame Weg endet? An diesen Fragen blieb Esme hängen. Sie selbst hatte noch nie so sehr geliebt, jedenfalls noch nicht in der Welt außerhalb ihrer Bücher, als dass sie sie selbst hätte beantworten können. Vielleicht bildeten sie deshalb den Boden, aus dem die ersten zarten Gedankenpflänzlein für die Wiedergänger-Reihe gesprossen waren. Mit Horror, Angst und Schrecken hatte das Ganze nichts zu tun. Nein, damit verband Esme die Welt der Toten nicht. Diese Verbindung war wohl erst mit dem Christentum in die Welt gekommen, das die Welt der Lebenden von der Welt der Toten getrennt haben wollte.