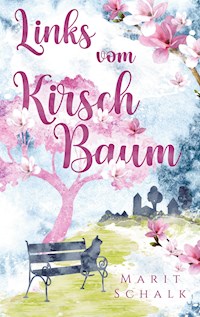
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mokita Ein Mokita ist eine Wahrheit, die jeder kennt, aber keiner ausspricht. Ellis erbt das Haus ihrer Oma mit dem alten Kirschbaum im Garten und kehrt in das kleine Dorf im Westerwald zurück, in dem sie aufgewachsen ist, nicht ahnend, dass dies ihr bisheriges Leben gehörig auf den Kopf stellen wird: Alte Fotos enthüllen ein lang gehütetes Familiengeheimnis und bringen nach und nach sicher geglaubte Tatsachen ins Wanken. Begegnungen mit Nachbar Alfons lassen weitere vermeintliche Gewissheiten bröckeln. Und dann ist da auf der anderen Seite des Kirschbaums auch noch ihr ehemaliger Schulfreund Carsten. Seine Anwesenheit verwirrt Ellis zusätzlich und lässt sie am Ende erkennen, dass es manchmal eine entscheidende Rolle spielt, von welcher Seite des Kirschbaums man die Welt betrachtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über die Autorin
Marit Schalk ist in Altenkirchen im Westerwald geboren und wuchs im schönen Siegtal auf. Schon als Kind hat sie sich langweilige Schulstunden oder Wartezeiten mit Tagträumen vertrieben und diese anschließend aufgeschrieben. Nach dem Studium der Germanistik und Pädagogik an der Universität Koblenz und zwei weiteren Ausbildungsjahren in Simmern/Hunsrück, kehrte sie in den Westerwald zurück, wo sie seither mit ihrem Mann, zwei
Töchtern und ihrem schwarzen Kater lebt.
2017 und 2018 erschien ihr Debüt „Außerhalb der Zeit“, eine romantische Zeitreisegeschichte in zwei Bänden. Mit „Links vom
Kirschbaum“ liegt nun ihr dritter Roman vor.
Instagram: https://www.instagram.com/maritschalk
Facebook: https://www.facebook.com/FederundTinte
Website: https://marit-schalk.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Katz und Maus
Stillleben mit Brille
Zwischen gestern und morgen
Blaue Giraffe
River Deep Mountain High
Eine Überraschung
Das letzte Abendmahl
Kein Weihnachten
Rote Schleife auf Flanell
Ungleiche Brüder
Alter Mann mit Katzen
Die richtigen Fragen
Allerhand Gedanken
Fundsachen
Ultramarinblau
Umbaupläne
Fünf schlichte Worte
Wut
Nach Hause
Mädelsabend
Zwei Seiten
Freundliche Schubser
Tohuwabohu
Merkwürdigkeiten
Killing Alice
Eine erstaunliche Entdeckung
Lebenslügen
Fontäne in Grau
Kollision
Shoppen in Erzert
Seniorenausflug
Göttliche Statik
Streit und Versöhnung
Gespräche mit und ohne Brille
Der Versuch einer Entschuldigung
Videoassistenz
My Fair Lady
Nachbarschaftliche Beziehungen
Feuerwehrfest
Nachwehen
Aussprache
Alles auf Frühling
Epilog
Prolog
„Mokita. Diesen Begriff habe ich vor Jahren von einem Studenten gelernt, der aus Papua-Neuguinea stammte. Der junge Mann erklärte mir damals, dass man darunter eine Wahrheit versteht, die jeder kennt, aber keiner ausspricht. Obwohl es kaum einen Ort auf der Welt gibt, der weiter von Papua-Neuguinea entfernt liegen könnte als das kleine Dorf im Westerwald, in dem ich aufgewachsen bin, wusste ich sofort, was die Leute auf jener fernen Insel mit ‚Mokita’ meinen. Es scheint sich dabei um ein weltweit auftretendes Phänomen zu handeln, das überall dort zu finden ist, wo Menschen in Gemeinschaften zusammenleben.
Unsere Sprache kennt dafür den Begriff ‚Offenes Geheimnis’. Wobei Geheimnisse nicht gleich etwas Schlechtes bedeuten müssen. Hingegen sollen Mokitas dazu neigen, bevorzugt unbequem zu sein. Es sind jene Wahrheiten, die einen bis ins Innerste treffen, sofern man sie ans Tageslicht brächte. Viel mehr als beim offenen Geheimnis ist das Aussprechen daher mit einem Tabu behaftet.
Leider gibt es auch falsche Mokitas, das sind die Schlimmsten. Sie geben bloß sehr erfolgreich vor, eine Wahrheit zu enthalten, und sind wegen des Tabus nur schwer zu entlarven, können aber gerade deswegen üblen Schaden anrichten.
Mokitas sind in etwa so häufig wie Streublumen auf einem romantischen Blusenstoff und kommen umso mehr vor, je kleiner eine Gruppe ist. Unter einer Stadtbevölkerung als Gesamtheit dürfte es nur wenige davon geben, denn mit der Größe der Gruppe steigt unweigerlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwer am Ende doch verplappert und die Wahrheit ausplaudert – und sei es in Gestalt eines geschwätzigen Touristenführers, der nicht davor zurückschreckt, Fremden auch die hässlichen Orte der Stadt zu zeigen. Innerhalb kleinerer Dorfgemeinschaften erhöhen sich die Chancen, auf ein Mokita zu stoßen. Und dort wo es zweifellos die meisten davon gibt: in Familien und bei Paaren.
Kann auch eine einzelne Person über ein Mokita verfügen? Ich denke, ja. Für diesen Fall kennt unsere Sprache noch ein eigenes Wort: Lebenslüge.
Wer sich daran macht, sich selbst zu verändern, sollte fest damit rechnen, unterwegs auf Mokitas zu stoßen; nicht nur auf die eigenen, sondern manchmal auch auf die von anderen. Dann ist es wichtig, mutig zu sein und den Mokitas die Stirn zu bieten, denn nur wer Lügen aufdeckt, hat eine Chance seinen Weg zu finden.“
Ich setze den Stift ab und blicke durchs Fenster hinaus in den Garten, wo sich die Äste des Kirschbaums jetzt schon unter der Last der Früchte biegen, auch wenn die Kirschen noch längst nicht geerntet werden können. In einer Schale vor mir habe ich lediglich eine Handvoll aus dem Baum herausgepickt, die man mit etwas gutem Willen als verzehrreif bezeichnen könnte. Das war gewiss voreilig, aber ich konnte nicht widerstehen.
Wir werden in diesem Sommer ein außergewöhnlich gutes Kirschenjahr haben, denke ich. Das ist im Westerwald nicht immer selbstverständlich, ist unser Klima hier doch bisweilen rau. Es kommt vor, dass wir manchmal mehrere Jahre in Folge nicht eine einzige der süßen Früchte ernten können, umso größer ist die Freude, wenn es dann mal der Fall ist.
Schnell überschlage ich, ob im Keller wohl noch genügend leere Einmachgläser vorhanden sind, um so viel wie möglich von den süßen Köstlichkeiten für die kirschenarmen Jahre zu konservieren. Dass es wichtig ist, Gutes aufzubewahren, damit man in schlechten Zeiten davon zehren kann, habe ich von meiner Oma gelernt, die eine wahre Meisterin im Einkochen gewesen ist. Und auch wenn ich rückblickend vieles was sie mich gelehrt hat, aus einem anderen Blickwinkel betrachte, will ich mich an diesen Ratschlag doch gerne halten. Meine Rechnung hinsichtlich der Einmachgläser fällt positiv aus und ich nicke zufrieden. Dann wende ich mich wieder meinem Notizbuch zu und lese mir durch, was ich bisher aufgeschrieben habe.
Es ist die Zusammenfassung meiner, teils auf schmerzhafte Weise, gewonnenen Erkenntnisse der letzten Monate. Aber es ist ein durchaus positives Resümee, denn sein Inhalt verhält sich nahezu proportional zur Anzahl der Kirschen an diesem Baum.
1
Katz und Maus
Neun Monate zuvor.
„Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.“
Sebastians kräftige Tenorstimme wetteifert mit dem hellen Sopran der Sängerin aus den Lautsprechern des Armaturenbretts und übertönt diese mühelos. Was zum Glück aber gut auszuhalten ist, da er eine durchaus angenehme Stimme hat und auch meist die Töne trifft. Noch im Parkhaus hat er den Soundtrack von „My Fair Lady“ gestartet und singt seither äußerst textsicher einen Song nach dem anderen mit.
Ich kann nicht mehr genau sagen, wie oft wir das Musical inzwischen schon gesehen haben. Es ist Sebastians absolutes Lieblingsstück. Wenn es sich irgendwie einrichten lässt, schleppt er mich zu jeder Aufführung im Umkreis von zweihundert Kilometern mit.
Heute bin ich allerdings diejenige, die die Eintrittskarten besorgt hat. Ich habe sie ihm zu seinem fünfunddreißigsten Geburtstag geschenkt, und offenbar habe ich damit einen Volltreffer gelandet. Ich gönne mir ein Lächeln, denn es gelingt mir nicht allzu oft, seinen Erwartungen gerecht zu werden. Entsprechend entspannt lasse ich mich in den Beifahrersitz zurückfallen und lausche seinem nach wie vor volltönenden Gesang.
Inzwischen haben wir die Kölner Innenstadt hinter uns gelassen und erreichen die Vororte. Die Lampen am Straßenrand tauchen den Wagen in gleichmäßigem Rhythmus abwechselnd immer wieder in Schatten und Licht. Mein Blick fällt auf Sebastian, dessen Gesicht hinter der modischen Hornbrille aufgrund der Beleuchtung ungewöhnlich blass wirkt, sein dunkles Haar erscheint dafür aber umso schwärzer, wodurch kein Schimmer der ersten grauen Strähnen hervorblitzt, die ihm in letzter Zeit gelegentlichen Kummer bereiten.
Als habe er meinen Blick gespürt, wendet er seine Aufmerksamkeit kurz von der Fahrbahn ab und mir zu.
„Das war eine ganz wunderbare Inszenierung heute Abend. Findest du nicht?“ Seine Augen leuchten hinter den Brillengläsern, bevor er sich wieder dem Verkehr zuwendet.
„Ja, es war sehr schön“, stimme ich zu.
Vielleicht liegt es daran, dass ich aufgrund der späten Stunde müde werde oder daran, dass ich einen Moment lang unaufmerksam bin – jedenfalls lässt es meine Zustimmung, völlig unbeabsichtigt, ein wenig an Enthusiasmus fehlen.
Sebastian hat es sofort bemerkt und stürzt sich prompt darauf wie eine Katze, die eine Maus wittert. Noch bevor ich etwas hinzufügen kann, um meine lahme Zustimmung positiv aufzupeppen, hakt er schon nach.
„Aber …?“
„Nichts. Kein Aber“, beeile ich mich, während ich an seiner Miene ablesen kann, wie die gute Stimmung zu bröckeln beginnt.
„Ach komm schon! Du hast diesen gewissen Ton in der Stimme, als ob irgendetwas an der heutigen Vorstellung nicht vollkommen perfekt gewesen wäre“, stellt er fest und klingt dabei bereits ein klein wenig eingeschnappt.
Ich weiß, was jetzt kommt. Er wird versuchen, mich in ein Streitgespräch zu verwickeln, aus dem er am Ende als Sieger hervorgeht. Solche Miniduelle führen wir schon seit Jahren, obwohl ich ständig auf der Hut bin, sie zu vermeiden. Aber er ist stets wachsam. Er lauert förmlich darauf, mich zu packen und einmal verbal durchzuschütteln. Dabei genügen ihm schon die geringsten Kleinigkeiten, wie ein Versprecher meinerseits oder eben ein in seinen Ohren unpassender Tonfall in der Stimme, um diesen sofort aufzugreifen und mir eine Lektion zu erteilen. So wie jetzt wieder. Ich habe die Aufführung nicht euphorisch genug gelobt.
„Es war alles super: die Musiker, die Sänger, das Bühnenbild …“, zähle ich wahrheitsgemäß auf, immer noch bemüht, die Situation zu retten und um zu vermeiden, dass er meint, stellvertretend für das gesamte Musical-Ensemble beleidigt sein zu müssen.
Aber er ist längst in Angriffsstellung und lässt nicht locker.
„Und was war nicht so toll?“
Ich könnte jetzt hartnäckig weiter beteuern, dass alles rundherum perfekt war, aber dafür ist es längst zu spät. Er wird mir kein Wort mehr glauben, jedenfalls kein positives. Ich spüre einen erneuten Seitenblick von ihm. Er wartet. Er lauert darauf, dass ich etwas sage, das er dann zerpflücken kann.
Für einen kurzen Moment erwäge ich, einfach gar nichts zu sagen. Aber dann wird er sich darüber echauffieren, dass ich durch meinen Tonfall angedeutet habe, nicht mit ihm einer Meinung zu sein und dass ich, nun da er nachfragt, nicht den Mumm habe, meinen Standpunkt ihm gegenüber zu vertreten. Er wird nicht aufhören, sich darüber auszulassen, bis wir zuhause sind. Und bis dahin sind es noch einige Kilometer. Wenn ich gar nichts sage, habe ich schon verloren. Versuche ich mich hingegen zu erklären, besteht immerhin eine winzig kleine Chance, doch noch ein gegenseitiges Einvernehmen herzustellen. Eine mikroskopisch kleine Chance bloß, aber immerhin mehr als nichts.
Innerlich aufseufzend stelle ich mich also der unvermeidlichen Konfrontation und rücke mit dem einzigen Kritikpunkt heraus, der mir aufgefallen ist, und den ich normalerweise nicht der Rede wert gefunden hätte.
„Nun ja, die Kostüme passten nicht so recht ins Bild“, erkläre ich und hoffe wider besseren Wissens immer noch, dass ihm die Kostüme nicht wichtig genug sind, um eine weitere Diskussion mit mir zu entfachen. Aber dem ist leider nicht so.
„Ich verstehe nicht, was du meinst. Hast du etwa irgendwo schiefe Nähte entdeckt?“ Er klingt verärgert. „Falls das der Fall sein sollte, ziehe ich meinen Hut vor deiner Sehstärke! Unsere Plätze waren zwar sehr gut, aber derart nah an den Darstellern waren wir nun doch nicht.“
Ich überhöre den Sarkasmus in seiner Stimme und erwidere ruhig: „Nein, es ist nur, dass die Kostüme nicht zur Epoche passten. ‚My Fair Lady’ spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber die Kostüme waren Mitte 19.“
Sebastian wirft mir erneut einen kurzen Blick zu. Diesmal glaube ich im Halbdunkel zu erkennen, dass er die Augen verdreht.
„Also ich fand die Kostüme sehr schön“, entgegnet er dann trotzig. Ich sehe, wie seine Kiefer vor Ärger aufeinander mahlen. Erneut wirft er mir einen herausfordernden Blick zu.
„Ja, sicher. Ich fand sie auch sehr schön“, stimme ich ihm resigniert zu. Ein allerletzter Versuch meinerseits, den Frieden wiederherzustellen. Es lag schließlich überhaupt nicht in meiner Absicht, uns den schönen Abend durch eine lächerliche Diskussion zu verderben. Aber mein kläglicher Versuch ist nicht von Erfolg gekrönt. Sebastian sucht jetzt Streit.
„Und ich denke, du irrst dich einfach nur, was die Kostüme angeht“, sagt er provokant und wohl wissend, dass er mir so nicht kommen kann.
Obwohl ich seinen Schachzug durchschaue, springe ich reflexartig auf diese Bemerkung an.
„Ich soll mich irren? Na, hör mal, mit der Mode vergangener Epochen kenne ich mich nun wirklich aus“, widerspreche ich energisch.
„Na, na, Eliza“, mahnt er freundlich. „Darf ich dich daran erinnern, dass du eine Herrenschneiderin bist und keine Historikerin?“
Jetzt nennt er mich auch noch Eliza! Das macht er immer, wenn er glaubt, mir einen Fehler unterstellen zu können.
Ich hole tief Luft und setze zu einer Verteidigung an: „Ja eben. Die Modestile vergangener Zeiten unterscheiden zu können, gehörte ebenfalls zu meiner Ausbildung. Ich weiß vielleicht nicht mehr so genau, wann, wo, welcher Kaiser regiert hat. Aber sag mir eine Jahreszahl und ich weiß, welche Kleidung die Leute zu dieser Zeit getragen haben, welche Stoffe und Schnitte damals ‚in’ waren. Schließlich habe ich neben meiner Ausbildung außerdem auch noch eine Mutter, die mal Kostümschneiderin an der Philharmonie war! Was glaubst du, worüber wir uns am Abendbrottisch unterhalten haben?“
Wenn meine Mutter Monika und ich überhaupt einmal zusammen zu Abend gegessen haben, was selten genug war, dann haben wir uns über Stoffe, Schneidertechniken und Kleidung unterhalten. Das einzige Thema eben, das uns überhaupt Gesprächsstoff bot, da wir uns ansonsten nicht viel zu sagen hatten. Aber das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir ist ein anderes Thema und gehört jetzt nicht hierher.
Ich richte meine Gedanken wieder auf Sebastian und setze noch ein wenig schnippisch hinzu: „Und im Übrigen ist Eliza Doolittle eine Blumenverkäuferin, keine Schneiderin!“
Er schenkt mir ein überlegenes Grinsen.
„Na, na! Nun lass doch mal gut sein!“, entgegnet er übertrieben beschwichtigend, so als spräche er mit einer Geisteskranken. „Ich verstehe gar nicht, warum du immer gleich so aufbrausen musst? Das sind diese lächerlichen Kostüme doch gar nicht wert.“
Wie immer geht er gar nicht darauf ein, was ich gesagt habe, sondern stellt mich stattdessen als diejenige dar, die herumnörgelt und sich über Nichtigkeiten aufregt. Damit macht er mich jedes Mal wahnsinnig.
Jetzt erdreistet er sich auch noch, in jovialem Ton zusammenzufassen: „Wir haben eine rundum gelungene Aufführung gesehen. Es gibt nicht den geringsten Anlass, irgendetwas daran mies zu machen. Und schon gar nicht du, die doch schließlich die Karten gekauft hat.“
„Ich mache doch gar nichts mies! Die Kostüme haben mir gefallen, sie passten nur nicht so ganz in die Epoche. Aber das hätte ich gar nicht erwähnt, wenn du nicht erwartet hättest, dass ich etwas dazu sage …“, rechtfertige ich mich.
„Erwartet?“, unterbricht er mich. „Ich habe gar nichts erwartet. Ich habe dich lediglich gefragt, was dir an dieser wunderbaren Inszenierung nicht gefallen hat. Dass dich die Kostüme gestört haben und du dich darüber aufregst …“
„Ich wollte mich doch gar nicht darüber aufregen“, falle ich ihm nun ins Wort.
„Machst du aber gerade“, kontert er.
„Nein! Ich rege mich darüber auf, dass wir hier einen Streit über eigentlich gar nichts führen!“
Meine Stimme klingt inzwischen schrill und verrät, dass ich mich auf verlorenem Posten fühle. Ich weiß einfach nicht, was ich Sebastian entgegensetzen soll, damit er endlich aufhört.
„Na also. Das ist doch die ganze Zeit meine Rede: Es gab überhaupt nichts zu kritisieren. Nur du glaubst wieder mal, etwas finden zu müssen“, meint er von oben herab und sieht dabei wie ein zufriedener Kater aus, der die Maus mit Haut und Haar erwischt hat.
Nun bin ich diejenige, die stumm mit den Zähnen knirscht. Jedes weitere Wort von meiner Seite könnte nur erneut von ihm verdreht werden. Wir würden uns endlos im Kreis drehen, wobei er der Jäger wäre und ich die Gejagte. Am Ende würde ich nur noch weitere Demütigungen einstecken müssen. So läuft es jedes Mal.
Wütend schließe ich die Augen und atme einmal tief durch, um dann sämtliche Erwiderungen, die mir noch durch den Kopf gehen, hinunterzuschlucken. Er ist an dem Punkt angelangt, dass er sein Mütchen ausreichend gekühlt hat. Wenn ich jetzt schweige, wird er dies als Zustimmung deuten und Ruhe geben. Innerlich erschöpft ergreife ich die Möglichkeit, mich in mein Mauseloch zu verkriechen, indem ich den Mund halte und ihn den Sieg davontragen lasse. Heißt es nicht, der Klügere gibt nach?
Ich starre zum Seitenfenster hinaus in die Dunkelheit, wütend auf Sebastian und seine herablassende Art, mit der er mich mal wieder abgekanzelt hat. Gleichzeitig bin ich zornig über mich selbst, weil ich mich zum wiederholten Male von ihm habe ausbooten lassen. Ich kenne ihn doch nun wirklich lange genug, um auf seine Provokationen nicht immer hereinfallen zu müssen! Und doch ist es ihm soeben wieder gelungen, mich aus der Reserve zu locken und mich am Ende wie blöd dastehen zu lassen. Am liebsten würde ich jetzt auf der Stelle aussteigen und einen irren Urschrei ausstoßen, um mir Luft zu machen. Aber wir befinden uns auf der B9, irgendwo im dunklen Niemandsland zwischen Köln und Bonn. Ein geeigneter Ort für einen Urschrei vielleicht, aber kein idealer Ausgangspunkt für einen nächtlichen Spaziergang bis nach Hause.
Noch während ich innerlich mit mir ringe, die in mir tobenden und um Ausdruck drängenden Gefühle lieber hier im Wagen herauszulassen und damit einen schweren Unfall zu riskieren, unterbricht der Klingelton meines Handys den inneren Aufruhr.
Ich sende ein dankbares Stoßgebet dafür gen Himmel, keine weitere Entscheidung bezüglich des Urschreis mehr treffen zu müssen und beginne augenblicklich, geschäftig in meiner Handtasche nach dem Telefon zu wühlen. Als ich es gefunden habe, werfe ich einen kurzen Blick aufs Display. Es ist der Anschluss meiner Mutter in Spanien. Meine Dankbarkeit für die Unterbrechung wandelt sich augenblicklich in ein flaues Gefühl in der Magengegend.
„Monika? Jetzt noch? Um diese Zeit?“, murmle ich überrascht. Hastig nehme ich den Anruf entgegen, während sich gleichzeitig das ungute Druckgefühl immer weiter im Magen ausbreitet.
Kaum habe ich mich gemeldet, höre ich die Stimme meiner Mutter so nah, als stünde sie neben mir. Sie überspringt ihre sonst üblichen Floskeln und schluchzt sofort los: „Ellis! Du musst nach Erzert fahren! Oma ist tot!“
2
Stillleben mit Brille
Sie ist tot. Fort. Einfach nicht mehr da. Die einzige Person, von der ich mit Überzeugung behaupten kann, dass sie mich bedingungslos und ohne Einschränkungen geliebt hat.
Wie so oft in den vergangenen fünf Tagen überfällt mich dieser Gedanke und erfüllt mich gleichermaßen mit Erstaunen wie mit Schrecken. Meine Magengrube befällt ein tonnenschweres Krampfgefühl, das sich nach oben hin zu einem Kloß im Hals formt und nach unten bis in meine Kniekehlen sackt, welche sich daraufhin schwammig und weich anfühlen, als seien sie schlagartig zu schwach, um mich tragen zu können. Das Gefühl währt nur einen kurzen Augenblick. Dann zwinge ich meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes, irgendwelche alltäglichen Handlungen oder banalen Gedanken, die mir helfen, Kloß, Magenkrampf und schwammige Knie so weit zu unterdrücken, dass ich weiter funktionieren kann.
Irgendwie funktionieren, das ist es, was mich in den letzten Tagen fast vollkommen in Anspruch genommen hat und wofür ich auch jetzt wieder meine ganze Energie aufwenden muss. Dabei befinde ich mich unter einer gläsernen Glocke, die mein Bewusstsein nach außen hin abschirmt und dafür sorgt, dass der Schmerz über meinen Verlust ein gerade noch erträgliches Maß behält. Wie durch einen Nebel nehme ich all die altbekannten Gesichter wahr, die zahlreich zur Beerdigung erschienen sind, höre ihre Stimmen wie durch Watte, die versuchen, mir Trost zuzusprechen. Beinahe mechanisch antworte ich ihnen, schüttle ihre Hände dabei, und lächle sogar manchmal an den richtigen Stellen.
Neben mir steht meine Mutter im vom Regen nassen Gras, der den ganzen Vormittag über vom Himmel fiel, und macht dasselbe.
Hinter mir befindet sich Sebastian, der sich darauf beschränkt, mir durch seine schweigende Anwesenheit den Rücken zu stärken und heute auf jegliche Art überflüssiger Kommentare verzichtet, weil sogar er weiß, dass dies so ziemlich das Letzte wäre, was ich jetzt noch verkraften könnte.
Auf der gegenüberliegenden Seite des offenen Grabs, in das der blumengeschmückte Sarg hinabgelassen wird, entdecke ich Dagmar und Olli, die mir in den letzten Tagen moralischen und praktischen Beistand geleistet haben, indem sie den Beerdigungskaffee organisiert, die Blumengebinde bestellt oder Unterkünfte für Trauergäste mit weiter Anreise besorgt haben. Die beiden sind schon – gefühlt – ewig miteinander verheiratet und meine besten Freunde seit Sandkastenzeiten. Im Grundschulalter gehörten wir mit einigen anderen Kindern aus dem Dorf zu einer „Bande“, die sich zeitweise drauf verlegt hatte, Erzert mit „Klingelmännchen“-Anschlägen zu terrorisieren. Mehrere Sommer lang verbrachten wir unsere Nachmittage damit, an Haustüren zu klingeln und uns dann kichernd im nächsten Gebüsch zu verstecken. Trotz meiner Traurigkeit muss ich innerlich lächeln, als ich daran denke.
Ein weiteres Mitglied unserer Bande war Carsten Krämer. Ebenso wie meinen Freunden, schulde ich auch ihm und seinem Opa Alfons einen Dank dafür, dass diese schweren letzten Tage ohne größere organisatorische Katastrophen verlaufen sind. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, haben sich meine Oma und der alte Alfons doch ihr ganzes Leben lang unter dem Kirschbaum hinweg, der die gemeinsame Grundstücksgrenze kennzeichnet, einen verbalen Kleinkrieg geliefert. Dieser bestand meistens aus allerlei gegenseitigen Sticheleien, gipfelte manchmal aber auch in lautstarkem Streit, wenn Alfons’ Katzen sich mal wieder in Omas Beeten erleichtert hatten. Umso bemerkenswerter finde ich es nun, dass er sich auch noch bis ans Grab begeben hat, obwohl ihm seit einem Schlaganfall das Gehen schwerfällt. Halb auf Carsten und halb auf einen Rollator gestützt, steht er mit wackligen Beinen da und sieht dabei so mitgenommen aus, als trauere er um Oma nicht weniger als ich.
Nun ja, er war derjenige, der sie nach ihrem Zusammenbruch gefunden hat, überlege ich. Sowas haut gewiss auch einen gestandenen alten Zimmermann aus den Schlappen. Oder aber er vermisst Oma sogar wirklich, denn mit wem soll er sich in Zukunft streiten?
Im Anschluss an das Begräbnis treffen sich alle „Im kühlen Grunde“, der Erzerter Dorfgaststätte, wo im großen Saal Kaffee, Kuchen und belegte Brötchen gereicht werden. Der riesige Raum brummt nur so von Stimmen, da nahezu das ganze Dorf gekommen ist, um Radermachers Hanne die letzte Ehre zu erweisen. Immerhin war sie „noch ein echtes Erzerter Urgestein“, wie Ortsbürgermeister Schreiner meiner Mutter und mir versichert, während er uns abwechselnd verlegen auf die Schultern klopft, weil mitfühlende Reden zu halten, eigentlich nicht sein Ding ist.
Nach dem Kaffee gibt es traditionell Likör und Schnaps und nachdem die ersten Pinnchen gekippt worden sind, wird die bis dahin gedämpfte Stimmung zunehmend heiter.
„Das muss so sein“, hat Oma mir mal erklärt. „Eine anständige Beerdigung dient nicht nur der Verabschiedung, sondern erinnert uns auch daran, dass es schön ist, zu leben.“
Im Andenken an diese Worte, sage ich daher nicht nein, als mir Marga Fuchs, die Wirtin, ein Tablett mit den hochprozentigen, klaren Flüssigkeiten unter die Nase hält. Ich schnappe mir ein Gläschen und kippe es hinunter, um gleich darauf noch nach einem zweiten zu greifen, da der darin enthaltene Pflaumenlikör so angenehm süßlich in meiner Kehle brennt.
Meine Schwiegermutter, die mir gegenübersitzt, schnalzt missbilligend mit der Zunge und schüttelt zusätzlich noch tadelnd den Kopf, um mir verstehen zu geben, dass es in ihren Augen ungehörig ist, sich in der Öffentlichkeit mehr als ein Gläschen zu genehmigen. Noch dazu als Frau!
Ich versuche, so zu tun, als bemerke ich ihren Tadel nicht, soll sie doch meinen, was sie will. Doch da greift leider eine Hand dazwischen, die ich als die von Sebastian erkenne.
„Einer reicht“, raunt er mir mahnend ins Ohr. „Du weißt doch, dass du das Zeug nicht gut verträgst. Nicht, dass dir auf der Heimfahrt noch schlecht wird.“
Damit hat er leider nicht ganz Unrecht. Wenn ich etwas getrunken habe, vertrage ich das Autofahren nicht. Es wäre schade um den guten Likör, wenn ich diesen später irgendwo in den Straßengraben spucken würde. Deshalb höre ich auf seine Mahnung und bedeute Marga mit einer Geste, dass ich es bei dem einen Gläschen belasse.
Kurz darauf verabschieden sich meine Mutter und ihr Freund Rüdiger, da sie ihren Flieger zurück nach Marbella erwischen müssen. Carsten verschwindet mit ihnen, da er ihnen angeboten hat, sie zum Köln-Bonner Flughafen zu fahren.
Beinahe reflexartig frage ich mich, ob dieses Angebot gänzlich ohne Hintergedanken ausgesprochen wurde. Immerhin wird meine Mutter Omas Häuschen erben, an dem die Krämers bekanntermaßen schon immer Interesse hatten …
Ich komme nicht dazu, den Gedanken zu beenden, da Tante Erna, Omas jüngste Schwester, ebenfalls aufbricht und mir zuvor wortreich erklärt, „wie schön die Beerdigung“ heute gewesen ist, um von diesem Punkt aus mühelos die Überleitung zu ihrer vor kurzem überstandenen Darm-OP und den daraus resultierenden Folgen zu schaffen. Ein Thema, dem ich nicht entfliehen kann, selbst wenn ich es wollte, denn Tante Erna hat die Angewohnheit, sich die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer zu sichern, indem sie immer wieder prüfende Zwischenfragen stellt.
Gute zwei Stunden später sind die Feierlichkeiten auch für uns beendet und wir begeben uns noch ein letztes Mal in Omas Haus zurück, um es darauf vorzubereiten, in Zukunft leer zu stehen.
Langsam gehe ich von Zimmer zu Zimmer, um Wasserhähne, Heizthermostate und elektrische Geräte zu überprüfen. Die alten Holzdielen unter meinen Füßen knarren wie zu einem letzten Lebewohl. Jedes Knacken ist ein vertrautes Geräusch. Und doch klingt es am heutigen Tag mit einem Mal ungewohnt laut in meinen Ohren.
Unwillkürlich verharre ich in meinem Schritt und lausche. Und als ich nichts höre – wie sollte ich, da meine Oma doch tot ist – versuche ich sie mir einzeln ins Gedächtnis zu rufen, all die kleinen Laute, die das Haus hervorbrachte, wenn sie sich durch die Zimmer bewegte. Der Klang ihrer trippelnden Schritte auf dem fleckigen Linoleum im Flur. Das Klicken der Schlösser, wenn sie die Türen hinter sich zuzog, immer sanft genug, dass es nicht knallte und doch mit genügend Schwung, dass die Tür tatsächlich hinter ihr zufiel. Das Klappern von Geschirr und das Rauschen der Wasserleitung, wenn sie kochte. Das dumpfe tockende Geräusch ihrer Gesundheitspantoffeln auf den hölzernen Treppenstufen, begleitet vom leisen Schleifen ihrer Hände an Wand und Geländer, wenn sie sich beidhändig daran abstützte, da ihr gelegentlich die Beine den Dienst versagten. Das Knarren der vorletzten oberen Treppenstufe, wenn sie hoch zu meinem Zimmer kam …
All das und noch viel mehr hat ihre menschliche Wärme und großmütterliche Liebe angekündigt, mit der sie mich manchmal förmlich überschüttet hat. Mehr noch als ihr persönlicher Duft, ihre leuchtenden azurblauen Augen oder was manch anderem vielleicht sonst noch von ihr im Gedächtnis bleiben würde, so wird es für mich immer diese ganz spezielle Begleitmusik des Hauses sein, welche ihr stets folgte, wenn sie durch die Räume ging.
Ich verlasse das Obergeschoss, in dem sich neben meinem alten Jugendzimmer nur ein nicht ausgebauter Speicherraum befindet. Dann betrete ich unten das Schlafzimmer mit dem dahinter liegenden Bad. Beide Räume nehmen die linke Haushälfte ein und liegen eine Treppenstufe tiefer als das übrige Erdgeschoss, da sich hier zu Omas Jugendzeit der Ziegenstall befand.
Ich blicke mich überall noch einmal um, entdecke altbekannte Gegenstände, betaste sie in dem Bewusstsein, dass ihre Augen nie wieder darüber blicken und ihre Finger sie nie wieder berühren werden. Stumme Zeugen eines ganzen Menschenlebens.
Seufzend gehe ich ins Wohnzimmer in der hinteren rechten Haushälfte. Die Einrichtung des Zimmers ist erwartungsgemäß altmodisch: dunkle, schwere Eichenmöbel, großblumige Polster – eben der alterstypische, durchaus spießbürgerliche Barockstil der einfachen Leute.
Auf dem Sofa überraschen mehrere aufwendig gearbeitete Kissen in bunten Farben: meine gesammelten Werke aus meiner Anfangszeit in der Schneiderlehre. Als Auszubildende zur Maßschneiderin für Herrenmode hatte ich manchmal das Gefühl zwischen all den gedeckten, vornehmen Anzugsstoffen depressiv zu werden und begann aus dem Grund in meiner Freizeit umso farbenfrohere Kissen, Decken, Topflappen und sogar Stofftiere zu nähen. Es war der Beginn eines Hobbys, das mich bis heute nicht mehr loslässt.
Einen Moment lang überlege ich, die Kissen mitzunehmen, verwerfe den Gedanken aber gleich wieder. Sie gehören hierher, in diesen biederen Raum, trotz oder gerade wegen ihrer unpassenden Fröhlichkeit.
Wie in den anderen Zimmern schließe ich auch hier die Läden und sperre das trübe Herbstlicht aus. Es riecht jetzt schon nach Staub und Moder, nach unbewohntem Haus.
Ich werde Dagmar daran erinnern müssen, regelmäßig durchzulüften, wenigstens einmal im Monat.
Und nach der Heizung muss sie schauen, die Heizkörper in allen Räumen ein klein wenig andrehen, damit im Winter nichts einfriert. Und …
Aber was mache ich mir für unnötige Gedanken? Dagmar und Olli werden dafür sorgen, dass alles in Schuss bleibt. Auf die beiden ist Verlass.
Zuletzt gehe ich in die Küche. Der schwache Duft nach kaltem Kaffee hängt noch immer in der Luft. Der Kühlschrank ist leer. Ein Topflappen klemmt in der Tür, um sie offenzuhalten. Der Wasserhahn hat aufgehört, zu tropfen, denn ich habe den Haupthahn im Keller abgedreht, ebenso wie die Sicherung des Elektroherdes. Die vordere linke Platte ist seit einem guten Jahr defekt.
Ausgerechnet die Platte, die man beim Kochen am meisten braucht, denke ich, so wie jedes Mal, wenn ich an den Herd trete.
„Mich hält der Herd noch aus. Und was danach kommt, kann mir egal sein“, hat Oma mir jedes Mal entgegnet, wenn ich ihr vorgeschlagen habe, einen neuen Herd zu kaufen. Mit einem leisen Seufzer wende ich mich ab.
Als ich den Fensterladen verschließe, fällt mein Blick auf das schmale Fensterbrett davor. Omas Brille liegt darauf, aufgeklappt neben einem feuerwehrroten Kugelschreiber auf einem halb ausgefüllten Kreuzworträtsel. Es liegt da, wie achtlos abgelegt. Nur ganz kurz, auf die Schnelle. So als würde sie in wenigen Minuten wieder gebraucht werden.
Hätte sie auch nur im Entferntesten geahnt, dass sie die Brille nicht mehr benötigen würde, sie hätte sie zurück ins grüne Etui gesteckt, das unter der Rätselzeitschrift hervorlugt. Ordnung musste für sie sein! Und wahrscheinlich hätte sie zu Lebzeiten nicht einmal den Tod als Ausrede für Unordnung gelten lassen.
Das Rätsel ist ebenfalls unvollendet geblieben. Auch das wäre in ihren Augen ein Unding. Sie pflegte stets so lange über den Lücken zu grübeln und notfalls nachzuschlagen, bis sie das letzte Kästchen ausgefüllt hatte.
Aber das Ende hat sie überraschend ereilt. Hat sie mitten im Leben erwischt und dann ausgerechnet in den Armen von Alfons Krämer sterben lassen. Alfons, an dem sie nie ein gutes Haar ließ, wann immer die Rede auf ihn kam oder sie ihn nur sah.
Alfons an ihrer Seite, die Brille nicht aufgeräumt und das Rätsel voller Lücken – die Umstände ihres Todes haben ihr gewiss nicht gefallen. Fast muss ich lachen, als ich mir vorstelle, wie sie sich darüber aufgeregt hätte, wären Oma die näheren Details ihres Sterbens im Voraus bekannt gewesen. Mit Sicherheit hätte sie nichts unversucht gelassen, um das Drehbuch ihres endgültigen Abschieds in ihrem Sinne umzuschreiben.
Ich sollte die Brille ins Etui stecken und sie einem guten Zweck zuführen. Brillen für Afrika. Oder lieber Nepal? Aber ich lasse sie ebenso unberührt wie den Kugelschreiber und das Rätselheft, achte sogar beim Schließen des Fensterladens eigens darauf, die Anordnung nicht zu verändern. Die geringste Änderung erscheint mir eine unverzeihliche Verfehlung, eine Entweihung.
„Ellis?!“ Sebastians Stimme lässt mich zusammenzucken. „Kommst du jetzt endlich? Wir warten die ganze Zeit da draußen!“
Er hat keine Lust mehr, noch länger hierzubleiben. Zum einen, weil er einen kompletten verregneten Tag auf dem Land verbringen musste, inmitten all der schrulligen Bauern und meiner lärmenden Verwandtschaft. Da er unseren Dialekt nur mit Mühe versteht, hält er die komplette hiesige Bevölkerung für in der Zeit zurückgeblieben und irgendwie seltsam.
Zum anderen ist er unzufrieden, weil er heute Nachmittag nicht die Beerdigung leiten durfte. Als Schwiegerenkel ist er davon ausgegangen, ein verbrieftes Recht darauf zu haben. Er ist der Ansicht, ich hätte mich nicht genügend dafür eingesetzt, dass die hiesige Pfarrerin ausgeladen wurde und er an ihrer Stelle die Zeremonie durchführen sollte.
Und um ehrlich zu sein, hat er durchaus recht mit seinem Vorwurf. Tatsächlich habe ich mich nicht übermäßig angestrengt, die Pfarrerin loszuwerden. Sie stammt aus der Gegend und weiß, was Oma, Tante Erna und alle anderen Leute von hier von einer anständigen Beerdigung erwarten. Ich wusste einfach, dass mit ihr an der Spitze des Trauerzuges nichts schiefgehen konnte.
„Was machst du denn noch die ganze Zeit?!“ Er steht in der Küchentür.
„Ich bin ja schon fertig“, erwidere ich schnippisch, nun meinerseits unzufrieden über seine Störung, aber er hat sich schon wieder abgewandt und strebt dem Ausgang zu. Ich schließe endgültig den Fensterladen, ohne das Rätselheft zu berühren, und tauche die Küche so in völlige Dunkelheit.
Ich taste mich in den Flur vor, der durch die kleine Scheibe in der Haustür spärlich beleuchtet wird und wo Sebastian auf mich gewartet hat. Nun geht er zum Wagen vor und lässt den Motor an, während ich die Haustür sorgfältig hinter mir abschließe. Dann folge ich ihm und lasse mich zu meinem Schwiegervater Waldi auf die Rückbank fallen.
Sebastian fährt augenblicklich los, als gelte es, vor einem herannahenden Unheil zu flüchten.
„Na endlich, Alice!“, lässt sich meine Schwiegermutter Lou vom Beifahrersitz vernehmen. Wie immer spricht sie den Namen falsch aus. Sie denkt, Ellis sei eine fehlerhafte Schreibweise des englischen Alice, und weil sie Anglizismen ordinär findet, betont sie den Namen französisch, eine Angewohnheit, die meine Mutter wiederum zur Weißglut treibt. Aber Monika ist ja zum Glück nicht hier.
„Wir befürchteten ja schon fast, dir sei etwas zugestoßen!“ Lou rechnet immer gerne mit dem Schlimmsten.
„Alles in Ordnung“, gebe ich kurz angebunden zurück, was jedoch niemand bemerkt, da Lou und Sebastian gleich darauf ein Gespräch über den Verlauf des heutigen Tages beginnen. Insbesondere der Predigt der Pfarrerin widmen sie eine detaillierte Analyse, wobei die Pfarrerin denkbar schlecht wegkommt.
„Ihre Predigt war ja sowas von gefühlsduselig und kitschig!“, meint Lou.
„Sie hat falsch betont, zu wenig Pausen gemacht und ihre Predigt war theologisch auch nicht in allen Punkten haltbar“, bemerkt Sebastian. „Schade, dass sie so schnell wegmusste. Ich hätte mich gern noch mit ihr darüber ausgetauscht.“
Was für ein Segen für die gute Frau, dass sie noch einen weiteren Termin hatte und ihr dieses Gespräch erspart geblieben ist, denke ich mit einem inneren Augenrollen.
Mir hat die Predigt gefallen. Man hat gemerkt, dass die Pfarrerin Oma persönlich gekannt und sie gemocht hat. Aus ihren Worten sprachen aufrichtige Warmherzigkeit und Anteilnahme, welche mich um Längen mehr getröstet haben als irgendwelche theologischen Diskurse. Aber ich mische mich nicht in das Gespräch ein, höre irgendwann nicht einmal mehr zu, sondern bin einfach nur dankbar für Waldis Schweigen und den Blick auf die am Fenster vorbeirauschenden Herbstwälder.
3
Zwischen gestern und morgen
Gut zwei Stunden später sitze ich allein in der Küche unserer Dienstwohnung im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bonn-Süd.
Sebastian hat sich unmittelbar nach unserer Ankunft mit einem unverständlichen Gemurmel in sein Arbeitszimmer zurückgezogen. Er ist am Sonntag mit dem Gottesdienst an der Reihe und seine Predigt ist nicht einmal halb fertig. Das liegt zum einen daran, dass er meinte, sich mit vermeintlich wertvollen Tipps in meine Vorbereitungen der Beerdigung einbringen zu müssen. Der andere Grund – was er aber niemals zugeben würde – ist der, dass er lieber an seinem Kurzvortrag über „Weltbild und Transzendenzerfahrung“ gearbeitet hat, den er kurz nach Neujahr vor Kollegen in Rothenburg ob der Tauber halten soll.
Als Gunther von Omas Tod gehört hat, hat er sich sofort angeboten, für Sebastian einzuspringen und den kommenden Sonntagsgottesdienst für ihn zu übernehmen, aber davon wollte er nichts wissen.
„Ich bin inzwischen schon lange genug Pfarrer und verfüge somit über ausreichend Routine, um eine angemessene Predigt auch mal auf die Schnelle verfassen zu können“, hat Sebastian entgegnet und ihm damit in einem Wisch gleich noch schnell klar gemacht, dass er ja bloß der Vikar ist, sprich: der Azubi.
Na, das hat er jetzt davon. Hätte er Gunther den Sonntag abgetreten, wäre er jetzt nicht im Stress, spreche ich gedanklich in meine Kaffeetasse hinein.
Im Übrigen hält Gunther auch ganz wunderbare Predigten. Er belehrt dabei nicht, sondern spricht normal zu den Leuten und erzählt dabei häufig Geschichten aus dem wahren Leben. Anders als die Predigten von Sebastian, die manchmal eher theologischen Vorlesungen ähneln. Aber natürlich würde ich so etwas nie zu ihm sagen. Sebastian würde mich nur wieder abkanzeln, dass ich davon doch rein gar keine Ahnung habe und mir indirekt vorhalten, dass ich keine Akademikerin bin und eine Theologin schon mal gar nicht. Darauf kann ich verzichten, würde ich doch mit Sicherheit mal wieder den Kürzeren ziehen. Ohnehin beschäftigen mich völlig andere Gedanken. Kurz zuvor habe ich nämlich in Erzert bei Carsten angerufen.
„Ich wollte mich wenigstens telefonisch bei dir dafür bedanken, dass du meine Mutter und Rüdiger nach Köln gefahren hast“, habe ich hastig hervorgestoßen, bevor er mit mir irgendwelchen Smalltalk hätte beginnen können.
„Ach, doch nicht dafür. Ich hatte ohnehin in der Richtung zu tun, der Abstecher zum Flughafen war kein großer Umweg“, hat er entgegnet.
„Trotzdem möchte ich mich ausdrücklich dafür bedanken und sei es nur, weil es sich so gehört“, habe ich mein Anliegen nochmal betont und mich kurz darauf auch schon von ihm verabschiedet, denn unser Verhältnis ist nicht derart herzlich, dass ich Lust gehabt hätte, mit ihm ein längeres Gespräch zu führen. Andererseits möchte ich auf keinen Fall auch nur den leisesten Verdacht aufkommen lassen, Carsten oder seinem Opa irgendetwas schuldig zu sein – und sei es nur ein läppisches Dankeschön.
Der Grund dafür, dass ich mir die Krämers auf Distanz halte, hat eigentlich nicht direkt mit Alfons und Carsten persönlich zu tun, vielmehr wurzelt er in jener uralten Fehde zwischen unseren Familien, die Alfons und Oma bis zuletzt weitergeführt haben.
Wobei es sich bei dieser Fehde keineswegs um eine blutige Vendetta handelt, wie man denken könnte. Unsere Familien waren niemals offen gegeneinander zu Felde gezogen. Vielmehr ist es so, dass jede Generation von Krämers auf ihre jeweils eigene Art versucht hat, uns Radermachers das Leben so schwer wie möglich zu machen und uns aus unserem kleinen Stammhaus zu vertreiben, das unglücklicherweise derart dicht neben dem der Krämers liegt, dass es diese zunehmend daran hindert, ihren wachsenden Zimmereibetrieb in der gewünschten Weise auszubauen. Da wir Radermachers in all den Jahrzehnten nicht bereit gewesen sind, unseren Grund und Boden an die Nachbarn zu verkaufen, herrscht auf deren Grundstück inzwischen ein unschönes Gedränge an Nebengebäuden für die Zimmerei, was den Krämers nicht übermäßig gefällt. Aus ihrer Sicht ist meine Familie eine lästige Laus in ihrem Pelz, die es loszuwerden gilt. Als Mitglied meiner Sippe empfiehlt es sich daher, stets auf der Hut zu sein und alles, was die Krämers tun, hinsichtlich Doppeldeutigkeiten und dubioser Absichten zu hinterfragen. Deshalb sitze ich hier in meiner Küche und überlege erneut, wie schon heute Nachmittag beim Beerdigungskaffee, ob es sich bei Carstens Fahrt zum Flughafen wirklich um nichts anderes handelt als einen freundlichen Nachbarschaftsdienst.
Fakt ist, dass meine Mutter als einziges Kind das Haus von Oma erben wird. Tatsache ist auch, dass sie dauerhaft mit Rüdiger in Spanien lebt und keinerlei Verwendung für das Häuschen hat. Man muss nicht übermäßig scharfsinnig sein, um auf den Gedanken zu kommen, dass das kleine Radermacher-Anwesen in naher Zukunft zum Verkauf stehen wird. Wenn ich Carsten Krämer hieße, würde ich meine Chance wittern, das Grundstück nebst Haus billig zu erwerben. Und was eignet sich da besser, als eine einstündige Fahrt zum Flughafen, um sich bei der zukünftigen Eigentümerin schon einmal ins Gespräch zu bringen? Vielleicht hat er sogar bereits versucht, in unverfänglichem Plauderton seine Kaufabsicht anzudeuten?
Mir wird heiß vor Empörung, als ich mir das Gespräch vorstelle zwischen meiner Mutter – in Trauer, ihrem Freund Rüdiger, zwar in diesem Fall bloß der Anhang, aber immerhin von Beruf Immobilienmakler, und Carsten, ein Krämer, und mir dabei die Details ausmale, wie sie unter einander ums Haus feilschen. Und das alles kaum drei Stunden nachdem Oma unter der Erde ist? Sowas ist pietätlos! Wie kann ein Mensch nur so hinterhältig sein? Kann das Carsten?
Das ist letzten Endes die Frage, die mich umtreibt, während mein Kaffee kalt wird.
Schließlich halte ich die Ungewissheit nicht mehr aus, greife erneut zum Telefon und wähle diesmal die Nummer meiner Mutter. Sie scheint sich über meinen Anruf zu freuen und erzählt, dass sie und Rüdiger vor einer halben Stunde in ihrem Haus in Marbella angekommen sind und einen angenehmen Flug hatten.
„Rüdiger lässt schön grüßen.“
„Hm, ja, schönen Gruß zurück“, tue ich der Höflichkeit genüge.
Rüdiger und ich, wir verstehen uns nicht besonders. Es ist nicht so, dass wir uns streiten, das haben wir ausgiebig in den Jahren erledigt, als meine Mutter mich aus Erzert fort nach Frankfurt geholt hatte und ich mit ihr und Rüdiger ihren Traum einer Familie leben musste. Vielmehr sind wir uns beide einfach nur gleichgültig. Er ist der langjährige Lebensgefährte meiner Mutter und ich ihre noch langjährigere Tochter – sie ist das Einzige, das mich und Rüdiger verbindet.
„Wie war denn eure Fahrt zum Flughafen?“, erkundige ich mich, um zum eigentlichen Grund meines Anrufs überzuleiten.
„Ebenfalls angenehm. Wir haben uns prima mit Carsten unterhalten“, erzählt sie.
Das dachte ich mir! Innerlich aufgewühlt, aber nach außen hin vollkommen gelassen, frage ich: „Ach ja? Worüber denn?“
„Übers Angeln“, antwortet sie.
Angeln?!
„Weißt du, Carsten angelt wohl auch seit ein paar Jahren, genau wie Rüdiger. Na, und da hatten die beiden natürlich ein Gesprächsthema. Du kennst ja Rüdiger – übers Fischefangen kann er sich stundenlang auslassen!“, sprudelt es weiter aus ihr heraus. „Und über die Zubereitung von Fischen! Carsten scheint ein guter Koch zu sein. Er hatte ein paar interessante Rezepte auf Lager, die Rüdiger demnächst ausprobieren möchte.“
Das kann doch wohl nicht wahr sein! Will sie mir ernsthaft weismachen, dass die Männer die ganze Fahrt über Kochrezepte ausgetauscht haben?
„Und über irgendetwas anderes habt ihr nicht geredet?“, gebe ich nicht auf. „Vielleicht über die Beerdigung?“
„Nein, nicht viel mehr als das übliche Geplänkel: Wer alles da war, die vielen schönen Blumen … Was man so redet eben“, entgegnet sie. „Warum fragst du? Worüber hätten wir sonst reden sollen?“
Über den Verkauf von Omas Haus?, denke ich, spreche es aber nicht aus, denn seltsamerweise hegt meine Mutter nicht das geringste Misstrauen gegen die Krämers und nimmt sie immer in Schutz, wenn Oma und ich ihnen unlautere Absichten unterstellt haben. Würde ich meinen Verdacht äußern und er wäre unbegründet, würden wir bloß in Streit darüber geraten, warum ich die Krämers nicht ausstehen kann. Und ein Streit an Omas Beerdigungstag erscheint mir ebenso pietätlos, wie auf der Fahrt zum Flughafen über ihr Haus zu verhandeln.
Da es dazu wohl offensichtlich doch nicht gekommen ist, murmle ich bloß: „Weiß nicht. War nur so eine Frage.“
Zum Glück ist Monika keine von diesen Müttern, die merken, wenn man ihnen ausweicht.
„Du Ellikind, ich muss jetzt auch Schluss machen“, sagt sie in diesem Moment. „Du weißt, dass ich nächste Woche diese Präsentation habe, und es ist noch so wahnsinnig viel dafür zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll! Und ich bin ja so froh, dass du dich um die Beerdigung und all das gekümmert hast! Das hast du wirklich ganz toll gemacht! Ich hätte das von hieraus ja gar nicht alles organisieren können.“ Sie macht eine Pause, um Luft zu holen, und fährt fort: „Und ich hoffe, dass du dir das mit Oma nicht allzu sehr zu Herzen nimmst. Ich weiß, dass du sehr an ihr gehangen hast. Aber sie hatte nun auch schon das gewisse Alter, in dem man damit rechnen muss.“
„Sie war erst vierundsiebzig!“, werfe ich ein.
„Und hatte bereits die eine oder andere Vorerkrankung! Das muss ich doch dir nicht erzählen!“
„Ja, ich weiß“, entgegne ich nur resigniert. Was soll ich sonst dazu sagen? Dass ich es furchtbar finde, wie sie über den Tod ihrer Mutter einfach so hinweggeht? Dass ich sie für kalt und oberflächlich halte, weil ihr ihre Bademodenschau für „die reife Frau des kommenden Sommers“ wichtiger ist als ihre Familie? Oder dass ich mir Mühe geben werde, den Tod meiner Mutter später auch einmal so locker zu nehmen wie sie? Ich bin mir sicher, dass sie die Ironie dieser Frage glatt überhören würde.
„Also mach’s gut, Ellikind! Wenn irgendwas ist, kannst du dich ja melden!“, flötet sie und legt auf.
Ich lege das Telefon zur Seite und drehe die Kaffeetasse in meinen Händen.
Nun gut, Carsten scheint sich zurückgehalten zu haben. Damit blende ich alles andere aus und konzentriere ich mich auf den für mich entscheidenden Punkt des Gesprächs. Somit ist die Gefahr, dass das Haus in falsche Hände gerät, zwar nicht gebannt, aber um ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen vertagt. Eine Sache weniger, die mir heute Nacht den Schlaf rauben wird.
4
Blaue Giraffe
Reichlich übernächtigt von einer Nacht, in der ich den gestrigen Beerdigungstag nochmals durchlebt und zwischendurch Omas Fortgehen beweint habe, räume ich den Frühstückstisch ab und verabschiede Sebastian in den Tag.
Er sieht nicht viel frischer aus als ich, hat aber immerhin die Predigt für Sonntag fertig. Jetzt bricht er auf, um eine Andacht im nahegelegenen Altenheim zu halten, was ihn auch nicht gerade aufmuntert. Es ist nicht so, dass er etwas gegen alte Leute, Kinder oder Menschen im Allgemeinen hätte. Aber er empfindet uns allesamt als anstrengend und tut sich im Umgang mit unserer Spezies schwer. Sebastian vergräbt sich lieber in seinen Büchern und beschäftigt sich mit dem Transzendentalen als sich mit den Leuten über vermeintliche Banalitäten zu unterhalten. Er würde die Menschen lieber über das Wesen des Heiligen Geistes belehren, als sich ihre Eheprobleme oder Anekdoten aus ihrer Kindheit anzuhören.
Letzteres ist jedoch genau das, was die Mitglieder seiner Gemeinde von ihm erwarten. In den meisten Fällen, mit denen Sebastian in seinem Beruf konfrontiert wird, kommt es einfach nur darauf an zuzuhören, aufrichtiges Interesse zu zeigen, einen verständnisvollen Händedruck oder ein Lächeln zu schenken. Sebastian aber mag das nicht akzeptieren. Er hat mich einmal gefragt, wofür er denn all die Jahre studiert habe, wenn es am Ende auf nicht mehr als das ankommen solle. Ich konnte ihm keine Antwort darauf geben, die ihn zufriedengestellt hätte oder besser gesagt, die er hören wollte, und so quält er sich weiterhin zu den Leuten und diese plagen sich mit ihm.
Nachdem er gegangen ist, wende ich mich seufzend dem Waschkorb zu, den wir gestern aus Erzert mitgebracht haben. Er enthält Omas gesammelte Rentenbescheide, Versicherungsunterlagen, Zeitschriftenabonnements sowie die Rechnungen sämtlicher Anschaffungen der letzten zwanzig Jahre.
„Die muss man aufbewahren, wegen der Garantie“, pflegte sie zu sagen.
Zum Glück hat sie die Papiere ordentlich abgeheftet, sodass es nicht ganz so schlimm werden wird, sich hindurchzuarbeiten, wie wenn alles aus einem einzigen Chaos bestünde. Trotzdem fällt mir eine ganze Liste von Dingen ein, die ich jetzt lieber täte.
Ich gehe in Sebastians Arbeitszimmer und kopiere mehrfach Omas Sterbeurkunde. Dann mache ich mir eine Aufstellung all der Institutionen, die in den Ordnern auftauchen und an die ich eine der Kopien verschicken muss. Gerade als ich mich frage, ob der „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises“ wohl auch einen Sterbenachweis benötigt, klingelt es an der Wohnungstür.
Die Unterbrechung kommt mir alles andere als ungelegen, zumal ich ahne, wer vor der Tür steht. Ich öffne und finde zu meiner Freude meine Vermutung bestätigt. Vor mir steht Ariela, Gunthers Verlobte. „Verlobt“ ist die übliche Umschreibung unverheirateter Geistlicher, um zu legitimieren, dass sie ohne Trauschein Sex haben. Auch wenn es bei uns Protestanten kein Zölibat gibt und unsere Sexualmoral im Vergleich zu den Katholiken vielleicht etwas lockerer erscheinen mag, so wird es von der Kirche trotzdem gern gesehen, wenn sich das geistliche Personal nach außen hin ein wenig konservativ gibt.
Aus diesem Grund wohnen Ariela und Gunther auch bloß halboffiziell zusammen in der zweiten Dienstwohnung oben unter dem Dach des Gemeindezentrums. Sie hängen es nicht an die große Glocke, um bei Gemeindemitgliedern mit altmodischen Ansichten kein allzu deutliches Murren hervorzurufen.
Bei den Gemeindemitgliedern nicht und auch nicht bei Sebastian. Dem gefällt es nämlich ebenfalls nicht, dass die beiden unverheiratet zusammenleben, schon allein deshalb, weil er sich sowas selbst niemals getraut hätte. Aber netterweise hüllt er sich zu diesem Thema weitgehend in Schweigen, entgegen seiner sonstigen Gewohnheit, sei es, weil ich mich mit Gunther und Ariela angefreundet habe oder bloß, weil sie sich zweifellos stets so diskret wie irgend möglich verhalten, sodass tatsächlich kaum jemand davon weiß.
Auf Arielas Arm kräht mir Chiara entgegen und streckt ihre Ärmchen nach mir aus.
In den Augen besagter Gemeindemitglieder ist die Kleine der zweite Fleck auf Gunthers ansonsten reiner Weste. Chiara ist nämlich nicht sein eigenes Kind, sondern ein Überbleibsel aus einer früheren Beziehung von seiner Verlobten. Das ist für Gunther aber kein Grund, sie zu verstecken. Im Gegenteil, er ist ziemlich vernarrt in sie, was ich sehr gut verstehen kann. Mir geht es genauso. Wer Chiara und ihre runden, braunen Kulleraugen sieht, der muss ihr einfach zu Füßen liegen.
Chiara und ich kennen uns gut. Ich passe häufiger auf sie auf, wenn ihre Mama zur Uni muss. Und gerade im Moment muss sie sehr oft dorthin, denn sie paukt für ihre nächste Prüfung.
„Hallo Ellis! Ich weiß, dass ich uns nicht angemeldet habe und dass du jetzt vielleicht andere Dinge um die Ohren hast“, beginnt Ariela sichtlich zerknirscht, „aber Gunther hat heute Termine und ich muss dringend nochmal in die Uni.“
„Hallo, meine Süße! Das ist aber schön, dass du zu mir kommst“, wende ich mich an Chiara und unterbreche damit den Redeschwall meiner Freundin. Ich nehme die Kleine aus ihren Armen, was sich beide bereitwillig gefallen lassen.
Ariela seufzt erleichtert auf.
„Du weißt doch, dass ich zu Hause bin und sehr gerne auf die Kleine aufpasse – mit und ohne Anmeldung!“, sage ich zu ihr.
„Ich dachte ja auch bloß, dass du noch zu tun hast, wegen der Beerdigung gestern“, erklärt sie.
„Nichts, was sich nicht aufschieben lässt“, versichere ich ihr. „Und außerdem kommt mir ein bisschen Leben in der Bude jetzt gerade recht.“
„Wenn ich nachher zurück bin, kannst du mir ja mal erzählen, wie es war – natürlich nur, wenn du das möchtest.“
„Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Jede Menge alte Bekannte, viele schöne Blumen und was eine Beerdigung eben sonst noch so ausmacht“, wehre ich ab und wiederhole damit fast wörtlich die gestrige Bemerkung meiner Mutter.
Ariela setzt unterdessen das Gepäck ihrer Tochter in unserer Diele ab, wobei ihr offenes, langes, strohblondes Kringelhaar in alle Richtungen fliegt.
„Hier sind frische Windeln und Feuchttücher, eine komplette Garnitur zum Wechseln und ihre Giraffe. Hier ist das Schnuffeltuch. Und in der anderen Tasche findest du ihre Kekse, die Trinkflasche, ein paar Spielzeuge …“, rattert sie dabei herunter. Sie ist nervös, weil Nervosität angesichts der sich nähernden Prüfung derzeit zum Dauerzustand bei ihr gehört. Sie futtert den ganzen Tag über Süßes, ist dabei aber schrecklich dünn, weil sie permanent auf hundertachtzig läuft. Ihre Jeans in Größe 34 engt sie nicht im Geringsten ein, es ist sogar noch so viel Luft darin, dass sie ihr Shirt mit in den Hosenbund gesteckt hat.
Ich eile in die Küche und komme mit einem Brötchen vom Frühstückstisch zurück, das ich ihr in die Hand drücke.
„Hier, iss was!“
Sie grinst dankbar und beißt herzhaft hinein, um dann in ihrer Tirade mütterlicher Anweisungen fortzufahren.
„Alles, wie immer“, unterbreche ich ihren Wortschwall zum zweiten Mal und nicke beruhigend. „Wir machen das schon, nicht wahr, Chiara?“
Chiara brabbelt etwas Unverständliches, was als Zustimmung durchgehen kann.
Ariela verstummt und lächelt.
„Ich weiß ja, dass ihr das prima hinbekommt. Danke, nochmals, Ellis. Du hast wirklich etwas bei mir gut.“ Sie drückt der Kleinen einen hastigen Kuss auf die Wange und eilt die Treppe hinunter.
„Wiedersehen, Mami.“ Wir winken ihr beide vergnügt hinterher und schwenken dabei Chiaras blaue Frotteegiraffe, die ich ihr genäht habe, als sie vor einem knappen Jahr in ihrer Babyschale in Gunthers Wohnung einzog.
Sobald ihre Mutter verschwunden ist, beginnt für Chiara, die Giraffe und mich ein vergnüglicher Vormittag mit Versteckspielen in unserer Wohnung und anschließendem, mittäglichem Pfannkuchenbacken.
Als Ariela am späten Nachmittag wiederkommt, ist ihr Kind mit der Giraffe im Arm auf meinem Sofa eingeschlafen.
Ich lade die sichtlich abgekämpfte Mama zu einer Tasse Kaffee ein, die uns beiden gleichermaßen guttun wird.
Ariela nimmt die Einladung an und lässt sich mit einem erleichterten Seufzer auf einen meiner Küchenstühle fallen, von dem sie durch die offenstehende Wohnzimmertür ihre schlafende Tochter beobachten kann.
„Du würdest eine ganz tolle Mama abgeben, Ellis. Warum habt ihr eigentlich keine Kinder, Sebastian und du?“, fragt sie mich, als ich ihr den Kaffee einschenke.
Fast hätte ich die braune Flüssigkeit daneben geschüttet, fange mich aber schnell wieder und antworte schulterzuckend: „Tja, klappt halt nicht.“
Sie hat trotzdem bemerkt, dass sie mir mit ihrer Bemerkung zu nahegetreten ist, und errötet ein wenig, als sie sich entschuldigt:
„Entschuldige. Das war wohl echt unsensibel von mir, so blöd zu fragen. Ich bin ein echter Trampel.“
Ich möchte nicht, dass ihr die Situation peinlich ist, und ich nehme ihr ihre Bemerkung auch gar nicht übel. Wir haben uns gleich von der ersten Begegnung an gemocht und seitdem einiges miteinander unternommen, aber wir kennen uns nicht lange genug, als dass sie es wissen könnte. Deshalb beeile ich mich, ihr zu erklären:
„Weißt du, wir wünschen uns Kinder. Am liebsten einen ganzen Stall voll. Aber es funktioniert nicht.“
„Das tut mir leid“, sagt sie mitfühlend und noch immer verlegen. „Habt ihr denn schon einmal darüber nachgedacht, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen? Weißt du, die Reproduktionsmedizin ist heute schon so weit …“, beginnt Ariela, die angehende Ärztin.
„Natürlich haben wir das“, winke ich ab und bemühe mich, dabei nicht ungeduldig zu wirken. Sie kann schließlich nicht wissen, welche jahrelange Odyssee ich hinter mir habe, nur um von jedem Gynäkologen immer wieder dasselbe zu hören.
„Das Problem ist bei uns auch nicht, dass ich nicht schwanger werden könnte“, erkläre ich, „sondern dass ich jedes Mal nach ein paar Wochen eine Fehlgeburt erleide. Warum das so ist, hat bisher kein Arzt herausgefunden. Alle sagen, dass Fehlgeburten sehr häufig vorkommen und es in den meisten Fällen keinen ersichtlichen Grund dafür gibt. Dass es also, um es kurz zu sagen, reine Glückssache ist, ob eine Schwangerschaft so lange besteht, bis es zur Geburt kommt oder eben nicht.“
Ich habe die Kanne inzwischen zur Seite gestellt und rühre mir nun schweigend Milch in meinen Kaffee, um meiner Freundin Zeit zu geben, das Gehörte zu verdauen.
„Das tut mir leid“, wiederholt sie. „Entschuldige meine dumme Fragerei.“
Ihre letzte Bemerkung wische ich mit einer lässigen Handbewegung fort. Dafür muss sie sich nun wirklich nicht entschuldigen. Um ihre Verlegenheit endgültig zu zerstreuen, versuche ich witzig zu sein.
„Na ja, man muss das alles positiv sehen. Es spart jede Menge Verhütungsmittel.“
Ariela tut mir den Gefallen und lächelt.
5
River Deep Mountain High
Der Oktober geht zu Ende und beschert uns zum Abschied ein paar letzte sonnige Tage. Es ist die Zeit im Jahr, wenn die Grenze zwischen Licht und Schatten besonders hart ist und die klare Luft die Welt in HD-Qualität erstrahlen lässt: Das Laub an den Bäumen leuchtet mit einem Mal golden, und sogar der meist graue Rhein trägt in diesen Tagen einen Hauch Blau in seinem Wasser.
Viele Menschen schwärmen vom „goldenen Oktober“. Er lockt sie nach draußen, um die vermeintlich letzten Sonnenstrahlen des Jahres noch einmal in sich aufzunehmen, bevor die trübe Zeit des Winters anbricht. Mir selbst geht es nicht anders. Ich ertappe mich dabei, dass ich häufiger aus dem Fenster sehe und den alten Leuten, Radfahrern, Joggern und kleinen Kindern auf ihren Laufrädern nachblicke, die an unserer Wohnung vorbei in Richtung Rheinufer streben, um dort, jeder in seinem Tempo, zu bummeln. Ich verspüre den Drang, es ihnen gleichzutun. Trotzdem mag ich solche sonnigen Herbsttage nicht uneingeschränkt, wird dieses vermeintliche Geschenk der letzten Sonnenstrahlen doch gleichzeitig von der stummen Warnung begleitet, dass die angenehme Jahreszeit alsbald vorbei ist. Diese Warnung erfolgt immer dann, wenn man aus der wärmenden Sonne in den Schatten tritt und dort schlagartig zu frieren beginnt.
Hoffentlich scheint die Sonne auch noch heute Nachmittag, wenn die Jungschar-Gruppe vorbei ist, überlege ich, während ich die Spülmaschine ausräume. Oder ich verlege das Treffen kurzerhand nach draußen und wir verbringen einfach mal unsere gemeinsame Zeit am Rhein? Frische Luft würde den Teenies bestimmt nicht schaden.
„Das Jungschar-Treffen fällt aus. Ich habe die Gemeindesekretärin gebeten, sämtliche Termine für heute abzusagen.“ Sebastian steht in der Küchentür und grinst mich schelmisch an.
„Warum? Was ist los?“, frage ich überrascht.
„Nix ist los. Außer, dass draußen die Sonne scheint und mir bei diesem Anblick der Gedanke kam, dass du und ich uns mal eine Auszeit verdient haben. Also habe ich uns beiden für heute freigegeben.“ Sein Grinsen wird noch breiter. „Wie sieht’s aus? Hast du keine Lust auf einen Ausflug bei dem schönen Wetter?“
„Doch, sehr!“, nicke ich und merke, wie sich Vorfreude und Neugier in mir breitmachen. „Wohin fahren wir denn?“
„Das verrate ich nicht.“ Er freut sich sichtlich, es für mich spannend zu machen. „Nur so viel: Zieh dir bequeme Schuhe an!“
„Wir gehen wandern?“, freue ich mich. Früher sind wir häufig gewandert, haben uns an freien Tagen ins Auto gesetzt und sind an die Mosel, an die Ahr oder in die Eifel gefahren, um die Gegend zu Fuß zu erkunden.
Er wiegt den Kopf hin und her.
„Na ja, eher ein ausgiebiger Spaziergang“, schränkt er ein.





























