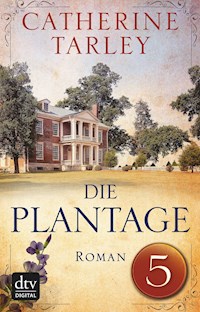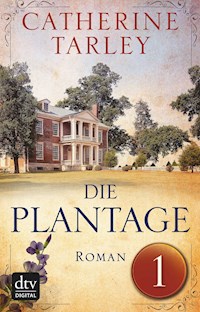
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kostenlos: das erste eSequel des Bestsellers Das große Südstaatenepos als eSequel in 5 Teilen. South Carolina 1783, kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg. Die junge Witwe Antonia Lorimer lebt alleine auf ihrer vom Krieg beschädigten Plantage Legacy. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Plantage wieder instand zu setzen und einen schwer verwundeten britischen Colonel gesund zu pflegen: William Marshall. Dass in den Kriegswirren ausgerechnet er ihren Mann Henry erschossen hat, weiß die junge Frau nicht und verliebt sich in den Colonel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
CATHERINE TARLEY
DIE PLANTAGE
Teil 1
Roman
Für Emily und Colin
Die Geschichte des Kriegers
Eine Legende des Otter-Stammes
Ein Krieger tötete einen schwachen Mann, so zerstörte er das Gleichgewicht der Welt. Die Götter in ihrem Zorn sandten die Dämonen der Finsternis, ihn für den Frevel zu bestrafen. Die Dämonen marterten ihn, und der Wind trug seine Klage über das Land. Die Frau des Getöteten aber hatte Mitleid und bat die Götter um Gnade. Da erließen ihm die Götter den Martertod. Zur Sühne sollte er die Lebensaufgabe des schwachen Mannes erfüllen. So vergrub er seine Waffen, nahm die Frau zur Gefährtin und erfüllte das Leben des anderen. Die Dämonen blieben bei ihm, um ihn zu erinnern.
I. Ankunft
Nacht. Sterne. Schmerzen. Ich bin verwundet … ich sterbe. Zwischen Gefallenen lag er auf dem nächtlichen Schlachtfeld, ein geschundener Körper mit zahllosen Verletzungen. Das Atmen fiel ihm schwer, jede Bewegung löste Qualen aus. Er verlor immer wieder das Bewusstsein. Aber der schmale Grat, der das Leben vom Tode trennt, war noch nicht überschritten.
Endlich erwachte er aus seiner totengleichen Erstarrung, und als gälte es, noch Schlimmerem als den Schmerzen zu entkommen, zog er sich, auf die Unterarme gestützt, in mühseligen Etappen einen Hang hinunter. Ein- oder zweimal berührte er in der Dunkelheit einen leblosen Körper, während er zur Talsenke kroch, angetrieben von der dumpfen Hoffnung, am Fuß des Abhangs an Wasser zu kommen.
Am anderen Morgen fand ihn sein Pferd am Rand eines schlammigen Rinnsals. Es blies ihm den warmen Tieratem ins Gesicht und vermittelte ihm die einfachste Form von Wirklichkeit: am Leben zu sein.
Irgendwie war es ihm gelungen, in den Sattel zu kommen. Seither trottete das Pferd dahin, blieb dann und wann stehen, um am Wegrand Gras oder Blätter von herabhängenden Zweigen zu fressen, an einem Bach zu trinken oder auszuruhen. Der Mann hielt sich im Sattel, meist lag er vornübergebeugt auf dem Hals seines Pferdes. Wenn er bei Bewusstsein war, trieb er es mit schwachem Schenkeldruck an, damit es in Bewegung blieb und weiter gen Süden ging.
Er hatte keine genaue Vorstellung, wie lange er unterwegs war oder wie weit er gekommen sein mochte. Seit Einbruch der Dämmerung folgte das Pferd einem breiten Flusslauf. Sie mussten das Plantagenland des Lowcountry erreicht haben.
Als er später in der Nacht wieder zu sich kam, war das Pferd stehen geblieben. Ringsum war es still. Er atmete den Staubgeruch trockener Spreu, anscheinend war das Pferd in einen leeren Stall gelaufen. Entkräftet ließ er sich aus dem Sattel gleiten, fiel zu Boden und verlor vor Schmerz fast die Besinnung. Schließlich schaffte er es, zur Stallwand zu kriechen und sich halb sitzend anzulehnen. Mit der unverletzten Linken zog er den Säbel. Den Griff der Waffe fest umschlossen, fielen ihm die Augen zu.
Es konnte nicht viel Zeit vergangen sein, als ihn das Geräusch von Schritten aufschreckte. Dann sah er Licht. Auf den Säbel gestützt, stemmte er sich hoch, dabei jagten von dem gebrochenen Bein grelle Schmerzen durch seinen Körper. Er biss die Zähne zusammen, um nicht laut aufzustöhnen. So stand er im Dunkeln und wartete.
II. Legacy
1.
Kühle Nachtluft wehte durch die Fenstertüren. Ein paar Blätter flogen vom Schreibtisch auf und schwebten kreiselnd zu Boden. Antonia hob sie auf, legte sie zu einem kleinen Stapel zusammen und stellte die Petroleumlampe aus geschliffenem Bleikristall darauf. Sie schraubte den Docht höher und nahm den Brief, den sie gelesen hatte, wieder zur Hand. Auf der Hälfte der Seite hielt sie inne, sah zum Fenster, horchte – nein, da war nichts, nur der nächtliche Gesang der Frösche, der von den Bewässerungsgräben in den Reisfeldern aufstieg und den der Wind herübertrug.
Sie zog das Schultertuch fester und schlang die Enden zu einem Knoten, ehe sie weiterlas. Plötzlich fuhr eine starke Windbö durch den Raum. Die Flamme blakte im Glaszylinder, die Fensterflügel schlugen laut aneinander. Schnell breitete sie die Arme über die Papiere, damit nicht alle vom Schreibtisch geweht wurden. Sie wollte aufstehen und die Fenster schließen, zögerte aber und ließ sich resigniert in den Stuhl zurückfallen. Was machte es für einen Unterschied, ob die Fenster geschlossen waren oder nicht? Der Raum vor ihr lag in Trümmern, die Außenmauer war an der Nordseite niedergebrochen, die hohe Decke mit den eleganten Stukkaturen zur Hälfte eingestürzt. Zwischen den rußgeschwärzten Wänden türmten sich Schutt und verbranntes Gebälk. Was das Feuer nicht zerstört hatte, war seit Monaten Wind und Wetter ausgesetzt.
Sie blickte durch den verwüsteten Saal, in dem vor dem Krieg ihre Bibliothek untergebracht gewesen war. Auch wenn der Großteil der Sammlung gerettet werden konnte, waren doch viele wertvolle Bände verbrannt. Ringsum standen noch die Gestelle der Büchertruhen, doch was von der aufwendigen Ausstattung des Raumes übrig war, zerfiel jeden Tag mehr. Die Vertäfelung war weitgehend zerstört, ausgebrannte Wandschränke lagen umgestürzt mit zerbrochenen Scheiben am Boden. Nur der Schreibtisch, ein solides englisches Möbelstück, hatte den Flammen getrotzt. Antonia hatte ihn in den unversehrten Teil des Raumes geschoben, um sich hier mit einem Berg unerledigter Post niederzulassen.
Eine Bibliothek unter freiem Himmel – was für eine Ironie! Vor ihren Augen wurde nach und nach zunichte, was für ein paar Jahre das Herzstück ihres Lebens gewesen war; wurde zunichte wie ihre Vorstellung von einer besseren Welt. Sie wusste, es war falsch, so zu denken, jetzt, da sich das Blatt endlich wendete und wieder Hoffnung bestand. Sie würden den Krieg gewinnen, die Ideale, an die sie immer geglaubt hatte, würden dem Land endlich den Frieden bringen. Enlightenment – die Aufklärung! In Europa erdacht, würde sie in Amerika Früchte tragen, diese Erleuchtung des Geistes, die auch Antonia wie so viele andere Menschen inspiriert und gelehrt hatte, freiheitlich zu denken.
Henry hatte sie deswegen geliebt. Er hatte ihren Enthusiasmus bewundert, ihren Glauben an ein Gesellschaftskonzept der Freiheit und Menschlichkeit bestärkt und seine Visionen mit ihr geteilt. Und sie hatte ihn geliebt, vielleicht mehr, als sie einen so leidenschaftslosen Mann hätte lieben sollen. Niemand war ihr je so nah gewesen. Wie hatten sie sich nur entfremden können? Mit dem Niedergang der Plantage fing es an. Henrys anspruchsvolle Projekte, seine Misswirtschaft und ein unbekümmerter Lebensstil hatten sie innerhalb weniger Jahre ruiniert. Antonia machte ihm nie einen Vorwurf, doch ihre Enttäuschung blieb ihm nicht verborgen. Er konnte es nicht verwinden, in ihren Augen versagt zu haben. So begann er, ihr aus dem Weg zu gehen, suchte Bestätigung in fragwürdiger Gesellschaft und militärischen Abenteuern; dabei fand er den Tod.
Sie seufzte und legte den Brief ungelesen zu den übrigen Papieren, größtenteils unbezahlte Rechnungen oder Mahnungen, auch Gebote von Spekulanten, die zu Schleuderpreisen Plantagenland aufkauften, das die Grundbesitzer nicht mehr bewirtschaften konnten. Manche, die sich für ihr Anwesen interessierten, kannte sie gut, es waren Nachbarn, früher Freunde von Henry, die mit ihm zur Jagd geritten und in ihrem Haus zu Gast gewesen waren. Jetzt, nach seinem Tod, schienen sie nur darauf zu warten, dass Antonia ihnen die alte Plantage am Plains River überließ.
Das alles war wenig ermutigend. Dennoch, sie hatte den Krieg überlebt, nur das zählte! Sie hatte sich in Sicherheit gebracht und gewartet, bis die Soldaten weiterzogen und der Sturm vorüber war. Nun war sie zurückgekehrt, um ihr Haus wieder aufzubauen und die Felder instand zu setzen. Sie würde alles daransetzen, die Plantage zu behalten. Niemals, das hatte sie sich geschworen, würde sie ihr Land irgendwelchen Kriegsgewinnlern überlassen. Entschlossen schob sie alle Papiere zusammen und legte den Packen in ein Schubfach des Schreibtischs.
Da war es wieder! Diesmal war sie ganz sicher, etwas gehört zu haben. Sie trat an eine Fenstertür und horchte. In der Dunkelheit draußen war nichts zu erkennen, aber sie konnte jetzt deutlich ein Geräusch von den gewohnten Lauten der Nacht unterscheiden: Schleppende, schwere Schritte, die sich dem Haus näherten, für einen Augenblick auf Höhe des Eingangs verhielten, um sich dann den Hang hinunter zum Wirtschaftshof zu entfernen. Ein Pferd! Vermutlich lief das Tier seiner Nase nach geradewegs zu den Stallungen. Nicht viele Pferde hatten den Krieg überlebt, auch dieses schien am Ende seiner Kräfte zu sein. Sie sollte versuchen, es einzufangen, für die Arbeit auf den Feldern würde sie jedes Zugtier brauchen.
Die Nacht duftete nach Jasmin, als sie mit einer Laterne in der Hand aus dem Haus trat und die neunzig Yards zum Wirtschaftshof ging. Früher standen in ihren Stallungen zwei Dutzend Arbeitspferde, dazu einige erstklassige Karossiers und die Reitpferde der Lorimers. Doch die Rotröcke hatten die besten Pferde gestohlen, und später hatten die Continentals alle noch verfügbaren Tiere requiriert. Seit Monaten war das Stallgebäude verlassen.
In dem offenen Doppeltor hob sie die Laterne über ihren Kopf und spähte ins Innere. Sie hörte leises Schnauben, das Scharren von Hufen, und trat ein. Im Lichtschein entdeckte sie die große, massige Gestalt des Pferdes, gesattelt und aufgezäumt stand es bei einem leeren Stallabteil, wo es in der staubigen Spreu nach Futter gesucht hatte. Nun hob es den Kopf. Der Lichtschein spiegelte sich in seinem goldenen Auge.
»Ruhig, mein Großer, alles ist gut«, sagte sie sanft und ging näher.
Es war ein eindrucksvolles Tier, ein Hengst von überhohem Stockmaß. Er beugte den muskulösen Hals, als sie herantrat und ihm mit der freien Hand durch die Mähne und über den Widerrist strich. Sein schwarzes Fell war von Schlamm und Blut verkrustet. Sie hob die Laterne, um sich das Zaumzeug genauer anzusehen. Die aufwendig gearbeitete Kandare mit Silberverzierungen an Kinn- und Stirnriemen war bestes englisches Handwerk, ebenso der schwere Militärsattel mit den weit ausschwingenden Sattelblättern. In einer der Satteltaschen fand sie zwei Pulverhörner und einen Beutel mit Bleikugeln, in der anderen steckte ein Holster mit zwei Pistolen. Sie nahm den Holster mit den Waffen heraus und legte ihn auf den Boden.
Hatte es nicht geheißen, die Kämpfe in dieser Gegend seien vorüber? Die Briten befanden sich auf dem Rückzug. Während die amerikanischen Truppen und Milizen aus Carolina und Virginia sie in Eilmärschen verfolgten, verschanzten sie sich in ihren Stützpunkten im Norden in der Hoffnung, sich mit General Clintons Armee zu vereinigen. Wie aber kam dann dieses voll aufgezäumte englische Kavalleriepferd hierher?
Das Tier schob hungrig das Maul in Antonias Hand. Sie streichelte ihm begütigend über die Nüstern; gleich würde sie Futter holen, doch zuvor wollte sie ihm den schweren Sattel abnehmen. Um beide Hände frei zu haben, stellte sie die Laterne auf den Boden. Als sie sich wieder aufrichtete, bemerkte sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Sie wagte nicht, sich umzusehen, doch ihr Herz schlug immer schneller, während sie mit mechanischen Handgriffen anfing, die Schnallen des Sattelgurts zu lösen. Und auf einmal bemerkte sie auch den Geruch: Die Ausdünstungen des warmen Pferdekörpers hatten ihn zunächst überdeckt, nun erkannte sie den brandigen Gestank nach Blut und Pulverrauch, der so viele Wochen die Luft über dem Landstrich verpestet hatte. Er weckte Erinnerungen an Geschützdonner, an die Schreie der Soldaten, an brennende Häuser und fliehende Menschen, an Sterbende und Tote. Wer immer dort im Dunkeln hinter ihr stand, ihn umgab der Geruch des Todes.
Angst wallte wie Übelkeit in ihr auf. Um nicht die Nerven zu verlieren, sprach sie beruhigend auf das Pferd ein. Als sie den losen Sattel mit beiden Händen packte, um ihn vom Pferderücken zu nehmen, wurde sie sich seines beträchtlichen Gewichts bewusst und erkannte ihre Chance: Sie spannte Arme und Schultern, atmete tief ein, und dann schwang sie den schweren Sattel in einer fließenden Bewegung über die Kruppe des Pferdes und schleuderte ihn mit aller Kraft hinter sich.
Der massive, holzverstärkte Sattelbug traf den Mann aus nächster Nähe, rammte ihm gegen Brustbein und Solarplexus. Ein Steigbügel schlug ihm an die Schläfe, ehe die Wucht des Aufpralls ihn gegen einen Stützpfeiler warf und er leblos zu Boden sank. Blut rann aus einer Schläfenwunde und aus seinem Mundwinkel. Als Antonia die Laterne über ihn hielt, glaubte sie, er sei tot.
2.
Im Januar 1781, nach Henrys Tod und nachdem ihre Plantage durch einen Anschlag britischer Truppen unbewohnbar geworden war, hatte Antonia bei ihrer Schwester Lydia im besetzten Charles Town Zuflucht gefunden. Inzwischen waren Monate vergangen. Der Revolutionskrieg hatte seinen erbitterten Höhepunkt überschritten, und das Gros der Invasionsarmee war nach Virginia abgezogen. Aber noch immer hielten britische Regimenter Charles Town und die Forts um die Stadt besetzt.
Während Lydia es verstand, sich eigennützig mit den Besatzern zu arrangieren, war Antonia es gründlich leid, in Gesellschaft der arroganten britischen Offiziere gute Miene zu wahren. Nachdem man sie schließlich mit anderen rebellisch gesinnten Bürgern gezwungen hatte, der öffentlichen Hinrichtung des berühmten Milizkommandeurs Hayne beizuwohnen, verließ sie die Stadt und verbrachte den Rest des Sommers zurückgezogen in ihrem Elternhaus auf Prospero Hill.
Ihr Großvater hatte das große Haus auf dem Hügel mit den prächtigen, über zwei Stockwerke reichenden Kolonnaden zu Anfang des Jahrhunderts erbaut. Von den Eingangsstufen reichte der Blick über die weite Ebene der Reisplantagen hin zum trägen Lauf des Cooper River, der in der Abendsonne aufleuchtete wie ein verschlungenes Band aus Gold.
Vier Generationen zuvor waren die Bells nach Carolina gekommen, anglikanische Auswanderer, die auf der Flucht vor Cromwells Truppen ihre Heimat in Südengland hatten verlassen müssen. Hatte der erste Robert Bell noch eigenhändig das Land um seine moosverfugte Blockhütte am Steilufer des Plains River gerodet, so wurde der dritte Robert Bell, Antonias Vater, einer der erfolgreichsten Pflanzer des Lowcountry. Er arrondierte das Farmland zwischen Cooper und Plains River zu einem stattlichen Besitz und wurde durch die Erträge seiner Reis- und Indigoplantagen ein reicher und geachteter Mann. Der Erfolg jedoch war überschattet von persönlichem Leid. Seine Frau Catherine und die beiden Söhne starben 1753 an Pocken. Um seine kleinen Töchter Diane und Lydia nicht mutterlos aufwachsen zu lassen, heiratete er wieder, aber auch seine zweite Frau Adela starb nach Antonias Geburt 1755 im Kindbett.
Robert Bells älteste Tochter Diane heiratete den ehrgeizigen Theodore Hocksley, Bells Kommissionär und späterer Stellvertreter. Als Bell 1773 einem Lungenleiden erlag, erbte Diane den gesamten Grundbesitz. Nun war Hocksley der Herr auf Prospero Hill. Bells zweite Tochter Lydia erbte das Elternhaus ihrer Mutter in Charles Town, Lyndon House, mit den dazugehörigen Gärten im Marschland westlich des Cooper River. Die Pachten für das Gartenland ermöglichten Lydia einen großzügigen Lebensstil. Selbstverständlich erwarben die Schwestern auch die Sklaven, die auf den Besitzungen lebten.
Antonia, die Jüngste, bekam als Vermächtnis ihres Vaters eine kleine Reis- und Indigopflanzung am Plains River. Antonia und ihr Mann Henry Lorimer gaben der Plantage den Namen Legacy.
Zu Ehren von Antonias Geburtstag hatte ihre Schwester Diane am letzten Tag des August 1781 auf Prospero Hill eine Dinnerparty gegeben. Es waren Leute ihres gesellschaftlichen Ranges gekommen, Bekannte der Bells und der Hocksleys. Durch den Krieg sah man bei gesellschaftlichen Anlässen immer auch Offiziere. So hatte Diane an diesem Abend einen Captain der South Carolina Militia eingeladen, Algernon Reed, einen vermögenden Junggesellen von Anfang dreißig, dem eine Plantage am Ashley River gehörte. Antonia war ihm bisher noch nicht persönlich begegnet. Doch ihr verstorbener Mann Henry Lorimer war mit ihm befreundet gewesen und auf Reeds Drängen in die Miliz eingetreten. Die letzten Monate seines Lebens hatte Henry meist in Reeds Gesellschaft verbracht. Nach allem, was Antonia zu Ohren gekommen war, hatten die Freunde sich die Zeit zwischen ihren militärischen Einsätzen an den Spieltischen und in den Bordellen der Stadt vertrieben. Als Antonia Captain Reed vorgestellt wurde, begegnete sie ihm mit einer gewissen Skepsis.
Reed, heimgekehrt von den letzten Rückzugsgefechten gegen die Briten in South Carolina, war der Held des Abends; er führte Antonia zu Tisch. Elegant, zuvorkommend, ein feiner Mann mit tizianroten Locken und einer rhetorischen Begabung, gelang es ihm, alle brillant zu unterhalten, ohne seine Tischdame dabei zu vernachlässigen. Von den heimatliebenden Gästen bestürmt, schilderte er die Kämpfe der Milizen gegen die britischen Divisionen und lobte den Mut und die Unerschrockenheit seiner Leute.
»Meine Männer haben den königlichen Truppen tapfer die Stirn geboten und ihrer Übermacht widerstanden. Und so, meine Herrschaften, ist es uns endlich gelungen, die Rotröcke aus Carolina hinauszujagen!« Er stand auf und erhob sein Glas: »Auf die siegreiche South Carolina Militia! Gott schütze Amerika, Land der Freiheit, Heimat der Tapferen!«
»Gott schütze Amerika!«
»Auf die Freiheit!«