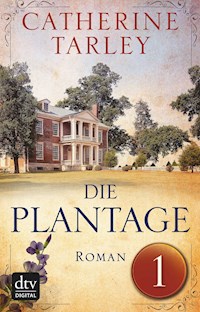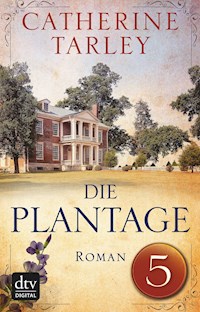1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das vierte eSequel des Bestsellers Das große Südstaatenepos als eSequel in 5 Teilen. South Carolina 1783, kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg. Die junge Witwe Antonia Lorimer lebt alleine auf ihrer vom Krieg beschädigten Plantage Legacy. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Plantage wieder instand zu setzen und einen schwer verwundeten britischen Colonel gesund zu pflegen: William Marshall. Dass in den Kriegswirren ausgerechnet er ihren Mann Henry erschossen hat, weiß die junge Frau nicht und verliebt sich in den Colonel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
CATHERINE TARLEY
DIE PLANTAGE
Teil 4
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Für Emily und Colin
VIII. Oliver Roscoe
33.
Die Tristar fuhr hart am Wind. Von der aufgewühlten See emporgehoben, wies ihr Bugspriet wie ein Speer gegen den Himmel. Gleich darauf neigte sich der Schiffsrumpf wieder steil hinab, in rasender Fahrt zwischen anrennenden Wellenbergen. Von Luv kamen immer neue schwarzblaue Wogen, stiegen wie glasige Wände neben dem Schiff auf und schienen für wenige Sekunden zu verharren, ehe sie sich zu einer kalten Umarmung beugten und ihre Wassermassen auf das Deck stürzten.
Ein Mann stand mit einem Tau gesichert auf dem Achterdeck. Im schwarzen Bootsmantel, den Kragen übers Kinn hoch geschlossen, stemmte er sich gegen die Heckgalerie. Seine Hände wurden vom kalten Salzwasser wund, indem er das Geländer umklammert hielt und mit breitem Stand die Bewegung des Schiffs abfing. Hereinbrechende Seen gingen auf ihn nieder, als wollten sie ihm die Knochen zerschlagen. Doch er würde die Brücke nicht verlassen, um unter Deck Schutz zu suchen. Entschlossen, den Sturm bis zum Ende durchzustehen, verlangte er nichts als ein Tau zur letzten Rettung, falls ihn die Kräfte verließen.
Der Mann musste verrückt sein!
Das Wasser fand den Weg überallhin, in die Offizierskammern, in die Quartiere der Besatzung vor dem Mast. Abwechselnd standen zwei Mann an der Lenzpumpe, der Pegel in der Bilge stieg beunruhigend schnell. Um dem Sturm die Angriffsfläche zu nehmen, wurden Segel aufgeholt und die Fahrt mit zwei Vorsegeln und dem Besansegel stabilisiert. Zum Reffen der oberen Segel mussten die Matrosen aufentern ins Rigg. Dort oben rissen die Bewegungen des Schiffs sie von Backbord nach Steuerbord, auf und ab mit dem wüsten Seegang. Auf den Rahen im brausenden Wind konnten sie die Befehle des Maats nur erahnen, der Sturm überbrüllte jeden menschlichen Laut. Der Kapitän gemahnte seine Leute an ihre Zuversicht. Jeder gab sein Bestes, während der Orkan stärker wurde und die See sich wütend aufbäumte.
Als ein Brecher die Tristar von achtern bis mittschiffs überflutete, fühlte der Mann sich wie von eisiger Faust gepackt und auf die Knie geworfen. Er schrie auf, brüllte vor Zorn, erstickte fast am zurückflutenden Wasser, das seinen Schrei ertränkte. Salzwasser auswürgend kämpfte er sich hoch, zog sich wieder auf die Füße. Er keuchte vor Anstrengung, als er sich erneut dem Sturm darbot.
Warum tat er das? Was hielt ihn davon ab, dem gesunden Menschenverstand zu folgen und sich allerspätestens jetzt in Sicherheit zu bringen? Wozu setzte er sein Leben mutwillig aufs Spiel? Nun, er war ein Spieler! Im Vertrauen auf sein Glück nahm er jedes Risiko in Kauf; so hatte er immer gelebt, und nur so hatte er überlebt. Er konnte sich nicht erinnern, dass man je auf ihn Rücksicht genommen hätte, darum tat er es auch nicht. Weil er nie gelernt hatte, vorsichtig zu sein, betrachtete er sein Leben als riskanten Zeitvertreib. Und wer im Spiel bleiben wollte, musste bereit sein, bei jedem Einsatz mitzugehen. Jung an Jahren, war er schon an einen Punkt gelangt, da das Leben für ihn nur in höchster Gefahr einen Sinn bekam. Spielen war alles und alles ein Spiel, also setzte er sein Leben. Was wäre faszinierender, als um den höchsten Einsatz zu spielen!
Im ungewöhnlich heißen Frühling 1757 wurde Miguel Olivero Ruizco Martinez de Avilés als letzter Abkömmling kreolischer Aristokraten in Spanisch-Florida geboren. Seine Vorfahren stammten aus Kastilien, Ramon Rodriguez Martinez de Avilés kam Anfang des sechzehnten Jahrhunderts mit einer Expedition von Abenteurern und Goldsuchern nach Nordamerika. Sein Sohn Hernan beteiligte sich im Jahre 1565 an Menéndez’ Vernichtungsfeldzug gegen die Hugenotten und erhielt von der spanischen Krone in Anerkennung seiner Verdienste einen Adelstitel und Latifundien im Nordosten Floridas. Das Territorium der Martinez de Avilés erstreckte sich von der Atlantikküste einige Tagesritte weit ins Landesinnere und von ihrem Herrensitz Soledad bei St. Augustine hundert Meilen nach Süden. Die Familie beherrschte praktisch ein Drittel Floridas über einhundertfünfzig Jahre wie ein eigenes Königreich. Erst mit dem Ende der Vormachtstellung Spaniens in Amerika verlor sie an Einfluss, ihr legendärer Reichtum schwand dahin, und die fortschreitende Landnahme anderer Kolonialmächte setzte ihrer feudalen Herrlichkeit ein Ende. Lange bevor Florida an England fiel, war von dem gewaltigen Grundbesitz nicht mehr übrig geblieben als ein paar Hektar Weidelandes und das Stammhaus auf der Indigoplantage Soledad.
Miguels Mutter, Isabella Maria Alba Ruizco Martinez de Avilés, eine unbedarfte Frau mit seelenvollen Augen, wurde unsanft aus ihren Jungmädchenträumen gerissen, als sie nach der Blatternepidemie von 1755 allein und ohne einen Real Bargeld dastand. Von der Verantwortung für den heruntergewirtschafteten Betrieb restlos überfordert, gab sie den elterlichen Nachlass in die Obhut des Anwalts der Familie und lebte vom stückweisen Verkauf ihres Grundbesitzes. Sie wohnte auf dem verfallenden Stammsitz ihrer Vorfahren in Gesellschaft einer Aufwartefrau und ihres letzten Haussklaven Cupide, den sie aus Sentimentalität nicht verkaufen wollte. Während sie durch die leeren Räume wanderte, sehnte sie sich nach einer Heirat mit einem wohlhabenden Mann, der sie aus ihrer ereignislosen Tristesse herausholte.
Während der Parade zum Namenstag der Infantin begegnete sie auf der Promenade von St. Augustine dem bildschönen Darrel Jackson, einem berufsmäßigen Spieler, der sich nach einer erfolgreichen Saison ein paar Tage des Nichtstuns gönnte. Isabella in ihrem Verlangen nach Liebe und Glück war für einen charmanten Herumtreiber wie Jackson leichte Beute. Er brauchte kaum eine Stunde verliebter Schmeichelei, schon war es um ihr Herz geschehen. Die atemberaubende Liebe ihres Lebens währte gerade drei Monate, dann fand sich Isabella verlassen und schwanger in dem baufälligen Anwesen von Soledad wieder.
In Einsamkeit und unter Schmerzen geboren, war der kleine Miguel für seine Mutter nur eine ungeliebte Erinnerung an ihr vergangenes Glück. Der ältliche Cupide kümmerte sich um den Jungen und zog ihn mit Familiengeschichten groß. Staunend lauschte Miguel Cupides Erzählungen vom Glanz und Ruhm der Martinez de Avilés, von rauschenden Festen und eleganten Soireen aus einer Ära bevor sein Großvater, der Zeichen der Zeit zu spät gewahr, Besitz und Privilegien verloren hatte. In Miguels kindlicher Phantasie wurde die glorreiche Vergangenheit der Familie zum Ersatz für alles, was ihm im wirklichen Leben fehlte.
Indes fand Donna Isabella Wege, wie sie Darrel Jackson vergessen konnte: sie verliebte sich immer wieder aufs Neue. Männer kamen und gingen in ihrem Leben, und bald lernte Miguel, dass er nicht im Weg sein durfte, wenn seine Mutter Herrenbesuch empfing. Da Cupide im Alter ungesellig wurde, war der Junge die meiste Zeit sich selbst und seiner Langeweile überlassen. So vertat er die einsamen Tage seiner Kindheit im verwilderten Garten hinter dem Haus, in Erwartung darauf, dass Mamá abends kam und ihm vorlas.
Die Jahre vergingen. Als Miguel mit zehn Jahren immer noch wartete, dass Mamá ihm vorlas, wurde Isabella endlich seiner vernachlässigten Bildung gewahr. Es gab kein Geld für einen Hauslehrer oder ein Internat, und natürlich kam eine öffentliche Schule nicht infrage. Doch weil gerade die warme Jahreszeit begann, vergaßen sie einstweilen die Schule und fuhren ans Meer. Wie jedes Jahr logierten sie in einem Sommerhaus von Verwandten in einem ruhigen Badeort, der keinesfalls mondän hätte genannt werden können, und verbrachten die Tage mit Ausfahrten oder Spaziergängen an der Uferpromenade.
Eines Nachmittags wurde Donna Isabella auf der Terrasse eines Cafés von einem Mann mittleren Alters angesprochen, dessen gepflegtes Äußeres sie gleich für ihn einnahm. Er stellte sich vor als Alfonso de Soto, Inhaber einer kleinen Druckerei in St. Augustine. Isabella bat ihn an ihren Tisch. Señor de Soto, hocherfreut über die Gesellschaft, bestellte Tee und für den jungen Herrn Miguel Schokolade und Mengen von Kuchen und Zuckergebäck.
Man traf sich täglich. De Soto verwöhnte Miguel, wo er nur konnte. Es war nicht zu übersehen, dass er von dem Jungen fasziniert war, was nicht verwunderte. Miguel war ein schönes Kind, nicht nur im herkömmlichen Sinne: Miguel war berückend. Lange dunkle Locken, wimpernbeschattete Augen und ein makelloser, blass olivenfarbener Teint gaben seinem Knabengesicht feminine Weichheit. Sein kindlicher Körper war zartgliedrig, seine Gesichtszüge drückten eine Art frühreifen Ennui aus, der bei einem Jungen seines Alters irritierte. Er war zu jung und sich seiner Ausstrahlung nicht bewusst, das war sein Unglück.
Als de Soto vorschlug, den Jungen zum Baden mitzunehmen, stimmte Isabella gleich zu, denn es kam ihr entgegen, wenn ihr Sohn ein paar Stunden außer Haus war. De Soto unternahm mit Miguel ausgedehnte Fahrten zu den Stranddünen südlich des Badeortes. Er gab sich den Anschein eines väterlichen Freundes und umwarb den Jungen mit kleinen Beweisen seiner Zuneigung. Bald wurden seine Annäherungen direkter, und eines Nachmittags war es um seine Beherrschung geschehen. Nach dem gemeinsamen Bad im Meer zog er den Jungen an sich, stammelte Liebesworte, versuchte, ihn zu küssen. Miguel wollte sich ihm entziehen. Doch de Soto war ein kräftiger Mann, er hielt den Jungen fest, öffnete seine Schenkel und streichelte sein Geschlecht. Miguel war vor Schreck und Scham wie gelähmt. Er weinte, aber er wehrte sich nicht, als de Soto ihn auf Hände und Knie niederdrückte und seinen Körper in Besitz nahm.
Isabella sah seine Not nicht oder wollte sie nicht sehen, bedenkenlos überließ sie ihn de Soto für seine täglichen Ausfahrten. Miguel wusste nicht, wie er sich des Mannes erwehren sollte, der ihn bei jeder Gelegenheit seiner Leidenschaft unterwarf. Unfähig, sich mitzuteilen – mit wem hätte er auch reden können? –, wählte er eine kindliche Ausflucht und wurde krank. Matt lag er danieder, konnte unmöglich aufstehen oder gar das Haus verlassen. De Soto zeigte sich besorgt und wollte den Patienten besuchen. Aber Miguel mochte niemanden sehen.
Obwohl der Arzt keine Krankheitssymptome feststellen konnte, machte sich Isabella große Sorgen. Sie redete sich ein, ihr Sohn leide an einer unbekannten, womöglich lebensgefährlichen Erkrankung, und saß seufzend an seinem Bett. Als Miguel sah, wie seine geliebte Mamá seinetwegen litt, konnte er nicht mehr guten Gewissens an seiner Ausflucht festhalten und wurde gesund. Als de Soto ihn wieder zum Strand mitnehmen wollte, drängte Isabella: »Sei ein lieber Junge, Miguel, mach Don Alfonso doch die Freude!« Miguel war ein lieber Junge, er machte ihm die Freude.
Inzwischen vergötterte de Soto den schönen Knaben. Großzügig versuchte er, ihm jeden Wunsch von den Augen abzulesen, führte ihn aus und brachte ihm täglich Geschenke. Aber Miguel hatte um de Sotos Zuwendung nie gebeten. Was dieser Mann ihm über lange Zeit antat, zerstörte seine Selbstachtung und schuf Empfindungen, unter denen er verzweifelt litt: Er wurde missbraucht, und die Welt ließ es zu.
Indem er das begriffen hatte, begann sich das Verhältnis zu seinen Mitmenschen von Grund auf zu verändern. Hatte er sich als elfjähriger Junge geschämt und erniedrigt gefühlt, minderwertig selbst in den Augen de Sotos, der doch behauptete, ihn zu lieben, so entwickelte er als Heranwachsender die Vorstellung, dass nach aller erduldeten Demütigung in Zukunft er derjenige sein werde, der demütigen und missbrauchen durfte, wen immer er dazu ausersehen würde. Diese Vorstellung durchdrang sein ganzes Wesen und äußerte sich schließlich in einem auffällig aggressiven Verhalten. Miguel wurde gemein, rücksichtslos, brutal; wer ihm nahekam, dem erging es schlecht. Er verfolgte kein bestimmtes Ziel, aber er tat, was er tun musste, um jeden, der sich mit ihm einließ, seiner Willkür zu unterwerfen; nur das konnte ihn befriedigen. Später, als erwachsener Mann, sollte er seinen ahnungslosen Opfern schmerzhaft klarmachen, wie unbarmherzig Miguel de Ruizco sein konnte.
Bei allem Unglück bewahrte ihn die Begegnung mit de Soto zumindest vor der fortschreitenden intellektuellen Verwahrlosung. Als Don Alfonso bei einem Besuch auf Soledad einen Eindruck von Miguels geistlosem Alltag bekam, konnte er sein Entsetzen kaum verbergen. Unverzüglich engagierte er auf eigene Kosten einen Hauslehrer, der dreimal die Woche zur Plantage hinausfuhr und mit Engelsgeduld versuchte, die versäumte Schulbildung teilweise wettzumachen. Miguel war jedoch schwierig und sperrte sich gegen alle Lerninhalte, die nicht spontan sein Interesse weckten. Der Lehrer bemerkte allerdings eine gewisse arithmetische Begabung seines Schülers, eine Vorliebe für Zahlenspiele. Der Grund dafür lag auf der Hand: Miguel hatte das Geld entdeckt! Er entwickelte ein scharfes Gespür dafür, dass alles im Leben seinen Preis hatte, auch seine eigene Person.
Unnötig zu erwähnen, dass Miguel, kaum dass er die Zusammenhänge verstanden hatte, de Soto teuer bezahlen ließ für die Willfährigkeit, die er ihm abverlangte. Miguel verband seine Forderungen nicht mit Anschuldigungen oder gar Drohungen, vielmehr erlaubte er Don Alfonso, sich als sein Gönner zu betrachten, wobei über Art und Umfang dessen, was gegönnt wurde, selbstverständlich Miguel nach Gutdünken entschied.
Nachdem sich Miguels kindliche Züge verloren, hörte de Soto auf, ihn zu bedrängen. Nie sprachen sie über das, was geschehen war. Mit der Zeit, als Miguel fälschlich annahm, den nötigen Abstand gefunden zu haben, pflegte er mit Don Alfonso einen höflichen, sogar respektvollen Umgang. Der ältere Mann führte den Dreizehnjährigen gerne in gute Restaurants aus, oder Miguel besuchte ihn in seiner Wohnung über der Druckerei. An einem Abend hatte de Soto ihn zu sich nach Hause eingeladen, nach dem Essen brachte er Miguel zur Tür. Beim Verabschieden fragte er ihn, ob er ein paar Tage mit ihm verreisen wolle, in den kleinen Badeort am Meer. Miguel blickte ihn ausdruckslos an und schüttelte stumm den Kopf. Wie beiläufig legte er de Soto den Arm um die Schulter, plötzlich zog er ihn von der Wohnungstür ans Treppengeländer und stürzte ihn die zwei Stockwerke hinab auf den Mosaikboden der Eingangshalle. Als Miguel durch die Halle hinausging, sah er den Toten nicht einmal an.
Die Tristar hatte die Schwelle zur Tiefsee hinter sich gelassen, der Sturm entfaltete nun seine volle Macht. Dreißig, vierzig Fuß hohe Wellenberge rollten vom Nordatlantik heran und wälzten grüne Wassermassen über das Schiff. Sturmböen drückten es weit in die Seitenlage, bis die Rahnocken fast in die See tauchten. Kaum hatte es sich wieder hochgekämpft, als neue Sturzseen hereinbrachen und sich mit den Wassern des entfesselten Himmels über die Decks ergossen.
Der Rudergänger bekam ein neues Kommando und nahm südöstlichen Kurs, um den schweren Seen auszuweichen. Doch der Wind verdoppelte seine Stärke, und unter dem gewaltigen Segeldruck gaben die Mastenlager langsam nach. Die Masten würden aus der Spur brechen, wenn nicht vorher die Besegelung riss. Da tauchte im Lee für einen kurzen Moment ein dunkles Phantom aus der Gischt: Cap d’Ouessant. Das Schiff näherte sich der vorgelagerten Klippe in rasendem Tempo. Am Klüverbaum riss die Takelung, dann ein lautes Kreischen, splitterndes Holz: Groß- und Besanstangen brachen, fegten mit Segeln und Rahen übers Deck, durchschlugen das Schanzkleid und rissen mehrere Männer mit über Bord. Beim nächsten Brecher übers Achterdeck konnte der Erste Offizier keine Leine mehr fassen, auch er wurde von der See verschluckt.
Der Mann auf der Brücke fühlte seine Hände nicht mehr. So oft er beim Rollen und Krängen des Schiffs stürzte, so oft die Wassermassen ihn auf die Planken niederdrückten, so oft stand er wieder auf, hustete mit brennender Kehle, spie das Salzwasser aus, krümmte sich würgend und glaubte ersticken zu müssen. Bevor er wieder zu Atem kam, warf ihn die nächste Woge zu Boden. Aber er kam wieder hoch und schüttelte zornig das Wasser aus seinem Haar. Nein, er würde sich nicht beugen! Der Orkan toste um ihn, doch er brüllte dagegen, aus Leibeskräften: Solange er stand, würde die Tristar segeln.
Mit vierzehn Jahren verließ Miguel Olivero Ruizco Martinez de Avilés seine Heimat Florida. Der Familienbesitz Soledad war gepfändet worden, Donna Isabella musste mit ihrem Sohn in Savannah bei ehemaligen Dienstboten unterkommen. Isabellas Lebensmut war gebrochen, sie verzehrte sich nach La Florida und begann zu kränkeln. Miguel Olivero kam in schlechte Gesellschaft, er raufte und trank. Um unter den Kolonial-Engländern bestehen zu können, verleugnete er seine spanischkatholische Abstammung und begann als Oliver Roscoe noch einmal von vorn.
Er unterschätzte, wie viel in ihm weiterlebte von dem kreolischen Jungen und seinen Konquistadorenträumen. In seinem verwilderten Geist trug er noch eine kindliche Sehnsucht nach Ruhmestaten, doch die Vorzeichen hatten sich geändert. Indem er der Welt gleichgültig entgegenblickte, begann er einen Kreuzzug in eigener Sache.
Mit der Pubertät nahm seine Körperkraft zu und er entdeckte, wie befriedigend physische Überlegenheit sein konnte. Von mittelgroßer Statur, leicht gebaut und schnell, war er der geborene Kämpfer. Aufgrund eines natürlichen Sinnes für Bewegungsabläufe wusste er seine Stärke optimal einzusetzen; das musste er auch, um sich auf den Straßen von Savannah zu behaupten. In den Bandenkriegen bekam sein Kampfstil etwas jäh Gewalttätiges, was ihm unter den Schlägern und Streunern der Stadt Respekt verschaffte. Einmal nahm ein Freund ihn mit in einen Fight Club, eine jener Kampfarenen, wo gegen hohe Wettsummen Schaukämpfe geboten wurden. Die Kämpfer hatten alle Freiheiten; von wenigen Grundregeln kaum behindert, war einzige Zielvorgabe die finale Kampfunfähigkeit des Gegners.
Roscoe unterwarf sich einem rigiden Training und bewarb sich bei verschiedenen Fight Clubs, in denen junge Männer für die Kampfarena ausgebildet wurden. Nicht lange, dann erkannte jemand sein Talent, und Roscoe fand seine Bestimmung in der Welt der Schaukämpfe. Ein Club auf dem Gelände der Warren Hastings Warf nahm den Fünfzehnjährigen auf. Das Training war hart, doch schon nach zwei Monaten hatte er genug gelernt, um einem durchschnittlichen Kämpfer seiner Gewichtsklasse entgegenzutreten. Bei den nächtlichen Sessions seines Clubs wurde er regelmäßig in den Ring geschickt. Er traf auf Amateure, Matrosen und Hafenarbeiter, denen es um die Herausforderung des Kräftemessens ging, aber auch auf professionelle Schläger, die nur wegen des Preisgeldes kämpften.
Roscoe war beängstigend gut; wen er zu Boden schickte, der stand so schnell nicht mehr auf. Wegen unnötiger Brutalität wurde er wiederholt verwarnt, längst hatte er unter den jugendlichen Preiskämpfern einen schlechten Ruf, aber der Club verdiente gut an ihm, deshalb behielt man ihn.
Mit sechzehn Jahren war er der Beste unter den Amateuren des Warren Hastings Fight Club. Cheftrainer Jerry Lloyd hatte ihn eine Weile beobachtet. Er wollte den virilen Jungen in der Profiliga sehen und schickte ihn nach ein paar zusätzlichen Trainings gegen Berufsfighter in den Ring. Nun traf Roscoe auf wahre Kampfmaschinen, meist waren es Sklaven von den Zuckerplantagen Jamaikas, die ihren Besitzern hohe Preisgelder einbrachten. Doch gegen Oliver Roscoe waren sie chancenlos. Er war nicht nur ein hochtrainierter Kämpfer, er hatte sich auch zahllose Kämpfe angesehen und die besondere Verletzlichkeit des menschlichen Körpers studiert. Er wusste, wie man jemanden schwer, sehr schwer oder tödlich verletzte.
Als Roscoe im Halifax Fight Club in Atlanta erstmals gegen einen Profi antrat, verstummten schon bald die Anfeuerungsrufe. Der Gegner, ein stiernackiger Syrer mit gewaltiger Armmuskulatur, griff überraschend schnell an. Roscoe wich seinen weit auslegenden Schlägen vier- oder fünfmal aus, dann hatte er den Takt des anderen erkannt. Nach dem sechsten Ausleger, der ihn wieder verfehlte, unterlief er die gegnerische Deckung und trat dem Mann von unten gegen die Kinnlade. Mit gebrochenem Kiefer stürzte der Syrer auf die Bretter. Er spuckte Blut, war vom Schock des Anschlags ganz benommen und kehrte nur langsam in die Gegenwart zurück, wo Roscoe ihn mit zwei schweren Faustschlägen in den Solarplexus empfing. Nach Luft ringend, krümmte sich der Syrer am Boden, während Roscoe sich abwandte und lässig um den Ring schlenderte.
Die Zuschauer begannen zu zählen, es sah nicht so aus, als ob der Syrer wieder aufstünde. Schon hob der Manager an zu den üblichen Phrasen von einem fairen Kampf und dem Sieg des besseren Mannes, als Roscoe seine Kreisbahn unterbrach. Mit zwei Schritten war er bei seinem wehrlosen Gegner und trat ihn ein Mal und sofort ein zweites Mal in den ungeschützten Bereich der Nieren und Lendenwirbel. Der Mann brüllte vor Schmerz, das Publikum stöhnte betroffen, der Manager sah sich nervös nach Unterstützung um. Aber Roscoe ließ ihm keine Bedenkzeit: Er packte die Handgelenke des Syrers und riss ihm die Arme straff nach hinten, die überdrehten Schultergelenke machten den Schmerz der Prozedur sichtbar. So hielt er den Oberkörper des Mannes für einige Sekunden, dann setzte er ihm einen Fuß zwischen die Schulterblätter und trat kurz zu. Das Geräusch brechender Knochen war deutlich zu vernehmen. Roscoe ließ ihn fallen und machte ein paar Übungen zur Lockerung seiner Armmuskulatur.
Der Syrer öffnete den blutigen Mund zu einem gurgelnden Laut, dann bewegte er sich nicht mehr. Empörte Rufe wurden laut, eine Welle von Beschimpfungen folgte. Der Manager des Halifax Fight Club übte Beschwichtigungsgesten und rief nach den Saalordnern. Jerry Lloyd indessen stieß Roscoe in den Tunnel zum Ausgang der Arena.
»Was ist los mit dir, Roscoe, bist du verrückt geworden?«, fuhr er ihn an. »Verflucht, du hast den Mann umgebracht!«
Roscoe, ohne Bewusstsein für die Situation, grinste und schüttelte die nassen Haarsträhnen aus dem Gesicht. Sein nackter Oberkörper glänzte von Schweiß, an seinen Händen klebte das Blut des Toten.
»Wie war ich, Jerry?«, fragte er in einem eigentümlichen, aufreizend schleppenden Tonfall. »Los, sag schon, war ich gut?«
Lloyd war nicht zu Scherzen aufgelegt. »Ich warne dich, Kleiner, so was darf nicht passieren, hast du mich verstanden? Noch so eine Nummer, und du bist gefeuert. Ist das klar?«
»Klar, Boss!«, beteuerte Roscoe mit alberner Schwurgeste. Weil sein Trainer unerbittlich schwieg, schlug Roscoes kindische Haltung in Trotz um. »Was willst du, Jerry?«, rief er. »Meinst du, ich lass mich von so einem miesen Schwein anrühren? Ich warte doch nicht, bis der mich an den Eiern kriegt.« Er spuckte auf den Boden. »He, er ist tot, Mann! Er hat’s nicht anders verdient.«
»Du bist ein Killer, mein Junge. Das ist schlecht fürs Geschäft«, knurrte der Trainer, drehte sich um und ließ ihn stehen.
»Geh, fick dich!«, rief Roscoe hinter ihm her. Dann bemerkte er das Blut an seinen Händen und wischte es nachlässig an den Hosenbeinen ab.
Roscoes Auftritte in den Kampfarenen liefen immer nach dem gleichen Muster ab. Meistens setzte er den Gegner durch seine erste gezielte Aktion außer Gefecht, damit war der Kampf zu Ende. Aber für Roscoe fing der eigentliche Akt jetzt erst an; er misshandelte mitleidlos den am Boden liegenden Gegner, bis er so eklatant und nachhaltig die Regeln gebrochen hatte, dass man ihn zwang, den Ring zu verlassen. Genau deshalb kamen die Leute immer wieder, Roscoes aggressiver Stil war in den Kampfarenen gefragt, und der Club hielt seine Hand über ihn.
Bald konnte er von den Preisgeldern gut leben. Er mochte Savannah, die vielen Plätze, Parks und Cafés, wo er so leicht Bekanntschaften machte. Wie er es von Kindheit an nicht anders kannte, erlagen die Menschen seinen äußerlichen Reizen. Wer ihn näher kennenlernte, wurde allerdings eines Besseren belehrt. Schön wie ein Engel, rief er Verlangen hervor, das er nicht erfüllen wollte. Der Fluch seines Lebens, bis zum Überdruss begehrt zu werden, fand kein Ende und forderte seine Tritte und Schläge geradezu heraus.
Donna Isabella war über den Werdegang ihres Sohnes bekümmert. Bei seinen seltenen Besuchen versäumte sie nie, ihn an seine Herkunft zu erinnern: Er sei ein Grande von Geburt, er müsse sich ehrenhaft verhalten. Auf ihr Drängen verpflichtete er sich schließlich 1774, gerade siebzehnjährig, zum Dienst in der britischen Kolonialarmee beim Infanteriekorps von Georgia. Die martialischen Strukturen des Heeres faszinierten ihn, die strengen Regeln und Gebote gaben seinem Leben erstmals eine Richtung und machten ihn unempfindlich selbst gegen den härtesten Drill. Während er das Kriegshandwerk der Infanterie erlernte, den Angriff in geschlossener Linie mit Schusswaffen und Bajonett, bemerkten seine Vorgesetzten seine Ausdauer und kämpferischen Fähigkeiten und schlugen ihn für die Offizierslaufbahn vor. Trotz fehlender Schulbildung – Roscoe konnte kaum lesen oder schreiben – wurde er als jüngster Offiziersanwärter zum Lieutenant befördert.
Ein Jahr lang tat er pflichtschuldig Kasernendienst. Nachdem man ihm außer kämpfen nichts beigebracht hatte, musste ihm der Leerlauf des Garnisonslebens auf Dauer wie eine Strafe vorkommen. Aus reiner Langeweile duellierte er sich mit anderen Offizieren, was in der Regel mit hohen Strafen bedroht war. Doch sein Captain ließ ihn trotz wiederholter Rügen gewähren.
Nun gab es in der Garnison von Savannah zwei neue Rekruten, die ihn allein durch ihre Existenz reizten. Die beiden waren ihm öfter wegen ihrer laxen Dienstauffassung aufgefallen. Eines Morgens kam er zur Wachinspektion über den Exerzierplatz, just als die zwei jungen Soldaten nach durchzechter Nacht zum Kasernentor hereinstolperten. Roscoe, zwanghaft wie er war, trennte streng zwischen den Anforderungen des Dienstes und privatem Vergnügen. Er maß also das Verhalten der beiden Rekruten, die beim Morgenappell seinen Herrschaftsbereich betraten, an seiner überkorrekten Auffassung vom Dienstbeginn, und ehe sie wussten, wie ihnen geschah, lagen sie im Karzer in Eisen.
Roscoe führte selber an Ort und Stelle die Disziplinarmaßnahmen durch. Hier ging es um Strafe, und wie konnte er sie besser bestrafen als durch Schmerzen? Nach den Erfahrungen in der Kampfarena wusste er, welcher Schlag schmerzte und welcher vernichtete, welche Tritte zermürbten und welche töteten, und was Knochen aushielten, bevor sie brachen. Er fing mit dem Jüngeren an – einer musste ja der Erste sein! – und erklärte dem Mann kurz die Situation: Er solle sich wehren, sonst mache es keinen Spaß. Natürlich gab es im Kerker keine Zuschauer, und niemand würde ihn zwingen, den Ring zu verlassen, und richtig, die Rekruten trugen Ketten an den Füßen! Aber sonst war es wie immer, als er jetzt mit ihnen Fight Club spielte.
Für seine eigenmächtige Strafaktion musste er sich vor einem Militärgericht verantworten; unter anderem zog das Urteil seine unehrenhafte Entlassung nach sich. Das war nun selbst für jemanden wie Oliver Roscoe mit seinem eigenwilligen Ehrbegriff zu viel. Bevor ihn die Militärpolizei zur Verbüßung der verhängten Strafe festnehmen konnte, verließ er Savannah für immer.
In jenem Sommer 1776 herrschte Siegesstimmung in South Carolina. General Lees Kontinentaltruppen hatten mit Unterstützung der örtlichen Milizen dem britischen Expeditionsheer eine vernichtende Niederlage beigebracht. Als dann am 4. Juli in Philadelphia die Unabhängigkeit für alle dreizehn Kolonien proklamiert wurde, gaben die Briten den Feldzug im Süden auf und der kommandierende General Clinton schiffte sich mit dem englischen Heer nach New York ein.
South Carolina feierte seine Unabhängigkeit mit überschwänglicher Begeisterung. Als Oliver Roscoe in Charles Town eintraf, schien die Stadt nur auf ihn gewartet zu haben. Die Patrioten luden ihn zu ihren Siegesfeiern ein, denn er war einer aus dem Süden, das reichte als Entree; »Savannah Kid« nannten sie ihn oder einfach »Handsome«. In der neuen Umgebung verlor er kein Wort über seine Karriere als Profikämpfer, sondern gab sich ganz im Stil der eleganten Stadt als Dandy. Mangels eigener Einkünfte auf finanzielle Zuwendungen angewiesen, ließ er sich aushalten; wer seine Spielschulden bezahlte, dem zeigte er sich erkenntlich, wie es von ihm erwartet wurde.