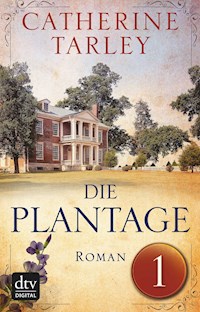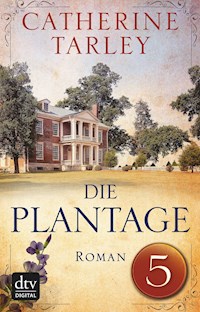6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller im Taschenbuch »Ihr Entschluss war gefasst: Sie würde ihre Zelte in Charles Town abbrechen und nach Legacy zurückkehren. Wenn sie die Plantage behalten wollte, durfte sie nicht untätig drauf warten, dass ein Wunder geschah.« South Carolina, 1781. Antonia Lorimer hat im Krieg alles verloren: Ihre Plantage wurde niedergebrannt, ihr Mann erschossen. Doch sie hat überlebt, nur das zählt! Jetzt, da der Sturm vorüber ist, kann sie endlich heimkehren. Und sie wird alles dransetzen, ihr Land zu behalten, denn niemals, das hat sie sich geschworen, wird sie es irgendwelchen Kriegsgewinnlern überlassen. Als sie nach Legacy zurückkommt, wird sie vor eine folgenschwere Entscheidung gestellt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1178
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
CATHERINE TARLEY
DIE PLANTAGE
Roman
Für Emily und Colin
Die Geschichte des Kriegers
Eine Legende des Otter-Stammes
Ein Krieger tötete einen schwachen Mann, so zerstörte er das Gleichgewicht der Welt. Die Götter in ihrem Zorn sandten die Dämonen der Finsternis, ihn für den Frevel zu bestrafen. Die Dämonen marterten ihn, und der Wind trug seine Klage über das Land. Die Frau des Getöteten aber hatte Mitleid und bat die Götter um Gnade. Da erließen ihm die Götter den Martertod. Zur Sühne sollte er die Lebensaufgabe des schwachen Mannes erfüllen. So vergrub er seine Waffen, nahm die Frau zur Gefährtin und erfüllte das Leben des anderen. Die Dämonen blieben bei ihm, um ihn zu erinnern.
I. Ankunft
Nacht. Sterne. Schmerzen. Ich bin verwundet … ich sterbe. Zwischen Gefallenen lag er auf dem nächtlichen Schlachtfeld, ein geschundener Körper mit zahllosen Verletzungen. Das Atmen fiel ihm schwer, jede Bewegung löste Qualen aus. Er verlor immer wieder das Bewusstsein. Aber der schmale Grat, der das Leben vom Tode trennt, war noch nicht überschritten.
Endlich erwachte er aus seiner totengleichen Erstarrung, und als gälte es, noch Schlimmerem als den Schmerzen zu entkommen, zog er sich, auf die Unterarme gestützt, in mühseligen Etappen einen Hang hinunter. Ein- oder zweimal berührte er in der Dunkelheit einen leblosen Körper, während er zur Talsenke kroch, angetrieben von der dumpfen Hoffnung, am Fuß des Abhangs an Wasser zu kommen.
Am anderen Morgen fand ihn sein Pferd am Rand eines schlammigen Rinnsals. Es blies ihm den warmen Tieratem ins Gesicht und vermittelte ihm die einfachste Form von Wirklichkeit: am Leben zu sein.
Irgendwie war es ihm gelungen, in den Sattel zu kommen. Seither trottete das Pferd dahin, blieb dann und wann stehen, um am Wegrand Gras oder Blätter von herabhängenden Zweigen zu fressen, an einem Bach zu trinken oder auszuruhen. Der Mann hielt sich im Sattel, meist lag er vornübergebeugt auf dem Hals seines Pferdes. Wenn er bei Bewusstsein war, trieb er es mit schwachem Schenkeldruck an, damit es in Bewegung blieb und weiter gen Süden ging.
Er hatte keine genaue Vorstellung, wie lange er unterwegs war oder wie weit er gekommen sein mochte. Seit Einbruch der Dämmerung folgte das Pferd einem breiten Flusslauf. Sie mussten das Plantagenland des Lowcountry erreicht haben.
Als er später in der Nacht wieder zu sich kam, war das Pferd stehen geblieben. Ringsum war es still. Er atmete den Staubgeruch trockener Spreu, anscheinend war das Pferd in einen leeren Stall gelaufen. Entkräftet ließ er sich aus dem Sattel gleiten, fiel zu Boden und verlor vor Schmerz fast die Besinnung. Schließlich schaffte er es, zur Stallwand zu kriechen und sich halb sitzend anzulehnen. Mit der unverletzten Linken zog er den Säbel. Den Griff der Waffe fest umschlossen, fielen ihm die Augen zu.
Es konnte nicht viel Zeit vergangen sein, als ihn das Geräusch von Schritten aufschreckte. Dann sah er Licht. Auf den Säbel gestützt, stemmte er sich hoch, dabei jagten von dem gebrochenen Bein grelle Schmerzen durch seinen Körper. Er biss die Zähne zusammen, um nicht laut aufzustöhnen. So stand er im Dunkeln und wartete.
II. Legacy
1.
Kühle Nachtluft wehte durch die Fenstertüren. Ein paar Blätter flogen vom Schreibtisch auf und schwebten kreiselnd zu Boden. Antonia hob sie auf, legte sie zu einem kleinen Stapel zusammen und stellte die Petroleumlampe aus geschliffenem Bleikristall darauf. Sie schraubte den Docht höher und nahm den Brief, den sie gelesen hatte, wieder zur Hand. Auf der Hälfte der Seite hielt sie inne, sah zum Fenster, horchte – nein, da war nichts, nur der nächtliche Gesang der Frösche, der von den Bewässerungsgräben in den Reisfeldern aufstieg und den der Wind herübertrug.
Sie zog das Schultertuch fester und schlang die Enden zu einem Knoten, ehe sie weiterlas. Plötzlich fuhr eine starke Windbö durch den Raum. Die Flamme blakte im Glaszylinder, die Fensterflügel schlugen laut aneinander. Schnell breitete sie die Arme über die Papiere, damit nicht alle vom Schreibtisch geweht wurden. Sie wollte aufstehen und die Fenster schließen, zögerte aber und ließ sich resigniert in den Stuhl zurückfallen. Was machte es für einen Unterschied, ob die Fenster geschlossen waren oder nicht? Der Raum vor ihr lag in Trümmern, die Außenmauer war an der Nordseite niedergebrochen, die hohe Decke mit den eleganten Stukkaturen zur Hälfte eingestürzt. Zwischen den rußgeschwärzten Wänden türmten sich Schutt und verbranntes Gebälk. Was das Feuer nicht zerstört hatte, war seit Monaten Wind und Wetter ausgesetzt.
Sie blickte durch den verwüsteten Saal, in dem vor dem Krieg ihre Bibliothek untergebracht gewesen war. Auch wenn der Großteil der Sammlung gerettet werden konnte, waren doch viele wertvolle Bände verbrannt. Ringsum standen noch die Gestelle der Büchertruhen, doch was von der aufwendigen Ausstattung des Raumes übrig war, zerfiel jeden Tag mehr. Die Vertäfelung war weitgehend zerstört, ausgebrannte Wandschränke lagen umgestürzt mit zerbrochenen Scheiben am Boden. Nur der Schreibtisch, ein solides englisches Möbelstück, hatte den Flammen getrotzt. Antonia hatte ihn in den unversehrten Teil des Raumes geschoben, um sich hier mit einem Berg unerledigter Post niederzulassen.
Eine Bibliothek unter freiem Himmel – was für eine Ironie. Vor ihren Augen wurde nach und nach zunichte, was für ein paar Jahre das Herzstück ihres Lebens gewesen war; wurde zunichte wie ihre Vorstellung von einer besseren Welt. Sie wusste, es war falsch, so zu denken, jetzt, da sich das Blatt endlich wendete und wieder Hoffnung bestand. Sie würden den Krieg gewinnen, die Ideale, an die sie immer geglaubt hatte, würden dem Land endlich den Frieden bringen. Enlightenment – die Aufklärung, in Europa erdacht, würde sie in Amerika Früchte tragen, diese Erleuchtung des Geistes, die auch Antonia wie so viele andere Menschen inspiriert und gelehrt hatte, freiheitlich zu denken.
Henry hatte sie deswegen geliebt. Er hatte ihren Enthusiasmus bewundert, ihren Glauben an ein Gesellschaftskonzept der Freiheit und Menschlichkeit bestärkt und seine Visionen mit ihr geteilt. Und sie hatte ihn geliebt, vielleicht mehr, als sie einen so leidenschaftslosen Mann hätte lieben sollen. Niemand war ihr je so nah gewesen. Wie hatten sie sich nur entfremden können? Mit dem Niedergang der Plantage fing es an. Henrys anspruchsvolle Projekte, seine Misswirtschaft und ein unbekümmerter Lebensstil hatten sie innerhalb weniger Jahre ruiniert. Antonia machte ihm nie einen Vorwurf, doch ihre Enttäuschung blieb ihm nicht verborgen. Er konnte es nicht verwinden, in ihren Augen versagt zu haben. So begann er, ihr aus dem Weg zu gehen, suchte Bestätigung in fragwürdiger Gesellschaft und militärischen Abenteuern; dabei fand er den Tod.
Sie seufzte und legte den Brief ungelesen zu den übrigen Papieren, größtenteils unbezahlte Rechnungen oder Mahnungen, auch Gebote von Spekulanten, die zu Schleuderpreisen Plantagenland aufkauften, das die Grundbesitzer nicht mehr bewirtschaften konnten. Manche, die sich für ihr Anwesen interessierten, kannte sie gut, es waren Nachbarn, früher Freunde von Henry, die mit ihm zur Jagd geritten und in ihrem Haus zu Gast gewesen waren. Jetzt, nach seinem Tod, schienen sie nur darauf zu warten, dass Antonia ihnen die alte Plantage am Plains River überließ.
Das alles war wenig ermutigend. Dennoch, sie hatte den Krieg überlebt, nur das zählte. Sie hatte sich in Sicherheit gebracht und gewartet, bis die Soldaten weiterzogen und der Sturm vorüber war. Nun war sie zurückgekehrt, um ihr Haus wieder aufzubauen und die Felder instand zu setzen. Sie würde alles daransetzen, die Plantage zu behalten. Niemals, das hatte sie sich geschworen, würde sie ihr Land irgendwelchen Kriegsgewinnlern überlassen. Entschlossen schob sie alle Papiere zusammen und legte den Packen in ein Schubfach des Schreibtischs.
Da war es wieder, diesmal war sie ganz sicher, etwas gehört zu haben. Sie trat an eine Fenstertür und horchte. In der Dunkelheit draußen war nichts zu erkennen, aber sie konnte jetzt deutlich ein Geräusch von den gewohnten Lauten der Nacht unterscheiden: Schleppende, schwere Schritte, die sich dem Haus näherten, für einen Augenblick auf Höhe des Eingangs verhielten, um sich dann den Hang hinunter zum Wirtschaftshof zu entfernen. Ein Pferd! Vermutlich lief das Tier seiner Nase nach geradewegs zu den Stallungen. Nicht viele Pferde hatten den Krieg überlebt, auch dieses schien am Ende seiner Kräfte zu sein. Sie sollte versuchen, es einzufangen, für die Arbeit auf den Feldern würde sie jedes Zugtier brauchen.
Die Nacht duftete nach Jasmin, als sie mit einer Laterne in der Hand aus dem Haus trat und die neunzig Yards zum Wirtschaftshof ging. Früher standen in ihren Stallungen zwei Dutzend Arbeitspferde, dazu einige erstklassige Karossiers und die Reitpferde der Lorimers. Doch die Rotröcke hatten die besten Pferde gestohlen, und später hatten die Continentals alle noch verfügbaren Tiere requiriert. Seit Monaten war das Stallgebäude verlassen.
In dem offenen Doppeltor hob sie die Laterne über ihren Kopf und spähte ins Innere. Sie hörte leises Schnauben, das Scharren von Hufen, und trat ein. Im Lichtschein entdeckte sie die große, massige Gestalt des Pferdes, gesattelt und aufgezäumt stand es bei einem leeren Stallabteil, wo es in der staubigen Spreu nach Futter gesucht hatte. Nun hob es den Kopf. Der Lichtschein spiegelte sich in seinem goldenen Auge.
»Ruhig, mein Großer, alles ist gut«, sagte sie sanft und ging näher.
Es war ein eindrucksvolles Tier, ein Hengst von überhohem Stockmaß. Er beugte den muskulösen Hals, als sie herantrat und ihm mit der freien Hand durch die Mähne und über den Widerrist strich. Sein schwarzes Fell war von Schlamm und Blut verkrustet. Sie hob die Laterne, um sich das Zaumzeug genauer anzusehen. Die aufwendig gearbeitete Kandare mit Silberverzierungen an Kinn- und Stirnriemen war bestes englisches Handwerk, ebenso der schwere Militärsattel mit den weit ausschwingenden Sattelblättern. In einer der Satteltaschen fand sie zwei Pulverhörner und einen Beutel mit Bleikugeln, in der anderen steckte ein Holster mit zwei Pistolen. Sie nahm den Holster mit den Waffen heraus und legte ihn auf den Boden.
Hatte es nicht geheißen, die Kämpfe in dieser Gegend seien vorüber? Die Briten befanden sich auf dem Rückzug. Während die amerikanischen Truppen und Milizen aus Carolina und Virginia sie in Eilmärschen verfolgten, verschanzten sie sich in ihren Stützpunkten im Norden in der Hoffnung, sich mit General Clintons Armee zu vereinigen. Wie aber kam dann dieses voll aufgezäumte englische Kavalleriepferd hierher?
Das Tier schob hungrig das Maul in Antonias Hand. Sie streichelte ihm begütigend über die Nüstern; gleich würde sie Futter holen, doch zuvor wollte sie ihm den schweren Sattel abnehmen. Um beide Hände frei zu haben, stellte sie die Laterne auf den Boden. Als sie sich wieder aufrichtete, bemerkte sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Sie wagte nicht, sich umzusehen, doch ihr Herz schlug immer schneller, während sie mit mechanischen Handgriffen anfing, die Schnallen des Sattelgurts zu lösen. Und auf einmal bemerkte sie auch den Geruch: Die Ausdünstungen des warmen Pferdekörpers hatten ihn zunächst überdeckt, nun erkannte sie den brandigen Gestank nach Blut und Pulverrauch, der so viele Wochen die Luft über dem Landstrich verpestet hatte. Er weckte Erinnerungen an Geschützdonner, an die Schreie der Soldaten, an brennende Häuser und fliehende Menschen, an Sterbende und Tote. Wer immer dort im Dunkeln hinter ihr stand, ihn umgab der Geruch des Todes.
Angst wallte wie Übelkeit in ihr auf. Um nicht die Nerven zu verlieren, sprach sie beruhigend auf das Pferd ein. Als sie den losen Sattel mit beiden Händen packte, um ihn vom Pferderücken zu nehmen, wurde sie sich seines beträchtlichen Gewichts bewusst und erkannte ihre Chance: Sie spannte Arme und Schultern, atmete tief ein, und dann schwang sie den schweren Sattel in einer fließenden Bewegung über die Kruppe des Pferdes und schleuderte ihn mit aller Kraft hinter sich.
Der massive, holzverstärkte Sattelbug traf den Mann aus nächster Nähe, rammte ihm gegen Brustbein und Solarplexus. Ein Steigbügel schlug ihm an die Schläfe, ehe die Wucht des Aufpralls ihn gegen einen Stützpfeiler warf und er leblos zu Boden sank. Blut rann aus einer Schläfenwunde und aus seinem Mundwinkel. Als Antonia die Laterne über ihn hielt, glaubte sie, er sei tot.
2.
Im Januar 1781, nach Henrys Tod und nachdem ihre Plantage durch einen Anschlag britischer Truppen unbewohnbar geworden war, hatte Antonia bei ihrer Schwester Lydia im besetzten Charles Town Zuflucht gefunden. Inzwischen waren Monate vergangen. Der Revolutionskrieg hatte seinen erbitterten Höhepunkt überschritten, und das Gros der Invasionsarmee war nach Virginia abgezogen. Aber noch immer hielten britische Regimenter Charles Town und die Forts um die Stadt besetzt.
Während Lydia es verstand, sich eigennützig mit den Besatzern zu arrangieren, war Antonia es gründlich leid, in Gesellschaft der arroganten britischen Offiziere gute Miene zu wahren. Nachdem man sie schließlich mit anderen rebellisch gesinnten Bürgern gezwungen hatte, der öffentlichen Hinrichtung des berühmten Milizkommandeurs Hayne beizuwohnen, verließ sie die Stadt und verbrachte den Rest des Sommers zurückgezogen in ihrem Elternhaus auf Prospero Hill.
Ihr Großvater hatte das große Haus auf dem Hügel mit den prächtigen, über zwei Stockwerke reichenden Kolonnaden zu Anfang des Jahrhunderts erbaut. Von den Eingangsstufen reichte der Blick über die weite Ebene der Reisplantagen hin zum trägen Lauf des Cooper River, der in der Abendsonne aufleuchtete wie ein verschlungenes Band aus Gold.
Vier Generationen zuvor waren die Bells nach Carolina gekommen, anglikanische Auswanderer, die auf der Flucht vor Cromwells Truppen ihre Heimat in Südengland hatten verlassen müssen. Hatte der erste Robert Bell noch eigenhändig das Land um seine moosverfugte Blockhütte am Steilufer des Plains River gerodet, so wurde der dritte Robert Bell, Antonias Vater, einer der erfolgreichsten Pflanzer des Lowcountry. Er arrondierte das Farmland zwischen Cooper und Plains River zu einem stattlichen Besitz und wurde durch die Erträge seiner Reis- und Indigoplantagen ein reicher und geachteter Mann. Der Erfolg jedoch war überschattet von persönlichem Leid. Seine Frau Catherine und die beiden Söhne starben 1753 an Pocken. Um seine kleinen Töchter Diane und Lydia nicht mutterlos aufwachsen zu lassen, heiratete er wieder, aber auch seine zweite Frau Adela starb nach Antonias Geburt 1755 im Kindbett.
Robert Bells älteste Tochter Diane heiratete den ehrgeizigen Theodore Hocksley, Bells Kommissionär und späterer Stellvertreter. Als Bell 1773 einem Lungenleiden erlag, erbte Diane den gesamten Grundbesitz. Nun war Hocksley der Herr auf Prospero Hill. Bells zweite Tochter Lydia erbte das Elternhaus ihrer Mutter in Charles Town, Lyndon House, mit den dazugehörigen Gärten im Marschland westlich des Cooper River. Die Pachten für das Gartenland ermöglichten Lydia einen großzügigen Lebensstil. Selbstverständlich erwarben die Schwestern auch die Sklaven, die auf den Besitzungen lebten.
Antonia, die Jüngste, bekam als Vermächtnis ihres Vaters eine kleine Reis- und Indigopflanzung am Plains River. Antonia und ihr Mann Henry Lorimer gaben der Plantage den Namen Legacy.
Zu Ehren von Antonias Geburtstag hatte ihre Schwester Diane am letzten Tag des August 1781 auf Prospero Hill eine Dinnerparty gegeben. Es waren Leute ihres gesellschaftlichen Ranges gekommen, Bekannte der Bells und der Hocksleys. Durch den Krieg sah man bei gesellschaftlichen Anlässen immer auch Offiziere. So hatte Diane an diesem Abend einen Captain der South Carolina Militia eingeladen, Algernon Reed, einen vermögenden Junggesellen von Anfang dreißig, dem eine Plantage am Ashley River gehörte. Antonia war ihm bisher noch nicht persönlich begegnet. Doch ihr verstorbener Mann Henry Lorimer war mit ihm befreundet gewesen und auf Reeds Drängen in die Miliz eingetreten. Die letzten Monate seines Lebens hatte Henry meist in Reeds Gesellschaft verbracht. Nach allem, was Antonia zu Ohren gekommen war, hatten die Freunde sich die Zeit zwischen ihren militärischen Einsätzen an den Spieltischen und in den Bordellen der Stadt vertrieben. Als Antonia Captain Reed vorgestellt wurde, begegnete sie ihm mit einer gewissen Skepsis.
Reed, heimgekehrt von den letzten Rückzugsgefechten gegen die Briten in South Carolina, war der Held des Abends; er führte Antonia zu Tisch. Elegant, zuvorkommend, ein feiner Mann mit tizianroten Locken und einer rhetorischen Begabung, gelang es ihm, alle brillant zu unterhalten, ohne seine Tischdame dabei zu vernachlässigen. Von den heimatliebenden Gästen bestürmt, schilderte er die Kämpfe der Milizen gegen die britischen Divisionen und lobte den Mut und die Unerschrockenheit seiner Leute.
»Meine Männer haben den königlichen Truppen tapfer die Stirn geboten und ihrer Übermacht widerstanden. Und so, meine Herrschaften, ist es uns endlich gelungen, die Rotröcke aus Carolina hinauszujagen!« Er stand auf und erhob sein Glas: »Auf die siegreiche South Carolina Militia! Gott schütze Amerika, Land der Freiheit, Heimat der Tapferen!«
»Gott schütze Amerika!«
»Auf die Freiheit!«
»Ja, auf die Freiheit!«, riefen die Pflanzer und ihre Damen, hingerissen von ihrem Patriotismus. Antonias Begeisterung hielt sich in Grenzen. Sie sah die selbstzufriedenen Gesichter ringsum und wunderte sich, wie diese Sklavenhalter es fertigbrachten, in Hochrufe auf die Freiheit auszubrechen, ohne dass ihnen das Wort im Halse stecken blieb. Auf einmal bemerkte sie, dass ihr Schwager das Pathos der anderen nicht teilte. Er wirkte verstimmt und blickte missgünstig in Reeds Richtung. Kaum war das Gläserklingen verebbt, tönte er über den ganzen Tisch hinweg: »Bravo, Reed, Charles Town wird Sie als Helden feiern.«
»Zu viel der Ehre, Sir«, entgegnete Reed. »Wir haben nur unsere Pflicht getan. Jetzt hat sich Lord Cornwallis mit seinen Truppen in Yorktown verschanzt, und General Washington wird ihnen mit seinen Virginiern bald den Rest geben. Für meine Männer wird es Zeit, dass sie nach Hause zu ihren Familien zurückkehren. Auch auf mich wartet viel Arbeit.«
»Im allgemeinen Siegestaumel denken Sie ans Geschäft?«, bemerkte Hocksley. »Aber wen wundert’s, dass ein Mann, dem weder Frau noch Kinder am Herzen liegen, sich ausschließlich um sein Vermögen sorgt.«
Peinliches Schweigen. Es schien, als sei Hocksley die Macht, die er mit dem Bell’schen Erbe an sich gebracht hatte, zu Kopfe gestiegen, dass er gar so selbstherrlich tat. Antonia wusste indessen, es ging um weit mehr: Als Vorstand des Planters Club führte Hocksley die einflussreiche Pflanzerlobby an, die das Handelsgeschehen im Lowcountry weitgehend kontrollierte. In dieser Funktion, natürlich auch im eigenen Interesse, hatte er Reeds Aufstieg genau beobachtet. Nachdem Reed mit gutem Geschäftssinn nach und nach den Landbesitz von Loyalisten, die die Kolonien verlassen mussten, aufgekauft und zu einer riesigen Plantage verbunden hatte, verfügte er über Anbauflächen, von denen andere nicht einmal zu träumen wagten. Würde die Arbeit auf den Feldern erst wieder aufgenommen, würde Reed auf seiner Plantage Hollow Park Reis und Baumwolle in einer Größenordnung produzieren, mit der andere Pflanzer nicht konkurrieren konnten. Vor diesem Hintergrund musste er Hocksleys Bemerkung als klare Kampfansage verstehen.
Allem Anschein nach wollte Reed sich jedoch nicht provozieren lassen. Mit feinem Lächeln verneigte er sich gegen den Gastgeber, als wäre ihm ein Kompliment gemacht worden; eine souveräne Geste, die unter den Gästen die Befangenheit löste und die Unterhaltung wieder aufleben ließ.
Der Vorfall war bald vergessen, nur Antonia wollte es nicht so hingehen lassen. »Wie charmant, Mr. Reed, und wie überaus klug. Sie sind nicht nur ein Held, Sie beherrschen offenbar auch die Kunst der Diplomatie. Oder sind Sie nur opportunistisch?«
Reed nahm ihre Stichelei gelassen hin. »Ihr Schwager führt gern das große Wort«, sagte er. »Offenbar ist er so sehr von sich eingenommen, dass er glaubt, er könne die Spielregeln unseres Geschäfts bestimmen.«
»Er bestimmt sie nicht nur, er verändert sie auch zu seinen Gunsten, wie es ihm gerade passt. Hocksley hält den Handelsplatz Charles Town fest in seinen habgierigen Händen. Nur wer nach seiner Pfeife tanzt, kann in Frieden seinen Geschäften nachgehen.«
»Sie sprechen aus Erfahrung?«
»So könnte man sagen. Hocksley hat alles darangesetzt, uns zu ruinieren. Hat Henry Ihnen das nicht erzählt?«
»Nein, Madam. Ihr Mann hat nicht versucht, seinen Misserfolg als Pflanzer zu beschönigen oder anderen die Schuld zu geben. Er sprach kaum von der Plantage, wenn wir zusammen waren.«
Antonia rückte unmerklich von ihm ab. Sie hatte ihre Vorbehalte gegen ihn, es gab etwas, das sie nicht vergessen konnte: Reeds Eskapaden mit seinem Intimus, einem zwielichtigen Kreolen, hatten Henry auf fatale Weise fasziniert. Sie wusste bis heute nicht und wollte es auch nicht wissen, wie ihr diese beiden den Ehemann entfremden konnten. Aber der Umgang mit dem sonderbaren Freundespaar hatte Henry verändert; das machte sie Reed zum Vorwurf. Vielleicht, dachte sie, könnte Henry noch am Leben sein, wenn er ihm nicht begegnet wäre.
Reed deutete ihr Schweigen auf seine Weise: »Bitte verstehen Sie mich richtig, ich meinte lediglich, dass Henry nicht viel über die Arbeit auf der Plantage redete. Von Ihnen, Madam, hat er oft gesprochen, wenn auch bei Weitem nicht oft genug …«
»Henry ist tot, Mr. Reed«, versetzte sie kühl. »Versuchen Sie etwa, der Witwe Ihres Freundes den Hof zu machen?«
»Verzeihen Sie, ich dachte, deswegen hätte man mich eingeladen.«
»Was fällt Ihnen ein!«
Ihr Ausruf ließ die Tischnachbarn interessiert aufblicken.
Reed lächelte, neigte sich zu ihr und sagte: »Madam, bitte korrigieren Sie mich, falls ich mich geirrt habe, aber es war nicht zu übersehen, wie Ihre Schwester uns den ganzen Abend mit wohlmeinenden Blicken bedacht hat. Anscheinend erwartete man von mir, dass ich mit Ihnen flirte. Ehrlich gesagt glaubte ich, auch Sie. Ich habe mein Bestes gegeben, leider ohne rechten Erfolg, wie ich sehe.«
Antonia starrte ihn entgeistert an. Sie hatte sich den ganzen Abend reserviert verhalten, wie konnte er sie derart missverstehen? Allein, dass er die Dinge so unverblümt beim Namen nannte, war ein Affront. Ohne ein weiteres Wort stand sie auf und verließ den Saal.
Draußen ging sie unter den Kolonnaden auf und ab und atmete die kühle Luft, die von den Rasenflächen aus dem dunklen Garten aufstieg, tief ein. Als sie sich wieder beruhigt hatte, setzte sie sich in einen Korbsessel. Den Kopf ins Polster zurückgelegt, beobachtete sie den Tanz der Nachtfalter um die gläsernen Laternen, die zwischen jedem Säulenpaar herabhingen und die Kolonnaden in weiches Licht tauchten.
Sie fühlte sich gedemütigt und enttäuscht. Aber was hatte sie sich von einem solchen Abend denn erwartet? Dianes Absicht, sie wieder zu verheiraten, war allzu offensichtlich. Ihre Schwester folgte blind dem gesellschaftlichen Leitmotiv, nur Ehefrauen wären ehrbar. Antonia nahm sich die Freiheit, diese Auffassung nicht zu teilen. Sie fühlte sich Henrys Angedenken und Legacy verpflichtet, im Übrigen wollte sie nach ihren eigenen Vorstellungen leben. Was also hatte sie mit diesen Leuten hier zu schaffen? Sie sollte sich besser um ihre Plantage kümmern, bevor alle Felder verwilderten und das ganze Anwesen verfiel. Ja, es war höchste Zeit, dass sie nach Hause zurückkehrte.
Sie hörte, wie die Fenstertür ins Schloss fiel, und wandte sich um. Reed war ihr nach draußen gefolgt. Er entzündete eine Zigarre und schritt rauchend durch den Säulengang. Als er zu ihrem Sessel kam, blieb er stehen und sah mit unbestimmtem Lächeln auf sie herab. Hier draußen, fand sie, wirkten seine Augen völlig farblos.
»Ich schätze, Madam, ich habe Sie durch meine Offenheit verletzt.«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen.«
»Ich wollte Ihnen auch nur sagen, dass Henry es verstanden hätte.« Nachlässig warf er die Zigarre in eine Steinvase und lehnte sich an eine Säule. »Ich denke, er hätte es gutgeheißen, wenn ich für Sie sorge. Weil ich sein Freund war.«
»Dass Henry und Sie befreundet waren, heißt nicht, dass ich Ihre Frau sein möchte.«
Er bedachte eine Weile, was sie gesagt hatte. »Sie wissen, dass ich Ihre kleine Plantage retten könnte.«
»Wollen Sie mich kaufen, Mr. Reed, zusammen mit meinem Land?«
»So würde ich es nicht nennen. Sagen wir einfach, ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, Legacy in einen Garten Eden zu verwandeln. Ihr ganz privates Paradies auf Erden, wie wäre das? Sie könnten Ihre und Henrys Ideen verwirklichen, den schönen Traum von Gleichheit und Brüderlichkeit. Wenigstens auf ein paar Morgen Land ginge Ihre Vision in Erfüllung, das ›kleine Modell‹ einer besseren Welt …«
»Hören Sie auf!«, rief sie ungehalten und stand auf, damit er nicht länger auf sie herabsehen konnte. »Sie behaupten, Henrys Freund zu sein, warum verspotten Sie dann seine Ideale? Sind Ihre so viel besser?«
»Ich fürchte, ich habe gar keine.«
»Wie zynisch Sie reden. Und Sie glauben, Sie könnten mir Henry ersetzen?«
»Ihn ersetzen?« Er lachte. »Ich kann viel mehr als das.« Plötzlich fasste er sie beim Arm. »Kommen Sie, gehen wir ein paar Schritte, es ist ein so schöner Abend.« Ein sonderbarer Ton schwang in seiner Stimme. Antonia wich zurück. Auf keinen Fall wollte sie länger mit ihm allein hier draußen bleiben.
»Ich fürchte, der Tau würde meine Schuhe verderben«, sagte sie und glitt rasch an ihm vorbei zum Eingang. »Adieu, Mr. Reed.«
Am anderen Morgen war ihr Entschluss gefasst: Sie würde ihre Zelte in Charles Town abbrechen und nach Legacy zurückkehren. Auch wenn es schlecht um die Plantage stand, ihre Pächter fortgezogen, die Landarbeiter geflohen waren: Wenn sie Legacy behalten wollte, durfte sie nicht länger untätig darauf warten, dass ein Wunder geschah.
Für die Rückfahrt in die Stadt stellte Diane ihr eine leichte Chaise zur Verfügung; das Gepäck würde man ihr später zusammen mit ihrem Hausrat aus Charles Town nachsenden. Die Schwestern hatten sich gerade in der Halle voneinander verabschiedet, als ein livrierter Haussklave kam und Antonia bat, ihm zum Arbeitszimmer ihres Schwagers zu folgen.
Hocksley stand an seinem Schreibtisch auf, begrüßte sie förmlich und bot ihr einen Platz an. Er selbst zog es vor, während ihrer Unterredung zu stehen. »Schön, dass wir vor Ihrer Heimreise Gelegenheit haben, unter vier Augen miteinander zu sprechen«, begann er. »Sie wissen hoffentlich, wie sehr es mir am Herzen liegt, Ihnen meine Hilfe anzubieten, jetzt, da Sie alleine zurechtkommen müssen.«
»Danke, Theodore, aber ich traue mir zu, die Verwaltung von Legacy selbst in die Hand zu nehmen.«
»Tatsächlich? Die meisten Anbauflächen Legacys liegen seit Jahren brach. Die Felder wieder instand zu setzen, ist ein aufwendiges Unterfangen.«
»Aufwendig, ja, aber nicht unmöglich.«
»Nun gut. Doch wie soll es weitergehen? Die Bewirtschaftung eines solchen Anwesens erfordert mehr als die Erfahrung eines einfachen Farmers – über die Sie im Übrigen nicht verfügen, meine Liebe. Der Erfolg einer Plantage hängt vom Weitblick und vom kaufmännischen Geschick eines Pflanzers ab. Das hatte der arme Henry leider zu spät begriffen.«
Er meinte Henrys Versuch, die Plantage nach unkonventionellen Methoden zu bewirtschaften. Ihr Mann war Philosoph gewesen, kein Farmer. Nachdem er die agrarökonomische Literatur ihrer Bibliothek zurate gezogen hatte, ließ er junge Nutzpflanzen und Schösslinge verschiedener Obstbäume aus Europa kommen und legte erste Modellpflanzungen an. Vom Boden und dem Klima South Carolinas begünstigt, lieferten seine Obst- und Gemüsegärten schon bald erfreuliche Erträge. Aber die Pflanzerlobby machte geschlossen Front gegen Henrys »Reformprodukte« und boykottierte auf Hocksleys Betreiben den Handel mit den neuen Agrargütern zugunsten ihrer riesigen Monokulturen.
»Gesetzt den Fall«, fuhr Hocksley belehrend fort, »man würde Ihnen Saatgut zur Verfügung stellen, und Ihre Nachbarn würden Sie bei der Instandsetzung der Plantage unterstützen, so entstünden für Sie daraus immense Verpflichtungen. Sie müssten die Plantage auf Jahre hinaus belasten.« Er blieb am Fenster stehen und sah auf die Gartenanlagen, während er beiläufig sagte: »Viel einfacher wäre es, Sie verkauften Legacy, ohne viel Aufhebens natürlich und zu fairen Bedingungen, vielleicht an jemanden aus dem engeren Umfeld, wobei ich nicht unbedingt von mir spreche. Ich garantiere Ihnen, Sie könnten schon bald ein sorgenfreies Leben führen. Wie ich hörte, hat Mr. Crossbow Ihnen für das Anwesen ein gutes Angebot gemacht. Schlagen Sie es nicht leichtfertig aus.«
Sie wusste, auf diesen Moment hatte er lange gewartet. Was immer sie tat, es war ihm ein Ärgernis. Nachdem sie in seinen Augen jahrelang Schande über die Familie gebracht hatte, wollte er endlich den Triumph auskosten, dass sie auf seine Großmut angewiesen war. Aber diese Freude würde sie ihm nicht machen. »Sie sprechen von einem guten Angebot, Theodore, von fairen Bedingungen? Sie müssten mich besser kennen! Ich weiß sehr wohl, was meine Plantage wert ist. Wieso sollte ich zu einem Schleuderpreis an Ihren Strohmann Crossbow verkaufen?«
Hocksley tat gelassen. »Es soll nicht heißen, ich hätte Ihnen nicht meine Hilfe angeboten.«
»Oh, ich benötige Ihre Hilfe nicht. Denn sehen Sie, ich stehe mit Ashley & Bolton, der Hausbank meiner Familie, in Verhandlung über einen Kredit zu wirklich großzügigen Bedingungen. Mr. Ashley erwartet mich just heute in Charles Town, damit wir die Sache zum Abschluss bringen. Wenn Sie mich also bitte entschuldigen würden.« Ehe er etwas erwidern konnte, ging sie hinaus.
Sie hatte geblufft. Aber das wusste Hocksley nicht. Bestimmt hielt er sie für arrogant genug, gegenüber Ashley & Bolton den guten Klang des Namens Bell für ihre Zwecke in Anspruch zu nehmen. Und genau das hatte sie auch vor. Gilbert Ashley, der Bankinhaber, hatte ihr unlängst geschrieben, sie möge ihn wegen ihrer wachsenden Darlehensschulden aufsuchen. Bei der Gelegenheit wollte sie den Bankier an die langjährigen Geschäftsverbindungen mit dem Bell’schen Familienunternehmen erinnern im Vertrauen darauf, er werde ihren Kredit noch einmal verlängern. Sie war sich sehr wohl im Klaren, dass sie trotz alledem als Bittstellerin erscheinen würde.
Während sie auf den Wagen wartete, schlenderte sie durch die Ziergärten, die den Vorplatz umgaben. Zwischen den zahlreichen aus Europa und Asien importierten, zum Teil fremdartigen Bäumen und Stauden fiel ihr Blick auf einen toten Stamm, dessen Aststümpfe bizarr wie weiße Knochen aufragten. Sie erinnerte sich an die imposante griechische Zypresse, die hier wie eine Speerspitze zum Himmel emporgewachsen war. Nachdenklich ging sie zum Vorplatz zurück, gerade als die Chaise vorfuhr. Ein Bursche mit brauner Haut und hellem Kraushaar, dessen Vater bestimmt kein Schwarzer war, sprang vom Kutschbock.
»Guten Morgen, Maam!«, rief er und riss den Wagenschlag auf.
»Hallo, Nat«, begrüßte sie den jungen Mulatten. »Sollst du mich heute in die Stadt fahren?«
»Ja, Maam, ich bin jetzt zweiter Kutscher«, erklärte er stolz. »Ich kutschier’ die Ladies.«
Nachdem Antonia eingestiegen war, fragte sie ihn: »Nat, weißt du, was mit dem Baum dort passiert ist?«
»Oh ja, Maam, das war im großen Gewittersturm letzten Herbst: Ein Blitz fährt hinein, die Erde zittert und es kracht fürchterlich! Danach stand da nur noch dieser Stamm.«
»Warum lässt Mr. Hocksley den toten Baum nicht fällen?«
»Das darf er nicht, Maam. Keiner rührt das Gerippe an. Das bringt Unglück.«
»Sagt wer?«
»Na, alle!«, antwortete Nat mit einer weit ausholenden Geste.
Antonia zog die Brauen zusammen. »Mr. Hocksley glaubt doch nicht an solchen Humbug.«
»Vielleicht tut er’s, vielleicht nicht.« Nat zuckte die Schultern. »Anscheinend will er keinen Ärger mit den Voodoo-Leuten.«
Er kletterte auf den Kutschersitz, schnalzte mit der Zunge, der Wagen fuhr an. Antonia blickte nachdenklich zu der kahlen Zypresse zurück.
Das Bankhaus Ashley & Bolton stand an der Kreuzung von Broad und Meeting Street, am alten Versammlungsplatz von Charles Town. Ringsum lagen weite Teile der Stadt in Schutt und Asche. Nach einem großen Brand und der Explosion des Pulvermagazins waren ganze Straßenzüge zerstört. Doch in dem Areal zwischen Rathaus, Gerichtshof und der St. Michael’s Episkopalkirche hatten einige Gebäude den Krieg weitgehend unbeschadet überstanden.
Ein Mann empfing Antonia, den sie zuvor in der Bank noch nie gesehen hatte. »Mr. Ashley bedauert, Sie nicht persönlich begrüßen zu können, Mrs. Lorimer. Er musste geschäftlich nach Philadelphia«, erklärte er und bat sie in den Konferenzsaal.
Sein Nordstaatenakzent ließ Antonia die Brauen heben. »Ich bedauere es noch weit mehr, Mister …«
»Tyler, Madam, Andrew Tyler, aus dem New Yorker Büro. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz.«
Antonia war enttäuscht, ja entmutigt. Sie hatte gehofft, die Freundschaft des alten Mr. Ashley zu ihrem Vater könnte ihr von Nutzen sein. Stattdessen sollte sie nun mit einem völlig Fremden über Dinge verhandeln, die ihre Lebensgrundlage berührten. Sie beobachtete Tyler, der vom Bürodiener ein Dossier entgegennahm und sich ihr gegenüber setzte. Er machte einen konzentrierten, professionellen Eindruck, während er die Akte durchblätterte. Tyler war ein attraktiver Mann: Klare Gesichtszüge, griechisches Profil, athletische Statur – nein, es ließ sich nicht leugnen, dass er blendend aussah. Trotzdem, er ist ein Yankee, dachte sie, und ihre Miene wurde ein wenig geringschätzig.
»Würden Sie mir bitte sagen, warum ich hergebeten wurde, Mr. Tyler?«
»Nun, Madam«, sagte er, »wir wissen um Ihre schwierige finanzielle Lage. Darum wollten wir Ihnen nahelegen, sich von uns beraten zu lassen.«
»Ist das so?«, meinte sie kühl.
Mit halbem Lächeln nahm er ihre Südstaatenarroganz hin, nach ein paar Monaten in Charles Town war er daran gewöhnt. Was ihn jedoch störte, war, dass sie wie selbstverständlich davon ausging, er schulde ihr einen Gefallen. Dabei war sie in Wirklichkeit voll und ganz auf seinen guten Willen angewiesen; eine Tatsache, die ihr bekannt sein musste und die sie bewusst ignorierte. Er ließ sich mit der Antwort Zeit.
»Sehen Sie, Mrs. Lorimer, ich habe hier die Kreditakte Ihrer Plantage. In summa schulden Sie der Bank mehr, als das Anwesen je wert war. Die Bodenpreise sind stark gefallen, dazu kommen die Kriegsschäden, die wir noch nicht einmal berücksichtigt haben. Es würde einiges Entgegenkommen unsererseits voraussetzen, wenn wir nach dem Verkauf auf die Durchsetzung weiterer Forderungen gegen Sie verzichteten.«
»Nach welchem Verkauf?«
»Nach dem Verkauf Ihrer Plantage.«
»Sie glauben doch nicht im Ernst«, rief sie, »ich würde Legacy verkaufen!«
»Sie werden es müssen.« Ungerührt schlug er die Akte zu. »Es tut mir leid, Madam, aber ich kann Ihren Kredit nicht mehr verlängern.«
Darauf war Antonia nicht vorbereitet. Sie wurde blass, die Kündigung des Bankkredits traf sie wie ein Schlag. Dieser geschäftstüchtige Yankee meinte es ernst, er wollte ihr nicht helfen. Vielleicht hätte sie liebenswürdiger sein, ihm weniger hochmütig begegnen sollen? Wie auch immer, später würde noch genug Zeit sein, sich Vorwürfe zu machen, jetzt musste sie sich schnell etwas einfallen lassen, wenn sie ihn dazu bringen wollte, die Angelegenheit noch einmal zu überdenken.
»Mr. Tyler, Sie wissen selbst, dass viele Pflanzer es genauso schwer haben wie ich. Die Plantagen des gesamten Lowcountry sind verwüstet worden, alles muss instand gesetzt werden. Es wird eine gewisse Zeit dauern, bis ich auf meinem Land wieder produzieren kann, und so lange brauche ich den Kredit Ihrer Bank. Geben Sie mir nur ein Jahr. Sie werden sehen, dann werde ich auf Legacy wieder Reis anbauen.«
»Und wie wollen Sie das ohne Arbeitskräfte bewerkstelligen? Ich hörte, Sie haben Ihre Sklaven freigelassen. Warum?«
»Weil der Wohlstand Amerikas nicht durch Ausbeutung und Sklaverei erkauft sein darf.« Sie bemerkte, wie hochtrabend das klang, und biss sich auf die Lippen.
»Soso, der Wohlstand Amerikas.« Tyler lächelte nachsichtig. »Verehrte Mrs. Lorimer, falls es Ihrer Aufmerksamkeit bisher entgangen sein sollte: Dieser Wohlstand, von dem Sie sprechen, wird von einer Anzahl industrialisierter Staaten im Norden geschaffen, und zwar von freien Männern aller Stände, die sich harter Arbeit nicht schämen. Während sich der Süden in feudaler Großmannssucht gefällt, werden diese Männer der Nordstaaten die Welt verändern … Aber zurück zu Ihrem Problem. Sie haben Ihre Sklaven, wohlgemerkt wertvolle Wirtschaftsgüter, ersatzlos aufgegeben. Freie Landarbeiter können Sie nicht bezahlen, also werden Sie weder in einem Jahr noch sonst irgendwann wieder Ihre Plantage bewirtschaften können.«
Er wollte ihre Kreditakte endgültig beiseiteschieben, da legte Antonia ihre Hand darauf. »Warten Sie! Meine Leute werden ohne Bezahlung arbeiten.«
Tyler hob ungläubig die Brauen. »Wieso glauben Sie, die Schwarzen würden das für Sie tun?«
»Legacy ist ihr Zuhause, genauso wie meines. Darum werden sie keinen Lohn verlangen. Aber um die Leute und ihre Familien zu ernähren, benötige ich Ihren Kredit.«
»Und welche Sicherheit können Sie mir geben?«
»Nun, Mr. Tyler, ich gebe Ihnen mein Wort.«
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, verschränkte die Arme. »Das Ehrenwort einer Südstaatenlady und der gute Wille einer Handvoll freigelassener Schwarzer?« Er nickte langsam. »Ich werde darüber nachdenken.«
3.
Antonia wusste nicht, wie lange sie schon auf dem kalten Boden kauerte, neben dem Mann in seinen blutstarrenden Kleidern. Er war schwer verwundet und bewusstlos. Das ganze Ausmaß seiner Verletzungen mochte sie sich gar nicht vorstellen. Sie erinnerte sich, dass bei dem Dinner auf Prospero Hill von einem Gefecht mit britischen Nachschubtruppen am Santee River die Rede gewesen war. Captain Reed hatte erwähnt, die englische Vorhut sei bei dem Zwischenfall vollständig vernichtet worden. Sollte der Verletzte etwa die lange Strecke vom Santee bis hierher geritten sein?
Sie fror. Vielleicht sollte sie einfach zurück ins Haus gehen, sie konnte ohnehin nichts für ihn tun. Er würde die Nacht wahrscheinlich nicht überleben. Morgen würde sie dann bei der Kommandantur den toten Soldaten melden. Sie nahm die Laterne, um sein Gesicht anzusehen. Er lag wie leblos da, angetrocknete Blutrinnsale im Mundwinkel und an der Schläfe, wo ihn der Steigbügel getroffen hatte. Er war so still, sein Brustkorb hob und senkte sich kaum wahrnehmbar. Sie wollte nach seinem Handgelenk greifen, um den Puls zu fühlen, tat es dann doch nicht. Vielleicht würde er wach, wenn sie ihn anfasste, und was dann? Selbst jetzt, da er ohnmächtig vor ihr lag, fürchtete sie sich vor ihm.
Sie wünschte, Henry wäre jetzt hier. Aber ihr Mann war tot, einer von Tausenden, die im Krieg umgekommen waren. Und dieser Soldat würde auch sterben, wenn sie nichts unternähme. Was für ein sinnloser Tod, nachdem er sich bis hierher geschleppt hatte. Nein, sie durfte ihn nicht so sterben lassen. Sie musste etwas tun. Und sie musste sich beeilen.
Die Bodendielen knarrten, während sich die Indianerin langsam in ihrem Schaukelstuhl wiegte. Die Tabakpfeife im Mund betrachtete sie unter halb geschlossenen Lidern die junge Frau in Männerkleidern, die durch den Wald und die Dunkelheit zu ihr gekommen war und sie anflehte: »Bitte, Vier Federn, du musst ihm helfen!«
»Muss ich das?«
»Um Himmels willen, er stirbt!«
»Dann stirbt er.«
Antonia presste die Lippen zusammen, um sich zu beherrschen. Vier Federn war der einzige Mensch, der ihr helfen konnte, aber es wäre zwecklos, ihre Hilfe erzwingen zu wollen. Die Indianerin vom Stamm der Secotan war in der Gegend als Heilerin bekannt. Mit ihren Kenntnissen der Naturmedizin behandelte sie Malaria und Gelbfieber, Brandwunden und Knochenbrüche. Sie half den Kindern, gesund zur Welt zu kommen, und den Alten, sie ohne Schmerzen wieder zu verlassen. Auch zu Antonias Geburt hatte man sie gerufen. Doch sie hatte nicht verhindern können, dass deren junge Mutter im Kindbett starb. Seither wachte sie über Antonias Leben, wie sie es der Sterbenden versprochen hatte.
»Ein Engländer also«, brummte sie durch den blauen Rauch, der von ihrer Pfeife aufstieg. »Haben nicht die Engländer deine Plantage verwüstet?«
»Das spielt jetzt keine Rolle«, sagte Antonia nervös. »Verstehst du denn nicht, ich kann ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen, es verstieße gegen das Gebot der Menschlichkeit.«
»Menschlichkeit!« Vier Federn schnaubte. »Was wissen die Leute nach sechs Jahren Krieg noch von Menschlichkeit? Dieser Engländer ist dein Feind, Antonia.«
Sie legte die Pfeife beiseite, und als hätte sie ihre Besucherin vergessen, schloss sie die Augen. Sacht schwang der Schaukelstuhl vor und zurück, vor und wieder zurück. Antonia spürte, wie die Zeit zerrann, und wollte die Hoffnung schon aufgeben, als ihr plötzlich ein neuer Gedanke kam. Beiläufig, als würde sie nur laut denken, sagte sie: »Ich könnte natürlich die schwarze Zauberin um Hilfe bitten. Es heißt, sie bereite Heiltränke für ihre Leute.«
»Bist du verrückt geworden?«, knurrte Vier Federn. »Die Voodoo-Frau ist unberechenbar, am Ende macht sie aus deinem Soldaten einen dieser lebenden Toten.«
Antonia hielt ihrem strengen Blick stand, ein stummes Kräftemessen, bis sich Vier Federn endlich erhob und die irdenen Krüge, in denen sie ihre Heilmittel aufbewahrte, zusammentrug.
Die Abendsonne vergoldete das Laub der Steineichen, die vor fast einhundert Jahren entlang der Auffahrt zum Herrenhaus gepflanzt worden waren. Ein langer Tag ging zu Ende. Im Küchenkamin glomm unter der Asche noch ein Rest Glut. Antonia warf einen Armvoll Brennholz darauf und ließ sich in einen Stuhl sinken. Sie war am Ende ihrer Kräfte. Sie hatte getan, was sie tun musste, um das Leben eines Fremden zu retten, dessen bloße Anwesenheit sie in Gefahr brachte. Doch sie war viel zu erschöpft, um sich darüber Sorgen zu machen. Vier Federn kam aus dem Nebenraum herein. Sie schürte das Herdfeuer und bereitete Tee in einer Blechkanne, die sie zusammen mit zwei Tassen auf den Tisch stellte. Dann zog sie sich einen Stuhl heran.
»Wir müssen reden«, sagte sie und schenkte den Tee ein. »Bist du noch wach?«
Was für eine Frage! Seit Sonnenaufgang hatte Antonia das Feuer im Herd nicht mehr ausgehen lassen. Kessel um Kessel hatte sie Wasser abgekocht und in den angrenzenden Schlafraum geschleppt. Sie hatte ihre Damasttischdecken vom Herrenhaus geholt, in Streifen geschnitten und zu Verbänden gerollt, um sie als blutgetränkte Stofffetzen später im Herdfeuer zu verbrennen. Müde trank sie einen Schluck Tee und nickte ergeben.
»Nun gut«, begann Vier Federn. »Es war ein hartes Stück Arbeit, diesen Mann wieder zusammenzuflicken. Ich habe seine Verletzungen behandelt, aber du wirst ihn noch wochenlang pflegen müssen. Glaub nicht, es wäre leicht, einen derart schwer verletzten Mann rund um die Uhr zu versorgen. Du musst seine Verbände wechseln, die Wunden sauber halten, ihn ernähren und waschen. Und wenn die Schmerzen ihn rasend machen, musst du auch das mit ihm durchstehen. Traust du dir das zu?«
»Ich denke schon«, sagte Antonia. »Er wird es doch schaffen, oder?«
»Ich bin mir nicht sicher. Er hat viel Blut verloren. Dazu kommt ein offener Bruch am rechten Unterschenkel, es könnte Wundbrand entstehen. Du weißt, was das bedeutet.«
Antonia nickte, ihr schauderte beim Gedanken an eine Amputation.
»Es sind auch einige Rippen gebrochen«, fuhr Vier Federn fort. »Quetschungen, Blutergüsse, eine Schusswunde im rechten Oberarm, die sich entzündet hat. Der Kratzer an der Schläfe, den du ihm verpasst hast, ist harmlos.« Sie machte eine Pause, bevor sie weitersprach: »Dann hat er noch diese seltsamen Verletzungen, gleichförmige, flach unter der Haut geführte Schnitte, wie vom Häuten. Sie verlaufen über seine Brust bis hinunter zu den Leisten. Es wurde eine breite Klinge benutzt, vielleicht ein Jagdmesser oder ein geschliffener Dolch. Er sollte wohl langsam sterben. Erstaunlich, dass er solche Martern überlebt hat.«
Beim Zuhören wurde es Antonia immer elender. Sie fragte sich, wer einem Menschen so etwas antun konnte. Ganz gleich, was der Mann getan hatte, niemand verdiente diese Art der Vergeltung.
»Er hat jetzt keine Schmerzen«, sagte Vier Federn, die ihre Erschütterung bemerkte. »Dank des Stechapfelsaftes wird er ein paar Stunden schlafen.« Sie reichte ihr eine kleine verkorkte Flasche. »Wenn er aufwacht, gib ihm hiervon einen oder zwei Tropfen, nicht mehr.«
»Du willst mich mit ihm allein lassen?«
»Im Augenblick kann ich nichts mehr für ihn tun. Sieh zu, dass er viel trinkt, Tee oder Wasser mit etwas Zucker und Salz.«
»Und davon soll er gesund werden? Ist das alles?«
»Nein, leider nicht.« Vier Federn seufzte. »Das gebrochene Bein muss ausgerichtet und geschient werden. Aber das schaffen wir nicht alleine.« Sie überlegte. »Wo ist dieser Schwarze, dein Kutscher?«
»Joshua? In Fort Wren, er wollte unbedingt bei den Pferden bleiben und für sie sorgen.«
»Das ist unser Mann!«, sagte Vier Federn. »Ich schicke ihm eine Nachricht, dass sich ein krankes Armeepferd nach Legacy verirrt hätte. Dann wird er sofort kommen.«
4.
Er erwachte in einem Bett mit vier hohen Pfosten. Die Vorhänge an den Fenstern waren zurückgezogen, es musste früh am Morgen sein.
Welcher Morgen? Wie lange lag er schon hier? Wo war er überhaupt? Es roch sauber, nach Kampfer und getrockneten Kräutern. Um den Brustkorb spürte er einen leichten Druck – es war ein Verband! Jemand hatte ihm die Uniform ausgezogen, ihn gewaschen und seine Wunden versorgt. Das Atmen tat jetzt weniger weh. Die Schmerzen, die seinen Körper tagelang in wilden Attacken überfallen hatten, schienen abgeklungen, vielleicht waren sie auch durch eine Droge betäubt. Vorsichtig bewegte er die Finger der einen, dann der anderen Hand. Er spürte, wie das Leben in seinen Körper zurückkehrte, versuchte, die rechte Hand zu schließen, schloss sie fest zur Faust, so als würde er seinen Säbel greifen – zum Teufel, der Säbel!
Er erinnerte sich, er war in diesem Stall … Eine Frau war hereingekommen, sie hatte ihn nicht bemerkt und begonnen, sein Pferd abzusatteln. Er wollte mit ihr sprechen, aber sie … hatte ihn mit dem verdammten Sattel zu Boden geworfen. Er stieß eine üble Verwünschung aus, sofort durchfuhr ein scharfer Schmerz seinen Brustkorb. Während er keuchend nach Atem rang, nahm er links von sich eine Bewegung wahr. Vorsichtig wandte er den Kopf und erblickte eine junge Frau in Männerkleidern, die auf der anderen Seite des Bettes lag. Sein Ausruf hatte sie geweckt, ihr Gesicht war blass und übernächtigt.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte sie mit unsicherer Stimme und setzte sich auf. »Haben Sie Schmerzen?«
»Wo sind wir hier?«
»Auf Legacy, einer Plantage am Plains River.« Unter seinem misstrauischen Blick zog sie ihre Stiefel an. »Ihr Pferd hat Sie hergebracht«, sagte sie, »aber keine Sorge, Sie sind hier in Sicherheit.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte er schroff.
»Die Plantage ist verlassen, außer mir ist hier niemand.«
»Niemand? Sie können mich nicht allein in dieses Zimmer gebracht haben.«
»Aber nein, natürlich nicht. Eine Indianerin, eine heilkundige Frau, hat mir geholfen. Sie hat auch Ihre Wunden versorgt.«
Er beobachtete voller Argwohn, wie sie um das Bett herum zur Tür ging. »Wo wollen Sie hin?«
»Nirgends … ich bin gleich zurück, ganz bestimmt!«, stieß sie nervös hervor und lief hinaus.
In der Küche atmete Antonia tief durch. Sie ärgerte sich darüber, dass der Engländer sie aus der Fassung gebracht hatte. Er sollte froh sein, dass er überhaupt noch lebte. Wenn sie andererseits bedachte, was ihm widerfahren war … Mit der Zeit würde er sicher zugänglicher werden, doch jetzt brauchte er Ruhe. Wie Vier Federn es ihr eingeschärft hatte, würde sie ihm regelmäßig ein paar Tropfen von dem Stechapfelsaft geben, damit er ohne Schmerzen schlafen konnte.
Sie nahm einen Krug und füllte ihn mit Wasser. Als sie das Krankenzimmer wieder betrat, trug sie wie zum Beweis ihrer guten Absicht den vollen Krug vor sich her. »Sehen Sie, ich habe nur frisches Wasser geholt.«
Auf der Truhe am Fußende des Bettes hatte sie neben dem Verbandszeug schon das Schlafmittel bereitgestellt. Sie füllte ein Glas mit Wasser und nahm die kleine Flasche zur Hand. Als sie aufsah, begegnete sie dem finsteren Blick des Soldaten. Er beobachtete genau, wie sie die Flasche entkorkte und eine klare Flüssigkeit dem Wasser hinzufügte.
Sie trat zu ihm ans Bett. »Hier, trinken Sie das, in kleinen Schlucken … nein, halt, warten Sie!«
Ehe sie ihn daran hindern konnte, trank er das Glas in einem Zug leer. Als er es ihr zurückgab, sagte er verächtlich: »Was werden Sie tun, wenn Ihnen die Betäubungsmittel ausgehen, Madam?« Sie nahm das leere Glas wortlos entgegen, da packte er ihr Handgelenk. Das Glas entglitt ihren Fingern und zersplitterte auf dem Boden. »Sehen Sie mich an!«, knurrte er mit vor Schmerz zusammengebissenen Zähnen und zog sie mit einem Ruck zu sich heran. »Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich bin ein Offizier der Krone, ich werde mich nicht betäubt und kampflos ergeben.«
»Aber … niemand wird Sie hier finden …«
»Jedenfalls nicht unbewaffnet! Geben Sie mir meinen Säbel zurück, sofort!« Sie versuchte, ihm ihren Arm zu entwinden, worauf er sie noch fester hielt. »Tun Sie, was ich Ihnen sage! Ich will … mein Schwert … und meine … Pistolen …«
Er konnte nicht weitersprechen. Seine hellgrauen Augen verdunkelten sich, der Griff um ihr Handgelenk lockerte sich, dann ließ er sie los. Sein Arm schlug hart auf die Bettkante. Bewusstlos fiel er zurück.
Als Vier Federn gegen Mittag zurückkam, lag der Soldat ohnmächtig auf seinem Krankenlager. Sie untersuchte ihn und versorgte seine Verletzungen. Erst danach ließ sie sich von Antonia berichten, was am Morgen vorgefallen war. Eine Weile saßen sie schweigend am Küchentisch, Antonia rollte frische Leinenstreifen zu Verbänden, Vier Federn rauchte.
Endlich nahm sie die Pfeife aus dem Mund und brummte: »Nur einen oder zwei Tropfen von der Medizin, hatte ich gesagt! Wenn du ihn umbringen wolltest, hätten wir uns die ganze Mühe sparen können!«
»Es tut mir leid. Ich wollte, dass er wieder einschläft. Er war so aggressiv.«
»Was hast du erwartet? Dass er sich bei dir bedankt?«
»Zumindest könnte er zulassen, dass ich ihm helfe.«
»Oh, das wird er schon tun, Antonia, aber du darfst ihn auf keinen Fall wie einen Gefangenen behandeln.« Vier Federn blickte nachdenklich zum Nebenzimmer. »Wahrscheinlich wird es nicht lange dauern, bis er versucht, von hier wegzukommen.«
»Mit einem gebrochenen Bein?«
»Unterschätze ihn nicht! Der Mann ist ein Krieger. Er führt ein Leben am Rande des Todes und wurde dafür ausgebildet, sein Letztes zu geben oder zu sterben.« Sie tat einen Zug aus der Pfeife und sah dem Rauch nach. »Außerdem weiß er, dass ihm die Zeit davonläuft. Es ist absehbar, dass die Engländer kapitulieren und das Land verlassen. Dein Soldat wird um jeden Preis seiner Armee folgen wollen.«
»In seinem Zustand?«
»Sehr richtig, genau da liegt das Problem, Antonia. Wenn er aufgegriffen wird und herauskommt, dass du einen flüchtigen britischen Offizier in deinem Haus gesundgepflegt hast, bist du dran.«
»Meinst du, das wüsste ich nicht!« Unwillig schob Antonia das Verbandszeug beiseite. »Ich muss ihm klarmachen, dass wir einen anderen Weg finden werden. Nur darf er nichts überstürzen.«
»Nichts überstürzen?«, rief Vier Federn. »Nach allem, was ihm passiert ist, soll er riskieren, dass man ihn hier entdeckt?«
»Wer sollte ihn denn entdecken? Es kommt doch niemand her.«
Im selben Moment hörten sie einen Wagen auf den Hof fahren und vor der Remise halten. Antonia sprang auf, als schwere Schritte über die Veranda dröhnten. Kurz darauf wurde schwungvoll die Eingangstür aufgestoßen. Herein kam ein riesiger Mann, ein Schwarzer in einem langen Staubmantel. Mitten in der Küche blieb er stehen, nahm den breitrandigen Hut vom Kopf und rief: »Aaah! Wieder zu Hause!«
»Joshua!« Antonia lief zu ihm, fasste seine Hand und strahlte. Joshua Robert war ihr Vertrauter, ihr Freund aus Kindertagen. Und er war ein freier Mann.
»Schönen guten Tag, Miss.« Joshua verneigte sich und begrüßte auch Vier Federn, die ihn schweigend musterte. »Ich habe mich gleich auf den Weg gemacht«, sagte er und sah Antonia erwartungsvoll an. »Es hieß, ich solle mich um ein verirrtes Pferd kümmern?«
Antonia wich seinem Blick aus. Jetzt erst bemerkte er auf dem Tisch den Stapel sauber gefalteter Tücher und die zu Rollen aufgewickelten Leinenstreifen und spürte leises Unbehagen. »Ich werde schon mal zum Stall rübergehen«, sagte er und wandte sich zur Tür.
»Das kann warten, Joshua«, meinte Vier Federn. »Wir brauchen zunächst hier drinnen deine Hilfe.«
»Wozu?«
»Im Zimmer nebenan liegt ein Soldat mit einem gebrochenen Bein. Alleine kann ich es nicht richten.«
Joshua zog die Brauen zusammen. »Wohl keiner von unseren Jungs, nehme ich an? Na, ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun.«
Vier Federn hatte es jetzt eilig. »Wir sollten anfangen, bevor er das Bewusstsein wiedererlangt. Macht Wasser heiß und wascht euch die Hände. Beeilt euch!«
Sie nahm eine Handvoll Bandagen und ihren Medizinbeutel und ging ins Krankenzimmer. Der Soldat lag reglos auf dem Bett, in einem Zustand zwischen Ohnmacht und Schlaf. Sie schlug die Decke zurück und strich sanft über seinen in Bandagen eingebundenen Körper. »Es wird wehtun. Aber du hast schon ganz anderes ertragen. Schlafe einfach weiter. Schlafe!«
Sie überzeugte sich, dass er gleichmäßig atmete. Dann entfernte sie den Verband von seinem Bein, säuberte die schorfige Wunde über dem Bruch und richtete frisches Verbandsmaterial her; auch zwei stabile Holzleisten hatte sie zum Schienen mitgebracht. Als Antonia und Joshua hereinkamen, erklärte sie ihnen in knappen Worten, wie sie vorgehen wollte.
Antonia starrte auf den Verletzten, auf das gebrochene Bein, die blutenden Wundränder und freiliegenden Knochen und wäre am liebsten hinausgelaufen. Doch sie blieb und hoffte nur, die Prozedur möge schnell vorübergehen.
Joshua betrachtete den Soldaten schweigend, während seine Miene sich zusehends verdüsterte. Als die Indianerin ihn aufforderte, ans Krankenbett heranzutreten und den Verletzten festzuhalten, fuhr er sie plötzlich feindselig an: »Nein, ich mach das nicht, soll er doch draufgehen!«
»Joshua«, sagte Vier Federn ruhig, »wir müssen jetzt anfangen.«
»Wissen Sie eigentlich, was Sie da von mir verlangen, Ma’m?«
»Sicher.« Sie ließ Joshua nicht aus den Augen. »Warum, glaubst du, habe ich gerade nach dir geschickt?«
Schließlich gab er widerwillig nach und nahm seinen Platz ein, befolgte die Anweisungen der Indianerin und hielt den Mann fest. Nun fasste Vier Federn das Bein des Mannes unterhalb der Bruchstelle, drehte, zog und dehnte es vorsichtig, um die Knochenteile voneinander zu lösen. Als sie eine Knochenspitze, die durch die Haut nach außen gedrungen war, zurückdrückte, wand sich der Verletzte trotz der Betäubung vor Schmerz. Joshua hielt ihn ungerührt nieder. Doch der Verletzte wehrte sich immer mehr.
»Antonia, sprich mit ihm!«, sagte Vier Federn.
Aber Antonia war zu bestürzt, um tröstende Worte für den Gepeinigten zu finden. Mit zitternder Hand wischte sie ihm den Schweiß von Stirn und Wangen, mehr konnte sie nicht tun. Indessen hielt Joshua ihn unnachgiebig fest, bis Vier Federn die Bruchstelle ausgerichtet, zwischen den Holzschienen fixiert und so verbunden hatte, dass das verletzte Bein vom Fußgelenk bis zur Hüfte ruhiggestellt war. Antonia atmete auf, als der Soldat in ruhigen Dämmerschlaf zurückfiel.
Joshua rieb sich mit einem Tuch das Blut von den Händen. Ohne den Verletzten noch einmal anzusehen, wandte er sich zum Gehen. »Kommen Sie, Miss Antonia, ich bringe Sie hinaus.«
Antonia zögerte.
»Geh nur«, sagte Vier Federn zu ihr. »Ich bleibe hier bei ihm.«
Als die beiden draußen waren, entnahm Vier Federn ihrem Medizinbeutel einen Kerzenstumpf aus dunklem Wachs, entzündete ihn und steckte ihn in einen Leuchter auf dem Kaminsims. Bald erfüllte den Raum der Geruch von bitterem Balsam. Nun setzte sie sich zu dem Kranken und verteilte auf seinem Lager verschiedene Gegenstände: Um seinen Kopf legte sie vier blaugrüne Federn der Karaa-Krähe, die ihr Totem war und Quelle ihrer spirituellen Kraft. Unter den Verband um seine Brust schob sie einen flachen Stein mit dem eingeritzten Bild einer Schlange, Symbol des Weißen Wassers, das aus dem Ursprung der Welt strömt. Zuletzt band sie dünne Lederschnüre um seine Handgelenke, auf die blaue Perlen gezogen waren, als Talismane gegen missgünstige Geister. Ein Beben durchlief seinen Körper. Sie legte die Hand auf seine Brust, zählte die Herzschläge, seufzte und strich ihm über die feuchte Stirn. Was sie als Heilerin für ihn tun konnte, war getan. Nun flocht sie sein dunkles Haar zu zwei Strängen, die sie zärtlich durch ihre rauen Hände gleiten ließ.
Seit sie ihm zum ersten Mal begegnet war, hatte sie gehofft, ihn wiederzusehen, diesen Engländer, dessen Anblick sie an die Krieger ihres Volkes erinnerte, so stolz, so mutig und streitbar. Als Antonia sie letzte Nacht aufgesucht und von einem englischen Soldaten erzählt hatte, der halbtot in ihren Stallungen lag, wusste Vier Federn, dass er zurückgekommen war. Sie kannte seine Geschichte, dies war nicht das Ende. Es konnte ein Anfang sein. »Du hast Fürsprache gefunden, William: Dein Leben für ein anderes!«
Der Mann warf den Kopf unruhig zur Seite, er atmete schnell und unstet. Die Indianerin erhob sich, breitete die Arme über ihm aus und rief die Geister ihrer untergegangenen Welt.
Antonia ging mit Joshua zu den Stallungen, um nach dem Pferd des Soldaten zu sehen. Ehe sie sich in der vorigen Nacht aufgemacht hatte, um Vier Federn zu holen, hatte sie das Tier in einem der leeren Stallabteile untergebracht und mit ausreichend Futter und Wasser versorgt, es dann aber sich selbst überlassen. Als Joshua nun das Gatter öffnete, wandte das Pferd sich herum, brachte seinen großen ramsnasigen Kopf näher heran, sog den Geruch des Mannes in seine Nüstern und stieß die Luft geräuschvoll wieder aus.
»Was bist du für ein prächtiger Bursche!«, sagte Joshua voller Bewunderung. Mit ruhiger Hand strich er über den Brustkorb des Pferdes, ertastete den Zustand von Knien, Sprunggelenken und Hufen. »Offenbar kann er eine ganze Menge verkraften«, bemerkte er. »Ein gut trainiertes Militärpferd, es muss in ausgezeichneter Verfassung gewesen sein vor diesem letzten Gewaltritt.« Er untersuchte Augen und Ohren des Tieres, dabei sagte er halblaut: »Da hat jemand drauf geachtet, dass du immer gut versorgt warst, nicht wahr, mein Großer?«
Er klopfte dem Pferd die Schulter, verließ die Box und schloss sorgfältig das Gatter. Antonia machte ihm ein Zeichen, ihr zu folgen. Sie gingen bis ans Ende der Stallgasse und betraten die Futterkammer, in der mehrere hüfthohe Hafertruhen standen. Antonia schob einen Stapel leerer Kleiesäcke von einer der Truhen und stemmte den Deckel auf. Joshua hob einen Sattel und Zaumzeug heraus.
»Nicht schlecht«, bemerkte er, »die Britische Armee spart nicht am Material.«
Antonia deutete erneut auf die Truhe. Er zog eine Pferdedecke heraus. Als er sah, was darunterlag, pfiff er leise durch die Zähne.
»Sieh an, ein kleines Waffenarsenal!« Nacheinander holte er einen Säbel mit Drapierung, einen Holster mit zwei Pistolen und einer Munitionstasche hervor und breitete alles auf dem Boden aus. »Was soll damit geschehen, Miss Antonia?«
»Das weiß ich noch nicht«, sagte sie nachdenklich, während Joshua die Pistolen sorgsam entlud und zusammen mit dem Säbel in die Truhe zurücklegte. »Fürs Erste bleibt alles hier. Wer käme schon auf die Idee, in unseren Futterkisten nach Waffen zu suchen?«
Als sie auf den Hof hinaustraten, stand die Sonne tief am westlichen Himmel. Antonia setzte sich an die Pferdetränke. Joshua, den Rücken gegen die sonnenwarme Stallmauer gelehnt, betrachtete sie nachdenklich. Er kannte Antonia gut genug, um zu wissen, dass sie sich in ihrer Hilfsbereitschaft für den Soldaten nicht beirren lassen würde. Und genau das bereitete ihm Sorgen. Schlimm genug, dass ihr nach dem Tod des Ehemannes auch der Verlust der Plantage drohte: Nun riskierte sie, in ernsthafte Schwierigkeiten zu geraten wegen dieses Deserteurs oder Kriegsverbrechers.
Dass sich Schwierigkeiten anbahnten, wusste er seit dem Moment, als er den Engländer wiedererkannt hatte. Er würde mit der Indianerin reden, aber er musste allein mit ihr reden. Antonia machte er den Vorschlag, sie solle ins Haus gehen und sich ausruhen, die Sorge um ihren Patienten könne sie vorerst ihm überlassen.
»Kommen Sie, Missy, Sie schlafen ja schon mit offenen Augen!«, rief er, um sie aufzuheitern, im sauertöpfischen Tonfall seiner Mutter, Antonias Nanny Charlene. »Hopp, auf Ihr Zimmer, und ’ne anständige junge Miss läuft nich in Stiefeln übern Hof!«
»Schon gut, Joshua.«, willigte Antonia lachend ein. »Ich werde mich ein wenig hinlegen. Aber ruf mich, bevor Vier Federn geht.«
Im Kutscherhaus legte Joshua gerade Feuerholz nach, als Vier Federn aus dem Krankenzimmer kam. Er nahm die Emailkanne vom Herd, in der frischer Kaffee dampfte, goss ihr eine Tasse davon ein, dann machte er sich wieder an der Feuerstelle zu schaffen. In Gegenwart der Indianerin fühlte er sich befangen. Es hieß, sie verfüge über die spirituellen Fähigkeiten des alten Volkes, dergleichen war ihm nicht geheuer.
»Dieser Soldat nebenan«, begann er grimmig. »Er ist der Engländer, der Captain Lorimer erschossen hat, dieser verfluchte Colonel Spencer!« Aufgebracht warf er den Schürhaken in den Korb mit dem Feuerholz. »Sie müssen ihn doch erkannt haben? Am Snakewater Creek hetzte er seine Reiterschwadron auf uns, als wären wir Schlachtvieh!«
Vier Federn blies in ihren heißen Kaffee und sagte ruhig: »Ich weiß, wer er ist.«
»Er hat Legacy zerstört, und Sie retten ihm das Leben?«
»Es war Antonias Entscheidung.«
»Sie hätte sich anders entschieden, wenn sie wüsste, wer er ist«, sagte Joshua wütend.
»Antonia hat Mitleid mit ihm. Das ist in Ordnung.«
»Oh nein, es ist nicht in Ordnung, und das wissen Sie!« Er war ungehalten, dass die Indianerin sich nicht besorgter zeigte. »Wir müssen ihr die Wahrheit über diesen Mann sagen!«
»Die Wahrheit? Glaub mir, Joshua, die Wahrheit ist mehr als das, was du oder ich dafür halten.« Sie nahm ihre Jacke und die Tasche mit den Amuletten und ging hinaus.
Joshua war im Recht, das wusste sie, und wem läge Antonias Wohl mehr am Herzen als ihr? Doch auch Williams Wohl lag ihr am Herzen, ach viel mehr als das!
»Wenn du willst, dass sie die Wahrheit erfährt, dann tu nichts. Warte einfach ab, was geschieht«, sagte sie zu Joshua, der ihr nach draußen gefolgt war. »Jetzt fahr mich nach Hause. Es war ein langer Tag.«
Der Himmel spannte sich über der Welt wie ein leuchtendblaues Fahnentuch. Die ersten Sterne gingen auf, als Joshua nach schweigsamer Fahrt den Wagen beim Altwasserkanal anhielt. Von hier führte ein Fußweg zur Kate der Indianerin. Sie sagte zum Abschied: »Antonia kann den Mann nicht alleine versorgen. Also hilf ihr, Joshua, und bleib in der Nähe.«
»Oh, Sie können sicher sein, Ma’m, ich werde Tag und Nacht ein Auge auf ihn haben, schließlich ist es mein Haus, und er liegt in meinem Bett.«
Antonia erwachte am hellen Morgen. Als sie erkannte, wie lange sie geschlafen hatte, war sie im Nu auf den Beinen. Sie wusch sich das Gesicht und kämmte sich vor dem Kaminspiegel. Sie fand, das viele dunkle Haar machte ihr Gesicht heute besonders blass, und flocht es zu einem festen Zopf, der ihr bis zur Taille über den Rücken fiel. Dann trat sie näher an den Spiegel heran und betrachtete sich eine Weile mit zusammengezogenen Brauen. Der Blick ihrer dunklen Augen war intensiv und verlieh ihrem schmalen Gesicht einen ernsten Ausdruck. Wie Charlene es ihr als Kind beigebracht hatte, schob sie mit den Zeigefingern ihre Mundwinkel nach oben. »Lächeln, Missy, lächeln!«, sagte sie zu ihrem Spiegelbild und musste über die Grimasse lachen. Sofort strahlten ihre Augen. Schnell stieg sie in Reithosen und Stiefel und griff im Hinausgehen nach einem abgetragenen Jagdrock ihres Mannes, die passende Kleidung für das Leben auf der Plantage, fand sie. Für gesellschaftliche Anlässe oder für Besuche in der Stadt wählte sie die komplizierte Garderobe, die ihr Stand ihr vorschrieb. Sonst trug sie gern Männerkleidung.