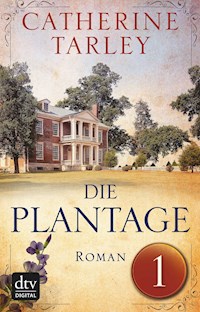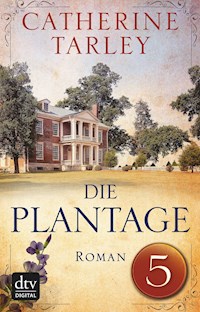
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das fünfte eSequel des Bestsellers Das große Südstaatenepos als eSequel in 5 Teilen. South Carolina 1783, kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg. Die junge Witwe Antonia Lorimer lebt alleine auf ihrer vom Krieg beschädigten Plantage Legacy. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Plantage wieder instand zu setzen und einen schwer verwundeten britischen Colonel gesund zu pflegen: William Marshall. Dass in den Kriegswirren ausgerechnet er ihren Mann Henry erschossen hat, weiß die junge Frau nicht und verliebt sich in den Colonel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
CATHERINE TARLEY
DIE PLANTAGE
Teil 5
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Für Emily und Colin
X. Heimkehr
39.
Am 16. Juni 1782 schrieb Père Guénégou an seinen Mitbruder und Freund Émanuel Rammeau:
»Mein Bruder in Christo, lieber Émanuel,
Unsere Congregation hat mir befohlen, dem armen Schiffbrüchigen meinen Schutz zu entziehen. Das betrübt mich sehr, zumal ich zu wenig Spanisch spreche, um dem Jungen zu erklären, warum er nicht länger bei mir bleiben kann. Dennoch glaube ich, eine barmherzige Lösung gefunden zu haben: Er ist ein Kind der Neuen Welt, und so scheint es mir das Beste, ihn in seine Heimat Neuspanien zurückzuschicken. Also erwirkte ich beim Generalprior in Lissabon die Erlaubnis, meinen lieben ›Engel‹ zum Ordenskolleg von Funchal zu senden, von wo er sich mit dem nächsten Schiff zu unserer Mission nach Brasilien einschiffen wird. Mit Gottes Hilfe sollte er danach den Weg nach Hause finden. Alles ist vorbereitet, nächste Woche bringt eine Schaluppe meinen Miguel nach Madeira. Ich bete darum, dass er in der Neuen Welt seinen Seelenfrieden wiederfinden möge.
Dein Bruder in Christo Horace Guénégou, OSH«
Die Glocken läuteten zum dritten Mal am Morgen. Oliver Roscoe fragte sich entnervt, wieso manche Menschen es für erstrebenswert hielten, ihre Lebenszeit mit einer dauernden Abfolge von Andachten zu vergeuden. Nicht nur tagsüber quälten ihn die frommen Pflichten, er hatte das Gefühl, die Gebete häuften sich besonders des Nachts, perfiderweise zur Zeit seines tiefsten Schlafs. Als wäre alles andere nicht schon schlimm genug!
Er überquerte den Klosterhof des Hieronymitenkonventes von Funchal. Ringsum bot sich eine atemberaubende Aussicht, nichts als azurblaues Meer unter lichtblauem Himmel, das Panorama eines grenzenlosen Horizonts. Dessen ungeachtet steuerte Roscoe geradewegs auf eine etwa sechs Fuß hohe Mauer zu, die den Innenhof mit der Abteikirche und den Wohngebäuden vom Klostergarten trennte. Nach kurzem Anlauf und einem katzenhaften Sprung saß er rittlings oben auf der Umfriedung des Gartens. Aus der Tasche seines grauen Novizenhabits nahm er ein Fladenbrot, das einer der dienenden Brüder im Refektorium für ihn beiseitegelegt hatte, und aß ein paar Bissen ohne großen Appetit. Ab und an kickte er kleine Steine vom Mauerkranz über den grünen Steilhang, der zur Altstadt und dem Hafen von Funchal abfiel.
Beim letzten vollen Stundenschlag verließen die Klosterschüler und Novizen das Kollegiengebäude und strebten in geordneter Eile dem Portal der Konventskirche Nossa Senhora da Incarnacao zu. Ein paar von Roscoes Konnovizen hatten ihn entdeckt und gaben ihm mit Zeichen zu verstehen, er solle sie zum Gottesdienst begleiten. Aber Roscoe hatte entschieden, heute seinem eigenen Zeitplan zu folgen. Er wandte ihnen den Rücken zu, schwang sich lässig von der Mauer und landete in einem gepflegten Garten, den die Gründer des Konvents der Meditation und gläubiger Erbauung gewidmet hatten. An diesem abgeschiedenen Ort gedachte er, den ihm geraubten Schlaf nachzuholen, legte sich zwischen Pflanzbeeten und blühenden Sträuchern ins Gras und schloss die Augen. Mehr denn je glich er einem schlafenden Engel im Garten Eden, und mehr denn je trog der Schein.
Als er zwei Stunden später, vom Schlaf erfrischt, den Garten wieder mit einem Sprung über die Mauer verließ, lag der Klosterhof menschenleer in der Mittagssonne; höchste Zeit, dass er einen wichtigen Entschluss in die Tat umsetzte. Er lief zu den Wohngebäuden, die zurückgesetzt zwischen der Kirche und der Bibliothek lagen. Das Dormitorium mit der Cella der Novizen schloss hier an die Außenmauer der Anlage. In dem Winkel befand sich ein vergitterter Durchlass, die Porta Benedicta, durch die man das Kloster diskret verlassen und wieder betreten konnte; vorausgesetzt, der Bruder Cellarius hielt einen Mitbruder für vertrauenswürdig genug, ihm den Schlüssel auszuhändigen. Roscoes Vertrauensvorschuss in der Konventgemeinschaft hatte sich schon bald nach seiner Ankunft auf ein absolutes Minimum reduziert. Trotzdem war er im Besitz des Schlüssels und nutzte die Pforte, wann und wie es ihm gefiel.
Die Aufnahme von Fra Miguel war für die frommen Brüder eine Zumutung. Anfangs hofften alle, er würde sich nach einer Eingewöhnungszeit der Ordensregel beugen und ins Klosterleben einfügen. Doch die Bemühungen der Confratres versagten bei diesem Novizen, dessen Gleichgültigkeit noch die erträglichere Seite seines Charakters darstellte. Roscoe zeigte nicht das geringste Verständnis für die drei heiligen Gelübde der Regularkleriker, die da sind Armut, Keuschheit und Gehorsam, und begegnete jeglicher religiösen Unterweisung mit aggressivem Widerwillen. Hingegen bewies er eine ausgeprägte Neigung für alles, was für die Brüder unter den Begriff Lasterhaftigkeit fiel, und waltete in der Cella Novitiorum wie der Fuchs im Hühnerstall. Er wurde im Kolleg nur noch geduldet, weil der Prior ein gutartiger Mann war und den jungen americano zur tieferen Seelenbildung für die Mission auserkoren hatte. Die Ablehnung indes beruhte auf Gegenseitigkeit; Roscoe hielt sich der mönchischen Gemeinschaft weitgehend fern. Vor allem dachte er nicht daran, sich von den Mönchen auf einen ihrer Außenposten in Südamerika schicken zu lassen.
Mehr denn je war ihm bewusst, dass er an einen Wendepunkt seines Lebens gelangt war. Im Auge des Orkans hatte er seinen Tod gesehen, doch das Meer hatte ihn wieder ausgespien. In einem kahlen Niemandsland am Ende der Welt hatte Miguel traurige Wochen in Gegenwart von Menschen verbracht, die außer der Armut nur ihren spröden Glauben kannten und die mit dem naufrage Espagnol, dem schiffbrüchigen Spanier, nichts zu tun haben wollten. Sein Leben schien zum Stillstand gekommen. Er sprach nicht mehr, vertat die Tage am einsamen Strand, indem er mit Tränen in den Augen aufs graue Meer starrte. Als er glaubte, vor lauter Unglück sterben zu müssen, brachte ihn eine glückliche Fügung nach Madeira. Da begriff Roscoe, dass er eine zweite Chance bekam: Er würde nach Amerika zurückkehren.
Wie bei früheren Lebensentscheidungen vertraute er auch diesmal darauf, dass seine Intuition ihm den Weg wies. Als er neben der Levada den Hang hinab zur Stadt lief, kannte er sein Ziel bereits von früheren Erkundungsgängen durch Funchal. Heute betrat er das weiße Haus mit den bunt glasierten Azulejos am Tor zum ersten Mal. Im begrünten Innenhof sah er zu den schmiedeeisernen Balkonen und dem Rankwerk von Bougainvilleen und Macleayen hinauf, als ein Diener in weißer Tunika sich lautlos auf bloßen Füßen näherte.
»Sie wünschen, Señor?«
»Ich möchte Señor Turner sprechen.«
Der Diener verneigte sich tief und sprach: »Wen darf ich melden?«
»Mein Name ist Miguel Martinez.« Das graue Klosterhabit hatte er unter einem Ginsterstrauch bei der Porta Benedicta zurückgelassen. Stattdessen hatte er die Kleider angezogen, die er beim Untergang der Tristar getragen hatte. In seinem blauen Admiralsrock, einem halbwegs weißen Hemd, Samthosen und Stulpenstiefeln wirkte er wie ein Marineoffizier, der ein neues Kommando und etwas Fortüne brauchte.
Nachdem der Diener gegangen war, wurde Roscoe sich des schweren Blütendufts in dem üppig bewachsenen Patio bewusst. Von überall klang der Gesang kleiner Vögel, die in Käfigen entlang der Laubengänge flatterten und den Innenhof mit ihren rollenden und zwitschernden Kadenzen erfüllten. Zwei Kinder kauerten unter dem Treppenaufgang und spielten mit jungen Katzen.
Er stand ganz still und nahm die Empfindung des Augenblicks in sich auf: der kühlschattige Patio, duftende Blüten, Vogelzwitschern, Kinderlachen – so sollte es sein, das Leben am Mittag, zwischen Erinnerungen an eine erfüllte Nacht und der Aussicht auf guten Machismo unter Freunden. Er schloss die Augen, er durfte diesen Augenblick nicht vergessen. Er brauchte eine Vision wie diese, um zu tun, was er jetzt tun musste.
»Señor Turner lässt bitten.«
Der Diener führte ihn in einen orientalisch anmutenden Raum und bat ihn um einen Augenblick Geduld. In einem mit kostbaren Fayencen eingefassten Bassin blühten Seerosen; unter der Wasseroberfläche standen Zierfische, bewegungslos bis auf den leichten Kiemenschlag. Roscoe ging zu einem Bogengang gegenüber der Tür, dahinter lag ein zweiter Innenhof. Unter den umlaufenden Arkaden türmten sich Warenkisten, Fässer, Säcke. Am Boden, zwischen Körben und verschnürtem Gepäck, saßen Männer vorwiegend jüngeren Alters, manche von ihnen schliefen, andere unterhielten sich oder besserten Kleidung und Schuhwerk aus. Sie alle machten keinen glücklichen Eindruck, als teilten sie denselben Fatalismus. Die Szene wirkte bedrückend, aber nicht beunruhigend.
»Señor Martinez, vermute ich?«
Roscoe drehte sich um. Ein Mann mittleren Alters mit schmalem Schnurrbart und blasser sommersprossiger Haut kam rasch auf ihn zu und neigte zur Begrüßung kaum merklich den Kopf. Auf Englisch angesprochen, fiel auch Roscoe übergangslos in sein schleppendes Südstaatenenglisch: »Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Turner.«
»Ganz meinerseits«, antwortete Turner gut gelaunt. Sie nahmen in bequemen Korbsesseln Platz. »Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Señor Martinez?«
Bevor Roscoe antwortete, erkundete er ein letztes Mal seinen Willen, dachte an Algernon, an die Freundschaft, die sie verband. Ja, sein Entschluss stand unumstößlich fest. »Ich muss nach Amerika. Wie ich hörte, vermitteln Sie die Möglichkeit einer Überfahrt.«
Turners blaue Augen blitzten kurz auf. »Was ist passiert, dass ein Gentleman diesen Weg in Betracht ziehen muss?«
»Ich habe mein Schiff verloren, Fracht, Kreditbriefe, alles. Nun will ich noch einmal von vorn anfangen.«
»Jung genug sind Sie«, sagte Turner geschäftsmäßig. »Die Bedingungen der Indentur sind Ihnen bekannt? Die Überfahrt, danach sieben Jahre Plantagenarbeit gemäß den allgemeinen Bestimmungen. Kein Vergnügen, aber zu schaffen für einen Mann, der weiß, was er will.«
»Wo genau wird es hingehen?«
»Ich vermittele meine Klienten an Señor Duarte Cortés, er wiederum beliefert die südlichen amerikanischen Provinzen. Jeder Kontrakt wird behördlich registriert. Nach Ablauf der festgesetzten Zeit erlangen Sie Ihren früheren Individualstatus zurück.«
»Und wann ist die nächste Passage?«
»Sie scheinen es eilig zu haben!« Turner lächelte dünn. »Unser Schiff, die Crusader, wird, so Gott will, in den nächsten Tagen hier eintreffen, Ladung aufnehmen und dann die Weiterfahrt über den Atlantik antreten. Nach Stopps auf Bermuda und den Florida Keys ist der Zielhafen Wilmington in Carolina. Sie haben noch fast eine Woche Zeit, es sich zu überlegen.«
»Ich brauche keine Bedenkzeit, Mr. Turner«, erwiderte Roscoe, dem die Aussicht auf die bevorstehende Heimreise den Entschluss leichter machte, obwohl er wusste, dass es alles andere als leicht sein würde. Doch in der Sache gab es keinen zweiten Anlauf, heute oder nie, das hatte er sich geschworen.
Turner, von Roscoes Tonfall wie von seinem Äußeren irritiert, musterte ihn mit unverhohlener Neugier. »Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf, Señor Martinez?«
»Aus La Florida. Aber ich lebte lange in Georgia und zuletzt in South Carolina.«
»Was macht ein Kreole unter lauter amerikanischen Rebellen?«
»Er kämpft mit ihnen gegen die Briten.«
»Touché!«, erwiderte Turner säuerlich. »Und Ihr Schiff?«
»Ein Newyorker Handelsfahrer. Wir kamen von London, als die Tristar in einem Sturm vor Cap d’Ouessant sank.«
Turner nickte nachdenklich. »Wie alt sind Sie, Señor?«
»Fünfundzwanzig.«
»Wenn Sie Ihre Freiheit wiedererlangen, werden Sie Anfang dreißig sein. Das ist noch kein Alter, aber Ihre Jugend ist dann vorüber. Haben Sie daran gedacht?« Roscoes ausdrucksloser Blick war ihm Antwort genug. »In Ordnung, Señor Martinez. Dann blieben noch die Formalitäten.«
Er entnahm einem Reisesekretär, der neben seinem Korbsessel stand, einen doppelseitigen Vertrag mit dem Titel »Plantation Indenture«. Roscoe trug seinen spanischen Namen und sein Alter ein, Turner ergänzte Beginn und Ende der Vertragsdauer. Nachdem beide unterschrieben hatten, teilte Turner den Kontrakt entlang einer gezahnten Linie.
»Gegen Vorlage dieses Papiers erhalten Sie nach Ablauf der Dienstzeit Ihre Freiheit zurück«, sagte er und gab Roscoe eine Hälfte des Kontrakts. »Gute Reise, Don Miguel!«
40.
Die Bar des Edinburgh Hotels war ein angenehmer Ort, um sich müßig dem Fluss der Zeit zu überlassen. Es war früh am Abend, Seeoffiziere und Händler kamen herein und mischten sich unter die Hotelgäste. Die Türen zur Hafenpromenade standen weit offen, dahinter glänzte die Bucht von Funchal unter der Abendsonne.
An den Schanktisch gelehnt, ließ William den Blick über die Mole zum Leuchtturm schweifen, zur Isla de Nossa Senhora da Conceição und weiter übers Meer. In Gedanken hatte er Amerika längst erreicht und weilte an einem Ort jenseits des atlantischen Ozeans, weit entfernt von Funchal, auch weit entfernt von seinem inneren Standpunkt. Jener ferne Ort weckte große Sehnsucht in ihm, und doch war er sich seiner Rückkehr und des Wiedersehens, das ihn dort erwartete, keinesfalls sicher. In Momenten wie diesen fiel es ihm schwer, an die Existenz eines Ortes namens Legacy zu glauben; als hätte ihm ein anderer davon erzählt.
In Madeira war er nur widerwillig an Land gegangen. Er hätte eine direkte Passage vorgezogen. Doch die Crusader war das nächste Schiff gewesen, das von London nach Amerika auslief, und weil er die Abreise von England nicht um zwei weitere Wochen aufschieben wollte, hatte er den Halt auf Madeira in Kauf genommen.
Inzwischen kamen ihm Zweifel, ob es der richtige Entschluss war, nach Carolina zurückzukehren. Die eintönige Fahrt, vorbei an Frankreich und der Iberischen Halbinsel, der erzwungene Aufenthalt auf Madeira, das alles war seiner Seelenlage nicht zuträglich und machte ihn geneigt, das ganze Unternehmen infrage zu stellen. Sein Bruder Thomas, der ihn gut kannte, hatte ihn beim Abschied in London vor genau dieser Art Zweifel säender Spekulationen gewarnt. Also befolgte er jetzt Thomas’ Rat, indem er der Aussicht über das Meer den Rücken kehrte und sich seiner nächsten Umgebung zuwandte.
In dem gemischten Publikum um die Bar fielen ihm zwei junge Männer auf, die sich in betulichem Kolonialenglisch unterhielten. Dem Aussehen nach mussten es Brüder sein, rotblonde, stämmige Burschen, die auf gediegene Art provinziell gekleidet waren. William schätzte sie auf Anfang zwanzig. Der Ältere der beiden hatte sich einen flaumigen Backenbart stehen lassen, was William an ein ihm wohlbekanntes Gesicht erinnerte. Als er den Kellner heranwinkte, unterbrachen die Brüder ihr Gespräch und verfolgten interessiert seine Order. Er wählte einen Brandy, was bei dem Jüngeren der beiden eine Reaktion hervorrief, die man nur als Frohlocken bezeichnen konnte. William überlegte, ob er das Betragen des jungen Amerikaners als alkoholbedingte Aufgekratztheit ignorieren oder sich provoziert fühlen sollte. Dabei ließ sein Blick zweifelsfrei erkennen, dass er eine Erklärung erwartete.
»Sir, wir wollten Sie nicht verärgern«, entschuldigte sich auch schon der Bärtige. »Wir hatten gewettet, ob ein Engländer Whiskey oder eher Brandy trinkt. Und da wir einen Gentleman wie Sie, Sir, insoweit als Gewährsmann betrachten, waren wir gespannt, was Sie ordern würden.«
»Ich habe auf Brandy getippt und gewonnen!«, ergänzte sein jüngerer Bruder munter. Weil William humorlos schwieg, setzte er hinzu: »Bitte gestatten Sie uns, Sie auf diesen Drink einzuladen.«
William nickte gnädig, und die Sache war aus der Welt.
»Wir sind Amerikaner, aus Charles Town, South Carolina«, sagte der junge Mann voll Stolz. »Wir waren eine Weile auf Barbados, haben den alten Familienbesitz wieder in Schwung gebracht.« Er verneigte sich formell. »Ich bin Frederick Shaughnessey, und dies ist mein Bruder Tobias.«
Natürlich Shaughnesseys! William lächelte kopfschüttelnd. Wie klein war doch die Welt.
»Sehr erfreut, meine Herren! Mein Name ist William Marshall.« Man trank sich zu. »Was tun zwei junge Pflanzer aus Barbados in Funchal?«, fragte er mit echtem Interesse.
Der Bärtige, Tobias, erklärte: »Wir sind auf dem Weg nach Le Havre-de-Grace, morgen fährt unser Schiff weiter. Fred will die Zuckerplantage weiterführen und muss neue Handelspartner in Europa gewinnen. Ich begleite ihn und werde mich eine Weile umtun, in Frankreich, vielleicht in Russland.«
»Möchten Sie denn keine Plantage aufbauen?«, fragte William, der in Tobias den jungen Frank Shaughnessey erkannte. »Nach dem Krieg gibt es genug brachliegendes Land. Ein unternehmender Geist wie Sie, Mr. Shaughnessey, könnte da sein Glück machen.«
»Andere waren leider schneller«, sagte Tobias nüchtern. »Reiche Bodenspekulanten aus dem Norden, die noch reicher werden wollten, haben den größten Schnitt gemacht.«
»Die Charles Towner Pflanzer waren selber schuld, auch unser alter Herr!«, meinte Frederick. »Wenn die Karten neu gemischt werden, muss man zugreifen! So eine Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen.«
»Was soll das heißen, Fred? Hätte Dad die Notlage seiner Nachbarn ausnutzen sollen? Um sich am Ruin anderer zu bereichern, wie Hocksley, wie Vandoussen …?«
»Das habe ich nicht gesagt, Toby. Ich spreche von Landaufkäufern, die Stück um Stück ganze Landstriche an sich gebracht haben. Wie hätten sonst diese Riesenplantagen am Ashley und Cooper River entstehen können? Männer wie Clayburn oder Reed, die haben gewusst, wie man investiert.«
William musste sehr an sich halten. »Reed?«
»Ein geschäftstüchtiger Händler aus Virginia«, erklärte Toby. »Er besitzt das meiste Plantagenland weit und breit.«
»Es gab einen Captain Reed … bei der Miliz.«
»Das ist er. Reed kam nach Charles Town, als die Briten die Nordstaaten besetzten. Er machte im Handel ein Vermögen. Am Ashley River hat er im großen Stil Land gekauft. Heute gehört ihm ein sagenhaftes Anwesen, Hollow Park, gigantische Anbauflächen für Reis, Tabak und Baumwolle.«
»Er lebt am Ashley River?«, fragte William, um sicherzugehen.
»Allerdings. Er verlässt Hollow Park so gut wie nie«, sagte Toby und schüttelte mitleidig den Kopf. »Dad nennt ihn einen höflichen Sonderling. Tja, Geld allein macht anscheinend nicht glücklich!«
William trank aus, wünschte den Shaughnesseys eine gute Weiterreise und ging hinaus. Die Mole ragte verlassen ins Meer, im Westen stand die Sonne tief am Horizont. William schritt rasch den Steinwall entlang bis zum Leuchtturm, kehrte um, ging den Weg zurück bis ans Ende der Hafenpromenade und hastete erneut zum Leuchtturm hinaus. Er forcierte seinen Gang, weit ausschreitend stützte er sich schwer auf seinen Stock und konnte doch nicht mit seinen rasenden Gedanken Schritt halten. Welche Ironie, dass er immer dann, wenn er sich von seinen Racheverlangen befreit zu haben glaubte, die Fährte seiner Peiniger kreuzte. So war es auch, als er nach England kam; er wollte in der Heimat Abstand vom Trauma der Folter gewinnen, und traf auf Oliver Roscoe.
Der arme Néné fiel Roscoes Bosheit zum Opfer, trotzdem ließ William ihn laufen. Die Vergangenheit sollte ruhen, er wollte endlich Frieden finden. Er war entschlossen gewesen, zu Antonia zurückzukehren und auf Serenity Heights mit ihr ein neues Leben zu beginnen. Und nun erfuhr er, dass er genau dort, am Ziel seiner Reise, Reed finden sollte, seinen Folterer, der dort die ganze Zeit auf ihn gewartet hatte. Es war, als lachten die Götter ihn aus!
Roscoe war auf See zugrunde gegangen. Doch Reed lebte, und solange er lebte, konnte William nicht zur Ruhe kommen. Am Fuße des Leuchtturms blieb er atemlos stehen und blickte in den blutroten Sonnenuntergang. Beim Gedanken an die Begegnung, die am Ende dieser Reise stand, befiel ihn lähmendes Entsetzen. Er wusste und hatte es immer gewusst, dass die Konfrontation mit Reed ihn in seinen inneren Abgrund stürzen würde. Wenn er Hand an seinen Folterer legte, musste er sich dem Entsetzen stellen und ein zweites Mal die eigene Vernichtung durchleben. Und überleben! Damals wollte sein geschundener Körper sich nicht ergeben. Was aber, wenn es heute nicht mehr so wäre? Ein gefährlicher Gedanke.
Er war ein anderer geworden, von seinem Ehrgeiz, seinen Hoffnungen und Illusionen war wenig übrig. Was, wenn er im entscheidenden Moment feststellen würde, dass er nicht die Kraft hatte, seine Rache zu vollenden? Weil es vielleicht nichts mehr gab, wofür es sich lohnte? Weil es zu spät war? Aber wie könnte es zu spät sein! Er war auf dem Weg zu Antonia, also war es auch noch nicht zu spät! Für sie musste er es zu Ende bringen, für ein Leben mit ihr musste er frei werden von der Angst, von dem Hass und der Verachtung, die ihn im Innern zerstörte. Er würde mit Reed abrechnen. Für Antonias Liebe musste er es tun.
Der Moment der Schwäche war vorüber, er verließ die dunkle Mole. Scharf klang der Dorn seines Stocks auf dem Pflaster. Der schweifende Lichtstrahl des Leuchtturms glitt über die ruhige See, streifte mit zuckend weißem Lichtfinger die Kaimauer und die von Algen bewachsenen Wellenbrecher vor der Außenmole. William ging unter dem suchenden Blendstrahl hindurch und beschleunigte seine Schritte Richtung Hafen. Er wollte rechtzeitig zum Dinner zurück auf dem Schiff sein.
Die Crusader war ein schwerer Frachtsegler aus der Vorkriegszeit mit einer zahlenstarken Mannschaft, wie es bei Schiffen älterer Bauart notwendig war, wenn es galt, die einfachen, großflächigen Bram- und Marssegel zu reffen. Die Brigg hatte beträchtlich Ladung aufgenommen, vor allem Eisen in Barren aus den englischen Erzhütten für die Werkzeugschmieden Pennsylvanias. In Madeira kamen Wein in Zwanzig-Galonen-Fässern und Häute aus Spanien für die Lederverarbeitung hinzu. Die Schauerleute mussten einen Teil der Beladung auf Deck verstauen, da der Platz im Schiffsrumpf der Unterbringung menschlicher Fracht vorbehalten war.
Nun war die Crusader kein Sklavenschiff im üblichen Sinne. Sie transportierte auf ihren Fahrten Indenturknechte aus Europa in die Neue Welt. Diesmal waren es Portugiesen aus Madeira und vom Festland, Kanarier und Spanier, die sich für den Preis einer Überfahrt und die vage Aussicht auf eine kleine Parzelle Ackerland an einen Patrón verkauft hatten, der sie als weiße Arbeitssklaven auf amerikanische Plantagen vermittelte. Im Unterschied zu einem schwarzen Sklaven konnte ein Indenturknecht nach Ablauf der üblichen siebenjährigen Dienstzeit wieder ein freies Leben führen, ohne Benachteiligung oder Diskriminierung, zumal in einem Land ohne die entwürdigenden Feudalstrukturen des alten Europa.
Die Indenturos auf der Crusader gehörten Señor Duarte Cortés, der streng darauf achtete, dass keiner seiner Dienstverpflichteten bevorzugt wurde, damit während der Überfahrt unter den Leuten Ruhe herrschte. Die Unterbringung an Bord war spartanisch, aber anders als afrikanische Sklaven konnten die Indenturos sich in ihrem Quartier frei bewegen und durften sich zu festgelegten Tageszeiten auch an Deck aufhalten. Sie bekamen Hängematten zum Schlafen und mehrmals täglich Mahlzeiten aus der Kombüse.
Für zahlende Passagiere gab es vier zweckmäßig eingerichtete Kajüten, die neben der Kapitänskajüte unterm Achterdeck lagen. In London ging William als einziger Passagier an Bord. Untertags blieb er in seiner Kajüte, las oder schrieb an einem Bericht über die Kampagnen in den südlichen Provinzen. In den Abendstunden ging er für ein oder zwei Stunden an Deck und unterhielt sich auf der Brücke mit Jim Greene, dem Rudergast der ersten Wache, dessen lakonischer Lancashire-Witz ihn an seine Heimat an der irischen See erinnerte.
Am Abend nach der Abfahrt von Madeira lernte er beim Dinner zwei weitere Passagiere kennen. Als man sich zu Tisch setzte, ließ der Kapitän es sich nicht nehmen, William mit gewisser Befriedigung als Colonel der Britischen Armee vorzustellen. Danach machten sich die Mitreisenden selber bekannt, und William hatte das Vergnügen, Mr. Henegue McElrond kennenzulernen, einen umgänglichen, etwas rechthaberischen Schotten, der im Auftrag einer Edelsteinschleiferei von Glasgow zu den Smaragdminen Brasiliens reiste. Der dritte Passagier war Señor Duarte Cortés, ein eitler Mann von Anfang fünfzig mit abgelebten Zügen, der vom Handel mit Indenturknechten profitierte, seit der Tabakboom und ein Mangel an schwarzen Sklaven in Virginia ihm Höchstpreise für weiße Leibeigene bescherten. Jim Greene hatte William berichtet, dass Cortés als spanischer Statthalter in Kuba früher den Sklavenmarkt von Havanna kontrolliert habe; seine Unbarmherzigkeit gegenüber afrikanischen Sklaven sei weithin bekannt gewesen.
Nach dem Dinner fragte Kapitän Robins, ob William und die beiden anderen Passagiere auf ein Glas Wein in seinen Salon kommen wollten. In der Hoffnung auf etwas Unterhaltung während der mehrwöchigen Reise schloss William sich der Gesellschaft an. Nach einer Stunde entschuldigte sich der Kapitän, dessen Dienstplan routinemäßige Kursabstimmungen mit dem Navigator vorsah; Mr. Fletcher, der zweite Offizier, sollte seine Gäste weiter unterhalten. Fletcher schlug ein Kartenspiel vor. Man rückte näher an den Tisch, die Karten wurden gegeben und die Einsätze geleistet. McElrond und Cortés als die »Zivilisten« spielten zusammen gegen die Offiziere Fletcher und Marshall. McElrond ging klug aber konservativ vor und vermied jedes Risiko. Ganz im Gegensatz zu Cortés, der ein leidenschaftlicher Spieler war und durch seine leichtsinnigen Alleingänge McElrond gern zur Verzweiflung brachte.
William und Fletcher machten ein schnelles, für ihre Gegner schwer durchschaubares Spiel. Fletcher, der typische Besucher von Offiziersclubs, bevorzugte einen offensiven Stil und zwang die Gegenspieler durch seine provokanten Eröffnungen zur Aufgabe ihrer Strategie. William dagegen gab seine Absichten nie zu erkennen. Er merkte sich jede Karte im Spielverlauf und wartete einfach ab, dass Cortés oder McElrond auf Fletchers flamboyante Aktionen eingingen, um die Partie seinerseits dann mit einer wohlüberlegten Kartenkombination zu entscheiden. Unnötig zu erwähnen, dass er sich mit Fletcher ohne Worte verständigte.
Es war schon spät, als McElrond aufstand und sich empfahl. Der Steward füllte noch einmal die Gläser, William und Fletcher tranken sich zu auf ihr erfolgreiches Spiel. Cortés entzündete eine Zigarre und blies feine Rauchkringel in die Luft.
»Es war mir ein großes Vergnügen, Señores«, sagte er mit einer Verneigung. »Sie haben souverän gespielt, auch unser Mr. McElrond. Da sieht man wieder, dass die Temperamente doch sehr verschieden sind. Wie schaffen es Engländer, bei einer so aufregenden Sache wie dem Glücksspiel kühl und diszipliniert zu bleiben?«
Fletcher lachte. »Gut, dass Mr. McElrond das nicht gehört hat!«
»Natürlich, er ist Schotte«, erinnerte sich Cortés. »Wie konnte ich das vergessen! Wahrscheinlich geht es Ihnen mit den Schotten so wie uns Spaniern mit den Portugiesen: Außenstehende bemerken kaum Unterschiede, während wir unsere Einzigartigkeit erbittert verteidigen. Wer will schon so sein wie sein Nachbar? Das ist wohl der Grund für die meisten Kriege.«
»Unterstellen Sie den Menschen nicht zu viel Esprit, Mr. Cortés«, erwiderte Fletcher mit der Arroganz der Kadettenschulen. »Mit Ausnahme weniger aufgeklärter Staaten wie dem Britischen Empire führen andere Länder ihre Kriege doch nur aus Machtanmaßung. Im Grunde ist der Gegner sogar austauschbar, es geht lediglich darum, jemanden zu unterwerfen; politische Motive dienen dabei einzig als Entschuldigung für Machtgier und Unterdrückung.«
»Bravo, Mr. Fletcher!« Cortés hob lächelnd das Glas. »Ich bin wirklich beruhigt, dass die meisten Kriege unter Beteiligung Ihres aufgeklärten Empires geführt werden, unter leidenschaftslosen Kommandeuren wie unserem Colonel hier.«
»Was wollen Sie damit sagen?«, fragte Fletcher nach einem Seitenblick zu William, der unbeteiligt schwieg.
Cortés sog an seiner Zigarre und sagte durch eine Wolke blauen Rauchs: »Junger Mann, lassen Sie uns Ihre schöne Abstraktion der Überlegenheit Englands an einem konkreten Beispiel überprüfen. Schauen Sie her«, er wies mit eleganter Geste auf William, »sehen Sie sich Mr. Marshall an, der Prototyp des britischen Offiziers, der die Traditionsgene Ihrer Militärkaste zur Schau trägt: Disziplin, kühle, abgeklärte Distanz – die pure Korrektheit. Auf den ersten Blick scheint er über jeden Zweifel erhaben.«
In Cortés’ Ton lag kaum ein Hauch Ironie. Fletcher wurde erst unsicher, als er Williams Blick bemerkte. »Was für Zweifel meinen Sie?«
»Nun, Señor Fletcher, Sie sprachen von Machtgier, von der Lust an Gewalt und Unterdrückung et cetera. Glauben Sie denn, es gibt andere Beweggründe für kriegerische Auseinandersetzungen? Denken Sie an Ihre englischen Eroberungskriege. Ein Blick ins Geschichtsbuch, und bei jedem regen sich Zweifel an der Integrität der Kriegsherren. Nehmen wir das jüngste Beispiel, den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg …«
»Sie meinen die Rebellion!«
»Wie auch immer, Señor Fletcher. Sie glauben doch nicht, irgendein englischer Befehlshaber hätte den Standpunkt einer höheren Moral bemüht, um Großbritanniens Überlegenheit gegenüber den aufständischen Kolonisten durchzusetzen? Im Gegenteil, sie schickten ihre Eliteeinheiten gegen schlecht bewaffnete Provinzler, überfielen ahnungslose Dörfer und machten die männlichen Bewohner bis hin zu elfjährigen Jungen nieder. Nennen Sie das eine aufgeklärte Art der Kriegsführung?«
Fletcher reagierte wie erwartet. »Ich behaupte ja nicht, dass alles richtig war. Sie sprechen vermutlich einzelne Exzesse schlecht geführter Truppen an …«
»Mein lieber Señor Fletcher, erlauben Sie, dass ich Sie korrigiere: Solche Exzesse waren im besetzten South Carolina vor knapp einem Jahr an der Tagesordnung.«
»Trotzdem können Sie daraus keine Rückschlüsse ziehen auf den offiziellen Angriffsplan oder auf taktische Empfehlungen der Befehlshaber.«
»Wirklich nicht? Was hatte Ihren Sir Clinton oder Ihren Lord Cornwallis wohl bewogen, derart erbarmungslos gegen die Kolonien zu Felde zu ziehen, wenn nicht die Machtgier Englands und der Wille, sich die abtrünnigen Gebiete gewaltsam wieder einzuverleiben? Hier, unser über jeden Zweifel erhabener Colonel kann Ihnen sicher berichten, wie es zu den Übergriffen kam.«
»Sir, es verbietet sich, Mr. Marshall mit derartigen Vorkommnissen in Verbindung zu bringen!«
»Tatsächlich? Ich denke, er ist dabei gewesen.«
Nun fand William, war es an der Zeit einzugreifen. »Es wäre ein Fehler, Señor, das Ziel unseres Einsatzes in den Kolonien mit den Mitteln zur Erreichung desselben zu verwechseln. Die Kampagnen hatten ihre dunklen Seiten, das will ich nicht bestreiten. Aber wer Krieg führt, muss zur Anwendung äußerster Gewalt bereit sein. Das ist die Grundvoraussetzung, andernfalls kann man es gleich sein lassen.«
»Ich verstehe«, warf Cortés ein,»der Zweck heiligt die Mittel!«
»Nicht unbedingt. Als Kommandeur der Britischen Armee muss ich darauf achten, dass unsere Aktionen im angemessenen Verhältnis stehen zu dem vorrangigen Interesse Englands, seinen Einfluss in der Welt zu erhalten.«
»Wie es sich erwiesen hat, gebührt dem Interesse Amerikas an seiner Freiheit der Vorrang. Die Welt gehört nicht England allein, Colonel.«
»Bedauerlicherweise«, meinte William ohne jede Ironie.
Cortés streifte behutsam die Asche von seiner Zigarre und sagte nachdenklich: »Sieben Jahre Krieg, sieben Jahre Besatzung ganzer Provinzen. Jeder weiß, wie schwer die Bevölkerung in den besetzten Gebieten gelitten hat.«
»Eklatante Verstöße gegen das Kriegsrecht wurden nie heruntergespielt oder geleugnet«, entgegnete William. »Heute erklärt man die Situation damit, dass die Soldaten moralisch korrumpiert gewesen seien. Die Verantwortlichen stellen sich auf den Standpunkt, die ablehnende Haltung der Bevölkerung und ihre Feindseligkeiten gegen die Besatzungstruppen seien schuld gewesen an einer fortschreitenden Verrohung der Sitten; daher konnte es nicht ausbleiben, dass bei Kampfhandlungen oder bei Auseinandersetzungen mit Zivilisten das Kriegsrecht verletzt wurde.«
»Ein interessanter Standpunkt«, meinte Cortés. »Was sagen Sie dazu, Señor Fletcher?«
Fletcher fehlten die Worte; Williams zynische Dialektik beschämte den geradlinigen Marineoffizier, sodass er betroffen schwieg. Cortés hatte auch keine Antwort erwartet. Er zog einen der Silberleuchter heran und entzündete an der Kerze seine Zigarre, die überm Reden ausgegangen war. Dabei betrachtete er William mit einem Ausdruck, in dem sich Neugier und Tücke die Waage hielten.
»Sind Sie auch der Ansicht, Colonel, die amerikanische Landbevölkerung hätte die Grausamkeiten der Expeditionstruppen durch ungerechtfertigten Widerstand selbst verschuldet?«
Darauf hätte William nicht geantwortet, wenn nicht Fletcher so verzweifelt auf eine Ehrenerklärung von ihm gewartet hätte. »Der Ausdruck ›Landbevölkerung‹ trifft es nicht ganz, Señor Cortés. Ersetzen Sie ihn durch die Bezeichnung ›Miliz‹, und Sie bekommen den richtigen Eindruck von der Situation in den südlichen Provinzen.«
»Gut, reden wir von Milizen. Was nichts an der Tatsache ändert, dass Sie ausgebildete Regulars gegen Bauernburschen und alte Männer schickten, die mit rostigen Säbeln aus den Indianerkriegen und einer Handvoll Gewehren antraten, und deren Anführer von General Washington aus gutem Grund nicht in die Reihen seiner Continentals aufgenommen wurden.«
»Falsch, Señor Cortés: Die Milizen wurden von Hauptleuten geführt, die ihre Ausbildung in den Garnisonen unseres Kolonialheeres absolviert hatten. Die Männer der freiwilligen Landwehr waren im wehrpflichtigen Alter, darunter viele Veteranen aus dem Siebenjährigen Krieg, die durchaus imstande waren, Washingtons Kontinentalarmee mit einsatzstarken Verbänden zu unterstützen, und es auch taten. Im Übrigen, Señor, operierten die Rebellenmilizen bevorzugt aus dem Hinterhalt, wodurch sie unsere technische Überlegenheit ausglichen. Unterstützt durch die Bevölkerung und dank ihrer guten Ortskenntnisse sind einheimische Verteidiger im Vorteil gegenüber jedem noch so gut bewaffneten und gedrillten Invasionsheer.«
Für Fletcher fügte er hinzu: »Wenn ich meine Leute zu einem bestimmten Ort schickte, waren die Rebellen meistens vor uns da und warteten in einem Versteck auf den günstigen Moment für den Überfall. Wir hatten dadurch große Verluste.«
»Auf die Dauer machte Sie das bestimmt wütend«, sagte Cortés konziliant. »Aber reicht das als Entschuldigung für Kriegsverbrechen?«
Fletcher sah nervös von einem zum andern. Offenbar wollte Cortés die genannten Übergriffe Spencer persönlich anlasten. William aber ließ den Vorwurf gelassen an sich abgleiten.
»Sie tragen einen großen Namen, Señor Cortés«, sagte er mit einem Anflug von Verachtung. »Er steht als Synonym für Spaniens Unmenschlichkeit gegen andere Völker. Während Ihrer Amtszeit in Havanna wurde in diesem Ihrem Namen das Naturrecht mit Füßen getreten. Ich möchte bezweifeln, dass Sie berufen sind, meine Entscheidungen in diesem Krieg zu beurteilen.«
Cortés konnte oder wollte darauf nichts erwidern. Er nickte stumm und blickte unter schweren Lidern in die Kerzenflamme, die Augen fahlbraune Halbmonde, das Erbe der Aztekenmädchen, die man auf Yucatan den weißen Göttern dargebracht hatte.
Fletcher wurde das anhaltende Schweigen unangenehm. Er sah zum Stundenglas. Vielleicht würde ein Hinweis auf die fortgeschrittene Zeit die Spannung lösen? Als Williams Blick ihn streifte, ließ er den Gedanken sofort fallen.
Ungerührt ließ William noch eine weitere Minute verstreichen. Dann nahm er sein Weinglas, trank den Rest von Kapitän Robins altem Port und bemerkte leichthin: »Wir haben zwar den Krieg verloren, Señor, aber heute Nacht eine Menge von Ihrem Geld gewonnen. Ich schlage Einsatzlimits vor, damit uns der Spaß am Ende nicht zu teuer kommt. Was halten Sie davon, Gentlemen?«
Er wollte nicht einfach das Thema wechseln, doch er wusste, der Kapitän würde es nicht gutheißen, wenn in seinem Salon um so hohe Summen gespielt wurde.
Cortés aber mochte nichts davon hören. »Ich bitte Sie, Colonel, wollen Sie uns um das ganze Vergnügen bringen? Oder fürchten Sie meine Revanche?«
Das war nun das Letzte, was William zu befürchten hatte. Wenn es darauf ankam, standen ihm spielerische Möglichkeiten zu Gebote, die zwar nicht orthodox waren, aber den Faktor des Zufalls eliminierten. »Ich gebe Ihnen jederzeit Gelegenheit zur Revanche, nur fürchte ich, unser Einvernehmen könnte darunter leiden.«
»Lassen Sie das meine Sorge sein, Colonel!«, rief Cortés stolz. »Wenn die Señores McElrond und Fletcher es vorziehen, sich in Sicherheit zu bringen, bitte! Doch ich wüsste nicht, was zwei Caballeros wie uns hindern sollte, das Glück auf die Probe zu stellen.«
William lächelte sein seltenes Lächeln und dachte, dass jeder im Leben Demut lernen musste. »Die Reise fängt an, mir Spaß zu machen!«, sagte er mit einer Verbeugung.
So verbrachte man die folgenden Abende beim Kartenspiel. Fletcher blieb Williams Spielpartner, nur während der Wachen nahm der Kapitän oder auch der Erste Offizier seinen Platz am Spieltisch ein. Zu guter Letzt hatte man sich doch auf eine Begrenzung des Verlustrisikos verständigt, dergestalt, dass zwar die Höhe der Einsätze offen blieb, das allabendliche Kartenspiel aber nach zwei Stunden endete. William war es nur recht, so konnte er seine nächtlichen Spaziergänge an Deck wiederaufnehmen und sich gelegentlich mit seinem Landsmann Greene unterhalten.
Am fünften Reisetag fühlte McElrond sich nicht wohl. Es herrschte starker Seegang, seit dem Morgen rollte die Brigg auf langen Wellenbergen auf und ab. Der Schotte ließ vom Steward ausrichten, er werde bis auf Weiteres in seiner Kajüte bleiben, und so fiel mit Rücksicht auf den seekranken McElrond das Kartenspiel aus. Am übernächsten Tag war das Meer wieder spiegelglatt, die Crusader glitt vor einer steten Brise ruhig dahin. Doch dem armen McElrond ging es nicht besser, im Gegenteil, er konnte nichts essen, klagte über kolikartige Schmerzen.
Nach dem Dinner ging William an Deck. Er stieg auf die Brücke und erzählte Greene von der Unpässlichkeit des Schotten.
»Also seekrank ist der bestimmt nicht«, bemerkte der Steuermann.
»Das denke ich auch.«
»Ein Doktor wär’ nicht schlecht.«
»Stimmt, der wäre jetzt nicht schlecht«, pflichtete William ihm bei. »Aber wir haben keinen an Bord.«
»Sir, unten bei den Indenturos gibt’s einen Wundarzt. Kein richtiger Doktor, aber anscheinend versteht er sein Handwerk.«
»Na, vielleicht könnte er McElrond helfen. Kann ich den Mann sprechen?«
»Aye, Sir. Wenn Sie wollen, gehen wir nach meiner Wache zu ihm.«
Den Stock unterm Arm, in breitem Stand, um den Seegang auszugleichen, lehnte William an der Heckgalerie. Die Crusader machte gute Fahrt, das kräftige Hoch über den Azoren beschleunigte den Passat, der sie schnell und gleichmäßig vorantrieb. William betrachtete die Konstellationen am westlichen Himmel. Seit der Abfahrt von Madeira lief der Kurs konstant westwärts, nächstes Ziel war Bermuda. Wenn sie keinem Orkan ausweichen mussten, konnten sie den Archipel bei gleicher Windstärke in zwei bis drei Wochen erreichen und nach einer weiteren knappen Woche die amerikanische Ostküste.
Die Schiffsglocke schlug zum Wachwechsel. Greene übergab das Steuer der nächsten Ruderwache, dann ging er hinunter zum Hauptdeck, öffnete das Großluk und forderte William auf, ihm zu folgen. Nacheinander stiegen sie den Niedergang hinunter in den Rumpf des Schiffes. William wusste, die Indenturknechte waren im zweiten Frachtdeck untergebracht, tief unten in der Last, in einem Bereich, der unterhalb der Wasserlinie lag. Er musste mit Greene also bis zum Kielraum hinunter; kein angenehmer Gedanke.
Vorn unter dem Oberdeck lagen die Mannschaftsquartiere. Die Balkendecke war niedrig, William ging gebeugt zwischen herabhängenden Laternen hinter Greene her. In der Back saßen zwei ältere Matrosen, einer besserte Kleidung aus, der andere schnitzte an einem Robbenzahn. Die Schiffsjungen schliefen in ihren Kojen, die übrigen Schlafplätze waren leer.
William tippte Greene auf die Schulter. »Sagen Sie, wo ist der Rest der Mannschaft?«
»Die ganze Freiwache ist da unten.« Greene deutete zum Boden.
Jetzt bemerkte William ein dumpfes Dröhnen, das aus dem Bauch des Schiffs kam und die Bodenplanken erschütterte. »Sie meinen, die Männer sind bei den Indenturos? Warum?«
»Das werden Sie gleich sehen, Sir«, sagte Greene und ging weiter. »Folgen Sie mir.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: