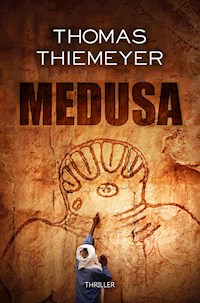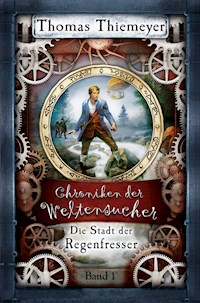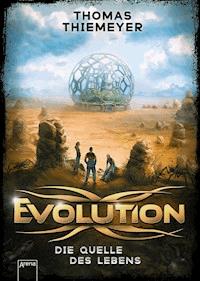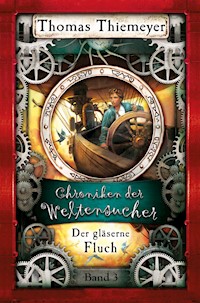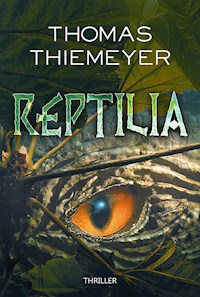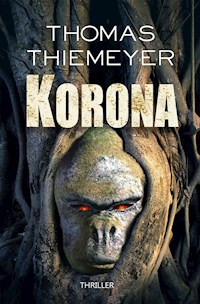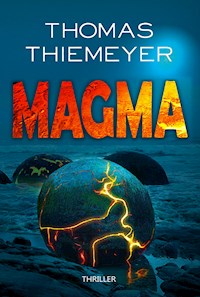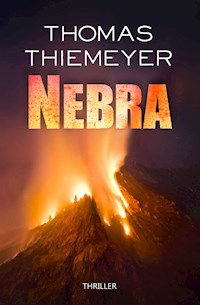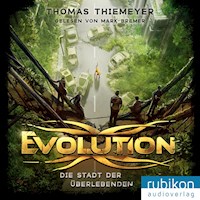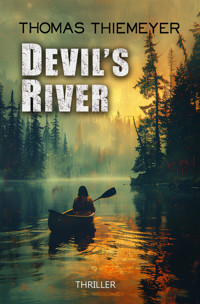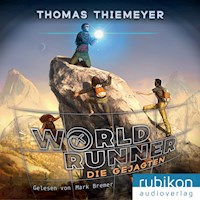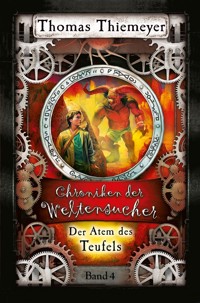Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Thomas Thiemeyer
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das verbotene Eden
- Sprache: Deutsch
Seit Juna aus dem Land der Frauen geflohen ist – mit einem Mann –, fühlt sich die junge Heilerin Gwen einsam und nichtswürdig. Sie schließt sich einem Spähtrupp an, der durch verlassene U-Bahn-Schächte in die Stadt der Männer vordringen soll. Doch der Einsatz scheitert grausam, und Gwen fällt in die Hände des jungen Kämpfers Logan, der sie als Sklavin verkaufen will. Logan aber hat die Rechnung ohne seine Gefühle gemacht – und setzt damit Ereignisse in Gang, die das Ende beider Welten bedeuten könnten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Thiemeyer
Logan und Gwen
(Erkenntnis)
Band 2 der Reihe Das verbotene Eden
Roman
Thomas Thiemeyer geboren 1963, studierte Geologie und Geografie, ehe er sich selbstständig machte und eine Laufbahn als Autor und Illustrator einschlug. Mit seinen Wissenschaftsthrillern und Jugendbuchzyklen, die etliche Preise gewannen, sich über eine halbe Million Mal verkauften und in viele Sprachen übersetzt wurden, ist er eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsliteratur. Seine Geschichten stehen in der Tradition klassischer Abenteuerromane und handeln des Öfteren von der Entdeckung versunkener Kulturen und der Bedrohung durch mysteriöse Mächte. Thomas Thiemeyer lebt in der Nähe von Stuttgart.
Mehr Infos über den Autor und Künstler unter:
www.thiemeyer.de
Thomas Thiemeyer
Das verbotene Eden
Logan und Gwen
Liebt ich wohl je? Nein, schwör es ab, Gesicht!
Du sahst bis jetzt noch wahre Schönheit nicht.
William Shakespeare: Romeo und Julia
© 2012 Thomas Thiemeyer
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nurmit Genehmigung des Autors wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Thomas Thiemeyer / Midjourney
ISBN: 9783948093556
eISBN: 9783948093549
Inhalt
Prolog
Teil 1 Spieglein, Spieglein an der Wand
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Teil 2 Von einer, die auszog, das Fürchten zu lernen
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Teil 3 Des Teufels rußiger Bruder
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Prolog
Der Junge hob den Kopf. Das Geräusch klang seltsam. Ein tiefes Brummen von jenseits des Flusses. Wie ein Schwarm zorniger Hornissen, der langsam von Osten näher kam.
Seit gestern lag eine unerklärliche Hitze über dem Land. Sie ließ die Luft flimmern und die Pflanzen um Regen betteln. Fern über dem Meer war der Himmel dunkel, ein untrüglicher Vorbote für ein heraufziehendes Gewitter. Ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Die Schwüle und die Gewitter kamen normalerweise erst im August.
Der Hund des Jungen hatte die Ohren aufgerichtet und stieß ein fragendes Winseln aus. Seinen Blick starr in die Ferne gerichtet, wartete er auf etwas. Die Schafe wanderten über die Weide, ganz gemächlich, wie Wolken über einen grünen Himmel. Der Junge stützte sich auf seinen Hirtenstab.
»Tja, ich weiß auch nicht«, sagte er. »Klingt irgendwie merkwürdig, oder?«
Kein natürliches Geräusch, so viel war klar. Ein Motor, aber nicht von der Sorte, wie sie hier in der Umgebung Verwendung fanden. Sein Großvater hatte noch um das Geheimnis gewusst, wie man aus Raps Treibstoff herstellte. Nach seinem Tod hatte er es an seine Tochter und die wiederum an ihren Mann weitergegeben. Jetzt besaßen seine Eltern einige Maschinen, die mit Rapsöl betrieben wurden, und hatten gut zu tun. Die Äcker waren groß, und dazu kam ein schwerer Boden. Wenn er nicht gerade Schafe hüten oder in die Schule gehen musste, liebte es der Junge, an der Seite seines Vaters den mechanischen Pflug über den Boden zu ziehen und die fruchtbare braune Erde aufzuwühlen. Auch die Walzen, mit denen das Öl aus den Rispen gedrückt wurde, waren motor-getrieben, genau wie der dreirädrige Wagen, mit dem seine Mutter die vollen Fässer nach Honfleur fuhr, wo das Öl gefiltert und gereinigt wurde.
Auf der anderen Seite des Flusses gab es Dampfmaschinen, die waren so groß wie ein Haus. Doch keines dieser Geräte klang auch nur annähernd so wie das, was sich da aus östlicher Richtung näherte. In den paar Minuten war das Geräusch auf das Doppelte angeschwollen.
Also entweder war der Fahrer ein komplett Irrer, oder er hatte einen Weg gefunden, über holprige Feldwege zu gleiten wie ein Schlittschuhläufer über einen zugefrorenen See.
Vielleicht war es gar kein Landfahrzeug, schoss es ihm durch den Kopf. Vielleicht war es ein Boot.
Das Gewässer war an dieser Stelle breit genug, dass Lastkähne auf ihm fahren konnten. Nur so ließ sich der rege Austausch von Gütern mit anderen Städten bewerkstelligen. Zwar klangen auch diese Motoren anders, aber mit Booten kannte er sich nicht so gut aus. Möglich, dass es jemandem gelungen war, ein Schnellboot oder etwas Ähnliches zu bauen.
Neugierig trat er aus dem Schatten der Linde und ging ein paar Schritte den Hügel hinab. Ein Schnellboot, das wäre doch mal was! Die Vorstellung von etwas, das eine Bugwelle erzeugen konnte, erregte ihn. Vor dem Zusammenbruch hatte es Wasserfahrzeuge gegeben, die so schnell waren, dass sie einen Menschen auf Kufen hinter sich herziehen konnten. Es hatte Schiffe gegeben – riesige Schiffe –, die die unermesslichen Weiten des Ozeans durchkreuzt und andere Kontinente besucht hatten. Auch sie waren heute verschwunden, genau wie viele andere Dinge, die früher gefahren, geschwommen oder geflogen waren. Ein paar dieser monströsen Leichen waren drüben in den Werften zu bestaunen, wo sie still vor sich hin rosteten oder als Rohstofflager verwendet wurden. Stumme Zeugen der Welt, wie sie vor dem Zusammenbruch gewesen war.
Natürlich hatte auch hier – wie fast überall auf der Erde – das Virus gewütet, aber aus irgendeinem Grund nicht ganz so heftig. Vielleicht waren die Küstenbewohner widerstandsfähiger, vielleicht lebten sie gesünder, vielleicht hatten sie aber auch einfach nur Glück gehabt, wer konnte das schon wissen? Die Geschichten der Wanderer waren jedenfalls schauerlich. Sie hatten von Landstrichen erzählt, in denen Frauen und Männer einander unversöhnlich gegenüberstanden, Kriege führten und wie Tiere ums Überleben kämpften. Die Berichte darüber waren in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Es gab immer weniger Wanderer, die das Risiko auf sich nahmen, diese Orte zu besuchen. Viele waren getötet worden, manche in Gefangenschaft geraten; einige hatte man wie Aussätzige behandelt und davongejagt. Hinzu kam, dass niemand einen Pfifferling darauf zu geben schien, was sie zu erzählen hatten. Es sah fast so aus, als hätten sich die Menschen mit der neuen Ordnung abgefunden, als hätten sie das Leid und das Elend als etwas Gottgegebenes akzeptiert und den Kopf in den Sand gesteckt. Dabei musste doch jedem klar sein, dass es eine Krankheit gewesen war, die das alles ausgelöst hatte. Jedes Kind lernte das heutzutage in der Schule. Es war Grundwissen und fester Bestandteil vieler Unterrichtsstunden, ebenso wie die Erforschung der Vergangenheit.
Bei dem Gedanken an den wöchentlichen Geschichtsunterricht musste der Junge lächeln. Unvorstellbar, zu was Menschen damals in der Lage gewesen waren! Das Wissen um Maschinen und andere technische Errungenschaften war in den Dunklen Jahren fast vollständig verlorengegangen. Hätten nicht Männer und Frauen wie seine Großeltern einiges von dem gerettet, was damals zum normalen Alltag gehörte, sie würden vermutlich heute noch wie in der Steinzeit leben. Doch die Menschen arbeiteten hart, und so wurde es jeden Tag etwas besser.
Langsam und träge strömte der Fluss in Richtung Meer. Kein Zeichen von irgendeinem Schnellboot mit breiter Bugwelle.
Den Jungen beschlich ein mulmiges Gefühl. Irgendetwas stimmte nicht. Sein Instinkt sagte ihm, dass es besser wäre, die Sachen zu packen und seinen Eltern von dem merkwürdigen Phänomen zu erzählen. Er war drauf und dran, den Hügel hinabzulaufen, als er jenseits der Bäume, wo der Fluss einen Knick machte, einen dunklen Punkt bemerkte. Er schwebte in einiger Entfernung über dem Horizont, änderte dann seine Richtung und kam genau auf ihn zu. Zuerst dachte er, der Punkt und das Brummen hätten nichts miteinander zu tun; doch schlagartig wurde ihm bewusst, dass er die Quelle des Geräuschs gefunden hatte.
Ein Winseln erklang. Sein Hund stand da, den Körper wie einen Bogen gespannt, den Schwanz zwischen den Hinterläufen eingeklemmt.
»Siehst du auch, was ich sehe?«
Der Hund stieß einen japsenden Laut aus.
»Du hast recht. Das … das sieht aus wie eine Flugmaschine. Aber das ist doch völlig unmöglich.« Der Junge beschirmte seine Augen mit der Hand. Ein eigentümliches Kribbeln kroch seinen Rücken empor. »Es gibt keine Flugmaschinen. Nicht mehr. Vater hat mir erzählt, dass es seit über dreißig Jahren keinem gelungen ist, eine zu bauen.«
Er spürte, wie sein Herz pochte. Wenn es bei ihnen keine Flugmaschinen gab, dann musste dieses Ding von außerhalb kommen. Von jenseits des Flusses, vielleicht sogar von noch viel weiter her.
Mit offenem Mund starrte er auf das Objekt. Es besaß zwei übereinanderliegende Flügel, zwischen denen jeweils zur Rechten und zur Linken tropfenförmige Gondeln hingen. Der Rumpf war wie der eines Schiffes schlank und lang gezogen, wobei das Heck in einen fächerförmigen Schwanz auslief. Das Ganze erinnerte entfernt an einen Vogel, wenn es auch viel plumper und ungelenker war. Nicht so elegant und geschmeidig wie der Greifvogel, der neben dem Ding herflog. Er behielt die Geschwindigkeit der Maschine mühelos bei und schien kein bisschen scheu oder verängstigt zu sein.
Das dunkle Monstrum war jetzt so nah, dass der Junge einen Blick auf die Insassen erhaschen konnte. Zumindest einer von ihnen war eine Frau. Ihr langes rotes Haar flatterte hinter ihr im Wind. Sie schien ihn gesehen zu haben, denn sie hob ihre Hand und winkte ihm zu. Keine zwei Sekunden später donnerte das Ungetüm über seinen Kopf hinweg.
Einen Moment lang schien die Welt den Atem anzuhalten, dann stoben die Schafe auseinander und suchten Unterschlupf unter den Bäumen.
Der Junge war wie versteinert. Mit wild klopfendem Herzen stand er da und konnte sich nicht rühren. Was er gesehen hatte, war einfach nicht möglich. Nach ein paar Atemzügen fiel die Starre von ihm ab. Die Schafe waren vergessen, er konnte sie später wieder zusammentreiben.
Einen wilden Schrei ausstoßend, drehte er sich um und rannte, so schnell ihn seine Beine trugen, Richtung Siedlung.
Teil 1
Spieglein, Spieglein an der Wand
Liebste Gwen,
wenn du das hier liest, werde ich bereits fort sein. Was ich getan habe, ist unverzeihlich, doch ich habe einfach keine andere Möglichkeit gesehen.
David und ich sind jetzt ein Paar. Wir werden das suchen, von dem meine Mutter sagte, es wäre unsere einzige Hoffnung: die Zuflucht. Ein Ort irgendwo im Westen, an dem Männer und Frauen wie vor den Dunklen Jahren zusammenleben.
Ich fühle mich so schäbig, dass ich dir nicht selbst von unseren Plänen berichtet habe, doch die Zeit drängte, und ich wusste mir nicht anders zu helfen.
Wenn du diesen Brief liest, haben wir unser Ziel schon erreicht – oder wir sind bei dem Versuch, dorthin zu gelangen, umgekommen.
Bete für mich, Gwen. So wie ich dafür bete, dass wir uns eines Tages wiedersehen.
Deine dich immer liebende Juna
1
Das Gesicht im Spiegel blickte sie wütend an. Die Wangen gerötet, die Augen schmal, die Haare ungezähmt.
Mein Leben ist ein Scherbenhaufen.
Sie fuhr mit den Händen durch ihre pechschwarzen Locken und versuchte, die störrische Mähne zu bändigen.
Ich dachte, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt, doch das war alles nur eine Illusion. Der Mensch, den ich am meisten geliebt habe, ist fort. Jetzt bin ich allein, und alles, was ich habe, ist dieser dämliche Spiegel.
Sie warf ihrem Gegenüber einen vernichtenden Blick zu.
Manchmal erkenne ich mich selbst kaum wieder.
Gwen fand ihre Stirn zu rund, die Augen zu nah beieinander und die Nase zu krumm. Manche sagten, sie sei schön, doch das konnte sie nicht nachvollziehen. Einzig ihr Mund, die geschwungenen Lippen und die kleinen Grübchen rechts und links konnten ihrem kritischen Blick standhalten.
Mein ganzes Leben habe ich hier in Glânmor verbracht, jetzt fühle ich mich wie eine Fremde. Wie konnte das nur geschehen? Kannst du es mir sagen?
Das Spiegelbild schwieg.
Von der Waschschüssel stieg Dampf auf. Die Welt war in Wolken getaucht. Weiche Schleier wogten über das Glas und verzerrten das Bild zu diffusen Formen. Ein Schrank, ein Tisch, ein paar Regale, ein geöffnetes Fenster. Dahinter, nur mit Mühe zu erkennen, die alte Atlaszeder, die ihren Schatten über dem Haus verteilte. Ein Windstoß fuhr über das Wasser und verwirbelte den Dampf. Gwen nahm ein Tuch und polierte das Glas. Inmitten des Nebels entstand ein unregelmäßig geformter Fleck.
Warum sprichst du nicht mit mir? Sag mir lieber, warum alles schiefgelaufen ist.
Schweigen.
Gwen tauchte ihre Hände ins Wasser. Die Temperatur war gerade noch erträglich. Noch etwas heißer, und sie hätte sich verbrüht. Sie griff in ein Tongefäß und streute ein paar Lavendelblüten ins Becken. Sofort verbreitete sich ein belebender, aromatischer Geruch. Sie beugte sich vor und schöpfte eine Handvoll Wasser in ihr Gesicht. Die Wärme brandete über sie hinweg und hinterließ Wohlbefinden. Sie spürte, wie sich ihre Haut entspannte. Mit vollen Händen schöpfte sie weiter, immer und immer wieder, so lange, bis ihr Gesicht rot war wie eine Tomate. Die Kälte verflog, zumindest äußerlich. Spätestens heute Abend jedoch, wenn sie zu Bett ging, würden ihre ständigen Begleiter wieder da sein: die Leere, die Einsamkeit – und die Fragen.
Warum hast du mich verlassen? Wohin bist du gegangen? Warum hast du mir nicht Lebewohl gesagt?
Alles, was ihr von Juna geblieben war, hing nebenan an der Wand. Ein Zettel, der an einen Pfeil gebunden aus der Flugmaschine geworfen worden war, mit einer Handschrift, die unmöglich Junas sein konnte. Wie die meisten Frauen in Glânmor konnte sie weder lesen noch schreiben. Bücher galten als etwas Schlechtes. Wissen wurde mündlich und in Form von Geschichten weitergegeben. Den Brief musste ein anderer verfasst haben. War er es gewesen, hatte er die Botschaft geschrieben? War ja eigentlich auch egal.
Warum hatte Juna Gwen ihren Entschluss nicht persönlich mitgeteilt? Schämte sie sich? Hatte sie geglaubt, sie könne sie deswegen verachten?
Ausgerechnet Juna, die immer so stark und schön gewesen war. Eine Kriegerin der Brigantia. Tochter der Hohepriesterin Arkana und Wächterin über alle Geheimnisse. Jung, stolz und sehr von sich überzeugt. Eine Frau, die immer wusste, was richtig war und was falsch. Wie konnte sie sich nur mit einem Mann einlassen? Mit einem Feind?
Vielleicht lag die Schuld ja bei Gwen. Vielleicht hatte sie Juna zu wenig geboten, ihr zu wenig Freiheiten gelassen oder sie zu sehr eingeengt. Was, wenn ihre Suche nach Nähe genau das Gegenteil bewirkt hatte?
Wenn ich dich enttäuscht haben sollte, Juna, so tut es mir leid. Aber warum hast du nie ein Wort gesagt? Habe ich nicht wenigstens dieses bisschen Offenheit verdient?
Warum nur, Juna, warum?
Gwen wischte eine Träne aus ihrem Augenwinkel. Was sie da tat, war sinnlos. Selbstzerfleischung. Eine angehende Heilerin sollte wissen, dass Verletzungen Zeit brauchten.
Wer war der Mann, der Junas Herz erobert hatte?
Gwen erinnerte sich undeutlich an einen Gefangenen. Ein junger Mönch aus einem der Klöster nahe der alten Stadt. Sie hatte ihn nur kurz zu Gesicht bekommen, in einem Käfig am See. Unscheinbar, blass, in sich gekehrt. Kein Mann, der eine Kriegerin der Brigantia beeindrucken konnte. Ein Grübler, ein Denker, ein Bücherwurm. Doch irgendetwas musste Juna in ihm gesehen haben. Manche sagten, er habe sie verhext, doch das konnte Gwen nicht glauben; dafür kannte sie ihre Gefährtin zu gut. Wenn jemand gegen die Verlockungen der Zauberei immun war, dann sie.
Aber was war es dann?
Gerüchte sprachen von einem Buch. Magdalena, die oberste Heilerin, hatte zuerst davon erzählt. Sie war eine Freundin der Hohepriesterin, die beiden standen in ständigem Austausch. Angeblich war Arkana die Letzte gewesen, mit der Juna vor ihrer Flucht Kontakt gehabt hatte. Doch was die beiden alten Frauen an Wissen teilten, drang nicht nach außen. Magdalena wich Gwens Fragen aus und berief sich auf ihre Vergesslichkeit. Einmal jedoch war ihr etwas herausgerutscht. Die Rede war von einem schmalen, schlanken Buch mit verbotenem Inhalt gewesen, daran erinnerte sich Gwen ganz genau. Angeblich enthielt es Texte, die von der Liebe handelten. Der Liebe zwischen Mann und Frau!
Konnte es so etwas geben?
Anscheinend war es sehr alt. Es stammte aus einer Zeit lange vor den Dunklen Jahren. Damals war es noch üblich gewesen, dass Männer und Frauen zusammenlebten, Kinder bekamen und diese gemeinsam aufzogen. Seither waren 65 Jahre vergangen, doch die Welt hatte sich in der Zwischenzeit komplett verändert. Es schien, als läge eine Ewigkeit dazwischen. Alles war seitdem anders geworden. Die Männer lebten in den Ruinen dessen, was einst eine große Stadt war. Sie standen unter der Führung eines Mannes, den alle Welt nur als den Inquisitor kannte: Marcus Capistranus. Der Teufel in Menschengestalt. Er überzog das Land mit Feuer und Hass, seine Grausamkeiten machten selbst vor Kindern und alten Leuten nicht halt. Jenseits der Verbotenen Zone begann das Reich der Frauen. Eine Welt des Friedens und der Harmonie, in der man im Einklang mit den Göttinnen lebte, in der man säte und erntete und Ehrfurcht vor der Natur hatte. Ihr goldenes Zentrum war die Stadt Glânmor, gelegen an den sanft abfallenden Flanken eines erloschenen Vulkans. Aus dem zentralen See erhob sich eine Insel mit einem Tempel darauf.
Glânmor war alt, viel älter, als manche Frauen wahrhaben wollten. Die Ursprünge lagen im Nebel der Geschichte verborgen, genau wie der Name, an dessen Herkunft sich niemand mehr erinnerte. Vermutlich war er während der großen Reinigung entstanden. Damals waren alle Andenken an die Zeit vor dem Zusammenbruch getilgt worden. Das Gebäude, das früher anstelle des Tempels auf dem heiligen Berg Mâlmot gestanden hatte, sollte Legenden zufolge einmal ein »Hotel« gewesen sein – ein Übernachtungsort für Ausflügler aus der großen Stadt, die nichts weiter im Sinn hatten, als sich zu amüsieren, die heißen Quellen zu entweihen und sich die Bäuche vollzustopfen. Doch die Altvorderen hatten das Gebäude umgebaut und aus ihm das gemacht, was es heute war: der Tempel der drei Göttinnen, das heilige Zentrum der gesamten Frauenwelt.
Abends, wenn es dunkel wurde, konnte man die Prozession der Gläubigen erkennen. Sie wanderten über die mit Fackeln beleuchteten Brücken zur Insel hinüber, erklommen die steilen Hänge und versammelten sich in der großen Halle zum Abendgebet.
Gwen griff nach dem Melkfett und verteilte es in ihrem Gesicht. Dann bestäubte sie ihren Dachshaarpinsel mit Kreidestaub und puderte ihre Wangen. Sie hasste ihre ewig roten Backen und die wohlgebräunte Haut. Sie wollte nicht, dass die anderen sie für einen Bauerntrampel hielten. Stattdessen wollte sie so aussehen wie die feinen Damen aus der Oberstadt, die nur selten ihre Häuser verließen, außer um Einkäufe zu erledigen oder bei wichtigen Versammlungen den Vorsitz zu führen. Frauen wie Arkana, Edana und der Rest des Hohen Rates.
Ein wenig Lidschatten, die Wimpern mit geöltem Kohlestaub nachgezogen, und Gwen war bereit für den Tag. Natürlich würde Magdalena es wieder missbilligen, dass sie geschminkt zum Dienst erschien. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz, lästerte sie und zitierte dabei ein altes Märchen, das sie oft und gern erzählte. Gwen war das egal. Gutes Aussehen, saubere Kleidung und ein höfliches Auftreten kamen bei den Kranken immer gut an. Die Häuser der Heilung waren ein Ort, an dem sich alle wohl fühlen sollten – auch die Pflegerinnen.
Ein letzter Blick in den Spiegel, die Fingernägel gereinigt, dann verließ sie das Haus.
2
Vor der Haustür wurde sie bereits erwartet. Mit stolz erhobenem Haupt präsentierte Füchschen ihren neuesten Fang: eine wohlgenährte Maus mit weißem Bauch und langem Schwanz.
Zum ersten Mal an diesem Morgen musste Gwen lächeln. Sie liebte ihre Katze über alles, aber was dieser rotgestreifte Tiger jeden Tag an Mäusen erbeutete, ging auf keine Kuhhaut. Sie hatte ja gehört, dass die Roten besonders gute Mäusefänger seien, aber die Wirklichkeit übertraf die Geschichten bei weitem. Wenn sie gewusst hätte, was da auf sie zukam, hätte sie es sich an diesem schicksalhaften Tag vor einigen Wochen, als sie mit Juna über den großen Markt von Glânmor geschlendert war, vielleicht anders überlegt.
Andererseits – nein.
Füchschen war ihr Ein und Alles. Niemals hätte sie eine andere Katze haben wollen. Sie kniete sich hin und kraulte ihr das Kinn. Füchschen brummte und schnurrte, dass man glauben konnte, sie habe eines dieser mechanischen Wunderwerke verschluckt, wie sie drüben in der Schmiede von Meisterin Helma hergestellt wurden. Ihre Mundwinkel waren zu einem breiten Katzengrinsen verzogen.
»Was hast du mir denn heute wieder Schönes mitgebracht? Lass mal sehen. Ah, ein saftiger Braten. Nichts für mich, das weißt du ja. Aber es gibt sicher andere, die sich riesig über so einen Happen freuen würden.« Gwen packte die Maus am Schwanz und hob sie in die Höhe. »Also, was soll ich damit machen?«
Füchschen blickte sie erwartungsvoll an. Sie war noch zu klein, um einen ganzen Nager zu verdrücken, was sie aber nicht davon abhielt, dauernd neue zu erbeuten.
»Weißt du was«, schlug Gwen vor, »ich bringe sie Freya. Magdalenas alte Katze kann selbst keine Mäuse mehr fangen und wird sich über das Geschenk bestimmt freuen. Im Gegenzug überlässt mir Magdalena vielleicht etwas Sahne. Da stehst du doch drauf, oder? Sahne gegen Maus, kein schlechter Tausch.«
Füchschen fing an, Gwen um die Beine zu streichen. Ihre ganze Haltung drückte Wohlbefinden aus. Nur mit Mühe konnte sich Gwen losreißen. Wie gerne hätte sie jetzt mit ihrer kleinen Freundin den Tag verbracht, aber die Arbeit rief. Sie war eh schon spät dran, und Magdalena hasste Unpünktlichkeit.
»Tut mir leid, ich muss los«, sagte sie. »Ich werde nicht zu lange fortbleiben, versprochen. Pass in der Zwischenzeit ein bisschen aufs Haus auf, und bitte, tu mir einen Gefallen …«, sie lächelte gequält, »keine Mäuse mehr. Mein Bedarf für heute ist gedeckt.«
Von ferne erklang der erste Morgengruß.
Gwen sprang auf, strich ihr Kleid glatt und marschierte los.
Die Häuser der Heilung lagen im Osten, gleich gegenüber den Kasernen, in denen die Brigantinnen ausgebildet wurden. Sie selbst wohnte im Westen, so dass sie einen langen Fußweg vor sich hatte. Zum Glück musste sie nicht außen herumlaufen, sondern konnte die Abkürzung über die Insel nehmen. Das wurde zwar von den Wachen nicht gerne gesehen, sparte aber eine Menge Zeit. Gwen schulterte ihre Tasche und eilte halb laufend, halb gehend die Straße hinunter.
Das Tal lag im Nebel. Die Sonne hatte den unteren Teil des Kraters noch nicht erreicht und lediglich den See in ein geheimnisvolles Zwielicht getaucht. Gwen blickte zum heiligen Berg hinauf. Auf seinen Flanken schimmerte golden der junge Morgen. Der Tempel selbst lag bereits im Licht, so dass die Strahlen von den Fenstern reflektiert wurden. Gwen konnte die aufwendigen Glasarbeiten sehen, mit denen der Eingangsbereich rechts und links der Säulen verziert worden war. Auf ihnen – das wusste sie – war in farbigen Bildern die Schöpfungsgeschichte dargestellt. Das Leben in Unschuld, der Sündenfall des Mannes sowie die Vertreibung aus dem Paradies. Man sah, wie der Mann der Erbsünde anheimfiel, als er an den Grundfesten der Schöpfung rüttelte. Doch die heilige Dreifaltigkeit Ambeth, Borbeth und Wilbeth, die Göttinnen der Fruchtbarkeit, der Heilung und des Lichts, schoben der Sache einen Riegel vor. Sie verbannten die Männer in die Ruinenstädte und zwangen sie, zwischen Ratten und alten Steinen ein jammervolles Dasein zu fristen. Den Frauen aber boten sie die Möglichkeit, ihr Schicksal selbst zu bestimmen und ein neues Leben zu beginnen.
Die Geschichte hatte Gwen immer beeindruckt, zeigte sie doch, zu was Männer fähig waren. Seit Junas Verschwinden fand sie zunehmend Trost im Glauben. Das tägliche Gebet, die Gespräche mit ihren Freundinnen, die Arbeit im Garten, all das hatte ihr geholfen, den Schmerz und die Fragen zu verarbeiten. Ganz auslöschen konnten sie sie jedoch nicht. Sie war so in Gedanken versunken, dass sie beinahe den zweiten Morgengruß überhört hätte.
Mit schnellen Schritten eilte sie über die Brücke. Die Holzbohlen unter ihren Füßen knarrten. Sie lauschte. Hatte man sie gehört? Doch am anderen Ufer war alles still. Keine Spur von den Wachen.
Das Wasser gluckerte unter den Stützpfosten und schwappte gegen das Ufer. Geheimnisvolle Nebelschwaden trieben über die Oberfläche. Gwen fröstelte.
Ohne Zwischenfälle erreichte sie die Tempelinsel und folgte im Uhrzeigersinn dem schilfbestandenen Weg. Alles war ruhig. Drüben von der Schmiede waren die ersten Hammerschläge zu vernehmen. Irgendwo krähte ein Hahn. Wenige Augenblicke später erreichte sie die Rückseite der Insel und den zweiten Steg. Immer noch keine Spur von den Wachen. Doch sie waren hier. Niemand betrat die Insel, ohne von ihnen gesehen zu werden; sie hielten sich jedoch meist versteckt.
Gwen zog den Kopf ein und eilte über den Steg. Nur noch wenige Schritte, dann war sie drüben. Sie atmete auf. Geschafft.
Als sie sich noch einmal umwandte, glaubte sie, rechts vom Steg ein Blinken zwischen den Bäumen zu erkennen. Die polierte Oberfläche einer Rüstung? Vermutlich. Diese Frauen waren geborene Kriegerinnen. Juna war lange Zeit eine von ihnen gewesen. Sie hatte Gwen einiges über die Kaste der Brigantinnen erzählt: von ihrer Ausbildung, dem Drill und den Kampfkünsten, von ihrer geistigen Disziplin, dem Gehorsam und der nicht zu erschütternden Treue zum Hohen Rat und zu den Bewohnerinnen dieses Landes. Dass sich ausgerechnet Juna mit einem Mann davongestohlen hatte, war für Gwen immer noch schwer nachvollziehbar. Keine Zeit für schwermütige Gedanken, ermahnte sie sich. Vom Gebetsturm erscholl der dritte und letzte Morgengruß.
Gwen biss sich auf die Unterlippe. Wieder zu spät. Das war schon das dritte Mal diese Woche. Die oberste Heilerin würde nicht erfreut sein.
Sie sah Magdalena schon von ferne. Den Rücken ihr zugewandt, befüllte sie Blumenkästen mit Geranien und zupfte abgestorbenes Laub ab. Zusammen mit den grünen Blättern bildeten die violetten Blüten einen wunderbaren Kontrast zu den weißgekalkten Außenwänden und den dunklen Holzbalken.
Die Häuser der Heilung bestanden aus drei langgezogenen, mit dunklem Riedgras gedeckten Fachwerkbauten, die ein Hufeisen bildeten. Das Zentrum nahm ein kleiner Park ein, in dem sich Rasenflächen und alte Bäume abwechselten. Gwen sah Kranke und Pflegerinnen, die den Sonnenschein genossen oder langsam im Schatten der Bäume herumschlenderten.
Magdalenas Heilmethode beruhte darauf, den Kranken ihren Lebensmut zurückzugeben. Dazu gehörten ein respektvoller Umgang und der Aufenthalt in einer schönen Umgebung. Bänke, Tische und mit weißem Kies gestreute Wege luden zum Verweilen ein und stärkten Körper, Geist und Seele. Magda sagte immer, die Genesung beruhe in erster Linie auf Selbstheilungskräften. Wer nicht gesund werden wollte, der wurde es auch nicht – ganz gleich, welche medizinischen Kunststückchen man an ihm vollbrachte.
Die oberste Heilerin hatte die Arbeit an dem Gesteck beendet und sich umgedreht. Ein Lächeln lag auf ihrem faltigen Gesicht, ganz so, als hätte sie gewusst, dass Gwen hinter ihr stand.
»Hallo, Gwen, sei gegrüßt. Hattest du eine angenehme Nacht?«
»Ja, Herrin, danke.« Gwen senkte den Kopf in Erwartung einer Standpauke. Doch es kam nichts. Magdalena tat nie, was man von ihr erwartete.
Die oberste Heilerin war alt. Uralt. Niemand wusste genau, wie viele Winter bereits hinter ihr lagen, aber es mussten weit über achtzig sein. Sie gehörte zu den betagtesten Frauen in Glânmor und zu den wenigen, die den Zusammenbruch und die Dunklen Jahre miterlebt hatten. Sie sprach nicht gerne darüber, aber Gwen hatte trotzdem einiges aufgeschnappt. Es gingen Gerüchte, Magdalena wäre mit einem Mann zusammen gewesen, als die Katastrophe hereinbrach. Angeblich habe sie ihn niedergestochen und sei dann Hals über Kopf in die Wildnis geflohen.
Magdalena war etwa einen Meter sechzig groß, von schmaler Statur und einnehmendem Wesen. Wenn sie lächelte, dann schien die Sonne, und wenn sie zornig war, dann donnerte und blitzte es! Ihre Haare waren schlohweiß und gingen ihr bis zur Hüfte. Selten trug sie sie offen; meist waren sie zu einem dicken Zopf geflochten, den sie zusätzlich mit Kornblumen oder Mohnblüten, mitunter auch mit braunen oder goldenen Bändern schmückte. Am beeindruckendsten waren ihre Augen. Sie schienen alles und jeden zu sehen, nichts entging ihnen. Von Alterserscheinungen, wie bei so vielen anderen Frauen ihrer Generation, war bei Magdalena nichts zu spüren. Sie habe keine Zeit, vergesslich zu werden, sagte sie immer. Wer rastet, der rostet. Dabei hatte sie alles andere als ein leichtes Leben gehabt. Vermutlich war es der tägliche Umgang mit Menschen, der sie jung bleiben ließ.
Gwen fasste sich ein Herz. »Bitte verzeiht, Herrin. Es tut mir leid, ich habe mich verspätet. Ich weiß, es ist diese Woche schon das dritte Mal, aber bei mir geht im Moment einiges drunter und drüber. Seit Junas Fortgang ist mein Leben nicht mehr so, wie es war. Es wird nicht wieder vorkommen, ich verspreche es Euch.«
Die Augen der alten Frau ruhten auf ihr. Kühl, nüchtern und von stahlgrauer Ruhe. »Wie lange bist du jetzt einfache Pflegerin?«
»Vier Jahre, Herrin.«
»Hattest du nie den Wunsch, mehr aus deinem Beruf zu machen? Wolltest du nie zur Schwesternschaft der Heilerinnen gehören?«
»Doch, Herrin, mehr als alles andere. Ihr wisst das. Ich habe in den letzten zwei Jahren alles gelernt, was es über die Heilkunst zu wissen gibt. Ich habe mich mit anderen Heilerinnen unterhalten und mir von ihnen zeigen lassen, wie man gebrochene Knochen schient, Wunden reinigt und näht, ja sogar Operationen durchführt. Ihr könnt Schwester Theresa fragen. Ich war immer sehr gelehrig und aufmerksam …«
»Ich habe mit Theresa gesprochen.«
Gwen stutzte. »Tatsächlich?«
»Sie sagt, du wärst die beste Schülerin, die sie je hatte.«
»Oh, das ist …« Gwen fehlten die Worte. Im Geist hatte sie sich schon ausgemalt, welchen Verlauf das Gespräch nehmen würde. Über die Frage nach dem beruflichen Ziel bis hin zur Ermahnung, dass sie dafür aber mehr tun müsse – das ganze Programm. Stattdessen jetzt ein Lob.
»Danke«, sagte sie. »Ich dachte …«
»Ich habe eine Überraschung für dich.«
Gwen verstummte zum zweiten Mal. Diesmal länger. Aha, dachte sie. Jetzt kommt’s. Es war klar, dass die oberste Heilerin ihre Verspätung nicht einfach so hinnehmen würde.
»Was für eine Überraschung?«, fragte sie mit leiser Stimme.
Magdalena straffte die Schultern. »Du bist schon sehr lange bei uns. Du hast viel gelernt und bist eine ausgezeichnete Pflegerin. Ich will, dass du versuchst, mehr aus dir zu machen. Besonders vor dem Hintergrund von Junas Fortgang. Du musst auf andere Gedanken kommen, und der beste Weg dahin führt über die Arbeit. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche.« Ein trauriges Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Wir brauchen gute Heilerinnen, und du könntest eine werden, das spüre ich. Natürlich müsstest du dich mehr ins Zeug legen, pünktlicher werden und mehr Distanz zu deinen Kranken aufbauen. Du stehst ihnen oft zu nah, und das könnte zum Problem werden, wenn du sie operieren müsstest.« Magdalena hob den Kopf. »Du wirst die Prüfung ablegen. Morgen früh. Du wirst eine Behandlung durchführen, allein und ohne Hilfe. Wenn es dir gelingt, wirst du in den Kreis der Eiren aufgenommen, der Töchter der Göttin Sulis. Dann darfst du dich künftig als Heilerin bezeichnen. Wenn nicht, nun …« Sie zuckte die Schultern. »Dann musst du eben noch mal ein Jahr warten. Jetzt geh. Du hast den Rest des Tages frei, um dich auf die Prüfung vorzubereiten.«
»Ihr … ihr wollt, dass ich die Prüfung zur Heilerin ablege? Morgen?«
»Ich meine, mich zu erinnern, das gesagt zu haben, ja.«
Gwen wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Der Moment, auf den sie so lange gehofft und um den sie gebetet hatte, war plötzlich da. Wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Typisch Magdalena.
»Ich … danke Euch«, stammelte sie. »Das ist … bei den Göttinnen, wenn ich das meiner Freundin erzähle. Die wird ganz aus dem Häuschen sein.« Nun, vielleicht auch nicht, dachte Gwen. Sie wusste, was Solveig von ihrer Arbeit hielt.
»Dank mir nicht zu früh«, sagte Magdalena. »Konzentrier dich auf die bevorstehende Prüfung und denke noch einmal in Ruhe über alles nach, was du gelernt hast. Ich werde es dir nicht zu leicht machen. Du wirst deine ganze Kraft brauchen.« In ihren Augen funkelte es. »Und untersteh dich, wieder zu spät zu kommen. Ich habe schon Anwärterinnen wegen geringerer Vergehen durchfallen lassen.«
3
Im Norden der alten Stadt …
Es war Abend geworden. Auf den Flanken der mächtigen Wohntürme schimmerte die untergehende Sonne. Wilder Wein und Efeu überwucherten die Fassaden und verliehen den Gebäuden das Aussehen bewaldeter Schluchten. Aus einigen der Fenster wehten Banner, doch die meisten waren leere Höhlen. Weiter unten ging es lebhafter zu. Der Duft von gebratenem Fleisch hing in der Luft. Lachen und Singen erklang, und wildes Gebrüll hallte durch die Schluchten. Der alljährliche Heuert-Wettkampf steuerte seinem Höhepunkt entgegen. Sämtliche Clans der Umgebung hatten sich versammelt, um ihren Favoriten anzufeuern und ihm zum Sieg zu verhelfen.
Logan prüfte den Sitz seiner Handschuhe. Das Leder war weich und geschmeidig, die Finger hatten guten Halt. Früher war ihm im Lauf eines Wettkampfes ab und zu mal ein Schwert oder Dolch entglitten, doch seit er in der Kanalisation auf das Versteck eines Kürschners gestoßen war, passierte ihm das nicht mehr. Leder aus Rattenhaut war ebenso dünn wie zäh. Ein äußerst widerstandsfähiges Material, was man gar nicht glauben mochte, wenn man die quiekenden Viecher so ansah. Der Kürschner selbst würde den Verlust nicht mehr beklagen; er war ebenso tot wie die Tiere, aus denen er seine Ware gefertigt hatte. Vermutlich ein Opfer der Bleichen, die in den Tiefen der U-Bahn-Schächte und der Kanalisation hausten.
»Norgal, Norgal!«
Der Eisengießer-Clan stimmte sich auf die Finalrunde ein. Logan lächelte grimmig. Dieser Stamm hatte schon immer die größten Schreihälse hervorgebracht.
Für Logan war es die dritte Teilnahme, wobei es ihm zum ersten Mal gelungen war, das Finale zu erreichen. Die Narben und Brüche hatten seinen Ehrgeiz nur noch mehr angestachelt. Diesmal konnte er es schaffen, das spürte er.
Die beiden Gegner gehörten zu den Besten ihres Standes. Er kannte sie gut genug, um zu wissen, wie er sie einzuschätzen hatte. Logan war ein Neuling, ein unbeschriebenes Blatt, der bisher nicht über die Vorentscheidungen hinausgekommen war. Sollte er gewinnen, würde er erhebliche Privilegien und Vergünstigungen erhalten. Von heute auf morgen wäre er der Liebling des Clans und persönlicher Günstling von Warlord Alexander, dem Oberhaupt des Clans vom Steinernen Turm.
»Norgal, Norgal!« Das Gebrüll wurde lauter. Es brandete gegen die steinernen Türme wie Wellen gegen einen Fels.
Die Stimmung war auf dem Höhepunkt.
Ein letztes Mal prüfte Logan seine Waffen, die Schnürung der Stiefel, den Sitz der Knie- und Armschützer. Auf den Helm wollte er verzichten. Er behinderte seine Sicht, abgesehen davon, dass er einem Schlag von Norgals Hammer ohnehin nicht standhalten würde. Wenn er gewinnen wollte, musste er schnell sein. Schnell und schlau.
»Norgal, Norgal!«
Dachs hielt ihm seinen Schild hin. Eine mit Nieten versehene Lederplatte, auf der das Wappen des Clans vom Steinernen Turm aufgemalt war. Logan steckte seine Hand durch die Schlaufe und lächelte seinem Bruder zu.
Dachs war etwa neun Jahre alt und seit etwa einem halben Jahr sein Knappe. Gunnar hatte ihn in der Wildnis gefunden, wo er sich vor Regen und Wölfen in einer Höhle versteckt hielt. Als der Schmied ihn zu sich genommen hatte, war er total verwildert und abgemagert gewesen. Er sprach kein Wort und glich eher einem wilden Tier als einem Menschen. Auf die Frage, wie er heiße, hatte er einen Dachs in den Sand gemalt, daher der Name.
Dachs hatte niemals auch nur ein Wort gesprochen. Logan tippte auf einen körperlichen Defekt, es konnte aber auch sein, dass ihm ein schreckliches Erlebnis die Stimme geraubt hatte. Wirklich wichtig war es nicht; Dachs konnte sich mit Händen und Füßen besser verständigen als manch einer mit Worten.
Die Wälder waren voll von Kreaturen wie Dachs. Kleine, magere Gestalten, die es irgendwie geschafft hatten, zu fliehen und in der Wildnis zu überleben. Normalerweise pflegten die Frauen die Säuglinge in steinernen Kreisen abzulegen, wo sie von Mitgliedern der städtischen Klostergemeinschaften abgeholt wurden. Doch manchmal ging etwas schief. Manchmal kam ihnen ein Tagelöhner oder Streuner zuvor, nahm das Baby mit und verkaufte es an irgendeinen, der bereit war, angemessen dafür zu zahlen. Der Markt florierte, denn Kinder waren Mangelware.
Nicht jeder konnte sich eine Frau leisten, so wie die Warlords oder Handelsfürsten. Eine Frau zu besitzen war etwas Besonderes. Nicht, weil diese Kreaturen als besonders hübsch oder liebenswert galten – sie waren einfach ungewöhnlich! Sich mit etwas zu umgeben, das von der Kirche als Teufelswerk und Abschaum klassifiziert wurde, war natürlich reizvoll. Frauen galten als das personifizierte Böse, und genau deswegen waren sie so interessant. Verbotene Früchte schmeckten immer noch am besten. Außerdem genossen die hohen Herren auf diese Weise das Privileg, ihren eigenen Nachwuchs zu zeugen, anstatt auf die Bastarde vom Wochenmarkt angewiesen zu sein. Für die einfachen Leute galt eine andere Regel: Wer einen Sohn haben wollte, der musste sich einen kaufen. So wie Gunnar, der für Logan mit einem Schwert nebst dazugehörigem Lederzeug bezahlt hatte. Dass er später noch Dachs dazubekommen würde, ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber er konnte den kleinen Streuner ja nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Die Chancen, im Wald zu überleben, standen eins zu zehn. Im Sommer konnte so ein kleiner Kerl immer ein paar Früchte, Wurzeln oder Ähren finden, aber mit Einbruch des Winters wurde der Lebensfaden stramm angezogen. Dann kamen die Wolfshunde und machten Jagd auf alles, was zu klein oder zu schwach war, um sich zu wehren. Wo immer sie hinzogen, wandelte der Tod auf ihren Spuren. Das galt auch für jemanden wie Dachs, der nur seinem früheren Herrn, einem notorischen Schläger und Säufer, entwischen wollte. Als Gunnar den Mann aufgesucht und mit ihm um den Jungen gefeilscht hatte, war dieser so betrunken, dass er sich mit einem Laib Brot und einer Flasche Schnaps einverstanden erklärte. Seitdem hatte der Schmied zwei Söhne – und das erfüllte ihn mit großem Stolz. Er gehörte damit zu den wohlhabenden Männern im Clan.
Logan ließ seinen Blick in die Runde schweifen.
Die Luft war ungewöhnlich schwül. Spätsommer. Die Hauswände strahlten die Hitze der Sonne ab. Er fühlte, wie ihm unter dem Wams der Schweiß ausbrach. Im Juli muss vor Hitze braten, was im September soll geraten, so lautete eine alte Bauernweisheit. Und gleich würde ihm noch viel heißer werden.
Er schlug mit seinem Schwert gegen den Schild. Er war bereit.
Die Stimmung auf dem Kampfplatz schwankte zwischen Ausgelassenheit und Aggressivität. Die Mitglieder der Eisengießer- und Nordhammer-Clans lieferten sich eine handfeste Prügelei am Spielfeldrand, während ihre Freunde Bier tranken und sie anfeuerten. Die Arena war ein ehemaliger Platz, an dessen Rändern umgestürzte Autos zu Tribünen aufgeschichtet waren. Fackeln und brennende Ölwannen beleuchteten die Szenerie und sorgten dafür, dass die ohnehin schon unerträglichen Temperaturen zusätzlich angeheizt wurden. Über die Fassaden der Gebäude huschten blutrote Schatten. Der Alkohol floss in Strömen, und ein Gestank nach Schweiß und Bier erfüllte die Arena.
Als Logan den fleckigen Rasen betrat, ertönten Schmähungen und Beifallsbekundungen. Beides verdient, wie er zugeben musste. Niemand hatte damit gerechnet, dass ein krasser Außenseiter wie er es so weit schaffen würde – am wenigsten er selbst. Sein Einzug ins Finale hatte dafür gesorgt, dass etliche Wetten geplatzt waren und viele, die nur aus Spaß auf ihn gesetzt hatten, einen unerwarteten Geldsegen in Empfang nehmen durften.
Die Ränge waren dicht besetzt mit Männern aus allen Teilen der Stadt. Da waren der Eisengießer-Clan und der Südhügel-Clan, beide vom anderen Ufer des großen Stroms, der Tiefenwalder-Clan aus dem Westen und natürlich der Nordhammer-Clan und der Clan vom Steinernen Turm aus dem Norden. Es gab aber auch kleinere Gruppierungen, lose zusammengewürfelte Haufen wie die Junkersdorfer oder die Lindenthaler. Banden, die ohne festen Wohnsitz die Außenbezirke der Stadt durchstreiften. Alle trugen ihre speziellen Farben und Ornamente, dazu Tierschädel, Blechdeckel, Malereien, Holzmasken und vieles andere. Schon allein der Körperschmuck und die vielen Tätowierungen waren beeindrukkend. Logan sah Kerle, die ihn mit einem Schlag unter die Erde gebracht hätten, baumlange Typen, die einen Mann in der Luft zerreißen konnten. Trotzdem stand er jetzt hier und nicht sie. Um ein guter Kämpfer zu sein, bedurfte es eben mehr als Muskeln, Kraft und Gewalt. Man musste clever sein. Man musste seinem Gegner immer einen Schritt voraus sein und wissen, was er als Nächstes tun würde. Ein Kampf wurde im Kopf entschieden, hatte Gunnar ihm gesagt, und Logan glaubte daran. Mochten seine Waffen im Vergleich zu denen seiner Kontrahenten noch so mickrig wirken, seine schärfste Waffe war sein Verstand.
Seine Gegner hatten Position bezogen.
Norgal stand rechts außen, in der Nähe seines Clans. Die Anfeuerungsrufe hatten nicht nachgelassen, und der Riese genoss das Bad in der Menge. Mindestens einen Meter neunzig groß und so breit wie ein Schrank, war er einer der gefährlichsten Gegner, die man sich vorstellen konnte. Sein Kampfname lautete der Zertrümmerer, und das war keineswegs übertrieben. Sein Kopf war kahl rasiert und beinahe vollständig mit Tätowierungen überzogen. An seinen Ohren baumelten dicke Goldringe, sie zogen die Ohrläppchen unnatürlich in die Länge. Seine Lippen waren wulstig, und seine kleinen Augen standen eng beieinander. Er war berühmt für seinen Hammer, ein zentnerschweres Ding, mit dem er früher Bolzen in Metallplatten geschlagen hatte. Logan betrachtete den Hammer und war bereit, jedes Gerücht zu glauben, das er jemals darüber gehört hatte.
Der andere Kämpfer war Wengul, genannt die Schlange. Er war ebenfalls recht groß, dabei aber so lang und so dünn wie eine Bogensehne. Wengul war ein Meister der Fernwaffen. Schleudern, Wurfmesser, Armbrüste und Bögen – er beherrschte sie alle. Am gefährlichsten waren seine Bumerangs, aus Eisen geformt und an den Kanten abgeschliffen, was sie zu fliegenden Messern machte. Das Problem mit diesen Dingern: Man sah sie erst kommen, wenn es fast schon zu spät war. Sie umkreisten einen und trafen einen von hinten, während man gleichzeitig seine Augen nach vorne richten musste, um nicht von Wenguls Wurfpfeilen erwischt zu werden. Logan hatte Wengul lange beobachtet und sich von früheren Kämpfen genau eingeprägt, wo man sich hinstellen musste, um dieser tödlichen Zange zu entgehen.
Wengul besaß eine überraschend helle Haut und lange blonde Haare, die zu einem Zopf verknotet waren. Er war zwar kein echter Albino, trotzdem ließ etwas an ihm den Gedanken aufkommen, dass sich seine Mutter mit den Bleichen eingelassen hatte.
Das waren sie also, seine beiden Gegner. Der eine stark, der andere verschlagen. Niemand, bei dem man sich auch nur den geringsten Fehler leisten konnte. Er würde seine ganze Kraft brauchen, um den heutigen Abend zu überleben.
Während Logan seine Gegner studierte, ertönte auf einmal ein metallisches Scheppern.
Auf der Tribüne der Warlords war eine kleine, gedrungene Gestalt erschienen: Quintus Marquardt, der Zeremonienmeister und oberste Verkünder. Es hieß, er sei schon als Schreihals zur Welt gekommen.
Quintus hämmerte dreimal gegen eine Metallplatte, und die Anfeuerungsrufe erstarben. Stille senkte sich über die Ränge. Alle blickten hinüber zur Tribüne.
Der Zeremonienmeister wartete, bis Ruhe eingekehrt war, dann richtete er seine Worte an die Menge:
»Hochwohlgeborene Warlords, Männer, Kämpfer, Clanmitglieder. Verehrte Reisende, Händler, Jäger und Fallensteller. Ihr alle habt den weiten Weg auf euch genommen, um das diesjährige Heuertfest mit uns zu feiern. Dafür danke ich euch.« Er deutete eine Verbeugung an.
»Wir haben uns heute hier versammelt, um den schnellsten, stärksten oder klügsten Kämpfer zu küren. Außerdem wollen wir feststellen, welcher Clan ein Jahr lang den Vorsitz über unsere Gemeinschaft führen wird.«
Donnernder Beifall ertönte. Die Männer schrien den Namen ihres Clans und trampelten dabei auf den Karosserien der verrosteten Autos herum. Quintus wartete eine Weile, bis sie sich ausgetobt hatten, dann hob er die Arme.
»Drei Clans konnten sich mit ihren Kämpfern für die Endausscheidung qualifizieren. Erlaubt mir, sie euch vorzustellen. Auf der hinteren Seite haben wir Wengul, genannt die Schlange. Er stammt vom Tiefenwalder-Clan und ist seines Zeichens Jäger und Fallensteller. Ein Meister des Bogens und beinahe ebenso gut mit seinen Wurfmessern. Ihr wollt einer Fliege auf zwanzig Meter ein Auge ausschießen? Dann ist Wengul euer Mann. Auf der linken Seite steht einer, den ich euch nicht vorzustellen brauche. Dreimaliger Champion und Gewinner des Tapferkeitsordens. Ein Berg von einem Mann. Sein Kampfschrei klingt wie Donner, und wo sein Hammer niederfährt, da bebt die Erde. Begrüßt mit mir Norgal vom Eisengießer-Clan.«
Wieder ertönten Schlachtrufe und lauter Beifall. Es war schwer zu sagen, welche Schreier lauter waren: die grünen Kobolde des Tiefenwalder-Clans oder die kahlgeschorenen Nordhämmer. Schmährufe wurden ausgetauscht, und am Rande der Tribüne kam es erneut zu einer Schlägerei. Es dauerte eine ganze Weile, bis Ruhe eingekehrt war und Quintus weitersprechen konnte.
»Der Dritte und Letzte im Bunde ist ein Neuzugang. Er ist der Favorit unseres Gastgebers Warlord Alexander, dem ich an dieser Stelle herzlich für den Empfang und die Organisation danken möchte. Begrüßt mit mir Logan vom Clan des Steinernen Turms.«
Wieder ertönte Applaus, doch er war deutlich verhaltener als bei den anderen beiden Kämpfern.
Logan warf einen Blick in Richtung Alexander und seines Sohnes Cedric. Die beiden saßen auf der rechten Seite der Ehrenloge und genossen die Veranstaltung sichtlich.
Quintus lächelte und fuhr fort: »Mit siebzehn Jahren ist Logan der jüngste Kämpfer, der es je bis in die Endausscheidung geschafft hat. Schon deshalb gebührt ihm euer Respekt.«
Logan spürte seinen Puls rasen. Was hatte er sich nur dabei gedacht? Wie konnte er ernsthaft annehmen, hier zu bestehen? Gewiss, er hatte sich den einen oder anderen Trick ausgedacht, aber angesichts der beiden Veteranen und der vielen Zuschauer sank ihm das Herz in die Hose. Dies war keine Samstagsnachmittagsbalgerei, dies war ein handfestes Gemetzel. Es gehörte mehr als nur einfache Bauernschläue dazu, um auch nur die ersten Minuten zu überleben. Es war Wahnsinn, einfach Wahnsinn.
Logan war so in Gedanken versunken, dass er beinahe überhörte, dass Quintus seine Rede beendet und das Zeichen gegeben hatte. Die drei Schläge gegen das Blech. Der Kampf hatte begonnen.
4
Gwen durchstreifte das Haus wie ein eingesperrtes Tier. Von der Küche zum Bad, vom Bad in ihr Schlafzimmer, von dort in die Wohnstube und wieder zurück in die Küche. Es musste nach dreiundzwanzig Uhr sein, und sie hätte eigentlich längst schlafen müssen, aber sie war einfach zu aufgeregt. Erst die Freude, dann die Zweifel. Anstatt zu lernen, hatte sie nur darüber nachdenken müssen, was sie wohl am nächsten Morgen erwartete. Eine Behandlung durchführen, hatte Magdalena gesagt. Viel nebulöser konnte man es ja wohl kaum ausdrücken. Das Spektrum reichte von Kräuterumschlägen bis hin zum Eingriff am offenen Gehirn. Nun, das vielleicht nicht unbedingt, aber eine Operation kam durchaus in Frage. Ihre Freundin Regula hatte vergangenen Monat einen offenen Bruch behandeln müssen und war fast daran gescheitert. Die Kranke hatte auf das Schmerzmittel schlecht reagiert und so heftig gezappelt und getobt, dass zwei Helferinnen nötig waren, um sie zu stabilisieren.
Als Heilerin durfte man sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen – weder vom Leid der Kranken, noch von Beschimpfungen oder Schmerzensschreien. Am schlimmsten war es bei Kindern. Gwen empfand so viel Mitgefühl für die Kleinen, dass sie es bislang nicht übers Herz gebracht hatte, bei einem von ihnen das Messer anzusetzen. Doch manchmal musste es eben sein.
Hoffentlich war es keine Operation. Ein ausgerenkter Arm, eine Verbrennung, eine Schnittverletzung oder Quetschung, irgendetwas in der Art hätte ihr gefallen, aber dafür gab es keine Garantie. Gwen kannte alle Kranken, die zurzeit in den Häusern der Heilung untergebracht waren. Keine davon erfüllte ihre Wunschkriterien. Gewiss, da war die alte Helena mit ihrem Gallenstein, aber sie war so schwach, dass Magda es niemals riskieren würde, einen Neuling auf sie anzusetzen.
Sosehr sie sich auch das Hirn zermarterte, Gwen hatte keine Ahnung, was morgen geschehen mochte. Außerdem musste sie ausgeschlafen sein, wenn sie die Prüfung bestehen wollte.
Sie blieb stehen. Sie war wieder in der Küche angelangt. Zum wievielten Mal jetzt?
Füchschen lag friedlich in ihrem Korb und blickte zu ihr empor. Der Mond schien zum Fenster herein, genau auf ihr Nest. »Na, meine Kleine. Kannst du auch nicht schlafen? Liegt vielleicht am Mond. Was soll ich machen? Ich habe schon alles versucht.«
Die grünen Augen blickten sie unverwandt an.
»Einen Spaziergang sagst du?« Gwen zuckte die Schultern.
»Warum eigentlich nicht? Zu mehr bin ich sowieso nicht in der Lage. Wie sieht’s aus, willst du mich begleiten?«
Füchschen gähnte und ließ ihre kleinen Zähne aufblitzen. Dann rappelte sie sich auf und folgte Gwen hinaus in die Dunkelheit.
Die Nacht war sternenklar. Der alte Baum wirkte wie ein Scherenschnitt, zwischen dessen Verästelungen Hunderte von Sternen blinkten. Die kühle Luft führte den Geruch von Holzfeuern mit sich. Irgendwo in der Ferne erklang der Ruf einer Eule. Keine Menschenseele war zu sehen, ganz Glânmor schlief.
Gwen strich über ihre Arme und marschierte los. Füchschen lief an ihrer Seite, ein verschwommener Fleck inmitten anderer verschwommener Flecken.
»Wie es aussieht, sind wir die Einzigen. Oder kannst du jemanden erkennen, jemanden aus deiner Familie vielleicht? Ich habe gehört, Katzen seien oft nachts unterwegs. Sehen tue ich allerdings niemanden. Nun, vielleicht ist es ja nur ein Gerücht, genau wie die Sache mit den neun Leben.«
Füchschen scherte sich nicht um Gwens Geplapper. Sie stromerte durch die Dunkelheit und untersuchte jeden Stein und jede Öffnung. Doch zum Glück waren die kleinen Nager alle verschwunden; Gwen hatte keine Lust, noch eine Maus zu beerdigen.
Ohne festes Ziel lief sie talabwärts in Richtung See. Vor ihr ragte der heilige Berg Mâlmot aus dem Wasser. Insel und Tempel lagen in tiefer Dunkelheit. Wie anders das alles bei Nacht aussah!
Kurz nach Sonnenaufgang hatte das Gebäude einen freundlichen Eindruck gemacht, doch jetzt wirkte es verwunschen und düster. Die Weiden am Ufer der Insel sahen aus wie die gebeugten Leiber alter Frauen, die ihre Hände ins Wasser hielten. Hieß es nicht, am Grunde des Sees läge eine versunkene Stadt? Manche behaupteten, an besonders klaren Tagen könne man tief unten die Ruinen zerfallener Paläste erkennen. Magdalena hatte davon gesprochen. Kein Wunder, denn sie war eine geborene Märchenerzählerin. Sie verstand es wie keine andere, spannende und aufregende Geschichten zum Besten zu geben, und hatte eine besondere Vorliebe für Sagen und Spukgeschichten, von denen sie unzählige zu kennen schien. Eine davon war die Geschichte von Artus und Nimue, der Herrin vom See. Gwen wusste nicht, wie oft sie die Sage von Excalibur, Guinevere, Lancelot und den Rittern der Tafelrunde schon gehört hatte, doch das machte nichts. Neben den Märchen der Gebrüder Grimm war es eine ihrer Lieblingsgeschichten. Besonders faszinierend fand sie den Bezug, den Magdalena zwischen Glânmor und der Artussage herstellte. War es möglich, dass der Berg Mâlmot tatsächlich die letzte Ruhestätte von König Artus war, wie Magdalena behauptete? Dann waren die Ruinen wahrhaftig die Mauern Avalons, und das verzauberte Schwert Excalibur lag vielleicht irgendwo am Grund dieses Sees.
Gwen spürte, wie sie eine Gänsehaut bekam. Es war eine Sache, eine solche Geschichte bei Tag zu hören; nachts jedoch sollte man lieber über weniger mysteriöse Dinge nachdenken, wie zum Beispiel über ihre Prüfung.
Sie fühlte aber, dass ihr der Spaziergang guttat. Ein Anflug von Müdigkeit überkam sie und ließ sie gähnen. Zeit, ins Bett zu gehen.
Sie wollte gerade umdrehen und sich auf den Heimweg machen, als sie am Ufer eine Gestalt bemerkte. Sie musste schon die ganze Zeit dort gestanden und auf das Wasser geblickt haben, doch war sie ihr nicht aufgefallen, weil sie so still stand.
Gwen blieb wie angewurzelt stehen. Die Frau im weißen Gewand und mit den langen blonden Haaren kam genau auf sie zu. Die Herrin vom See, schoss es Gwen durch den Kopf. Nimue, die Hüterin der Quelle, die Königin des Wassers.
Bildete sie sich das ein, oder lächelte die Frau? Nein, kein Zweifel, jetzt hob sie sogar ihre Hand.
»Bist du das, Gwen?«
Gwen versuchte zu antworten, brachte aber keinen Laut hervor.
»Kannst du auch nicht schlafen?«
Sagengestalten besitzen besondere Zauberkräfte, das wusste jeder. Sie konnten einen Menschen dazu bringen, Dinge zu tun, die er gar nicht wollte. So manche Frau zogen sie in die Tiefen ihres Reichs und machten sie zu einer Undine, einer grünen Jungfer, dazu verdammt, zwischen den Ruinen umherzuschwimmen.
Gwen spürte ihre Hände kaum noch. Mit angstgeweiteten Augen wich sie zurück.
»Bleib doch stehen, mein Kind. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich möchte mit dir reden. Hast du keine Lust, die Stille der Nacht mit mir zu teilen?«
Gwen schüttelte den Kopf. Die Kreatur übte eine rätselhafte Macht auf sie aus.
»Nein.« Es war kaum mehr als ein Hauchen. »Ich muss jetzt zurück.«
Die Augen des Wesens wurden groß und traurig. »Ich dachte, du hättest vielleicht ein paar Fragen.«
Gwen schüttelte den Kopf.
Die Frau wartete einen Moment und zuckte die Schultern. »Schade. Aber wie du willst. Dann lasse ich dich jetzt allein. Leb wohl.«
Sie drehte sich um und entschwand in Richtung Brücke. Sie wurde kleiner und kleiner und tauchte zwischen den Bäumen auf der anderen Seite unter.
Der Spuk war vorbei.
»Hast du das gesehen?« Gwen atmete auf. »Bei den Göttinnen, das war das Unheimlichste, was mir in meinem ganzen Leben widerfahren ist. Schau dir meine Hände an, sie zittern immer noch.«
Füchschen beachtete sie gar nicht. Dafür, dass sie über so feine Sinne verfügte, wirkte sie seltsam unbeteiligt. Ihr Fell war glatt, das Gesicht entspannt. Sagte man nicht, Tiere besäßen ein instinktives Gespür für Gefahr?
Plötzlich flammte drüben auf der Insel ein Licht auf. Ein Fenster inmitten der Schwärze des Tempels. Eine schlanke Gestalt stand einige Zeit in der Öffnung, dann verschwand sie wieder. Selbst auf diese Entfernung waren ihre langen Haare und ihr helles Gewand zu erkennen.
Gwen runzelte die Stirn. War das nicht die Frau vom See?
Die Erkenntnis traf sie wie ein Blitzschlag. Wie konnte sie nur so einfältig sein! Das war keine Spukerscheinung. Das war Arkana, die Hohepriesterin. Junas Mutter.
5
Dachs konnte sehen, dass es nicht gut lief.
Von der ersten Minute an hatten Norgal und Wengul sich gegen seinen Bruder verschworen und ihn derart in Bedrängnis gebracht, dass er nur noch damit beschäftigt war, Angriffe abzuwehren, statt seine eigene Taktik zu verfolgen. Der Plan war nur allzu deutlich: Sie wollten den Neuzugang ausschalten und dann die Sache untereinander ausmachen.
Es hatte Prinzip, dass der Endkampf nicht Mann gegen Mann, sondern in einer Dreier-Konstellation ausgefochten wurde. So bekamen auch Kämpfer eine Chance, die unter normalen Umständen zu schwach oder benachteiligt waren. Absprachen im Vorfeld waren zwar verboten, aber manchmal genügte ein kurzer Blickkontakt, um eine vorübergehende Allianz gegen einen übermächtigen Gegner zu schließen, was der Fairness des Wettkampfs zugutekam. Diesmal lief es allerdings alles andere als fair ab. Die beiden Stärksten hatten sich gegen den Schwächsten verschworen, und das bekam auch das Publikum mit. Wilde Empörung machte sich breit, und Wutschreie hallten über das Kampffeld. Die Anhänger der beiden Champions wussten nicht so recht, was sie von der Sache halten sollten, und blieben lieber still.
Norgals Hammer sauste dicht neben Logan zu Boden. Nur mit einem gewagten Sprung, der seine Deckung entblößte, konnte er dem schrecklichen Angriff entkommen. Dachs bemerkte, wie Wengul seine Messer hob. Als hätte er auf diesen Moment gewartet, schleuderte er die Klingen mit einer fließenden Bewegung in Logans Richtung. Dachs sah das Aufblitzen von Metall und hörte, wie die tödlichen Geschosse auf gehärtetes Leder prallten. Logan hatte blitzschnell seinen Schild herumgerissen und sie abgewehrt. Ansonsten wäre er jetzt tot.
Im Publikum entstand Unruhe. Eines der Wurfmesser war abgeprallt und hatte einen Tiefenwalder in die Schulter getroffen. Der Mann war offensichtlich schwer angetrunken. Bei dem Versuch, die Klinge herauszuziehen, geriet er aus dem Gleichgewicht und kippte nach hinten vom Auto herunter.
Hämisches Gejohle ertönte von den Rängen des Steinernen Turms. Logan verschaffte der Vorfall ein wenig Zeit. Er taumelte aus der Reichweite von Norgals Hammer, rannte auf den gegenüberliegenden Spielfeldabschnitt und stützte sich schwer atmend auf sein Schwert.
Dachs runzelte besorgt die Stirn. So erledigt hatte er seinen Bruder schon lange nicht gesehen. Dabei sollte er eigentlich in Topform sein. Er hatte jeden Tag trainiert, hatte Waldläufe gemacht und war sogar die Nordwand eines der Wohntürme emporgeklettert, um seine Kraft und Ausdauer zu stärken. Ihn jetzt so aus der Puste zu sehen, erschreckte Dachs. Jedoch: Es war etwas anderes, ob man ruhig im Wald trainierte oder in der Arena vor Hunderten von Zuschauern um sein Leben kämpfen musste.
Norgal und Wengul gaben ein Zeichen und drangen erneut auf Logan ein. Diesmal gingen sie planmäßig vor. Offenbar war ihnen bewusst geworden, dass sie so ein flinkes Eichhörnchen nur mit Geduld und Kaltblütigkeit zur Strecke bringen konnten. Systematisch trieben sie Logan in eine Ecke. Dachs fiel es schwer, hinzusehen. Wenn Logan sich nicht ganz schnell etwas einfallen ließ, war der Wettkampf für ihn zu Ende. Gunnar schien das auch so zu sehen. Ihr Vater verfolgte das Spektakel mit grauem Gesicht.
Logan stand mit dem Rücken gegen zwei leere Fässer gelehnt. Hilflos musste er mit ansehen, wie seine beiden Gegner unaufhaltsam näher kamen. Dann, in einem Augenblick größter Verzweiflung, sprang er vor und versuchte, zwischen den beiden hindurch in Sicherheit zu gelangen. Das war der Moment, auf den Norgal gewartet hatte.
Der Riese riss seinen Hammer hoch und ließ ihn auf den Flüchtenden heruntersausen. Ein furchtbares Krachen ertönte. Der Schild, den Logan zum Schutz über seinen Kopf gehalten hatte, zerbarst und fiel – in Dutzende kleiner Stücke zerbrochen – zu Boden. Logan taumelte, dann fiel er auf die Knie. Er griff sich an die Brust und hielt seine Hand in die Höhe. Ein Aufschrei ging durch die Menge. Dachs blieb beinahe das Herz stehen. Die Hand war rot. Auf Logans Brust war ein Fleck zu sehen, der rasch größer wurde. Sein Bruder kroch noch ein paar Meter, bis er beinahe die Mitte der Arena erreicht hatte. Er schien etwas sagen zu wollen, doch aus Mund und Nase lief ebenfalls Blut. Mit einem Röcheln brach er zusammen und blieb liegen. Ein Moment atemloser Spannung, dann brandeten Applaus und Buhrufe auf. Quintus schlug mit seinem Stab zweimal gegen das Blech. Das Zeichen, dass der erste Kämpfer ausgeschieden war.
Dachs wusste vor Entsetzen nicht, was er machen sollte. Er hob die Arme und signalisierte den Sanitätern, sie sollten Logan zu Hilfe eilen, aber seine Bemühungen gingen im Sturm der Schlachtrufe einfach unter. Außerdem lag Logan so unglücklich, dass der Rettungsdienst nicht an ihn herankam. Kein Sanitäter war so lebensmüde, während eines laufenden Kampfes in die Mitte des Platzes zu rennen. Es war zum Verzweifeln. Und gerade ging der Kampf in die zweite Runde.
Logan versuchte, seine Knochen zu sortieren. Junge, war das ein Schlag gewesen! Obwohl er sich innerlich darauf vorbereitet hatte, war er immer noch überrascht von der Heftigkeit, mit der Norgals Hammer seinen Schild zerfetzt und ihn zu Boden geworfen hatte. Sein linker Arm fühlte sich an wie abgestorben. Ein Teil des Blutes schien tatsächlich echt zu sein. Nun gut, das konnte dem schauspielerischen Eindruck, den er zu hinterlassen beabsichtigte, nur förderlich sein.
Er hatte diese Idee schon lange mit sich herumgetragen, doch sie war nie über das Stadium eines Notfallplans hinausgekommen. Jetzt war er froh, dass er sich trotz seiner Abneigung gegen den Betrug so gewissenhaft vorbereitet hatte. Der präparierte Schild, die mit Kirsch- und Johannisbeersaft gefüllten Tierblasen und die Gurte, mit denen sie unter seinem Hemd befestigt waren. Selbst der Trick, eine dieser Blasen im Mund zu deponieren und im richtigen Moment draufzubeißen, hatte sehr überzeugend funktioniert. Er hörte immer noch das entsetzte Stöhnen, als er die rote Hand hob. Natürlich tat es ihm leid, seinen Vater und seinen Bruder derart hinters Licht zu führen, aber manchmal heiligte die Not alle Mittel. Und wie recht er gehabt hatte!
Verborgene Absprachen galten als regelwidrig, dennoch hatte er beobachtet, wie die beiden Veteranen vor dem Kampf geheime Zeichen ausgetauscht hatten. Und als ob er es geahnt hätte, gingen sie gleich von Anfang an gemeinsam auf ihn los. Spätestens ab diesem Moment war er glücklich, dass er Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hatte. Jetzt musste er nur noch abwarten, ob auch der Rest gelingen würde.
Die beiden Kämpfer umkreisten ihn. Norgal stand nur wenige Meter entfernt und versuchte, Wenguls Pfeile mit seinen Unterarmschienen abzuwehren. Ein Schild kam für ihn nicht in Frage. Der Hammer war viel zu schwer, um ihn mit nur einer Hand zu tragen, aber so ganz funktionierte das mit den Schienen nicht. Zwischen den Augenschlitzen hindurch sah Logan, dass einer der Pfeile bereits sein Ziel gefunden hatte. Er steckte in der Schulter, ganz nah am Schlüsselbein. Den minimalen Blutverlust steckte der Riese jedoch locker weg. Da bedurfte es schon anderer Treffer.
Wengul schien das auch so zu sehen und setzte alles auf eine Karte. Seine Angriffe kamen jetzt Schlag auf Schlag. Die Sehne seines Bogens surrte, als würde er versuchen, darauf Harfe zu spielen. Norgal hingegen setzte auf Zeit. Sobald Wengul seine Pfeile verschossen hatte, würde er ihn in den Nahkampf zwingen, und was das bedeutete, war klar.
Wieder zischte ein Pfeil von der Sehne und verfehlte Norgal nur knapp. Der Riese stand so dicht bei Logan, dass dieser seinen säuerlichen Schweiß riechen konnte. Um dem Geschoss auszuweichen, musste Norgal zur Seite hechten. Dabei trat er auf Logans linken Fuß. Nur mit Mühe konnte Logan einen Schrei unterdrücken. Der Schmerz war kaum auszuhalten. Aber wenn er jetzt zuckte, wäre sein ganzer Plan für die Katz gewesen.
Nur noch ein paar Minuten.