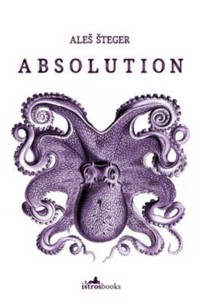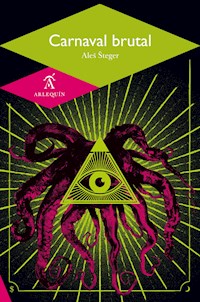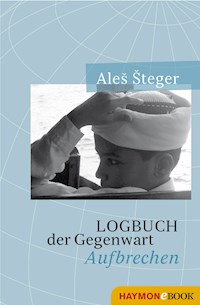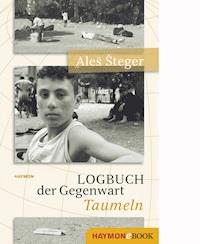
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Logbuch der Gegenwart
- Sprache: Deutsch
AUTHENTISCH, UNVERMITTELT UND HAUTNAH Ein bestimmter Tag im Jahr, ein bestimmter Ort auf der Welt: Für sein einzigartiges "Logbuch der Gegenwart" geht Aleš Šteger dorthin, wo die Wunden unserer Zeit klaffen. Jeweils exakt zwölf Stunden nimmt er sich, um seine Eindrücke festzuhalten, die durch seine Augen und Hände direkt aufs Papier fließen. So entstehen seltene Momente der Wachheit, die den Leser/die Leserin direkt ins Herz unserer Gegenwart führen. EIN LOGBUCH UNSERER ZEIT, UNSERER WELT Ljubljana, Platz der Republik, am Tag des prophezeiten Weltuntergangs; Minamisōma nahe dem Atomkraftwerk von Fukushima; Mexico City während einer Demonstration gegen den Umgang der Regierung mit dem Mord an 43 Studenten; Belgrad, Busstation, Zwischenstopp syrischer Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Ungarn - mit einem Blick durch seine Augen führt uns Šteger direkt in das Herz des Phänomens. DER BLICK DES DICHTERS TRIFFT AUF NÜCHTERNE REALITÄT Als einer der bedeutendsten slowenischen Gegenwartsautoren macht sich Aleš Šteger seine Sprachbegabung zunutze, um hochbrisante Themen, Schauplätze und Schicksale unserer Zeit literarisch einzufangen: authentisch, unvermittelt und hautnah. Mit einem Vorwort von Péter Nádas und vielen Fotoaufnahmen des Autors an den Schauplätzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aleš Šteger
Logbuch der GegenwartTaumeln
Aus dem Slowenischenvon Matthias GöritzMit einem Vorwort vonPéter Nádas
Inhalt
Titel
Péter Nádas – Die Nachricht von der Katastrophe
Ljubljana – 21. Dezember 2012
Fukushima und Minamisōma – 16. Juni 2013
Mexico City – 26. November 2014
Belgrad – 2. August 2015
Aleš Šteger
Zum Autor
Impressum
Péter Nádas
Die Nachrichtvon der Katastrophe
Die erzählende Dichtung des Aleš Šteger
Alles, was kaputtgehen kann, geht auch kaputt. Zum Begreifen dieser Weisheit ist kein besonders scharfer Verstand nötig, es genügt die Erfahrung des Alltags. Wir arbeiten mit technischen Geräten, deren Funktionsweise wir nicht kennen, notwendigerweise werfen wir die kaputten weg und kaufen stattdessen bessere, andere. Dieses Prinzip definiert unsere Sicht der Welt. Das Prinzip der Allmacht des Kaufens. Die Auswirkungen und Defekte größerer Systeme verursachen dann einen richtigen Kurzschluss in unserem Denken. Kein Wunder. Ausgetrocknete Flussbette und plötzliche Überflutungen kann man nicht wegwerfen, man kann nicht einmal mit ihnen rechnen.
Auch wir, eine Frau und ein Mann, arbeiteten unter dem wolkenlos blauen Aprilhimmel, mit der Heugabel wendeten wir das gemähte Gras, damit gutes, trockenes Heu daraus entstand, das der Nachbar für seine Kuh holen würde. Doch wie sollte er es seiner Kuh geben, wenn nicht nur sämtliche Halme unseres Grases, sondern jeder einzelne Halm von jedermanns Gras, vom Baltischen Meer bis zu den Bergen des Balkans, radioaktiv verseucht war. Oder was sollten wir mit dem besonders früh und üppig gedeihenden Spinat anfangen. Sollten wir ihn ernten, blanchieren, kühlen, portionieren und in die Tiefkühltruhe geben, wie wir es in früheren Jahren getan hatten? Die Strahlung ist nicht wahrnehmbar. Oder sollten wir das Ganze abschneiden und es auf den sorgfältig gepflegten und deswegen reichlich mit Würmern durchsetzten Komposter werfen, der infolge der Explosion von Tschernobyl ebenso kontaminiert war, wie unser Gras und unser Haar.
Die Katastrophe unterscheidet sich dadurch von allen anderen Situationen des Lebens, dass sie sich persönlich an dich wendet, es gibt kein Schlupfloch, ihren klaren Fragen zu entkommen, es gibt keinen Aufschub, und nicht nur du weißt keine Antwort auf sie, niemand weiß eine. Und Gott ist, wie allgemein bekannt, schweigsam. Du kannst nicht sagen, es fällt zwar radioaktiver Regen, doch morgen wird er aufgehört haben. Du kannst nicht sagen, es brennt zwar die Sonne der globalen Erwärmung nieder und lässt vor deinen Augen die Flussbette austrocknen und das Getreide verdorren, doch dann oder dann wird es regnen. Unter dem Gewicht der Katastrophe bricht als Erstes das universale menschliche Prinzip der Hoffnung in sich zusammen. Es gibt nichts, weswegen, und nichts, worüber man sprechen könnte, wenn man keinen Unsinn reden will. Inmitten der Katastrophe kann der Verstand immerhin noch erfassen, dass das Wort bis dahin ausschließlich vom Prinzip Hoffnung genährt wurde und es nun kein Weiter gibt. Es ist zu spät. Man kann nicht jeden bis dahin von der Menschheit ausgesprochenen Satz nachträglich abändern oder korrigieren. Die Erkenntnis, dass wir auch das Prinzip Hoffnung missbraucht haben, kommt spät. Ich würde vielleicht sogar sagen, wir haben auch das biblische Gebot der Vermehrung missbraucht.
Das Dichterwort vermag zuweilen doch ein wenig mehr, es kann weiter gehen, und lässt sich selbst dann vernehmen, wenn andere nichts Vernünftiges zu sagen, ja nicht einmal Wasser, nicht einmal Luft zum Atmen haben. Aleš Šteger ist ein Meister der unmöglichen poetischen Äußerung. Seine Vorsicht, seine Behutsamkeit, seine Umsicht hat er höchstwahrscheinlich von den Göttern bekommen, die ihm zudem ein schönes Lächeln geschenkt haben. Ich möchte hinzufügen, dass er das alles nicht von den römischen, sondern von den byzantinischen Göttern bekommen hat.
Denn es ist in meinem als Zugabe erhaltenen Leben nach Tschernobyl kaum ein Vierteljahrhundert vergangen, als ich in einer Live-übertragung mitansehen musste, wie eine wunderschön gealterte japanische Gärtnerin auf den Knien rutschend aus ihren Spinatbeeten die größten Blätter einzeln herauszupft, damit die kleineren noch wachsen können. Sie arbeitet unerschütterlich, inmitten einer üppigen Spinatpflanzung. Gleichwohl werden ihre vom fachlichen Standpunkt perfekten Bewegungen nicht mehr vom Prinzip Hoffnung, sondern vom Mangel einer Alternative in Gang gehalten. Wider alle Vernunft gehorcht sie ihrer Disziplin. In ihrer unmittelbaren Umgebung ist der Behälter bei etwa 2800˚ Celsius durchgebrannt, es ist eingetreten, was eintreten konnte. Die vollständige Kernschmelze in drei Atomreaktoren. Es folgen die drei Explosionen. Regen fällt. Der Spinat muss geerntet werden. Sie hat einen Regenmantel gekauft.
Auch inmitten einer Katastrophe macht es keinen Sinn, die Katastrophe auszurufen. Šteger schlägt nur leise Töne an. Dabei weiß er, was die japanische Gärtnerin weiß und was wir alle wissen. Das urzeitliche Verhaltensprinzip des sinnvollen Schweigens hat, wie auch die lautstarke Prophezeiung, heutzutage zwar jeden Sinn verloren, beides funktioniert dennoch als Prinzip des Handelns.
Er handelt so, wie die uralte Japanerin an diesem regnerischen Märzmorgen unter dem schwerst kontaminierten Himmel von Fukushima. Er sieht, was sie sieht, er sieht, was wir sehen, und er gehorcht dem Gebot seiner Profession. Höchstens sagt er trotzig zu sich selbst, er werde in seinem abgeschlossenen Zimmer sicher keine Gedichte mehr schreiben. Ein Entschluss würdig eines bedeutenden Philosophen. Ein wenig erinnert er an Diogenes von Sinope, der auch rasend gewordener Sokrates genannt worden ist, weil er im Namen der Prinzipien der Natur gesellschaftliche Konventionen aufs Korn nahm. Ich bleibe nicht in meinem Zimmer und gehe los, um die Grenzen meines Geburtshauses abzuschreiten. Allerdings haben Grenzen im Himmel und auf Erden alle ihre früheren Funktionen verloren. Es gibt keine Gewalt, keinen Stacheldraht, keine Armee, die sie schützen würden. Von da an schreibe nicht mehr ich meine Gedichte, mein Weg schreibt sie. Mein Ich ist nicht mehr und nicht weniger als die Außenwelt. Ich soll ein verlorener Handschuh werden, weil es auf dem Weg verlorene Handschuhe erblickt. Auch seine Stilistik folgt schließlich dem Prinzip des Handschuhs, sie wird zwischen Erzählung und Gedicht oszillieren, er wandelt sie ineinander um, auf diese Weise reist er nicht nur im Raum, sondern öffnet sich einen eigenen Weg zwischen den beiden großen literarischen Gattungen. Auch in seinen Gedichten ist Aleš Šteger ein Erzähler, der auch dann Lyriker bleibt, wenn er Prosa schreibt, und nicht deshalb, weil diese Prosa rhythmisch ist. Mit der Umwandlung gewinnt er Klarheit über einen geheimnisvollen Unterschied. Es ist ein höchst bemerkenswerter Umstand, dass er es gerade zu der Zeit tut, als sein ungarischer Dichterkollege János Térey auf ganz ähnliche Weise die Gedichtsprache hinter sich lässt und sich auf eine Prosa verlegt, die durch und durch Lyrik bleibt. Natürlich haben beide ihre Vorgänger im zweiten und dritten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts, unter den polnischen, tschechischen und russischen Katastrophisten, die angesichts der neuerlich nahenden Katastrophe unzufrieden mit den westlichen Avantgarde- bewegungen, dem Futurismus, dem Dadaismus und dem Surrealismus sind und nicht allein auf dem Individuellen, sondern auch auf dem anthropologisch Gemeinsamen aufbauen.
Šteger ist auf dem grenzüberschreitenden Fußweg auch zu uns gekommen, schon allein deshalb, weil wir wirklich nicht weit von der Grenze seines Heimatlandes wohnen. Matthias Göritz, sein deutscher Übersetzer, schreibt über ihn: „Wer ihn lesen hört und mit ihm spricht, ist von seinem Charme eingenommen, einem unverwechselbaren Charme, der sich auch in seinen Gedichten findet.“ Nie habe ich ihn deutlicher in seiner leiblichen Wirklichkeit erlebt, als nach diesem Fußmarsch, wie er dastand und wartete, dass ich das Gartentor öffne. Sein urbaner Charme, wie ich ihn aus Paris, Berlin und Ljubljana von früher gut kannte, war verschwunden, hatte sich verflüchtigt. Vom langen Fußmarsch war er so stark und sonnengegerbt, wie seine Ahnen gewesen sein mochten, aller Wahrscheinlichkeit nach Hirten im Gebirge, an die er vielleicht selbst keine Erinnerung hat. Er brachte sie mit seiner leiblichen Wirklichkeit mit, dergestalt waren die Unbekannten mitmarschiert. In den Großstädten der Welt kommt man ohne Lächeln nicht aus, nun aber lächelte er kaum, sein Lächeln leuchtete eher aus der Tiefe seiner Aufmerksamkeit.
Oder er setzt sich auf einem bedeutenderen Platz seiner Stadt ins Schaufenster eines Kaufhauses, um inmitten der Katastrophe nicht mit seinem Gedicht allein zu sein, damit Individuum und Umgebung sich gegenseitig durchdringen, um Gemeinsamkeit zu schaffen. Dort werde ich schreiben, sagt er, im Schaufenster, was wahrlich dem Akt eines Diogenes gleichkommt. Wenn es nun mal keinen Unterschied zwischen innen und außen mehr gibt, keinen geben kann, wenn es keine Grenze gibt, wenn wir nun mal nach außen und nach innen gekehrt, ineinander umgewandelt werden können, wenn das Universelle und das Individuelle sich im Moment der Katastrophe berühren und aneinander festbrennen, dann soll ihre Gemeinsamkeit doch endlich auch im Gedicht keine zwei getrennten Phänomene bilden. Ein Gedicht soll sich von meiner Haut nicht unterscheiden. Oder er lässt diese nicht wahrnehmbaren Signale auch durch seine Haut hindurch und fährt geradewegs nach Fukushima. Und wenn er Kunde davon erhält, dass in der mexikanischen Provinz Guerrero Polizisten und maskierte Banditen gemeinsam einen Autobus mit Studenten angegriffen, sechs Studenten erschossen und dreiundvierzig an einen unbekannten Ort verschleppt haben, um sie dort umzubringen und die Leichen vermutlich auf einer Mülldeponie zu verbrennen, dann fährt er in das vom globalen Drogenhandel, von der Armut, der lokalen Korruption und dem weltumspannenden politischen Banditentum zugrunde gerichtete, bis zum heutigen Tag an den Folgen des Kolonialismus leidende Mexiko, um mit ihnen zusammen zu sein, mit den Lebenden, den Hilfebedürftigen, den ins Elend Gestürzten, um uns inmitten einer Massendemonstration etwas zuzurufen, persönlich, uns allen. Šteger ist kein Katastrophentourist, kein Lustreisender, mit Sicherheit kein Flaneur, kein Globetrotter, alles andere als das. Ich würde ihn eher einen einsamen, ein wenig verrückten Pilger nennen, der für Sünden büßt, die zu begehen er mit aller Kraft und unter allen Umständen zu vermeiden sucht. Und wenn sich aus dem in der Tat vollständig ausgeplünderten und sämtlicher Naturschätze beraubten, aufgeplatzten Afrika und dem in Bruderkriege gestürzten, genauer gesagt vom globalen Waffenhandel verheerten Asien ein Strom von Vertriebenen, eine Völkerwanderung in Bewegung setzt, dann fährt er ihr nach Belgrad entgegen, setzt sich am Busbahnhof auf eine Bank, kauft Milch und Bonbons für die Kinder, und unterhält sich mit ihnen, so gut es geht. Er gewinnt auch einen Freund, Ejmen, sie schreiben einander ihre Namen auf ein Stück Papier.
Am 4. April 2012 kam mir eine Idee, während ich in irgendeine luxuriöse Fensterauslage in Rom schaute und über das ungewöhnliche Überlappen der Bilder nachdachte, das durch die Spiegelung im Fenster entstand. Ich wurde zugleich von Gefühlen der Anziehung und der Ab-stoßung überwältigt. Die Idee an sich hatte nichts mit Exhibitionismus zu tun, sondern mit dem Wunsch, die eigenen Ängste zu überwinden. Es ging mir nicht darum, zu zeigen, was man kann (oder nicht kann). Im Gegenteil, es geht darum, mich und damit meine Sprache in eine Situation zu versetzen, die mir keine andere Möglichkeit lässt, als zu reagieren. Im Fall des Schriftstellers ist diese Reaktion das Schreiben, die Literatur. Sie ist das, was aus dem Geplanten ausbricht. Sie ist das, was unter keinen Umständen eine Chance hat, sich der Konstellation des Zufälligen zu entziehen: der Zeit ihrer Entstehung, dem Entstehungsort, der Interaktionen und der Ereignisse, die in die Textgenese hineinspielen. Was genau ist ein literarischer Text, wenn er nicht den Ort und die Zeit seiner Entstehung in sich trägt? Und was wäre Literatur, wenn sie in den Zustand äußersten Zwanges und direkter Gefahr versetzt würde, wo sie zu nichts als zu einer instinktiven Reaktion vereinfacht würde?
Die Regeln des „Spiels“, das ich mir da ausgedacht habe, sind einfach. Den Schreibort vorher auszusuchen. Einen öffentlichen Raum, wenn möglich. Einen Ort, der eine lebhafte, aber unberechenbare Geschichte erzählt. Den Termin für das Schreiben im Voraus festzulegen. Wenn möglich, ein Datum zu wählen, das mit einer bestimmten Menge an Gedenk-Gepäck beladen ist. Die Schreibzeit, in welcher der Text geschrieben werden soll (oder auch nicht), auf nicht mehr als zwölf Stunden zu beschränken. Den Text so schnell wie möglich zu veröffentlichen, vielleicht sogar noch am selben Tag. Keine Bücher oder Zeitungen, keine Notizen, die man im Voraus vorbereitet, mitzunehmen, keine grundlegenden Bezugspunkte, keine Interaktion mit der Welt des Internets. Nur ein äußerlicher Inkubationsreiz, um zu schreiben, ein frei Haus geliefertes und fragiles Sicherheitsnetz des Flüchtigen und des Ausgesetzt-Seins. Nur der Glaube an die Zeit, an das Hier und Jetzt. Und an die Worte. Die Worte …
Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, teile ich eine Zitrone in zwei Hälften, presse den Saft aus der einen Hälfte und trinke ihn.
Jeden Morgen, Morgen für Morgen, trinke ich den Saft einer halben Zitrone, mit etwas Wasser verdünnt.
Möge das ganze Saure mich bei guter Gesundheit halten. Zumindest möchte ich daran glauben, obwohl ich nicht sicher bin, ob es die große Menge an Zitronensaft ist, oder doch eher mein Glaube an die schützenden Eigenschaften der Zitrone, die der guten Gesundheit förderlich sind.
Morgen für Morgen, Tag für Tag, beginne ich damit, eine Zitrone auszusuchen, die ich dann teile.
Ist das Messer stumpf, foltere ich die Schale der Zitrone; sie schlägt zurück, auch wenn es nur mit Säure ist, unangenehme Säure, die uns schützt.
Manchmal spritzt die Zitrone und ich fluche leise.
Wie heute.
Das Treppenhaus ist plötzlich ohne jedes Licht, und ich taste mich blind durch die Dunkelheit, bis das Auge sich anpasst und die Schatten der Nacht zutraulicher werden.
Draußen ist die Luft frisch, so frisch, wie sie im Zentrum von Ljubljana nur sein kann. Über der Stadt hängen einige der am stärksten verschmutzten Kubikmeter Luft im ganzen Land. Den-noch bringt jeder Morgen etwas aus der Tiefe der Wälder mit, vielleicht ein paar Geister, die eine schlaflose Nacht verbracht, mit ihren Vorfahren und anderen unsichtbaren Kreaturen ein Gespräch geführt haben. Vielleicht sind sie selbst Vorfahren und Nachkommen; vielleicht haben sie sich mit den Baumwipfeln zusammengetan, die vom Heldenplatz der Nation aus ansteigen, den ich auf meinem Weg zum Kaufhaus Maxi überquere. Totemartige Wesen, die aufgewacht sind, um mich vor dem Tag zu warnen, der noch nicht angebrochen ist. Ein angebrochener Tag?
Der Schrei einer Krähe hallt aus den Baumkronen. Sie kreisen durch die Schatten der Nacht, treiben über das Dach des Parlaments, große Schwärme von Krähen in der Dunkelheit. Ich versuche, sie zu fotografieren, aber es ist zu dunkel, um die winzigen Geister mit der Kamera einzufangen, die sich aus einer anderen Dimension tief in diesen Freitagmorgen gebohrt haben.
Was wollen mir diese Kreaturen der Nacht sagen? Es ist nicht einfach nur ein höhnisches Krächzen, das herabfährt auf eine Person, die verstohlen und in gedankenverschnürtem Parka in die Schlinge läuft, die sie sich selber gelegt hat.
Meine Worte, warum habt ihr mich verlassen?
Nein, ich widerstehe, ich sollte so wenig wie möglich denken, so wenig Sprache, so wenig Worte wie möglich, bitte, lass sie erst dann kommen, wenn ich mich im Schaufenster eingerichtet habe.
Es gibt hier ganz offensichtlich zwei Dinge: eine vollständig ausgepresste Zitrone und den Vergleich, den ich in dieser Zitrusfrucht als eine Metapher für meine Gemeinschaft, meinen Stamm, mein Volk erkenne (diktiert bekomme?). Nicht nur das; wenn ich sie vergleiche, sie gleichsetze, uns gleichsetze mit dieser halben Zitrone, deren Saft ich in ein Glas presse und deren Schale schließlich am Rand des Glases reibe, um die Kerne herauszulösen, die dann regungslos am Boden liegen, versunken im trüben Wasser.
Aber wem gehört sie, diese pressende Hand? Und durch wessen Kehle läuft die Flüssigkeit?
Sind die Antworten wirklich so eindeutig wie diese hoffnungs-lose Weihnachtsmusik aus der Konserve, die mich umgibt?
Draußen bricht die Blaue Stunde an.
Ich sitze im Schaufenster eines Kaufhauses. Der Computer ist eingeschaltet. Ich sollte mich jetzt aufraffen und schreiben, morgenfrisch, voller Energie. Schreib so viel wie möglich über alles, was dir durch den Kopf geht. Alles zählt, sage ich mir, als ich beginne. Alles, und ich meine alles, hat eine Bedeutung, eine Rolle. Mit Worten kann man alles in Gold verwandeln. Doch nichts davon ist eine Hilfe. Als ob ich taub wäre und gebrechlich. Die Musik schlägt mir aufs Hirn. Unfähig zu komponieren, nicht einmal ein paar Sätze, nicht einmal ein einziges Wort am Schwanz zu packen.
Zum Beispiel: „Beginn“. Das Wort.
Es war Mittag, es war Rom, und es war ein Moment der Überlappung, ein Moment der Offenbarung, als mir die Idee für die heutige Aktion kam. Die sich überlappenden Bilder, zuerst die Opulenz eines Schaufensters, ein Paar Puppen in Kleidern, die jeweils mehr kosteten, als ein durchschnittlicher slowenischer Dichter verdient, sagen wir, in einem Jahrzehnt (obwohl sich das bald ändern wird, dem aktuellen Trend nach zu urteilen, bald werde ich sagen können: im Leben).
Vor dem Schaufenster hält ein Mann, beugt sich sanft herunter. Einen Augenblick lang flackert ein kleines Licht im Schutz seiner Hände auf. Nichts übertrifft die Schönheit des Aufleuchtens einer einsamen Zigarette im Dunkel. Es ist kurz vor der Dämmerung. Es ist der Punkt des Übergangs zwischen Tag und Nacht, zwischen Mund und Feuer.
Aber, wie ich schon sagte, es war Mittag, als ich das Überlappen meines Spiegelbildes bemerkte, die Reflexion der Passanten, Konstellationen von sich überlappenden Lichtspiegelungen, sich überlappenden römischen Geistern, ins Schaufenster gestellten Attrappen, zum Leben erweckt durch diese ungewöhnliche, unerklärliche Mischung aus Anziehung und Abstoßung.
„Guten Morgen“, höre ich von der Trennwand hinter mir. Nur einen Augenblick zuvor stand die Verkäuferin noch vor dem Service- Eingang, eine Zigarette rauchend, und jetzt ist sie zurück in ihrem Verkaufsraum.
Schreibt man schon fleißig?
Ich habe nie darüber nachgedacht, dass all diese Leute ja schon herumlaufen, eineinhalb Stunden bevor der Laden seine Türen öffnet, geschweige denn dass sie so früh auf Hochtouren arbeiten. Als ich am Wachmann vorbei und durch den Lieferanteneingang in die Lebensmittelabteilung des Supermarkts ging, stellte ich ein Maß an Arbeitsbegeisterung fest, das mir von tagsüber nicht bekannt ist. Verkäufer, schwere Tränensäcke unter den Augen, schneiden Pakete auf, zeichnen aus, verpacken, stapeln; Lieferanten auf Schlafentzug; milchgesichtige Wachen, die gerade erst die Kassen geleert haben; der gesamte Ameisenhaufen der Menschheit, energisch arbeitend, Stunden bevor der erste Verbraucher die Schwelle des ehrenwerten Geschäfts überschreitet.
Als ich meinen Weg ins Innere des Kaufhauses Maxi fortsetze, in die Abteilung mit Accessoires für Frauen, Handschuhe und Taschen verschwenderisch ausgelegt, wo ich hinter einem Schreibtisch im Schaufenster sitzen soll, werde ich von einem Gefühl ergriffen, das weder neu noch originell ist. Doch es steigt auf, zumindest in mir, wenn auch ein wenig unklar: In all diesen Geschäften und Banken, all den Versicherungen und Büros, all den Parlamenten und Anwaltskanzleien, verbringen Menschen aus Fleisch und Blut ihr Leben, ihre Schicksale, Tag für Tag. Welches Geschick teilen wir alle mit ihnen? Das Schicksal der Worte? Das Schicksal der Zitronen?
Draußen, auf dem Platz der Republik, gehen die Lichter aus. Ein nebliger Morgen, aus Monotonie gestrickt, grau. Es gibt keine Garantie, dass der Tag nicht vor Einbruch der Dunkelheit verschlungen wird.
Es war, wie schon ein paar Mal erwähnt, in Rom am 4. April 2012, als mich eine ungewöhnliche Konstellation von Bildern in einem Schaufenster auf die Idee brachte, mich selbst und meine Sprache in diese unmögliche Situation zu bringen. Gibt es einen schlimmeren Albtraum für den Schriftsteller, als in einem Raum von fragwürdiger Sicherheit zu schreiben, der dauernden Möglichkeit der Unterbrechung ausgesetzt, an einem Ort, wo Zeit und Raum diktieren, worüber du schreibst? Es geht ja nicht um bloßes Schildern, oder darum, dass ich etwas berichte (Journalisten und Reporter tun das weit anmutiger als die meisten Autoren). Es geht um wirkliche Literatur. Es geht um meine gleichzeitige Präsenz auf beiden Seiten des Fensters. Im Freien zu sein, unter den Menschen, die anhalten (oder auch nicht) beim Versuch mit mir zu sprechen, während ich im Schaufenster bin. Drinnen, mit einem stillen Musiker in mir, der meine Gedanken steuert; mit einem Flüsterer, einem Fiedler, einem Dämon, einer Muse, demjenigen, der meine geheimen Pläne enthüllt, der mich weit hinaus ins Abenteuer und in Obsessionen zieht, in den Wahnsinn, und mich definiert, und meine Freunde und alle anderen, die so nie sein werden, meine spirituellen Beziehungen bestimmt und meinen Zustand der Aufmerksamkeit (im Wachsein).
Es geht um eine doppelte Wachheit. Ein Wachsein in der Sprache. Und wach zu sein als Mensch, der ans Ende von etwas gelangt ist. Ans Ende der Geschichten, ans Ende der Zeit. Eine Idee, die durch Beobachtung und Abstand geboren wird, noch ist es ein bisschen schwierig, zugleich zu beobachten und eine Erfahrung erster Hand zu durchleben.
Ich werde noch nicht von den Blicken der Passanten gestört, denn es ist früh, und es sind nur wenige, und vielen fällt die Person, die sie sehen, die im Schaufenster sitzt und tippt, gar nicht auf.
Der größte Schrecken ist die Musik.
„Guten Morgen, na, geben wir schon Vollgas?“, fragt der Pförtner.
Ich habe das Datum mehrere Monate im Voraus bestimmt, denn ich wollte an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit so ausgesetzt sein.
Sich aussetzen. Was heißt das?
Das Bild ähnelt einem Piratenfilm, in dem gefesselte Gefangene von einer Hellebarde gezwungen werden, sich über den Rand des Schiffs zu bewegen, ans Ende der Planke, die über die Wellen hinausragt, wobei nur ein leichter Schubs reicht, damit sie in den Ozean stürzen und um ihr Leben schwimmen.
Genau so muss ich schreiben, gegen die unmögliche Musik, die direkt in meinem Rücken explodiert.
Münzen klimpern hinter mir. Der Kassierer zählt Wechselgeld, Metall gleitet über die Verkaufstheke, Münzen klappern, wenn sie in ihr jeweiliges Fach fallen.
Wehklagende E-Gitarren, I love you X-mas.