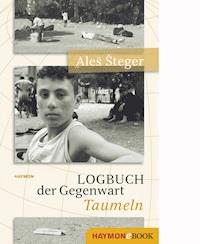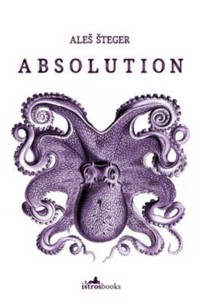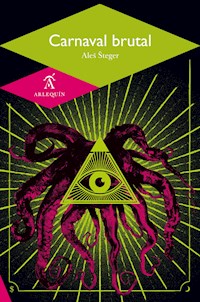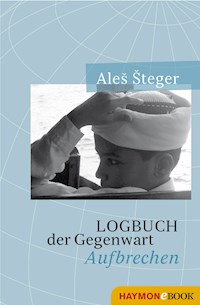Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Aleš Štegers Erzählungen hallen die antiken griechischen Mythen durch die modernen Schicksale. Prometheus ist bei Šteger ein Bergarbeiter, der einen verlassenen Tunnel aushebt und Fürchterliches zutage fördert. Auch von Narziss, Orpheus, Medusa, Ikarus erfahren wir sehr heutige Geschichten. Barisha aus Istanbul etwa entführt ihre minderjährige Tochter, um sie vor ihrem ehemaligen Partner zu retten, der sie schon als Braut verkauft hat. Sie soll einmal ein besseres Leben haben - es ist eine moderne Geschichte der Entführung Europas. Die alten Griechen wussten, dass das Schicksal des Menschen vorbestimmt und unausweichlich ist. Sind die Götter nur ein verkleinertes, fernes Abbild unserer Schwächen? Oder sind wir Menschen ein blasses Abbild von ihnen? Wenn die Götter uns verfolgen, uns in ihre Fallen locken, wenn sie uns etwas zuflüstern, uns mit allerlei Tricks verführen, wenn sie uns schließlich verlassen und wir allein zurückbleiben, traurig vielleicht, verzweifelt und um alles gebracht - welchen Ausdruck erkennen wir dann in ihren göttlichen Gesichtern? Denn wir Menschen, in den Momenten des größten menschlichen Glücks oder Unglücks, lesen ihre Mimik immer ganz deutlich: Liegt ein gnädiges göttliches Lächeln im Antlitz der Götter? Ist es ein nachsichtiges Lachen? Offener Spott über unser Unglück? Gar ein grausames Krächzen? Oder erkennen wir nur ein trauriges Schweigen als die grausamste und womöglich charakteristischste Form des göttlichen Lachens? Aleš Šteger erzählt eindringlich und mit großem erzählerischen Atem von Leidenschaften, von Sehnsüchten, Wünschen und Traumata.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aleš Šteger
Das Lachen der Götter
Erzählungen
Aus dem Slowenischen von Matthias Göritz
Inhalt
Europa
Prometheus
Narziss
Orpheus
Medusa
Ikarus
Europa
1.
Das Wetter ist umgeschlagen. Stürmischer Wind und heftiger Regen haben den gesamten Verkehr zum Erliegen gebracht, auch den Schiffsverkehr. Die Fähre wird die Insel erst verlassen, wenn sich die Lage stabilisiert hat, was einige Tage dauern kann. Glücklicherweise konnte ich meinen Rückflug zum zweiten Mal verschieben und meinen Aufenthalt in der Pension Gunnarson verlängern. Das Steinhaus des Gästehauses ist mehrere Jahrhunderte alt: ein Dachgeschosszimmer, starker Fäulnisgeruch, gelegentliche Stromausfälle, der knarrende Lackboden und die Zugluft unter den Fensterbänken. Das Gästehaus sah auf Booking.com viel besser aus. Ich starre stundenlang aus dem Fenster auf den Nebel und in den Regen, der gegen die Scheiben schlägt. Schon um drei Uhr nachmittags verschwinden die Konturen vom allem, und bald sind die einzigen Orientierungspunkte in der Dunkelheit die Geräusche des Sturms und das rote Bereitschaftslicht des abgeschalteten Fernsehers. Ich kann immer noch kaum die Ränder des Notizbuchs in meinem Schoß erkennen, das Stück Papier, das ich im Dunkeln immer wieder zu- und auffalte. Im nächsten Moment verschwindet beides. Es liegt alles in meiner Hand, und auch wieder nicht. Nur wenn ich die Augen schließe, kann ich noch eine Lichtspur sehen, die Illusion meiner Erinnerung. So liege ich eine Weile da, zugedeckt mit allen Decken, mit denen die Zimmer im Gunnarson-Gästehaus ausgestattet sind, und ich passe auf, dass ich die Wodkaflasche auf dem Nachttisch nicht aus Versehen im Dunkeln umstoße. Ich ertaste den Sockel der Tischlampe, die mich im nächsten Moment blendet. Ich blättere in meinem Tagebuch. Ich lese immer wieder über die Seiten, die ich vor vielen Jahren dahin gekritzelt habe, kopiere Sätze, kommentiere sie und füge immer wieder etwas hinzu. Ich spüre, wie bei dieser Aufgabe die Macht der Erinnerung in mir erwacht, dann wieder bin ich mir unsicher, ob ich das alles nicht erfinde, Ereignisse verdrehe, die acht Jahre zurück und weit weg liegen wie die Schatten fremder Gegenstände mitten in der Nacht. Ab und zu nehme ich einen Schluck aus der Flasche, um mich zu wärmen. Dann starre ich wieder aus dem Fenster und betrachte mein eigenes Spiegelbild in der dunklen Glasscheibe. Wie gut, dass ich mein altes Tagebuch mitgenommen habe! Was wäre jetzt ohne diese Seiten? Wahnvorstellungen? Schreiben beruhigt mich, gibt mir das Gefühl, dass es eine Welt gibt, dass es Wahrheit und Erkenntnis gibt. Wenn ich schreibe, kläre ich, was mit uns geschehen ist, aber noch mehr erkläre ich mir selbst meine Gefühle und versuche, die inneren Anschuldigungen und Einwände der Vernunft, die an mir nagen, zu kontrollieren. Ich weiß nicht, ob ich Fortschritte mache, ob es mir mit der Zeit gelingen wird, die Teile des zerbrochenen Erinnerungsmosaiks zusammenzusetzen, aber ich weiß, dass ich nicht aufhören darf, dass ich alles aufschreiben muss, was ich fühle und denke, für mich, für meine Seele. Als hätte ich diesen Moment vorausgesehen, hatte ich das Tagebuch automatisch eingepackt. Ich ging davon aus, dass Barisha und ich uns nach so vielen Jahren wiedersehen würden, und dass die alten Notizen mir helfen würden, mich an die Namen unserer gemeinsamen Istanbuler Bekannten und unsere Gespräche zu erinnern. Ohne diese Seiten wäre ich meinen eigenen inneren Gedächtnisanpassungen völlig ausgeliefert gewesen. Ich führe nur gelegentlich Tagebuch und lese praktisch nie, was ich geschrieben habe. Warum schreibe ich es dann? Weil ich meinem Gedächtnis nie ganz getraut habe und Wege finden musste, mich zu schützen. In der akademischen Welt kommt das Eingeständnis der eigenen Vergesslichkeit einem Selbstmord gleich. Die Tatsache, dass ich mich schon lange nicht mehr gegen das Vergessen wehre, würde vielen Menschen ketzerisch vorkommen. Ich verstehe es als einen natürlichen neurologischen Prozess. Ich bin mir sicher, dass das Vergessen eine Funktion hat, sonst würde es nicht existieren. Das Vergessen ist nicht schlimm. Das Vergessen schützt, es ermöglicht etwas Drittes, davon bin ich fest überzeugt. Ich führe und behalte die Tagebücher lediglich als letzten Ausweg. Und ich habe sie fast nie bei mir. Aber dieses Mal schon … Ich bin verwirrt, alles hängt mit mir zusammen und ich kann das Gefühl der Fatalität nicht abschütteln. Ich bin nicht bloß passiver Zeuge, auch wenn es so aussehen mag, auch wenn ich alles getan habe, was in meiner Macht stand, um nie mehr als eben ein passiver Zeuge zu sein.
2.
Ist es zu naiv, zu fatalistisch, zu sagen, dass alles vorherbestimmt, ja unvermeidlich war? Ihr Anruf in meinem Hotel in Stockholm. Barisha klang apokalyptisch, aber sie klang immer apokalyptisch. Ob ich nicht unverzüglich nach Vaxholm kommen könnte? Natürlich konnte ich nicht, der Kongress war im Gang, ich für drei Panels angemeldet. Und selbst wenn ich es nicht gewesen wäre, gehörte es sich, bis zum Ende dabei zu bleiben, und ich hatte keine Lust, sie wiederzusehen. Monatelang hatte ich mir immer wieder am Telefon angehört, dass sie mit allem Schluss machen würde, zu lange, als dass ich ihre Geschichten noch ernst nehmen könnte. Doch als der Kongress zu Ende war, rissen ihre SMS nicht ab. Und dann war da noch Alis E-Mail. Schweren Herzens verschob ich meinen Rückflug und erfuhr erst dann zu meiner Überraschung, dass Vaxholm kein Vorort von Stockholm ist, sondern ein Ort auf einer der vielen Inseln im Archipel vor der schwedischen Hauptstadt. Also kaufte ich ein Fährticket, rechnete die Verbindungen aus und glaubte, dass ich am nächsten Morgen früh von meinem Treffen mit Barisha zurück sein würde. In Vaxholm erwartete mich dann ein Schock. Die Polizei war in Barishas Wohnung, es folgte ein mehrstündiges Warten auf dem Revier, ein Polizeiprotokoll und die Identifizierung der Leiche am nächsten Morgen in Vaxholms Vårdcentral, dem städtischen Krankenhaus. Inzwischen hatte sich das Wetter geändert. Barisha wäre mit ziemlicher Sicherheit noch am Leben, wenn ich sofort nach ihrem ersten Anruf gekommen wäre. Dieser Gedanke wird mich nie verlassen. Auch wenn es im vergangenen Jahr unzählige ähnliche Anrufe gegeben hat. Ich habe mich einfach an ihre Verzweiflung gewöhnt. Sie sprach unaufhörlich über ihr ruiniertes Leben und das des Mädchens. Von inneren Zweifeln und der Kraft der Selbsttäuschung. Die ganze Zeit über konnte ich nicht wissen, dass es niemandem gelungen wäre, Barisha in diesen schwierigen Zeiten beistehen zu können. Ich war mir sicher, dass es andere Bekannte, Kollegen, vielleicht einen Liebhaber gab. Ich hatte nie gefragt. Ich habe es nie zugelassen, dass wir uns zu nahe gekommen wären. Distanz schützt, ebenso wie das Vergessen. Dessen bin ich mir sicher. Zugleich war ich durch unsere kurze Affäre vor zwei Jahren an sie gebunden. Ich war nicht in der Lage, den Kontakt vollständig abzubrechen, obwohl ich es im Stillen wollte. Es war ein albernes Abenteuer, eine durchsoffene Nacht nach dem Kongress des Europäischen Verbands der Literaturübersetzer in Brüssel. Wir hatten uns betrunken, dann schleppte sie mich in ihr Hotelzimmer ab. Als wir fertig waren, lag plötzlich ein ganz anderer Mensch neben mir. Es war, als ob der Sex eine versteckte Psychose oder eine bestimmte Angst in ihr hervorgerufen hätte. Sie hörte nicht auf zu weinen. Ihr kleines Mädchen war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Auf den Bildern ihres Handys sah sie schon ziemlich erwachsen aus. Ich hörte mir bis zum Morgengrauen Geschichten über die beiden an, tröstete sie und versuchte, sie zu ermutigen, aber im Grunde konnte ich sie nicht erreichen. Erst an diesem schlaflosen verkaterten Morgen spürte ich, wie instabil und unberechenbar Barisha war und wie unsagbar weit wir voneinander entfernt waren. Und dann gestand ich mir ein, was ich schon bei unserer ersten Begegnung in Istanbul vermutet hatte: dass ich ihre Welt einfach nicht verstand, geschweige denn ihre Gefühle. Dass ich sie nie wirklich verstehen würde. All dies wurde nun bestätigt und erscheint mir jetzt ganz logisch und offensichtlich. Damals aber … In Brüssel hatte ich das Ganze zu technisch betrachtet, als eine Art von Krisenmanagement. Es gab ein Problem, und ich versuchte, es zu lösen. Nach ihrer Flucht aus der Türkei geriet Barisha in die frustrierenden Mühlen der Asylbürokratie. Das brachte sie schließlich an den Rand ihrer Kräfte. Aber nicht die Bürokratie war das Problem, sondern ihre Einsamkeit, das habe ich damals wohl nicht gesehen, oder besser gesagt, ich war nicht bereit, es zu sehen. Statt der menschlichen Nähe, nach der sie sich so sehr sehnte, vermittelte ich ihr einen Anwalt, der ihr und dem kleinen Mädchen in nur wenigen Monaten zunächst Asyl in Schweden und später eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis verschaffte. Ich betrachtete ihre Probleme so nüchtern wie möglich, analysierte die Möglichkeiten, wählte die günstigste aus und legte die Schritte, Optionen, Risiken und möglichen Ergebnisse fest – rein technisch eben. Ich war zufrieden, ja sogar stolz auf all das, was ich für sie erreicht hatte. Barisha hingegen kümmerte sich wenig darum, obwohl die Verhandlung bezüglich des rechtlichen Status für ihr zukünftiges Leben und das ihres kleinen Mädchens entscheidend war. Anstatt über die juristischen Verfahren und die neuen Hoffnungen zu sprechen, erzählte sie am Telefon immer mehr davon, was die Ablehnung, die Hindernisse und das Leid aus ihr und dem Mädchen gemacht hatten, wie sie irreparabel verkrüppelte und zerstört wurde. Ich habe ihre Ausbrüche von Fatalismus willentlich überhört. Gleichzeitig hatte ich den größten Respekt vor Barisha. Ich bewunderte, was sie bereit war, für das Kind eines Fremden zu opfern. Selbst wenn … Die Wahrheit ist, dass ich selbst nie bereit gewesen war, mich zu tief auf irgendeine Form von Beziehung einzulassen, nicht einmal auf eine wirklich freundschaftliche. Und erst jetzt, während ich dies schreibe, spüre ich die Last der Schuld, die deshalb auf mir lastet, und ich spüre, dass mein völliger Unwille, sich ihren Problemen wirklich zu stellen, auch bei mir Spuren hinterlassen hat. Jede Bekanntschaft, und sei sie noch so oberflächlich, hinterlässt Spuren, ob wir es zugeben oder nicht. Jede Ankunft ist auch eine Flucht von irgendwo fort, und es ist unmöglich, sich vor den Mühlen des Lebens völlig abzuschotten. Vor acht Jahren, als ich meine erste und wahrscheinlich letzte Reise nach Istanbul unternahm, hätte ich nie an so etwas gedacht.
3.
Ich lese immer wieder die Beschreibung des ersten Morgens in Istanbul in meinem Tagebuch. Das historische Viertel Sultanahmet. An der schwer lesbaren Handschrift und den umständlichen Sätzen erkenne ich die Folgen der vorangegangenen Nacht. Wie vereinbart, hatte mich Ali am Flughafen abgeholt. Mit dem Taxi fuhren wir mehr als anderthalb Stunden im dichten Verkehr nach Istanbul hinein. Inzwischen war die Nacht angebrochen. Ich war müde und wollte im Hotel bleiben, aber Ali bestand darauf, dass wir Abendessen gehen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten oder an die Richtung, in die wir fuhren, nur eine winzige Skizze am Rande meines Tagebuchs erinnert mich lebhaft an den gebratenen Rinderkopf, der auf einem großen Silbertablett serviert wurde, an Alis Lachen, an das Klirren der Raki-Gläser, das mir sofort den Boden unter den Füßen wegzog, an die scharfe Kälte des Abends und an den herrlichen Anblick des dichten Nachtschiffverkehrs auf dem Bosporus. Wir kannten uns nicht gut. Tatsächlich hatten wir uns erst ein einziges Mal vorher gesehen, aber Ali erkannte sofort mit boshaftem Witz unsere gemeinsame Vorliebe für alles, was die Ränder einer Kultur sichtbar macht. So begann ein Saufgelage, bei dem mir die außergewöhnlich schmackhafte gekochte Stierzunge und der ganze Rinderkopfbraten als erschreckende kulinarische Höhepunkte in Erinnerung geblieben sind. Dann verblasst meine Erinnerung, bis ein ganz klares Detail wieder auftaucht, ein einsamer, straßenbeleuchteter Ort, an dem einst ein Triumphbogen stand, von dem aus in Byzanz die Entfernungen gemessen wurden; der Nabel des türkischen Reiches, eine Informationstafel für Touristen davor, hinter der ich mich in der Nacht übergeben hatte. Der nächste Morgen begann mit starken Kopfschmerzen, die mich an das europäische Hochschulkooperationsprojekt erinnerten, für das ich nach Istanbul gekommen war. Professor Ali, der sechs Monate zuvor bei uns in Heidelberg Vorträge gehalten hatte und diesmal meinen Besuch hierher organisierte, hatte mir im Voraus einen Ablaufplan geschickt, der eine Vorlesung in der Universität, einen kurzen Übersetzungsworkshop mit Studenten, einen öffentlichen Auftritt, ein bescheidenes und in der Regel förmliches und langweiliges spätes Mittagessen oder frühes Abendessen vorsah. Vor Ort jedoch begann alles bereits am Abend meiner Ankunft auf eine Art und Weise durcheinanderzugeraten, dass ich mich am folgenden Tag völlig hilflos und beschämt fühlte. Beim Durchlesen meiner damaligen Notizen schäme ich mich erneut, was durch einige Sätze voller naiver touristischer Begeisterung noch verstärkt wird, die Begeisterung für Sultanahmet, für die kleinen Straßenläden, die mit glitzernden blauen Nazars und Keramiken vollgestopft waren, eine unreflektierte Begeisterung für die Kelimläden, die rund um das Hotel ihre Türen geöffnet hatten, während ich am Morgen nach meiner Ankunft versuchte, meinen Kater zu vertreiben und meine Gedanken bei einem Morgenspaziergang zu ordnen. Aus der Ferne betrachtet war auch mein Tagebuchgemecker über die Qualität des Hotels, in dem ich untergebracht wurde, ziemlich hohl. Die Kritik war zwar berechtigt. Der Frühstücksraum befand sich im fünften Stock, der Aufzug brachte einen nur bis zum vierten Stock, und dann musste man sich einen Weg durch ein Labyrinth enger, stinkender Gänge bahnen, immer wieder an einer der offenen Türen eines der düsteren Zimmer vorbei, die vor Müll, Essensresten und schmutziger Bettwäsche auf dem Boden überquollen, eine weitere Treppe hinauf über den Gang, der violett ausgemalt war und an dessen Wänden schmutzige Lilien abgebildet waren. Ich weiß noch, wie ich mir den Kopf mit aller Kraft am Türsturz anschlug und fluchte. Ich nehme an, dass ich noch an den Höhepunkt der letzten Nacht dachte, von dem mir noch tagelang danach übel wurde, als Ali und ich pickten und aßen, oder besser gesagt, als jeder von uns ein Auge aus dem riesigen Haufen Knochen und dem geröstetem Gewebe vor uns herausnahm und es herunterschlürfte und die ekelhaft klebrige Spur im Mund und in der Kehle mit einem neuen Glas Raki herunterspülte. Im Frühstücksraum des Hotels saß neben mir nur ein weiteres türkisches Paar. Der Mann maß mich immer wieder streng. Die Frau neben ihm trug einen langen schwarzen Mantel und hatte den Kopf bedeckt. Warum schreibe ich all diese Details überhaupt auf? Denn ich erinnere mich wieder an die Zerstreutheit meiner Gedanken an jenem Morgen, an meine wahrscheinlich übertriebene Angst, dass ich bei meinem ersten Besuch eines muslimischen Landes einen mir fremden kulturellen Kodex brechen, die Frau oder ihren Mann auch nur durch meine Blicke beleidigen würde? Warum diese Unsicherheit?
4.
Ich wache schweißgebadet auf. Es dauert lange, bis ich merke, wo ich bin. Draußen tobt immer noch der Sturm. Der Raum ist kalt. Es ist halb drei Uhr, nachts. Der Traum war schrecklich. Die Straßenbahn Nr. 1, Barisha und ich darin. Wir fahren durch eine Wüste, und plötzlich biegt der Fahrer von der Strecke ab und wir fahren über die Dünen. Niemand sagt etwas. Vor uns öffnet sich ein tiefer Abgrund. Ich rufe Barisha, die nicht antwortet. Aber siehst du denn nicht, der Fahrer wird uns alle umbringen, rufe ich, Leute, wacht auf. Dann merke ich, dass ich immer unsichtbarer werde. Ich kann mich selbst gerade noch sehen, aber keiner der Fahrgäste scheint dies zu können. Sie starren ruhig aus den Fenstern der Straßenbahn. Irgendwie merke ich dann im Schlaf, dass ich träume, und ich versuche, den Traum zurückzubringen, um ihn zu korrigieren. Ich schaffe es, an die Stelle zurückzukehren, an der die Straßenbahn von den Gleisen abbiegt und in Richtung Abgrund fährt. Ich versuche, meine Hände aus den metallenen Griffen zu befreien, ich schaffe es sogar, einen der Griffe abzureißen, und schreie dabei, aber es hilft nicht, oder zumindest verschlimmert es den Traum, denn ich kehre immer wieder in dieselbe unlösbare Agonie des Verschwindens bei vollem Bewusstsein zurück. Anstatt nur einmal in den Abgrund zu stürzen, hält uns mein Widerstand gegen den Fluss des Traums in einem Teufelskreis gefangen. Unser Tod wiederholt sich, und jede Wiederholung erschöpft mich mehr. Jetzt, wo ich dies schreibe, habe ich große Angst, wieder einzuschlafen. So oft bin ich in dieser Nacht gestorben, so oft war ich völlig hilflos, habe geschrien und den Horror noch einmal durchlebt, während die anderen Passagiere sanft lächeln, bereit, das Unvermeidliche zu akzeptieren und alles hinter sich zu lassen. Für sie, die in meinem Traum waren, war das alles nur ein weiterer Albtraum, den man so schnell wie möglich vergessen sollte, und die Arbeit wäre erledigt.
5.
Zum dritten Mal bietet mir der Rezeptionist seinen Ledersessel vor der Eingangstür des Hotels an, dann setzt er sich gelangweilt wieder hin. Neben ihm stehen vier Männer und trinken Tee, streuen ein paar türkische Sätze in den Novembertag ein und nippen wieder nachdenklich. Als wir monatelang miteinander korrespondierten und die notwendigen Vorbereitungen für meinen Besuch trafen, war ich überzeugt, dass Barisha der Name eines Mannes war. Dementsprechend überrascht bin ich, als eine zerbrechliche Frau auftaucht, mit blassen Wangen, blauen Flecken und einer ungewöhnlichen Schirmmütze, unter der sich rote Locken abzeichnen. Sie kommt fast 50 Minuten zu spät. Keine Entschuldigung, kein Zeichen des Bedauerns, nur ein »Ach, da bist du ja, komm schon, lass uns gehen, dass wir nicht zu spät kommen«. Alis Assistentin und zugleich Sekretärin des Verbands der Literaturübersetzer, winzige Schritte, das Echo von Absätzen auf altem Kopfsteinpflaster. Wir gehen schweigend am Großen Basar vorbei. Ich bleibe stehen und betrachte die weißen Steinsäulen durch den rostigen Metallzaun. Barisha winkt mir zu. Ich folge ihr. Aus der Nähe kann ich die schönen Ornamente an den Steinsäulen erkennen. »Sind das Suren aus dem Koran?«, frage ich und zeige auf die kalligrafischen Inschriften auf den Grabsteinen. »Nein«, nickt Barisha, »alles, was du hier siehst, sind Lobgesänge. Früher verdienten viele Dichter ihren Lebensunterhalt damit, dass sie Gedichte für verschiedene Zeremonien und für Grabsteine schrieben. Die großen Paschas und ihre Söhne sind hier begraben.« Ich beobachte noch eine Weile das geheimnisvolle Zusammenspiel der Ornamente, die Schrift, die gleichzeitig eine Abfolge von fein gesetzten Knoten ist. Wenn ich diese Knoten zuziehen könnte, würde der ornamentale Sinn unergründlich werden, ähnlich der Stille, in der wir weiterschreiten, weil ich mich nicht traue, weitere Fragen zu stellen, um nicht völlig unwissend zu erscheinen. Bald sind wir an der Universität. Der Geruch der Kantine, die kahlen Wände und viele junge Leute, die neugierigen Blicke, die Jungen, die aufeinander lehnen, sich gegenseitig an den Händen halten, dann ganze Trauben grau-grüner Kopftücher der Studentinnen. Alis Klasse, fast nur Jungen, einige solide Fragen über deutsche Romantik und Goethes Gefühlswelt des Sturm und Drang. Sie wollen etwas über Werther erfahren und darüber, wie Goethes West-Östlicher Diwan unsere Wahrnehmung der muslimischen Welt geprägt hat. Es folgt ein Übersetzungsworkshop, an dem auch Ali teilnimmt, der den ganzen Morgen zuvor Vorträge gehalten hat. Wir übersetzen »Wanderers Nachtlied«. Wir essen jeder ein Stück Spinatbörek in der Kantine, dann gehen Ali und ich spazieren. Wir halten vor einem aufwendig verzierten Steinportal, wo wir uns vor einer Polizeistreife ausweisen müssen. Ali zuckt mit den Schultern: »Das ist Routine, keine Sorge«, sagt er in seinem perfekten Oxbridge-Englisch. »Früher war dies ein Lyzeum, aber seit langem befindet sich hinter diesem kunstvollen Portal eine Polizeistation. Ich war hier einmal zehn Tage lang inhaftiert. Später habe ich diese Erfahrung in meinen Romanen beschrieben, und ich muss sagen, dass sie nützlich war, wenn auch ziemlich hart«, sagt Ali, steckt seinen Ausweis zurück in die Brieftasche und schaut den beiden Polizisten nach. »Warst du in Einzelhaft oder in einer Zelle mit den anderen?« Ali starrt schweigend auf die Wand des Polizeireviers, als ob er auf etwas starrt, das nicht hier, vor uns, ist, etwas, das nur für ihn sichtbar ist. »Mit anderen«, antwortet er langsam. »Ich war jung und dachte, dass solche Dinge nur mir und meinesgleichen passieren können. Dann ging ich für zehn Jahre nach England. Als sich der politische Wind drehte, kam ich zurück. Man hat keinen festen Platz in dieser Welt«, fügt er leise hinzu. »Das sind alles Erfahrungen und alles bereichert einen«, lächelt er und beschleunigt sein Tempo. Im smoggesättigten Spätnachmittagslicht sieht Ali wie ein Gespenst in einem langen grauen Regenmantel aus. Seine Gestalt verblasst, nur seine Wange wird gelegentlich vom Schein einer Zigarette erhellt. Praktisch jeder Mann, dem wir begegnen, könnte Ali sein. Als ich hinter ihm den Sultanahmed überquere, habe ich das Gefühl, dass ich hinter allen und niemandem laufe. Während ich dieses Ereignis acht Jahre später niederschreibe, wird auch alles andere für einen Moment erhellt, was auf diesen Spaziergang mit Ali in der Altstadt von Istanbul folgte, einen Spaziergang, von dem ich nicht einmal mehr sagen kann, ob er im europäischen oder im asiatischen Teil der Stadt stattfand. In diesem nächtlichen Wiedererleben der Vergangenheit wird jedes noch so kleine Detail zum Schlüssel für das Verständnis der ganzen Geschichte. Wenn diese schreckliche, stürmische Nacht endlich vorbei sein wird, wenn ich endlich die Pension Gunnarson in Vaxholm, Schweden, verlassen werde können, werden mir die Sätze im Tagebuch und noch mehr die Sätze, die ich gerade abschreibe, die Echos von Echos, die Schatten von Schatten, die wiederbelebten Gespenster eines unzuverlässigen Versuchs, die Zeit festzuhalten, wahrscheinlich überflüssig, überdreht, wenn nicht sogar völlig wahnhaft erscheinen. Tote Sätze, die von der Hand eines psychisch überforderten Schlaflosen auf Papier gekritzelt wurden, das Wiedererwecken von Erinnerungen als Selbsttherapie für Hilflose. Aber in dieser Nacht leuchten die Worte für mich wie nie zuvor. Die schmerzhaft wiedererweckten Erinnerungen erhellen im Nachhinein, was für mich im Moment des Niederschreibens völlig unsichtbar war. Es ist, als hätten die Worte beiläufig, fast unbeabsichtigt, durch ihre eigene innere magnetische Logik, die Vorahnung einer Tragödie an sich geklebt, die sich vor acht Jahren bestenfalls heimlich angedeutet hatte, eine leichte Brise, die langsam am Himmel keimte.
6.
Wenn ich mir den Pavillon der Istanbuler Bibliothek hinter den Mauern des Gülhane-Parks in Erinnerung rufe, die Büste des Dichters Ahmet Hamdi Tanpınar, neben der Ali und ich ein Foto gemacht haben und nach dem die Bibliothek benannt ist, fühle ich mich unwohl, weil ich so wenig über türkische Poesie, Kultur und Geschichte weiß – dieses Gefühl der Hilflosigkeit beim Erleben einer fremden Kultur, das mir in meinen Tagebucheinträgen immer wieder begegnet. Über die Türken, die ich aus Heidelberg kenne, kann ich nur sagen, dass sie fleißig, aber speziell, oft schwierig und in meinen Augen meist völlig irrational sind mit ihren Mercedes, verschleierten Frauen, Dönerläden und ihrem übersteigerten Ehrgefühl. In Deutschland sind sie eine Minderheit, doch hier, in Istanbul, bin die kleinstmögliche Minderheit ich, allein, umgeben von ihnen. Das verändert alles und löst Mechanismen der Angst und Demut aus, die ich nicht gewohnt bin. Barisha trifft Ali und mich in der Bibliothek. Sie ist sehr nervös, weil praktisch niemand zu der Veranstaltung gekommen ist, nicht einmal Alis Studenten. In dem Pavillon sind etwa hundertfünfzig Stühle leer. Einer davon ist von dem Mann besetzt, der heute Abend unser Simultanübersetzer ist. Der Vorsitzende des Literaturübersetzerverbandes, ein älterer Herr, der, wie sich herausstellt, in Heidelberg Chemie studiert hat, trifft ebenfalls ein, vor allem wohl um mit mir sein Deutsch aufzufrischen. Er spricht kein Englisch, aber neben Deutsch spricht er Französisch und Arabisch. Nach einiger Zeit kommt ein Mann mit einem kleinen Mädchen herein. Barisha geht auf ihn zu, sie unterhalten sich leise, während das Mädchen die Holztreppe hinaufsteigt, über die Stühle springt, sich an den Mann hängt, der die ganze Zeit leicht lächelt. Dann sitzen der Mann und das Mädchen in der letzten Reihe, weit weg von uns, die auf die Bühne gehen. Wir beginnen. Während Ali eine lange Einführungsrede hält, beugt sich Barisha, die zu meiner Rechten sitzt, vor und flüstert mir mit Blick auf das Mädchen zu: »Ihre Mutter war eine sehr berühmte Dichterin. Für das kleine Mädchen ist es das erste Mal, dass sie einer Gedichtlesung zuhört, verstehst du?« Ich weiß noch, wie diese Worte von Barisha auf mir lasteten, so dass ich mich danach nicht mehr traute, den Mann und das Mädchen genau zu betrachten, sondern sie nur noch verstohlen ansah. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich nicht mehr an das Gesicht des Mannes erinnern kann. Ich erinnere mich nur an seine stämmige Figur, seinen Wollrolli, aber nicht an sein Gesicht. In meinen Notizen finde ich die Frage: »War das der Vater des Mädchens?« Daneben habe ich einen Satz notiert, den Ali einige Stunden vor der Veranstaltung in der Bibliothek gesagt hatte, als er beiläufig erwähnte, dass seine Geliebte, lover, ebenfalls zu der Veranstaltung kommen würde. Oder meinte er einen männlichen Liebhaber?
7.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, worüber wir an jenem späten Novembernachmittag im fast leeren Bibliothekssaal sprachen. Ich erinnere mich an die hektischen Notizen des Übersetzers, der immer wieder Zusammenfassungen des Gesagten ins Englische übersetzen musste, um die Vorgaben der Geldgeber zu erfüllen, an Alis feierliche Stimme, als er feierlich türkische Übersetzungen romantischer Gedichte vorlas, und an meine eigene Lesung der deutschen Originale. In diesem Moment braut sich draußen wieder der Sturm zusammen. Es ist 4:15 Uhr nachts, ich fühle mich völlig leer, mein Kopf ohne jeden Gedanken, stumpf und todmüde. Ich höre das Aufprallen des Meeres am nahen Ufer, das Aufschlagen der Regentropfen auf die Fensterscheiben, die die Kälte des leeren Bibliothekspavillons in meine Erinnerung zurückrufen, Alis endloses Gerede und das kleine Mädchen, das in den Armen des Mannes eingeschlafen ist, ihre kleinen Arme, die nur mit einer dünnen rosa Bluse bekleidet sind, umklammern die kräftige Gestalt des Mannes im Schlaf. Jetzt glaube ich ihn für einen Moment zu sehen, wie er in seiner schwarzen Lederjacke sitzt, regungslos, aufrecht wie eine Kerze, mit einem ausdruckslosen Lächeln, das auch dann nicht von seiner Wange weicht, als wir nach fast zwei Stunden endlich fertig sind und das Echo des Klatschens von ein paar Händen in dem riesigen Raum ertönt.
8.
Vielleicht war das alles nur Barishas Einbildung. Aber wenn das wahr ist – warum? Ich kann mir unsere stundenlangen Telefongespräche anders nicht erklären, zuerst nach ihrer Flucht aus der Türkei und besonders intensiv später, nach dem Verschwinden des Mädchens. Die Gespräche im letzten Jahr waren eine unerbittliche Tirade von Selbstvorwürfen, häufige Ausbrüche von hysterischem Weinen, die manchmal in klare, selbstironische Kommentare übergingen. Barisha war eine Meisterin des Letzteren und verstand es immer wieder, sich selbst als tragische Versagerin darzustellen. Ich interpretierte ihren Humor als den gesunden Kern ihrer Persönlichkeit und als den Schutz, der sie vor der Verwirklichung einer ihrer hundert Drohungen, sich etwas anzutun, bewahrte. Im Allgemeinen verstand ich Barishas Selbstmorddrohungen als ein Erbe übertriebener osmanischer Rhetorik und nicht als ernsthafte Absicht. Ich nahm an, dass Barisha wirklich nur Zeit, Zeit und Arbeit brauchte, um sich von dem vermissten Mädchen abzulenken. Ich betrachtete ihren Zynismus als Heilmittel und sah in ihr eine verwandte Seele. Wie falsch ich doch lag! Natürlich ahnte ich, dass das Einzige, was ihr in ihrer Not wirklich helfen konnte, die Anwesenheit von jemandem war, der sich ihrer annahm, und nicht die vermeintlich raffinierten, vermeintlich vernünftigen, vermeintlich allwissenden Worte, die Tausende von Kilometern entfernt in einen Telefonhörer gesprochen wurden. So wie sie sich für das kleine Mädchen geopfert hat, sollte sich nun jemand für sie opfern. Solange der Kreis der Liebe zwischen Menschen, die sich füreinander aufopfern, geschlossen ist, stirbt niemand. Aber wenn der Kreis zerbricht und jemand, der sich aufgeopfert hat, allein zurückbleibt, dann … Ich habe mich nie in Barisha verliebt, geschweige denn sie wirklich geliebt. Es ist in der Tat die Frage, ob ich jemals einen Menschen kennengelernt habe, für den ich bereit wäre, meinen Job in Heidelberg aufzugeben oder zumindest meine Verpflichtungen für eine Weile einzustellen und mich ganz der Lösung der Probleme anderer zu widmen. Ich hatte auch Angst, dass Barisha sich zu sehr an mich hängen könnte, was im Nachhinein betrachtet eine ziemlich narzisstische Idee war. Vielleicht schreibe ich diese Zeilen, um das Gefühl der Verantwortung mit Worten wegzuspülen, um die Schuldgefühle zu vertreiben, die mich seit vorgestern belasten, als ich bei meiner Ankunft auf der Insel erfuhr, dass Barishas Leiche in den frühen Morgenstunden nicht weit von meinem Gästehaus an den Strand gespült worden war. Draußen höre ich deutlich das Donnern des Meeres, in dem Barishas zerbrechlicher Körper zu einem toten Spielball der Strömung geworden ist. Ich höre das Trommeln des Wassers, das uns von allen Seiten umspült, vom Nachthimmel und vom Meer, ich höre das Meer als einen Ruf des Gewissens und der Erinnerung. Für einen Moment scheint es mir, dass unsere Insel ein unzuverlässiges Land ist, dass der Sturm und das Wasser die Richter über uns alle sind, und dass sie jeden Moment die Möglichkeit haben, uns endgültig zu verurteilen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich Istanbul wieder, die Straßenbahn Nummer 1, ich sehe Barisha, die mir gegenüber durch die schmutzigen Fenster schaut. Und dann, zur gleichen Zeit, vielleicht sogar in der Zeit vor dieser Erinnerung (obwohl es dafür keine andere Logik gibt als die Logik der Vorahnung und der Negation der Zeit), sehe ich ein anderes Bild, Barishas aufgedunsenes blassblaues Gesicht, von dem die Folie im unterirdischen Kühlhaus von Vaxholms Vårdcentral für einige Augenblicke vor mir abgezogen wird. Als ich die Augen öffne, ist es völlig dunkel um mich herum. Der Strom ist wieder ausgefallen. Bald blinkt die Glühbirne ein paar Mal auf, und die Lampe leuchtet wieder. Ich liege regungslos, gefühllos, durchgefroren da, und frage mich, ob es morgen noch einen Morgen geben wird, einen neuen Tag?
9.
Am nächsten Morgen bietet mir der Rezeptionist meines Istanbuler Hotels wieder seinen verstaubten Sessel an und lächelt mir mit einem Stirnrunzeln zu. Die Geschichte vom vorigen Morgen wiederholt sich, nur dass ich diesmal volle anderthalb Stunden auf Barisha warte. Als sie endlich auftaucht, begrüßt sie mich kurz, bezahlt die Hotelrechnung an der Tür und dann sind wir weg. Ich höre, wie sie murmelt: »Es ging wirklich nicht früher«, und ich tue so, als ob es mich nicht interessiert, obwohl sich der Groll in mir nur langsam abkühlt. Mein Flug zurück nach Deutschland geht am späten Abend, vorher nimmt mich Barisha noch zur Buchmesse mit, die ziemlich weit außerhalb der Stadt stattfindet. Es stellt sich heraus, dass Barisha nicht weiß, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin kommt. Sie fragt die Leute an der Straßenbahnhaltestelle. Bald versammelt sich eine kleine Gruppe von Menschen um sie herum, die sich streiten, sich gegenseitig überzeugen, sich auf die Schultern klopfen und aufschreien. Eine Straßenbahn kommt an, die meisten steigen ein. Wir warten. »Wie geht es dir?«, frage ich, um Barishas Schweigen zu brechen. Sie sieht mich mit ihren breiten Augenringen an. »Mir geht es wirklich schlecht«, sagt sie und zündet sich eine Zigarette an. Ich erinnere mich, wie hilflos und zerbrechlich sie mir in diesem Moment erschien, und jetzt, da ich zum Fenster schaue, hinter dem die Dunkelheit der Nacht langsam dem windigen Grau eines regnerischen Morgens weicht, wird mir bewusst, wie Barishas Geheimnis mich neugierig machte und mich mehr berührte, als mir lieb war. Die Straßenbahn Nummer 1 kam an und wir stiegen ein. Seltsam ist für mich die kristalline Klarheit, mit der ich mich, im Bett liegend in einer eiskalten Pension irgendwo in den Schären vor Stockholm, an zwei oder drei Szenen erinnere, die ich im Vorbeifahren gesehen habe, als die Straßenbahn vorbeiratterte: ein Junge, der auf der Straße Mandarinen verkaufte, eine alte Frau, die fast von der Straßenbahn hätte überfahren werden können, Szenen von Menschenmengen auf dem Weg zu einem unbekannten Ziel. Dann erinnere ich mich an den Klang von Barishas Stimme, die unser Schweigen brach, mehr ein Rätsel als eine Aussage. Sie sagte: »Sie war eine der besten Dichterinnen, die wir hatten.« Und erst nach einer Weile, als wir an einer Haltestelle anhielten, wo viele Leute aus- und einstiegen, fügte sie hinzu: »Die Mutter des kleinen Mädchens, das du gestern in der Bibliothek gesehen hast.« Einen Moment später begann Barishas längerer Monolog, den ich nicht erwartet und eigentlich noch weniger gewollt hatte, geflüsterte, langsam und deutlich ausgesprochene Sätze, die nicht aufhören wollten. Es war, als ob ein Damm gebrochen wäre. Mit jedem Satz wurde ich tiefer und tiefer in den Hintergrund der Geschichte des Mädchens, aber auch in die Geschichte von Barisha hineingezogen. Jetzt, acht Jahre später, erkenne ich gerade erst, was ich damals nicht einmal geahnt habe. Mit Barishas Geschichte wurde ich in den Hintergrund der Geschichte geführt, die zu meiner Geschichte wurde.