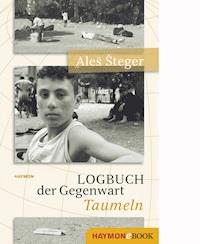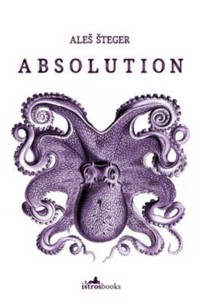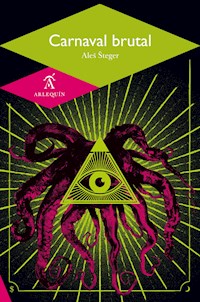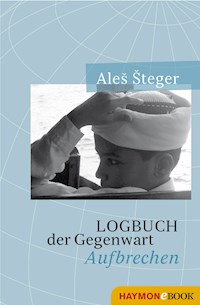Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein hochpoetischer und gesellschaftskritischer Roman, der zeigt, was mit uns allen passieren könnte – wenn es nicht schon längst passiert. Es herrschen angespannte Zeiten: Die EU befindet sich mit dem Rest der Welt in Handelskriegen, in den Regalen der Supermärkte gibt es keine Bananen mehr. In Slowenien stehen Wahlen vor der Tür, und in Ljubljana treffen Proteste auf Gegenproteste, extremistische Parteien befinden sich im Aufwind. Inmitten dieses Chaos durchlebt eine junge Schriftstellerin ihre ganz eigene Krise, Liebe und Finanzen liegen im Argen. Um Letzterem Abhilfe zu schaffen, nimmt sie einen Honorarauftrag an, Creative Writing Workshops in einem Gefängnis durchzuführen. Während drei Gefangene ihr immer wieder neue Erzählungen liefern, die alle vom Krieg handeln, beginnt sie, einen historischen Roman zu schreiben, der von der Freundschaft zwischen Antonio Scopoli und Carl von Linné erzählt, von Scopolis Reise durch das kriegsverwüstete Europa des 18. Jahrhunderts und von dem Ort, an dem die erste Banane auf europäischem Boden gezüchtet wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aleš Šteger
Neverend
Roman
Aus dem Slowenischenvon Matthias Göritzund Alexandra Natalie Zaleznik
»Aber hier lassen wir, wenn ich das richtig sehe, niemanden zurück. Dennoch können wir mit Recht behaupten, dass andere uns verlassen haben, denn unsere Nächsten, die entweder gestorben oder vor dem Tod geflohen sind, haben uns in der schlimmsten Not zurückgelassen, als wären wir einander Fremde.«
Bocaccio, Decamerone
Inhalt
Umschlag
Titel
Neverend
Impressum
2. September
Kafka bringt Bananen mit. Keine Ahnung, woher er sie hat. Vor zwei Monaten sind sie über Nacht aus den Regalen der Supermärkte verschwunden. Der Handelskrieg zwischen der Europäischen Union und dem Rest der Welt dauert schon Jahre, wir haben ihn jedoch bis vor Kurzem nicht wahrgenommen. Er hat sich in aller Stille abgespielt, während Verhandlungen in mondänen Urlaubsorten, Wirtschaftskammern und auf diplomatischen Empfängen. In den letzten Monaten nimmt er jedoch ungeahnte Ausmaße an. Wir alle sind sein Material, sein Opfer und seine Körper. Wie ein Krebs wuchs er klamm und heimlich im Inneren heran, jetzt aber ist er urplötzlich an die Oberfläche vorgedrungen und verändert den Alltag gewaltig.
Weniger wichtig dabei ist, dass Bananen und zahlreiche andere Artikel unerreichbar, selten und sogar zu Objekten des Begehrens geworden sind, deren Wert auf dem Schwarzmarkt schwindelerregend gestiegen ist.
Viel wichtiger dagegen ist das Bestärken des unsichtbaren Gefühls, dass jeder von uns in die Geiselrolle eines größeren Systems versetzt wird. Wie eine Seifenblase zerplatzt so nebenbei die angebliche persönliche Freiheit. Ich, du, keiner ruht mehr in sich, wir alle sind das Eigentum größerer Strukturen und konkurrierender Systeme. Eine unsichtbare Hand verfügt frei über uns. Es hängt nicht von mir ab, wann sie nach mir fassen, mich austauschen, verpfänden oder für was auch immer benutzen wird. Plötzlich spüre ich auf physischer Ebene etwas, das ich nie zuvor gespürt habe. Ich spüre, dass ich verwundbar bin, so verdammt verwundbar und gefangen, nicht wegen meiner inneren Not, sondern aufgrund der äußeren Umstände, auf die ich keinen Einfluss habe.
Kafka hat den Schlüssel zu meiner Wohnung. Ich weiß zwar, wann er kommen wird, aber gewöhnlich tue ich so, als ob mich sein Besuch überrascht. Obwohl es nicht stimmt. Ich weiß selbst nicht, wie ich mich in dieses alberne Spiel verwickelt habe. Er dagegen weiß es genau. Oder er denkt gar nicht darüber nach. Lachend und ganz selbstverständlich kommt er und macht es sich gemütlich. Er kommt einfach und ist Teil des Interieurs. Das hat etwas äußerst Störendes in sich, aber wie soll ich es ihm erklären? Wie soll ich es mir selbst erklären?
Er kommt nicht nur mit einem ganzen Bananenbüschel, er kommt auch mit einem Palmenblatt, das aus einer Plastiktüte ragt. Er sagt, dass er mich mit Bananen zu verführen wünscht, mit Bananen zu betäuben, dass er mir Arkadien zeigen möchte.
Ich fahre mit den Fingerspitzen über die hellgrüne, glatte Oberfläche. Sie ist wie der Äquator, wie die Tropen, ich spüre den Regen, lange, unendlich fließende Tropfen, die monatelang über dieses Blatt geglitten sind, den Geruch der Arbeiter, die das Blatt, samt Früchten und Zweigen, wie eben Bananen geerntet werden, abgeschlagen und aufgeladen haben. Als würde ich über die Haut des Palmenblatts fahren. An den Enden ist es zerfranst und braun, aber noch immer jung und geschmeidig, in seinem Inneren wächst da schon das klar ausgeformte Gefühl von Vergänglichkeit und kommendem Untergang.
Kafka legt sein Geschenk auf den Küchentisch und bedient sich sofort.
Wir sprechen mit vollgestopften Bananenmündern, er über die Liebe und Literatur, ich über die Abfallentsorgung, die in meinem Vorstadtviertel anscheinend komplett eingestellt wurde.
Kafka hört nicht auf. Als er bereits die fünfte Banane zu essen beginnt, nehme ich ihm die letzten beiden weg und bringe sie an einen sicheren Ort. Er ist eine Art Gordon Brown, der in der Rolle als britischer Premier nur Bananen gefressen hat.
Ich sage zu ihm: »Du bist mein Gordon.« Er aber winkt lediglich mit dem Palmenblatt und beginnt damit über meine Oberschenkel zu streifen, dass ich eine Gänsehaut bekomme.
Seine Berührung: einerseits störend, andererseits wiederum nicht. Er ist das einzige Individuum auf der Welt, das meine Wohnung, meine Küche, meinen Raum einfach so betreten darf.
Letzte Nacht habe ich wieder nicht geschlafen, ich bin höchstens ab und zu in winzige, unverbundene Traumfetzen hineingewatet und fand mich am Morgen, als ob ich die Nacht in einer Badewanne voll kaltem schmutzigem Wasser verbracht hätte. Die Haut ist gespannt, aufgedunsen, gar nicht mehr wie meine. Wie eine richtige ländliche Braut habe ich eine Doppelschicht Make-up aufgetragen, während des Wartens die Fingernagelhaut abgeknabbert, ich erwartete ihn dann, wie es sich gehört. Ihn, Kafka, den Bananenkönig. Und seine Berührungen.
Kafka bemerkt rein gar nichts davon. Er nennt mich schöne Gefangene, Kerkermeisterin meiner selbst, ein entführter Geist. Er nennt mich immer gleich, obwohl ich immer ganz anders bin, eine andere, mir selbst unbekannt.
Wenn er spricht, höre ich mich nicht. Auch wenn er aufhört zu sprechen, höre ich mich danach noch einige Zeit nicht.
Mit meinem Gehör stimmt alles. Wie jeden Tag dringen Laute vom Hof in meine Ohren. Obwohl die Schule schon begonnen hat, spielen die Kinder immer noch Paintball. Ich höre dumpfe Schüsse, Weinen, Geschrei und freudiges Toben. Woher bekommen sie die ganzen Farbpatronen? Der Hof und die umliegenden Gebäude sind voll von roten Flecken, und wenn es regnet, zerfließen sie an den grauen Wänden in traurige, blinde, blutige Augen, die von überall in alle Richtungen blicken.
Inmitten des Lärms höre ich auch Paulas Gekreische. Die Kinder kümmern sich nicht um sie. Immer wieder schießt jemand in ihre Garage oder vor ihre Füße, sodass die roten Tropfen auf ihrer schwarzen Schürze zerplatzen, das ist alles.
Kafka umarmt mich von hinten.
Das Wellen eines geheimnisvollen Meeres, Palmen, Afrika, vielleicht Mittelamerika, ein Wind, der hier und da den Vollmond aufdeckt. Die Gleichnisse müssen so kitschig wie möglich sein, auch so klischeehaft, denn so ist auch unsere Beziehung.
Ich sehe eine Wespe langsam über die Fensterscheibe klettern, sie schüttelt ihre Flügel, hebt kurz ab, prallt einige Male gegen das durchsichtige Glas, sucht weiter nach dem Ausgang.
Gerne würde ich das Fenster sperrangelweit öffnen, sie rauslassen, aber Kafkas Hände drehen mich zu ihm, ich spüre ihn am ganzen Körper, seinen Geruch, den Duft nach Bananen.
Während er sich die Hose anzieht, erzählt er mir, dass er eine Arbeit für mich hat. Im Gefängnis. Ich soll einen Kurs leiten, kreatives Schreiben mit Mördern und Vergewaltigern, Brandstiftern und Betrügern. Ich blicke in sein idiotisch grinsendes Gesicht, während er sich mit dem Palmenblatt kalte Luft zuwedelt.
»Ja«, antworte ich, »so ein Job ist gewiss wie ein Hauptgewinn im Lotto.«
Kafka weiß, dass es mich reizt, meine Höhle zu verlassen.
Kafka weiß, dass ich gleichzeitig Angst habe und meine Wohnung am liebsten nie wieder verlassen würde.
Kafka weiß, dass ich nicht weiß, was ich will. Das ist seine Stärke.
Jetzt verstehe ich Kafkas Geschenk. Mit was werden in Krisenzeiten wohl Affen im Tierpark gefüttert? Bananen bekommen nämlich nur die gehorsamsten Affen, die allerzahmsten Orang-Utans, die jetzt obendrein noch an einem Literaturworkshop mit mir teilnehmen werden, der obersten Affenkönigin.
Habe ich das wirklich nötig? Schaffe ich das? Mein Leben zu ändern, den Handschuh nach außen zu wenden, die Welt mit meinem Inneren zu berühren? Zu unterrichten? Überdies literarisches Schreiben!
Nein, bin ich nicht, ich kann nicht, es geht nicht. Und obendrein im Gefängnis, zwischen Verurteilten!
In meinem Kopf taucht abrupt ein Gegenargument auf (ein kleines listiges Äffchen, das seine Banane bekommen hat, dem ich jetzt nur schwer widerspreche): Ein bisschen Luft wird dir nicht schaden, und sei es Gefängnisluft.
»Ein bisschen Realität hat noch keiner Schriftstellerin geschadet«, behauptet Kafka.
Wie selbstbewusst, wie souverän er davon überzeugt ist, dass es nur eine einzige Realität gibt.
Es überrascht mich immer aufs Neue, insgeheim und ohne dass Kafka etwas davon merkt, zerbricht es mich auch.
3. September
Fast eine halbe Million Menschen vorm Brandenburger Tor, das sind fast die Hälfte der Einwohner Sloweniens. Ich schaue mir Bilder im Netz an, viele junge Leute mit Slogans gegen Aufrüstung, einige oben ohne. Blumenkinder und Karneval. Es hat fast den Anschein, als wären sie auf einem Hippie-Event und nicht auf einer Demonstration gegen die Maßnahmen der neuen deutschen Regierung. Fast eine Million und das Lächeln des neuen deutschen Kanzlers. Er sagt, dass fast eine Million doch noch nicht eine Million seien, dass die Demokratie eine einzige sei, die gleiche für alle, und dass die Regierung keinen Millimeter von der Erhöhung der Militärausgaben abweichen werde.
Heutzutage lächeln alle nur noch. Auch ich. Ich gehe ins Bad und übe das Lächeln, eine halbe Stunde am Morgen und eine halbe am Abend, bis ich nicht sehe, wie mir Karies über die Sechser hinten oben wächst.
Auch bei uns keine guten Aussichten. Nur noch knappe zwei Monate bis zu den Wahlen, die Plakate hängen bereits. Und auch auf ihnen lächeln alle. Die Situation ist aber ernst! Die Situation ist verdammt ernst! Oder es scheint nur mir so, dass sie ernst werde, und ich verstehe diese Art mitteleuropäisch-balkanischen Humors einfach nicht. Was, wenn auch hier die Populisten gewinnen? Über Nacht ist die Welt zu einem stark geschrumpften, zu heiß gewaschenen Wollanzug geworden. Alles ist zu klein, kein Ausweg, nirgends. Selbstsucht, Ängste, jeder versucht seine eigenen Gespenster zu beschützen. Am liebsten würde ich die Fenster und Türen nicht mehr öffnen. Hass schwebt durch die Luft, und es kommt mir vor, als würde ich angesteckt, vergiftet, sobald ich die Türschwelle überschreite.
Die Welt dreht sich aber nicht um, auch wenn ich in der Küche einen Kopfstand mache. Und ich bringe damit auch nicht den Hass und meine Angst, die sich zusammen mit dem Geruch von Herbst eingestellt haben, aus dem Gleichgewicht. Nur mein Körper erscheint mir für ein paar Augenblicke, in denen ich es schaffe, in dieser Position zu verharren, die ich als Kind mit Leichtigkeit bewältigt habe, als der Körper einer Fremden. Der Bauch und die Brüste im Rachen, die Wangen angespannt, die Zunge ungewöhnlich fremd.
Keine Rettung. Keine Politik. Keine Hoffnung. Keine Erwartungen. Keine Liebe. Keine Perspektive. Der einzig relativ konkrete Gedanke, dass man sich in einer Krise immer selbst helfen muss, ist ein albernes Kindermärchen.
Keine Hilfe. Nur Lächeln. Nur Zuckungen. Ein gezwungenes, groteskes Grinsen, Pierrot, Joker und all die anderen traurigen Clowns der Welt.
Und der Job? Ich verachte Creative-Writing-Workshops regelrecht. Hab ich bei Kafka in seinem Seminar all diese Jahre irgendetwas gelernt? Vielleicht nur, dass es neben mir noch andere unvergleichlich krankhaft ambitionierte und frustrierte Leute gibt, die davon träumen, Schriftsteller zu werden. Dass ich nie und absolut nie ein Pseudonym annehmen darf, am wenigsten eines, das einem bekannten existenzialistischen Schriftsteller gehört. Und dass ich nie in der Öffentlichkeit lachen darf. Ernsthaftigkeit, deprimierte Wichtigtuerei hat seine Wirkung.
»Mit einem Pseudonym bist du nicht mehr Peter oder Paulus, du wirst zu Kafka. Dann kannst du gelassen die ganze Welt verarschen«, sagt Kafka.
»Was für eine totale Befreiung, zu sehen, dass es keine Form der Verpflichtung gibt, sondern nur ein Spiel von Signifikanten«, sagt er und lächelt wieder vor seinen fünfundzwanzig Studentinnen im Seminar.
Und wir lächeln zurück.
Weil uns unsere Mütter so erzogen haben.
Lange, endlose Jahre des Trainings in lächelnder Koketterie.
Keiner lehrt dich, auf deinen Instinkt zu hören, die Grundsätze von gesunder Ernährung, des aufrechten Gangs und der aufrechten Pose. Nein, stattdessen lehren sie dich zu lächeln, um dich besser verkaufen zu können.
Kafkas Lächeln ist genau dasselbe wie das des neuen deutschen Kanzlers, wenn er die Vertreibung aller Migranten und die Schließung der Asylantenheime verkündet.
Welcher Kafka? Mein ehemaliger Lehrer im Schreibseminar oder mein ehemaliger Lehrmeister in ernster Literatur?
»Was für eine totale Befreiung ist dieses Spiel der Signifikanten. Schreibt, schreibt, als ob nicht ihr schreiben würdet.«
Mir ist aber nicht zum Lachen.
Die Mundwinkel vorm Spiegel fallen mir wieder herunter, ich schaffe es nicht, länger als siebzehn Minuten ununterbrochen zu lächeln. Wie schaffen die das alle im Fernsehen? Ich versuche den Trick mit den Wattestäbchen. Ich steck sie in die Mundwinkel, bis ich wie eine Fratze aussehe, dann hebe ich beide Mundwinkel mit den Enden der Stäbchen langsam an. Kein Glück liegt mehr auf einem solchen Gesicht, es sieht eher tragisch aus, wie das Gesicht eines traurigen Clowns. Das Beharren in dieser Position stärkt das Bewusstsein, dass man ununterbrochen alles belächeln muss, in jeder Situation, umso mehr, wenn man allein ist und tatenlos herumsitzt. Nichts, aber auch gar nichts tut.
Was wir nicht alles anstellen, um nichts zu machen. Ich würde alles geben, nur um fern von allen Leuten zu sein und in Ruhe zu schreiben.
Ich glaube, ich hätte ohne Mund auf die Welt kommen müssen. Und ohne Ohren und ohne Augen. Taubstummblind wie mein Kühlschrankmagnet mit den drei kleinen Äffchen, eines drückt sich die Augen zu, eines die Ohren, eines den Mund.
Frieden? Ich hab noch nie im Leben einen Workshop geleitet. Noch nie war ich im Knast. Ich kenne keinen anderen Häftling als mich selbst. Aber ich gehe ab und zu auf einen Spaziergang und mache das Licht aus, wenn ich es selber will.
Am allerwenigsten auf der Welt brauche ich zusätzliches Chaos. Mein Leben steht kopf. Meine Literatur ist ein Trümmerhaufen. Ich muss rational bleiben, deshalb hab ich mir auch dieses Heft gekauft, um mein Protokoll zu führen, mit der Hand, in ganz altmodischem Stil. So was hab ich nie gemacht, ich hatte nie Zeit dafür. Immer schien es mir etwas Abstoßendes zu sein, etwas eklig Selbstverliebtes, ein Tagebuch zu führen. Umso mehr, wenn das Tagebuch von einem Schriftsteller oder einer öffentlichen Persönlichkeit geführt wird, weil es unmöglich ist, es zu schreiben, ohne mit dem Hintergedanken zu spielen, ob die Notizen eines Tages veröffentlicht werden. Pfui!
Bei mir ist es anders. Ich weiß, dass ich mein eigenes Publikum bin.
Ein Protokoll also oder sogar eine Art Experiment mit mir selbst. Nur so kann ich mich irgendwie mit Kafkas Angebot anfreunden, es akzeptabel finden, vielleicht sogar realisierbar. Alles dreht sich vor mir, und ich brauche einen festen Halt. Ein Plan ist ein Halt. Ein Heft ist ein Halt. Siebzehn Minuten Lächeln vor dem Spiegel sind ein Halt. Fast eine Million Menschen sind ein Halt. Das aktive Notieren des Geschehens dieser paar Monate, in denen ich hinter Gittern arbeiten werde, ist ein Halt.
Es heißt, das Gefängnis in Dob habe höchstes Niveau, und sogar das Essen sei solide, das sagt wenigstens Kafka. Er spricht es aus und stopft sich die fünfte Banane in den Mund und lacht laut, sodass ihm das Bananenfleisch durch die Zähne quillt. Er fasst mich dabei am Arm. Ekelhaft! Was für ein perverser Zyniker.
Was nicht mal so eine schlechte Definition von Politiker ist.
Unter dem Stichwort PÖNOLOGIE lese ich: »Wir alle fangen unser Leben auf dem gleichen Pfad an, das heißt mit der Geburt, doch biegen einige auf bestimmte ›Seitenwege‹ ab und finden sich in Gefängnissen oder in Besserungsanstalten wieder, wie man Gefängnisse anders bezeichnet. Sie leben anders, in einer anderen Organisationsstruktur, nach einem andern Schema als die Mehrheit der Menschen, und ihre Lebensweise verändert sich.«
4. September
Ich trage einen Kolonialhut und eine Aufmachung vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Ich bin Forscherin, tief im Urwald. Die Eingeborenen bringen mich auf ein Territorium, das mit kleinen Schädeln gekennzeichnet ist. Sie ähneln Affenschädeln, es sind Hunderte, sie hängen von den Baumkronen und baumeln eineinhalb Meter über dem Boden. Als ich dazwischen umhergehe, durchfährt mich der Gedanke, dass einige davon Menschenköpfen ähneln, nur dass sie viel kleiner sind. Einige unterhalten sich miteinander. Obwohl sie abgeschlagen und tot sind, öffnen sie hier und da ihre Augen, schielen uns, die wir vorsichtig an ihnen vorbeigehen, an. Einer meiner Träger wird von einem der Schädel gebissen. Er ist verloren, im nächsten Moment breitet sich ein Ausschlag über seinen Körper aus, er wird rot, glühend heiß, zuckt und ergibt sich. Der Träger stirbt in schlimmsten Qualen, verfault im Nu, verwandelt sich in dunkelroten Schleim. Wir befinden uns auf dem Friedhof eines unbekannten Stammes. Auf der zentralen Grabkammer ist eine Markierung, ein Kreis mit zwei kleineren Kreisen im Inneren. Hinter dem großen Stein, der den Eingang verschließt, ertönen Hilferufe. Es ist meine Mutter. Ich beauftrage die Träger, den Stein zu entfernen. Es geht nicht. Wir stemmen uns alle dagegen, aber der Stein bewegt sich keinen Zentimeter. Meine Mutter schreit immer lauter, sie müsse raus, ihr gehe die Luft aus. Dann verstummt ihre Stimme. Verzweifelt versuche ich ins Innere der Grabkammer zu dringen. Ich kratze, hämmere auf den Stein, nichts. Ich beginne zu weinen. Als die Tränen auf den Stein fallen, rührt sich der Stein. Als ich das sehe, beauftrage ich meine Leute zu weinen. Wir weinen, und der Stein rollt im Nu weg. Dahinter ist ein dunkles Loch. Meine Mutter ist nirgends zu sehen. Die Gruft ist vollkommen leer. Ein einziger winziger Rest ist da, eine Art verwesender Körper. Er ist ganz klein und dünn. Er muss schon Jahrzehnte hier sein. Als bestünde er nur aus Haut, unter der das Skelett entfernt worden ist, vollkommen schwarz und zu einer schwarzen, stumpfen Hülse zusammengeschrumpft, dünn wie Papier. Noch sind die Gesichtszüge erkennbar, die dürren Hände, den Leib umklammernd, die Knie, an die Brust gezogen, aber alles sehr verkleinert. Dann bin ich plötzlich allein. Meine Träger sind weg. Ich irre allein durch den Urwald. Als ich den schlammigen Fluss überquere, beißt mir ein Krokodil ein Bein ab. Es tut gar nicht weh. Ich wundere mich über mich selbst, wie es möglich ist, dass ich ohne Bein problemlos weiter gehen kann. Ich fürchte mich lediglich vor dem Anblick des Beinstumpfs. Dennoch zwinge ich mich dazu und schaue hinab. Von den kalten Fliesen heben sich alle zehn Zehen beider Füße. Ich stehe in der Mitte des Badezimmers. Selbst Stunden später, als ich vergebens versuche einzuschlafen, taste ich immer wieder den einen und den anderen Fuß ab, strecke sie unter der Decke hervor, erst einen, dann den anderen, dann wieder den einen, dann beide gleichzeitig, verwundert über das Wunder, dass ich sie noch habe und beide noch immer mit meinem Körper verwachsen sind. Ich stehe vor dem Morgengrauen auf. Beim Schreiben gibt es keine Wunder. Ich tippe automatisch, die Finger bewegen sich von selbst, aber alles, was sie tun, ist genau das Gegenteil eines Wunders. Alles, was ich schreibe, ist ein Teil jener quälenden Halbwachheit im Traum, als das Schreckliche schon passiert war, aber ein Teil von mir vergebens versucht, sich den Tatsachen entgegenzustellen, alles zurückzuspulen, den Verlauf der Träume zu korrigieren, ein Gewehr von irgendwoher zu zaubern und der Bestie geradewegs ins klaffende Maul zu schießen. Aber da ist kein Gewehr, ich bin allein. Es hilft nicht, dass ich aus dem Schlaf gerissen werde, noch weniger vermag Mutters Stimme, die noch immer irgendwo ruft, den Verlust meines Gleichgewichts zu verhindern, den Verlust der Fähigkeit, mich zu bewegen, und meine Angst vor den Träumen zu beseitigen, die selbst dann weitergehen, wenn ich bereits wach bin, von denen ich zurückgeworfen werde wie von einem unsichtbaren Käfig, der mich abprallen lässt und den ich nur jetzt erblicke, als ich dies schreibe.
6. September
Kafka stülpt sich meine Unterhose über den Kopf und salutiert als Hitler, den Zeige- und den Mittelfinger der rechten Hand als Führerbart. Ich lache, schmiege mich an, Körper an Körper, und klemme mich so fest an ihn, wie ich nur kann, bis er mich um Gnade anwinselt. Ich weiß, dass es sehr bald verdrießliche Augenblicke geben wird, in denen sich sein Blick verirren, sein Gesicht melancholisch und abwesend sein wird. In diesen Augenblicken ist er ohne Gegenwehr. Ich kann tief in ihn hineinsehen, als ob ich in einen Strudel blicke, in dem die Spiegelbilder eines Kindes und eines alten Mannes zusammenfließen.
»Woran denkst du?«, so rufe ich ihn wieder zurück.
Er antwortet nie auf diese Frage. Er drückt mich nur sehr, sehr stark an sich. Diese Umarmung unterscheidet sich von seinen anderen Umarmungen, sie ist ehrlich und warm, sie gibt mir das Gefühl von Geborgenheit, sie gibt mir das Gefühl, dass ich selbst ein sicherer Ort bin und ich mich ihm genauso ungeschützt ausliefern kann.
Immer wieder sprechen wir über Essen. Auch er denkt darüber nach, Veganer zu werden. Doch er will mir sein Manuskript nicht zeigen, von dem er schon das ganze Jahr erzählt, dass es etwas wirklich Großes sein wird, prophezeit er, etwas, das die Welt noch nicht gesehen hat. Ein großes Kochbuch des Todes. Gerichte, groß wie Konzentrationslager, Häppchen aus Schrecken und Ausweglosigkeit, Aufstieg und Fall von Zwiebeln, Kartoffelkriege, die Diktatur von Hunger und Völlerei.
»Ah, ja?«, sage ich.
»Mjamm, mjamm«, sagt er und versteckt sich wieder hinter seinem unmöglichen Tarnungslächeln, bei dem es mich schaudert.
Er erklärt mir Details meiner Arbeit, jetzt ist mir die Sache ein wenig klarer. Das Programm mit dem Titel »Wiedereingliederung und Aktivierung« verschickt Schriftsteller an mehrere Gefängnisse im Staat mit dem Vorhaben, dass die Schaffenden Motivation und Kompetenzen der Gefangenen für die Zeit, in der sie wieder auf freiem Fuß sein werden, stärken.
Sowohl Kafka als auch ich glauben nicht, dass irgendein Geldgeber im Ministerium davon ausgeht, es sei möglich, die verlorenen Seelen in den Gefängnissen zu motivieren oder ihre Kompetenzen irgendwie zu erweitern.
Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand in den Gefängnissen, angefangen mit denen, die die Gefängnisse leiten und kontrollieren, bis hin zu den letzten Sträflingen, meint, dass Schriftsteller jemandem die Moral stärken und die Kompetenz für das Leben im Gefängnis oder draußen steigern könnten.
Und noch weniger glaube ich, dass die Schriftsteller selber daran glauben, irgendjemandem in einem Gefängnis irgendetwas Sinnvolles zu erzählen, irgendetwas Aufbauendes, ganz zu schweigen von etwas Nützlichem für das Leben in Freiheit.
Die Wahrheit ist, dass wir Schriftsteller es alle wegen des Geldes machen. Und das Ministerium unterstützt das, weil sie zum Verschwenden von Geldern gezwungen sind, was aber durch eine maximal edelmütige Hülle verschleiert werden muss.
»Gutmenschentum bewegt die Welt«, sagt Kafka und grinst weiter.
Diese und ähnliche Aussagen fallen in mich hinein, mit stumpfem Klang, bleiben irgendwo tief in mir liegen, ein Störfaktor, sie zerfallen dort und verwandeln sich in Mulch, durch den ich immer schwerer durchblicke. Wenn Kafka bei mir ist, werde ich zu einem dunklen undurchdringlichen Wald ohne Tiere.
Keine lebenden Tiere, nur Spuren von Bestien, abgezogene Häute und Kadaver
In den Gefängnissen lassen sie es zu, dass alle Objekte dieses quasi philanthropischen Spiels werden, weil eben alles besser ist, als dass sich nichts, aber auch gar nichts tut (wenigstens aus der Sicht der Gefangenen) und dass die Gefängnisse bei den verschiedensten Studien als veraltete und rückständige Institutionen bewertet werden (aus der Sicht des Ministeriums).
Ein wunderbarer Ausgangspunkt für meine Arbeit in den kommenden Monaten. Ich und die Gefangenen sind beiderseits absolut desillusioniert und demotiviert, doch trotzdem spielen wir das durchschaubare Spiel mit, an das keiner glaubt.
Ich und die Gefangenen: ein durchschaubares, sinnloses und durch und durch nichtiges Zusammensein, das wiedereingliedern und aktivieren soll.
Diese Erkenntnis beruhigt mich. Es wäre fast unerträglich, sich mit Gefangenen zu treffen, die von mir irgendetwas erwarten würden. Oder ich von ihnen. Weiß ich doch selbst nicht, was ich von flüchtigen Treffen mit Nachbarn im Treppenhaus in unserem Gebäude erwarten soll, von Treffen mit Schriftstellerkollegen oder von Treffen mit Kafka. Was soll ich von den wenigen sozialen Kontakten erwarten, die mich noch an die äußere Welt binden. Ich stelle mir vor, dass es unerträglich gewesen wäre, die Logik umzudrehen, und dass jetzt Leute, die Verbrechen begangen haben, von mir abhängen sollten, ich könnte das nicht ertragen. So aber erwartet der eine absolut nichts vom anderen, was nicht die schlechteste Ausgangsposition dafür ist, dass irgendetwas passiert, das mehr ist als nichts.
Nachdem Kafka gegangen ist, verbringe ich den ganzen Nachmittag in Vorbereitung auf den morgigen Beginn meines Kurses. Ich kämpfe mich durch Handbücher für das Leiten von Creative-Writing-Workshops, ich stöbere im Netz, finde aber nichts Vernünftiges. Auf alle Fälle habe ich ein paar kopierte Texte und ein paar praktische Übungen vorbereitet (über ein vorgegebenes Objekt schreiben, über die erste Kindheitserinnerung schreiben, das Verfassen eines klassischen Briefs, Haiku, das Rappen von Texten mit sozial engagierter Thematik, das Verfassen von Filmszenarios und von Songtexten), doch werde ich mich im Verlauf entscheiden, wie und was wir machen.
Okay, ich geb’s zu, ich hab Schiss. Ich hab Schiss vor all den Männern, vor der Kommunikation, wie sie mich als Frau angehen werden, vor all den möglichen Situationen. Sie haben mir gesagt, dass es ganze vierunddreißig Anmeldungen gibt, was eindeutig zu viel ist. Ich antworte ihnen, dass alle zur Einführungsstunde kommen können, dass wir uns aber später dann anders organisieren müssen. Ich stehe in Kontakt mit dem Gefängnispsychologen, er heißt Doktor Petek und ist Therapeut, ein Spezialist für Freizeitaktivitäten in Strafanstalten. Den E-Mails nach zu urteilen, ist er korrekt. Wieso auch nicht? Es ist ein Traumberuf, sich mit der Freizeit zu beschäftigen. So wie ich. Eine Schriftstellerin, Romanautorin. Die Unendlichkeit der ungeformten Freizeit. Ein Traumberuf. Dazu ein Traumberuf für beide. Sowohl er als auch ich führen unsere Berufe im Gefängnis aus. Traumhafte Aussichten hinter Gittern. Na so was!
Über die angemeldeten Häftlinge weiß ich praktisch nichts. Im Gefängnis in Dob gibt es sehr unterschiedliche Typen von Gefangenen. Angefangen von kleinen Delinquenten mit Freiheitsstrafen von eineinhalb Jahren (offener Vollzug), bis zu Schwerverbrechern, die auch fünfzehn oder mehr Jahre absitzen müssen (geschlossener Vollzug). Den Letzten geben sie wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, sich bei mir wiedereinzugliedern und zu aktivieren, oder doch? Bei dem Gedanken wird mir heiß.
In was für eine Scheiße hat Kafka mich gebracht!
Und was für eine zynische Antwort auf meine Bitte, mir zu helfen!
»Was soll ich mit all diesen Gefangenen machen?«, fragte ich ihn.
Kafka lachte auf.
»Gib ihnen was zu arbeiten. Die sollen schreiben. Etwas, das sie wurmt, etwas, vor dem sie Respekt haben, Angst. Ein für sie ernstes, fatales Thema, etwas zu Morden oder Krieg oder ihren Vätern und Müttern oder so was Ähnliches. Wirst schon sehen, ein paar Sitzungen und du wirst vierunddreißig weinende Patienten in deinem Kurs haben.«
7. September
Bis Dob braucht der Bus eine volle Stunde. Jede Menge Kinder mit Schultaschen. Die meisten verlassen den Bus in der Vorstadt, den letzten Teil der Fahrt bleiben wir nur eine Handvoll Fahrgäste. Ich fühle eine widerliche Müdigkeit. Das Wummern der Räder und ein bitterer Geschmack im Mund. Als ich die Augen öffne, bin ich allein mit dem Fahrer. Felder, Strommasten, Wälder in der Ferne. Den letzten Kilometer muss ich zu Fuß gehen. Die Straße führt bergauf, Birnen- und Apfelbäume, zahlreiche Wespen überall, das Gefühl verschlafener dörflicher Freiheit, die sich auf dem Hügelkamm plötzlich in einen klaustrophobischen Blick verwandelt, als die Warnschilder, der Stacheldraht und eine hohe, schützende Mauer auftauchen.
Am Empfang wartet Dr. Petek auf mich. Ich gehe durch den Metalldetektor, Rucksack, Computer und Telefon muss ich beim Wärter lassen. Ich darf nur mein Buch mitnehmen, das der Beamte durchblättert. Denkt er wirklich, dass ich, wie in alten Filmen, eine Feile und eine Metallsäge hineinschmuggle? Oder Drogen für die Gefangenen?
Petek, um die vierzig, formell, aber freundlich. Er erzählt mir, dass es nicht das erste Mal sei, dass sie Workshops mit Schriftstellern veranstalten. Ansonsten sind sie überwiegend auf Workshops mit Tonmodellieren und Holzbearbeitung spezialisiert. Er spricht über die modernen Standards des Gefängnisses in Dob, über die fantastischen Weiterbildungsmöglichkeiten, die die Gefangenen in Anspruch nehmen können, eine Bibliothek, ein Musikzimmer, Fitnessräume, verschiedenste Kurse und Weiterbildungsseminare, von denen sich besonders der Kochkurs großer Beliebtheit erfreut.
»Eigentlich ist das ein Wohnheim und kein Gefängnis«, sagt er.
Ich frage, wie viele Teilnehmer im Workshop erwartet würden. Er sagt, er wisse es nicht. Meistens sei es so, dass sich viel mehr anmelden, als dann auch wirklich erscheinen, da gleichzeitig auch die Übertragung eines Fußballspiels stattfinde. Wir gehen an einem asphaltierten Handballfeld vorbei, das von einem hohen Zaun umgeben ist. Um die dreißig Häftlinge laufen im Kreis, einige schnauben humpelnd, andere gehen mit federndem Schritt. Niemand joggt. Ein paar stehen in der Ecke und sprechen miteinander. Sie sind ganz normal angezogen, in Jeans und Jogginganzügen. Ich habe ein merkwürdiges Gefühl, obwohl sich niemand um uns schert. Das Herz pocht wild, meine Füße zögern, die Schritte sind unregelmäßig, als würde ich über Scherben laufen. Alles um mich wirkt relativ normal, überhaupt nicht wie in amerikanischen Filmen. Wenn es nicht den Drahtzaun gäbe, würde ich sagen, ich bin beim Kollektivturnen von älteren Herrschaften dabei. So aber …
Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich es nicht wage, mit jemandem Blickkontakt aufzunehmen, die einzige Ausnahme ist Dr. Petek. Ein Schamgefühl, weil ich von draußen komme? Weil ich eine Frau bin? Weil mir Freiheit groß auf die Stirn geschrieben steht? Ein langer, kahler Gang, einer von mehreren Klassenräumen. Keiner drin. Wir warten fünf Minuten. Zehn. Niemand kommt. Dann erscheinen zwei, und nach fünf Minuten kommt noch einer. Drei von vierunddreißig Angemeldeten?
»So ist es im Gefängnis. Wir können sie nicht zwingen, und immer passiert auch noch was anderes, Aktivitäten überschneiden sich sehr oft. Es tut mir leid«, sagt Dr. Petek. Ich bin erleichtert. Ich arbeite lieber mit wenigen Leuten als mit vielen, obwohl auch die Arbeit eins zu eins viele Fallen in sich trägt. Auf jeden Fall möchte ich keine intime Beziehung mit den Gefangenen aufnehmen, was aber in so kleinen Gruppen fast unmöglich ist.
Die drei Gefangenen haben sich weit auseinandergesetzt, keiner sitzt vorne. Große Distanz zwischen ihnen und mir scheint mir gut. Sie schafft das Gefühl, dass ich zu den leeren Stühlen vor mir spreche, was mir wiederum Selbstvertrauen gibt. Petek sitzt an der Seite, nicht interessiert an dem, was geschieht, kritzelt er in seinem Notizbuch herum. Wenn alles gut läuft, wird er mich zukünftig allein mit den Teilnehmern des Workshops arbeiten lassen, so hat er es mir gleich bei meiner Ankunft mitgeteilt.
Kurze Vorstellung der drei, die ich wiedereingliedern und aktivieren soll. Der Erste stellt sich als Panfi vor, er ist um die fünfzig, recht korpulent und gesprächig. Es ist sofort klar, dass er nach einem Opfer sucht, das ihm zuhört. Ich erfahre, dass sie heute zum Mittagessen Brathuhn hatten, Kartoffelpüree, Gemüsesuppe und eine Nachspeise. Dass es im Gefängnis sehr schwierig ist, nicht zuzunehmen, obwohl er regelmäßig zum Sport geht. Dass sie im Gefängnis außerordentlich gut kochen (lächeln bei dieser Aussage die anderen zwei leicht oder kommt mir das nur so vor?) Der Zweite heißt Fil (oder Phil?), er ist eher von der zurückhaltenden Sorte und der Älteste unter ihnen. Ein langer weißer Bart, eine Halbglatze, der Rest der Haare mit einem Gummi zum Pferdeschwänzchen gebunden, vorsichtige, gewählte und durchdachte Bewegungen und Worte. Große, graue Ringe unter den Augen.
Der Dritte, Jüngste, muss so um die vierzig sein oder ein wenig älter. Dioneus. Was für ein Name. Ich habe noch von niemandem gehört, der so einen Namen hat. Er sitzt unruhig, die Beine auf den Nachbarstuhl gestreckt, dann wieder übereinandergeschlagen, dann wieder so, als wären die Stühle ihm im Weg, wobei er sich die ganze Zeit wegdreht, sein Blick aus dem Fenster mit den herabgelassenen Jalousien gerichtet. Hinter den Jalousien befindet sich ein enger Gang mit einer Mauer, oberhalb der Mauer ist ein Streifen blauen Himmels erkennbar. Dioneus zieht in regelmäßigen Abständen Schnodder hoch. Der Tick eines Drogensüchtigen? Durch die Nase alles einzusaugen, was einen umgibt, zum Beispiel die Wand da draußen und den kleinen Fleck Himmel von der anderen Seite der Jalousie?
Ich spreche über mich, über meine Ansichten von Literatur, was für mich Literatur ist, was ich mache und was mich persönlich interessiert. Nervös, mit einem mir unbekannten inneren Widerwillen, lese ich ein paar Abschnitte aus meinem Roman. Ich kann meine eigene Nervosität wortwörtlich riechen, sehen und hören, was mich nur noch nervöser macht. Zum Glück unterbricht Panfi bald meinen Monolog mit einer Frage. Dann sprechen wir fast zwanzig Minuten darüber, warum die Heldin meines Romans am Ende Selbstmord begeht. Panfi meint, dass das ein sehr schwieriges Thema sei. Umso mehr für eine so junge Schriftstellerin. Dass etwas Ähnliches schon Goethe mit seinem Werther versucht hat. Ich bin überrascht, dass er Goethes Roman kennt.
Ich frage sie, was sie lesen, ob sie überhaupt Bücher im Gefängnis haben. Bei der Frage übernimmt Dr. Petek das Wort und erklärt mir, dass die Gefängnisbibliothek relativ gut mit Klassikern bestückt ist, weniger mit zeitgenössischer Literatur. Dass aber selbstverständlich nur wenig Gefangene überhaupt lesen. Panfi, der ab und zu in der Gefängnisbibliothek arbeitet, sei eher eine Ausnahme. Dabei seufzt Panfi auf, was er für neue Romane geben würde, von denen er nur die Rezensionen in der Zeitung lesen kann. Ich frage, wie es mit dem Internet aussieht. Das ist untersagt, Gefangene haben keinen Zugang zum Internet, sagt Panfi. Fil sagt, dass das auch Vorteile mit sich bringe, man könne sich ganz sich selbst widmen und eine strikte Lebensordnung einhalten. Wenn Gefangene Zugang zum Internet hätten, würden sie nur dauernd in sozialen Netzwerken hängen.
Dr. Petek verkündet, die Stunde sei bald um und die Gefangenen müssten zurück. In Eile frage ich sie noch, ob jemand von ihnen schreiben würde. Darauf bekomme ich keine Antwort, sogar der gesprächige Panfi schweigt. Ich frage sie, ob sie bis Ende der Woche eine ganz kurze Geschichte schreiben mögen, nicht länger als zwei Seiten, und sie Dr. Petek geben mögen, damit er sie mir zuschicken könnte. Petek nickt dazu.
Panfi fragt nach dem Thema, über das sie schreiben sollten. Obwohl ich diese Frage hätte erwarten sollen, überrascht sie mich doch ein wenig. »Krieg. Schreibt vom Krieg«, sage ich. Im gleichen Moment, da ich das Wort Krieg ausgesprochen habe, bereue ich es schon. Selber hätte ich bestimmt etwas Anderes ausgewählt, so habe ich auf Kafkas Ratschlag gehört, was mir im Moment als fataler Fehler erscheint, doch zurück kann ich nicht mehr. Ich sitze in der Patsche, schaue zu Petek, der dabei ganz gleichgültig wirkt. Das vorgeschlagene Thema scheint für die drei keine Schwierigkeit darzustellen.
»Okay«, denke ich. »Vielleicht bin ich zu sensibel. Ich hätte ihnen auch etwas Neutraleres vorschlagen können, zum Beispiel Themen wie Ökologie, Zukunft oder Träume. So aber …«
Der Wärter klopft an die Tür, die Gefangenen verabschieden sich und verschwinden. Petek begleitet mich bis zum Ausgang. Er sagt, dass es möglich wäre, dass noch jemand zur Gruppe hinzustoßen könnte, wobei ich nicht enttäuscht sein solle, wenn es nur bei drei Teilnehmern bleibe. Ich nicke.
Das Handballfeld ist jetzt leer. Ich schaudere. Es steckt nicht mehr der Bote des Herbstes im weichen, noch immer warmen Wind, der in sich schon die frische Schärfe von kühleren Tagen trägt, sondern ein brutal kalter Duft nach Winter.
Ich sehe Männer, die an den Fenstergittern des Gebäudes nebenan hängen. Petek bemerkt das.
»Das ist die Abteilung mit den Einzelzimmern. Ein echter Luxus«, lacht er.
Wir verabschieden uns beim Wärter an der Pforte, wo ich meinen Rucksack, den Laptop und das Telefon wiederbekomme.
Ich verlasse das Gefängnis erleichtert und befreit. Es ist noch hell, aber trotzdem geht in dem Moment, als ich mich auf dem Kamm des Hügels noch einmal umdrehe, die Straßenbeleuchtung an. Von Weitem und hell erleuchtet sieht das Gefängnis weniger gruselig aus als vorhin. Eher wie ein Wohnheim als wie ein Gefängnis, wiederhole ich Peteks Worte.
Als ich im Zentrum von Ljubljana wieder aus dem Bus steige, ist es schon finsterste Nacht.
8. September
Ich beobachte die beiden Bananen auf dem Küchentisch. Sie waren perfekt goldgelb, als Kafka sie herbrachte, jetzt aber sind bereits die ersten graubraunen Flecken aufgetaucht. Ich bemerke einen leichten, fast nicht wahrnehmbaren Duft nach Obst und noch etwas. Wahrscheinlich Chemikalien, mit denen die Bananen bespritzt werden, bevor sie noch grün in eine besondere Folie gewickelt und auf die Überseeschiffe geladen werden. Wir manövrieren auf hoher See, ich und der Küchentisch, die Stühle und die Decke und Fenster. Wir sind immer wieder von Neuem und noch immer auf dem Weg. Uns umgibt der düstere Rumpf großer Container, der Rumpf eines Fischerboots, der Rumpf eines jahrtausendealten Einbaums, raue Bretter einer Sklaven-Galeere, Stahlschrauben im Rumpf eines touristischen Übersee-Kreuzfahrtschiffs, der Rumpf im Maschinenraum eines Kriegs-Transportschiffs, das blinkende, schleimige Fleisch im Magen von Jonas Fisch und der Carbonfaserrumpf von Schmuggelbooten. Alles bewegt sich, schwankt, beugt sich leicht und wendet und dreht sich fast unmerklich. Wenn ich meine Augen schließe, spüre ich ganz klar das unaufhaltsame Fließen und die Ungreifbarkeit von allem, was mich umgibt. Mein Auge wehrt sich vor dem Unbestimmten und versucht die Logik der Ozeane zu übertölpeln, es zieht mich zwischen die Ränder des gelben Anführungszeichens der beiden Bananen auf dem Tisch, ein Zeichen von Luxus, ein Stillleben unserer Zeit. Es sieht zwar noch lebendig aus, im Wesentlichen ist es jedoch bereits in tiefster Zersetzung, betrügerisch getarnt wie die Wendung »nature morte«. Die Küche, Wohnung, unser Gebäude, diese Stadt, unser Staat und die Planeten fahren durch die Dunkelheit, bewegen sich, mischen sich und fließen ineinander. Die tote Natur des gepflückten Obstes, die Gegenstände in der Küche, mein Körper, ich, die ich sie betrachte, gefangen im Moment der Illusion. Für ein klassisches malerisches Motiv fehlen nur noch Schmetterling und Raupe als Gleichnis der Umwandlung. Bei den beiden Bananen sehe ich jedoch keine Möglichkeit zur Umwandlung. Der Weg von allem, was mich umgibt, ist offen, der Horizont ist der Himmel selbst, offen und klar, der Weg der Früchte, der Blüten und des getöteten Wilds auf den Leinwänden ist von Künstlern schon klar bestimmt, es ist ein Abstieg in die Dunkelheit. Aus dem Tod in den Tod. Oder zumindest ein vorhersehbares Kommen zu seiner verfaulten Essenz. Im Stillleben liegt kein Geheimnis, das Auge weiß, welches Schicksal die gemalten Gegenstände erwartet, darum betrachtet es diese dem Anschein nach noch Lebendigen gern, das heißt die lebenden Toten. Wenn ich die Augen schließe, ist alles um mich herum ein Geheimnis, Reise und Möglichkeit, ein Ineinanderfließen ohne jeglichen Halt.
Tiefe Gedanken. Tiefe Gedanken.
Als Kind konnte ich stundenlang mit geschlossenen Augen daliegen und in Gedanken über Ljubljana fliegen: über den Burghügel hinweg, die Kopftücher der Marktfrauen, den Turm des Puppentheaters mit seiner Uhr, über die sich bräunenden Kronen der Kastanienbäume und Platanen, die mit Katzenkopfsteinen gepflasterten Gassen und den leuchtenden Widerschein der Autos, die sich langsam über die Einfallstraßen in Richtung Vorstadt und Hügel und verschneiten Alpengipfel in der Ferne bewegten. Sobald ich meine Augen öffnete, war es aus mit dem Fliegen, das Gesehene und Gespürte versetzte mich zurück in den harten Griff der Gegenstände. Zusammen mit dem Fliegen verlor ich jegliche Sicherheit, das eigene Gewicht und das Gefühl der eigenen Grenze. Mit dem Öffnen der Augen bekam ich meinen Körper zurück, von dem ich seit jeher dachte, er gehöre mir nicht oder, besser gesagt, dass ich ihn mir nur ausgeliehen habe, dass er mit mir in einem Mietverhältnis steht.
Tiefe Gedanken. Tiefe Gedanken.
Ich kratze mich am Kopf, und winzige Schuppen fallen auf das Zeitungspapier, sie schreiben unleserliche Zeichen über die fettigen Buchstaben des Titels NOCH ZWEI MONATE BIS ZU DEN WAHLEN, bis ich sie wegpuste, als wären sie Sternenstaub.
Wenn ich fliege, ist nichts davon wichtig, was in dieser oder irgendeiner anderen Zeitung geschrieben steht. Ich fliege mit einem verächtlichen Lächeln und weichem Seelchen über die Titel, Bilder und Texte hinweg.
Schon beim Öffnen der Augen bin ich jedoch bereits in die Sprache der Politiker abgestürzt, in die Sprache der Macht und Manipulation.
Allen ist klar, dass es so wie bis jetzt nicht mehr weitergehen kann, dass der Staat neue Gesichter braucht, neue politische Leader, neue Gauner und Betrüger. Die einen versuchen uns mit Fliegen zu überzeugen, die anderen mit Trachten, die Dritten mit der Apokalypse. Aber keiner der Kandidaten besitzt Charisma, bei dem man das Auge gleichgültig zudrücken könnte, um für eine Weile die bittere Realität vergessen zu können, die immer, ohne Ausnahme, enttäuscht. Keiner verheißt der Unstabilität ein Ende. Sechs Regierungen in drei Jahren sind entschieden zu viel. Und alle haben wortwörtlich in Korruption und Inkompetenz miteinander konkurriert. Bei so vielen Namen kann man sich unmöglich orientieren. Die traditionellen Parteien sind schon längst zerfallen, entstanden sind eine ganze Menge neue, es gibt zu viele unbekannte Gesichter, die mehr oder weniger fahle und dilettantische Imitationen des Brüsseler Durchschnitts sind, der karrieristischen Aufmerksamkeit und bürokratischen Langeweile.
Leere Gedanken. Leere Gedanken.
Was ich an gedruckten Zeitungen liebe, dieser aussterbenden Art: dass ich nach dem Blättern darin immer schwarze Finger habe. Dass mich die Spur von Druckfarbe andauernd physisch daran erinnert, was für eine Sauerei ich lese.
Dann das Telefon. Nach ein paar Sätzen bin ich mit Eva zerstritten. Sie befürwortet eine weiche Diktatur. Sie ist der Meinung, dass Foucault unmissverständlich gezeigt hat, dass einzig jene Gesellschaften eine Zukunft haben, die über klare Hierarchien verfügen und ein strukturelles Belohnen und infolgedessen ein definiertes Straf- und Unterdrückungssystem haben. Ohne dies könne eine Gesellschaft nun mal überhaupt nicht funktionieren. Im Gegensatz dazu bin ich für eine liberale, demokratische Regelung, nach der es zwar einer breiten Schicht erlaubt wird zu stehlen, die gleichzeitig aber auch etlichen kompetenten Personen ermöglicht, sich vom Rande der Gesellschaft aus durchzusetzen, unabhängig von ihrer Abstammung. Ich befürworte eine Demokratie vom Demos. Eva lacht über mich, Foucault habe schön dargestellt, dass Demos eine Sklavenherrschaft sei. Dazu komme die ihm untergeordnete Plebs, das Volk, welches laut Definition kein Entscheidungsrecht hatte. Eine Plebokratie habe es nie gegeben, nicht einmal in Maos China. Ich erwidere, brülle ins Telefon, sie soll endlich ihren Michel vergessen. Man müsse wie in Alice im Wunderland herrschen, brülle ich, oder noch besser, verbessere ich mich vollkommen heiser, wie die Königin in Alices Wunderland. Eva lacht schadenfroh. Erneut zitiert sie Foucault, der in mehreren Texten verdeutlicht, dass ich unrecht habe und so weiter und so fort. Unter allen Franzosen liebt Eva nur die Philosophen. Und von allen Philosophen liebt sie einzig und allein Michel Foucault. Ich bezweifle zwar, dass sie mehr als ein oder zwei seiner Bücher gelesen hat, dieses eine oder beide immerhin sehr aufmerksam, was ihr genügt, um in bestimmten Momenten einen von Michels Gedanken aus dem Ärmel zu schütteln, um damit ihre These zu bekräftigen, sei sie auch noch so dumm. Ihre Methode ist uralt und nichts Besonderes. Das Besondere an Eva ist die absolute Souveränität ihres Treibens. Eva benutzt ihren allerliebsten, schlauesten, ihren oh, là, là Michel wie Dynamit, mit dem sie die stärkste Verteidigungsmauer ihres Gesprächspartners zum Einsturz bringt. Ich habe eine Weile gebraucht, um dies zu erkennen. Aber die Erkenntnis selbst hilft nicht. Noch immer drehe ich durch, wenn sie Michel erwähnt. Das ist ein vorbestimmtes Kampfszenarium, aus dem ich immer innerlich zerrüttet hervorgehe, Eva dagegen triumphierend.
Wütende Gedanken. Wütende Gedanken.
9. September
In der Früh eine SMS von meiner Tante, dass mein Onkel gestorben ist. Mit sechsundsiebzig Jahren, eigentlich ein hohes Alter bei seinem Alkoholismus und dem ungezügelten Lebensstil. Die machohafte Souveränität ist zwar nach dem Sechzigsten abgeklungen, die Angst vor dem Altern hat ihn verlangsamt, einen Hypochonder aus ihm gemacht, eine stubenhockende Katze, einen Schatten seines einstigen Selbst. Er hat sich freiwillig einer Lobotomie unterzogen, um das Altern zu verlangsamen. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich gelegentlich mit, wenn er ausging, als Alibi vor meiner Tante, die ziemlich streng war. Ich wuchs zwischen lokalen Säufern auf, in einer Bar neben einem lokalen Supermarkt, in dem es immer nach Katzenpisse stank und stets klug über Fußball, Privatisierung des Gesellschaftsvermögens und Bücher dahergeredet wurde. Als der Onkel von einer seiner letzten vielen Entzugsbehandlungen wegen Alkoholismus heimkehrte, war er plötzlich wie ausgewechselt. Er schmiss alle Bücher aus der Wohnung und kaufte sich einen neuen Fernseher mit gigantischem Bildschirm. Die letzten Jahre haben wir uns nicht gesehen. Als ich erfuhr, dass er Krebs hat, war es mir vollkommen gleichgültig. Einige Zeit habe ich mir wegen dieser Gleichgültigkeit Vorwürfe gemacht, trotzdem besuchte ich ihn nicht. Auch jetzt spüre ich nichts. Erneut analysiere ich den Raum, aber ich spüre seinen Geist nicht, weder seine Präsenz noch seine Abwesenheit. Nichts, rein gar nichts. Nur das Schwanken einer alten Fichte draußen auf dem Hof vor der Wohnung, Flugzeugspuren auf dem blassblauen Himmel. Ich beobachte, wie langsam sie dem Anschein nach vorbeigleiten, obwohl sie in Wirklichkeit sehr schnell sind. Ich starre in einen Punkt, wo gerade noch das Flugzeug war, und beobachte, wie schnell sich die doppelte Spur am Himmel auflöst. Ich schaue auf den Sekundenzeiger und messe die Zeit des Auflösens. Es dauert exakt vierundzwanzig Sekunden vom Augenblick, als die Flugzeugmotoren die weißen Überreste des verbrannten Kerosins ausstoßen, bis zum Augenblick, in dem sich die flauschige Spur am Himmel verdünnt, durchsichtig wird, in Fetzen zerfällt und schließlich vollkommen verschwindet. Der Anblick der schwindenden Spur beruhigt mich. Oder erfüllt mich zumindest mit Gleichgültigkeit. Später schaue ich noch einmal in den Himmel und wiederhole die Übung. Das Flugzeug sieht gleich aus, aber es dauert diesmal nur zwölf Sekunden, bis sich die Spur auflöst. Wahrscheinlich handelt es sich um eine andere Art von Motor, eine andere Flughöhe, um Veränderungen in der Atmosphäre, ich könnte hundert Gründe finden. Trotz allem erfüllt mich bei der Halbierung der Verfallszeit ein Hauch von tiefer Wehmut, lässt mich den ganzen Tag nicht los.
10. September
Heute eine E-Mail von Dr. Petek. Ein einziger Satz, dem ich eine bestimmte poetische Dimension nicht absprechen kann. »Mit schönen Grüßen aus dem Gefängnis!« Und drei Attachments, alle ohne Unterschrift. Soll ich raten, welche von den drei Erzählungen Panfi, welche Fil (oder Phil, ich weiß es noch immer nicht) und welche Dioneus geschrieben hat? Oder schrieb einer von ihnen alle drei? Oder zwei? Oder alle drei alle zusammen oder noch anders? Ich lese alles einmal durch, zweimal, rate, kann mich nicht entscheiden. Das Wahrscheinlichste ist, dass keiner von ihnen etwas geschrieben hat, sondern dass sie es von Weißgottwo abgeschrieben haben. Die Geschichten erscheinen mir zu literarisch für Gefangene. Und das brauche ich am wenigsten. Mein Wunsch und meine Aufgabe ist es nicht, aus Gefangenen falsche oder richtige Schriftsteller zu machen, sondern sie einfach zu aktivieren und wiedereinzugliedern. Frei nach dem Motto: Solange sie schreiben, stellen sie keinen Unfug an, beziehungsweise: Wer schreibt, denkt nichts Böses. Daran glaube ich selbstverständlich absolut nicht. Die ethische Dimension des schriftstellerischen Aktes, diese feuchten Träume von zweitklassigen literarischen Touristen auf irgendeiner PEN-Exkursion oder was auch immer! Es gibt Geschichten von literarischen Schelmen, die alle der Reihe nach beweisen, dass der Schreibakt an sich nicht befreit, aus dem Schreibenden macht er keine besseren Menschen, eher fanatischere und gewieftere. Wer schreibt, plant. Wer schreibt, ist dazu im Stande, sich auf tückische Weise zu wehren, wenn ihn der Staat anklagt. Wer schreibt, denkt schärfer. Auch böse Sachen. Wenn ich an faschistische, nazistische und kommunistische Autoren wie Céline, Benn, D’Annunzio, Becher oder Pound denke, dreht sich mir der Magen um. Gar nicht zu sprechen von den Massen der soliden, vielleicht sogar erstklassigen Autoren, die sich von jeher den Machthabern für eine Prise Erfolg und Privilegien verkauft haben. Maxim Gorki beim Besuch im Gulag schaut sich alles schön an und berichtet von den Naturschönheiten, den Moskitos im Sommer und den schweren Wintern am Weißen Meer. Oder Neruda und seine Oden an Stalin, der selber ein Dichter war und nicht mal ein ganz schlechter, was man von Diktatoren ja erwarten würde. Der Höhepunkt der Verschlingung von Poetik und Politik sind die unübersichtlichen Massen von Schriftstellern an führenden Stellen zu Kriegszeiten auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, Schriftsteller, die als Kriegsverbrecher endeten, Kriegsgewinnler, Nationalverräter, kleinliche Krümelkacker, notorische Narzissten und politische Aufsteiger, verkommene Politiker und Mörder. Wie schon immer. Die drei Erzählungen, die ich bekommen habe, könnten von drei verschiedenen Autoren geschrieben worden sein, vielleicht nur von einem, von zweien oder von allen dreien zusammen. Und nein, ich glaube nicht, dass sie deswegen, weil sie etwas geschrieben haben, und am wenigsten noch, weil sie eine Kriegserzählung geschrieben haben, zu besseren Menschen wurden. Dass sie für irgendetwas, das sie nach der Entlassung aus dem Knast erwartet, durchs Schreiben zum Überleben aktiviert und wiedereingegliedert werden.
Labyrinth
Der Krieg war beendet. Ich wurde mit meinen Einheiten geschickt, um die Stadt Sala an den neu gebildeten Staat anzuschließen. Sala lag weitab von jeder wichtigen Straße, wirtschaftlich und strategisch wertlos. Die Bewohner waren bekannt für ihre Sturheit, ihre Launenhaftigkeit und ihre Feindseligkeit gegenüber Fremden. Sie zogen nicht fort, sprachen einen unverständlichen Dialekt und heirateten ausschließlich untereinander. Unter der osmanischen Herrschaft war die Stadt von einer mächtigen Mauer umgeben, die man die zweite Mauer Chinas nannte. Ihre Ruinen sind noch heute von Weitem sichtbar. Dies zeugt von dem jahrhundertealten Wunsch der Einwohner der Stadt, so weit wie möglich von der Außenwelt entfernt zu sein. Die nachfolgenden kaiserlichen oder kommunistischen Herrscher konnten die Eigenwilligkeit der Bewohner von Sala nicht ändern. Bei Ausbruch des letzten Krieges wählten die Einwohner einen ungewöhnlichen Kurs, der sich von den anderen im ganzen Land unterschied, wo die Menschen sich für eine der Konfliktparteien entschieden haben. Sie legten ein dichtes, von Stacheldrahtzäunen und anderen Militärfallen durchzogenes Minenfeld um die Ruinen der mächtigen Mauer, unterbrachen jede Kommunikation mit der Außenwelt und schlossen sich in die eigene Stadt ein. Während über vier Jahre ein brutaler Krieg von Brüdern gegen Brüder tobte, blieb Sala eine Welt für sich. Während dieser Zeit kam niemand in die Stadt oder verließ sie. Jetzt, mit unserer Ankunft, war endlich das Ende des Eigensinns der Einwohner erreicht, ein Moment, in dem die Kommunikation mit dem Rest des Landes zusammen mit der militärischen und rechtlichen Ordnung wiederhergestellt werden würde. Tagelang räumten meine Männer die Hauptstraße, die direkt ins Zentrum der Stadt führte, von Sprengstoff und allen Arten heimtückischer Fallen. Es war ein Wunder, dass bei diesem gefährlichen Job niemand in die Luft gesprengt wurde. Während der ganzen Zeit waren in der Stadt keine Menschen zu sehen. Meine Männer wurden langsam von Beklommenheit überwältigt. Ich musste ständig bei ihnen sein und sicherstellen, dass ihre Moral nicht zu sehr sank. Nach sechs Tagen war die Allee endlich frei von Minen. Ich befahl ihnen, in voller Kampfausrüstung und mit größter Vorsicht in die Stadt zu ziehen, da ich nicht wusste, welche Überraschungen uns hinter der Stadtmauer erwarteten. Meine Einheiten rückten langsam und vorsichtig vor. Wir durchsuchten jedes Gebäude entlang der Allee, sicherten uns strategische Positionen und suchten nach zusätzlichen Fallen, während wir nach den Einwohnern der Stadt suchten. Die Stadt war völlig tot. Wir fanden keine Spuren von Unruhen, Kämpfen oder Umsiedlungen. Alle Häuser waren in einem lebenswerten Zustand, aber ohne Menschen, als ob sie von jemandem verlassen worden wären, der morgens zur Arbeit geht und nicht zurückkehrt. Wir sahen auf Tischen angeordnetes Besteck, offene Bücher auf mit einer dicken Staubschicht bedeckten Sofas, sich langsam drehende Mobiles über leeren Krippen und so weiter. Es war unheimlich und anders als alles, was ich in vier Jahren beim Militär erlebt hatte. Und ich hatte viele Dinge erlebt.
Am späten Nachmittag rückten wir zum Hauptplatz mit seinen drei funktionierenden Springbrunnen vor. Wir betraten das verlassene Rathaus und durchsuchten es von oben bis unten. Ich befahl, die Flagge des neuen Staates zu hissen. Ich trat auf den Platz, nahm meinen Helm ab und zündete mir eine Zigarette an. Meine Männer, müde von der Anspannung und ihrer schweren Ausrüstung, setzten sich neben die Brunnen. Beim Rauchen ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen. Die Straße, auf der wir ankamen und die, wie ich sicher war, geradeaus von der Stadt wegführte, endete nun fern in einer Kurve und einer Reihe von Gebäuden, von denen ich hätte schwören können, dass es sie einige Stunden zuvor noch nicht gab. Ich befahl meinen Männern sofort, die ganze Angelegenheit zu untersuchen. Zwei Stunden später kehrten sie zutiefst verunsichert zurück. Sie konnten immer noch keine Menschen finden, aber sie fanden auch nicht mehr den Weg, auf dem wir in die Stadt gekommen waren. Die Allee gliederte sich in ein Labyrinth von Gassen und immer kleineren Straßen, die nirgendwohin oder nur zurück zum Ausgangspunkt führten. Ich habe meine Männer aus nächster Nähe beobachtet, um sicherzugehen, dass sie mich nicht zum Narren hielten oder unter dem Einfluss irgendeiner Substanz standen. Aber das Einzige, was ich in ihren Augen finden konnte, war Angst. Diese Angst wuchs allerdings zusammen mit der Tatsache, dass unsere Navigationsinstrumente nicht mehr funktionierten. Ich sah mich um. Es wurde dunkel in der Stadt. Mir kam es so vor, als würden sich die Straßen um uns herum unmerklich bewegen und sich immer enger zusammenziehen. Mit ein paar meiner Männer machte ich mich auf den Weg, um mich auch selbst umzusehen. Als wir zum Hauptplatz zurückkehrten, war es bereits dunkel. Obwohl es absolut ausgeschlossen schien, begann ich zu glauben, dass sich die Stadt Sala, diese abgelegene kleine Stadt Sala mit uns allen in der Mitte, in ein kompliziertes Labyrinth verwandelt hatte, ohne dass es einen offensichtlichen Ausgang gab. Ich schaute auf den Balkon des Rathauses, wo unsere Fahne im Licht des aufgehenden Mondes wehte. Der Krieg war noch nicht vorbei. Für uns ging der Krieg weiter. Aber nicht auf Schlachtfeldern, in Frontgräben oder in verschiedenen militärischen Hinterhalten, sondern hier, in der schreienden Einsamkeit einer toten Stadt.
Fels
Alles, was ich im Leben kennengelernt habe, ist ein Kiesberg, unser Dorf und der Fels. Sie sagen, dass der Kiesberg seit Jahrhunderten wächst. Er ist so imposant, dass sein Schatten abends und morgens sogar die entferntesten Orte verdeckt und seine mächtigen Hänge von jedem Punkt im Königreich aus sichtbar sind. Mehrere tausend der Hütten in meinem Dorf stehen am Fuße. Jeder, der hier lebt, ist ein Sklave auf seinem eigenen Land. Wir dürfen weder gehen noch in Frieden leben. Unsere Meister wechseln alle paar Jahre oder Jahrzehnte, aber unser Schicksal bleibt unverändert. Der Felsen befindet sich auf der anderen Seite des Dorfes. Es ist nicht möglich, den Felsen zu beschreiben, da er für jeden Menschen immer anders aussieht. Das einzig Sichere ist, dass der Fels klein ist, viel kleiner als der Kiesberg, was ein eigentümliches Paradoxon ist, da der Kiesberg vollständig aus dem Material gewachsen ist, das wir aus dem Fels gegraben haben, sodass der Fels aufhören sollte zu existieren. Aber der Fels hält unserem Schweiß und unserer Anstrengung stand und bleibt jahrhundertelang gleich groß. Jeden Morgen treiben uns unsere Gebieter durch einen engen Tunnel ins Innere des Felsens. Wir wissen nie, was uns dort erwartet. Einmal ist das gesamte Innere mit Fresken der Heiligen Mutter Maria und orthodoxer Heiliger bemalt, das nächste Mal mit muslimischen Ornamenten, ein anderes Mal mit Fresken der katholischen Heiligen und der Kreuzigung. Unsere Aufgabe ist immer die gleiche. Wir verwenden Spitzhacken und andere Werkzeuge, um die Bilder von den inneren Sandwänden zu entfernen, alles, was dort erscheint, zu löschen, in Staub umzuwandeln und die Überreste von der Höhle zum Kiesberg zu bringen. Ich erinnere mich, als ich als Neunjähriger zum ersten Mal den Tunnel betrat und anhielt, als wäre ich von der Schönheit seines Inneren versteinert. Ich konnte nicht verstehen, wer etwas so Schönes geschaffen hatte, und noch weniger den Willen meiner Gebieter, all diese Schönheit zu zerstören. Nach Jahrzehnten des harten Grabens wurde ich fast völlig gleichgültig. Ohne innere Zweifel oder Vorbehalte schwinge ich meine Spitzhacke unter dem trüben Schein von Fackeln und spalte ebenfalls die Gesichter von Heiligen und hinduistischen Göttinnen, spalte Konfuzius’ Lächeln und die schönsten islamischen Ornamente. Mein Schicksal ist das Schicksal eines Zerstörers. Meine Seele ist gleich der Seele eines jeden Sklaven. Meine Hütte am Fuße des Kiesbergs ist so kalt wie alle Hütten in unserem Dorf. Trotzdem habe ich aufgehört zu fragen: Woher kommen all diese Bilder, all diese Schönheit in der Höhle? Wer erschafft sie unermüdlich, als würde er sich über uns lustig machen, die wir sie Tag für Tag aus den inneren Gewölben des Felsens reißen? Wer ruiniert unsere Existenz? Ich wurde als Sklave geboren und ich glaube, dass ich bald als Sklave sterben werde. Eines Tages werden wir es schaffen, das letzte Bild zu entfernen, das letzte Ornament zu zerstören, die letzte Figur, den letzten Namen oder ein flüchtiges Zeichen irgendeiner Art von Retter aus dem Weg zu räumen, die dünnen Wände des Felsens zu durchbrechen und das Tageslicht zu erreichen. Mein Schicksal ist entschieden, aber es wird ein Tag kommen, an dem meine Nachkommen den Felsen durchbrechen und ihn für immer vom Erdboden tilgen.
Baum
Ich bin ein fauler Baum. Ich bin nur noch ein weiterer Baum. Hierzulande, da wo ich wachse, standen früher viele herum. Dann kamen Leute, zuerst mit Äxten. Sie haben einen von uns gefällt, auseinandergesägt, auf Pferdegespanne verladen und weggefahren. So verschwand die große Kiefer. So verschwanden die Erlen und Kastanienbäume. Zu der Zeit wuchsen wir noch schneller, als uns die Menschen fällten. Dann kamen sie immer häufiger und in immer größerer Zahl. Sie begannen mit Motorsägen zu kommen und anderen Maschinen. Motorsägen stinken. Menschen stinken. Schon immer haben sie gestunken. Mich waschen der Regen und der Himmel. Der Mensch wäscht sich nur im eigenen Schweiß. Der Mensch stinkt. Vor Zeiten war ich Teil eines mächtigen Walds. Jetzt bin ich ein einsamer Wächter oben auf dem kahlen Hügel. Ich weiß nicht, warum man gerade mich hat stehen lassen. Oft kommen sie und bewundern meine mächtigen Äste. Im Herbst kommen sie Eicheln sammeln, die ich ihnen ausschütte. Für die Tiere, die die Menschen mästen und fressen, so sagen sie. Die Menschen verstehen und wissen nicht viel. Ich würde sogar sagen, dass Menschen nichts wissen und gar nichts verstehen. Manchmal kommen Kinder in meinen Schatten und klettern über meine Wurzeln. Manchmal lehnt sich ein verliebtes Paar an mich. Mein Stamm ist zerfurcht von ihren Zeichen. Ich verstehe sie nicht, doch es scheint, als würden sie den Menschen viel bedeuten. Einmal kamen Menschen und wollten mich fällen. Als sie da waren und die in mich geritzten Zeichen sahen, stellten sie ihre Sägen ab und lasen eine Zeit lang, was auf meinem Stamm steht. Das ist deiner, Jugoslav, sagte einer von ihnen und zeigte auf eine der vernarbten Stellen an meinem Stamm. Alle lachten ihn aus. Ich weiß nicht, warum sie mich nicht gefällt haben. Den Holzfäller, über den sich die anderen lustig machten, habe ich schon als Kind gut gekannt. Ein paar Winter später kam er wieder. Es herrschte Krieg, und es war kurz vor Ende der Nacht. Eine größere Menge Menschen kam. Sie hatten sieben gefesselte Männer dabei. Immer wieder stieß einer der Begleiter mit dem Kolben einem der Gefesselten in die Rippen, sodass der aufstöhnte. Keiner kümmerte sich darum. Im Dunkel stolperte dann der, der sich unter den Gefangenen austobte, über eine meiner ausladenden Wurzeln. Er fiel hin. Du fauler Baum, grummelte er und entließ einen Feuerstoß aus seinem Gewehr in meinen Stamm. Jugoslav stieß ihn zu Boden und nahm ihm die Waffe ab. Er spuckte auf den Mann, der sich vor Schmerz wälzte. Jugoslav war ihr Anführer. Alle stanken nach Mensch und Schnaps. Sie warfen Stricke über meine Äste und hängten alle sieben Gefesselten auf. Einen nach dem anderen. Als sie fertig waren, stellten sie sich rund um meinen Stamm und pissten mich an wie Hunde. Dann gingen sie. Die Gehängten baumelten ein paar Tage an mir. Ich kannte das. Es war nicht das erste Mal, dass Menschen an meinen Ästen andere Menschen aufhängten. Das geschah immer wieder. Ich hab die meisten vergessen, die an mir hingen. Tote Menschen schwingen alle recht ähnlich. Doch die, die andere aufgehängt haben, vergesse ich nie. Auch Jugoslav nicht. Ich wusste, dass wir uns bald wieder begegnen würden. Bäume wissen so etwas einfach. Der nächste Winter war eisig, sodass meine Rinde aufplatzte. In der Nähe verklangen die Echos von Gewehren und der Knall von Haubitzen. Auf einmal roch ich ihn. Er kam näher. Ich roch seine Angst, er war verwundet. Er hinkte, hinterließ im Schnee eine Blutspur. Sie verfolgten ihn. Er schleppte sich an meinen Stamm und lehnte sich an mich, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, unweit der Stelle, an der er als Kind seinen Namen in mich ritzte. Jeden Moment würden seine Verfolger auftauchen, und es wäre aus. Jugoslav, rief ich mit meinen Ästen. Er hörte mich nicht. Seine trüben Augen suchten verzweifelt einen Ausweg. Jugoslav, es ist Zeit, rief ich. Ich öffnete meinen hohlen Stamm und versteckte ihn in mir. Die Verfolger suchten überall lange nach ihm. Sie konnten nicht verstehen, wohin er verschwunden war. So ist es eben. Menschen verstehen und wissen aber auch gar nichts. Seitdem ist Jugoslav bei mir in Sicherheit. Ich gebe ihn niemandem. Wir saugen zusammen die Säfte der Erde und alles, was unter der Erde vergraben liegt. Ich bin ein Baum. Man sagt, ich sei ein fauler Baum. Ein Baum mit einem Menschen in mir. Noch stehe ich.
12. September
Auf dem Hof werde ich von meiner Nachbarin Paula aufgehalten. Sie inspiziert mich genau, als hätte ich etwas im Gesicht. Dann sagt sie: »Es ist aus und vorbei mit dir, du bist schwarz gekleidet wie ich, und es ist aus mit dir. Liebes Kind, du wirst unsterblich werden müssen«, sagt sie.
»Und wie stellt man das an?«, frage ich sie.