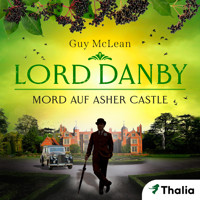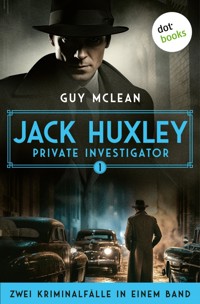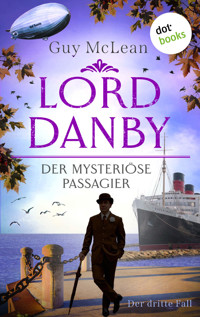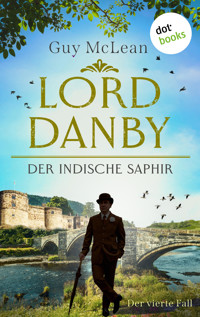
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Landhaus-Krimivergnügen wie von Agatha Christie nach mehreren Gläsern Portwein! Skipton Castle in North Yorkshire, 1936. Als der berüchtigte, Crenshaw-Saphir – auf dem, wie es heißt, ein alter Fluch liegt – nach England überführt wird, kann Lord Danby sich dieses Spektakel natürlich nicht entgehen lassen. Doch der erhabene Anlass wird schon bald von einem pietätlosen Vorkommnis erschüttert: Man findet den rechtmäßigen Erben des Edelsteins, Sir Godfrey Lyndhurst, tot in seinem Arbeitszimmer. Hat der Fluch ihn dahingerafft? Oder war es Mord? Während Danby niedere Dinge wie die Aufklärung des Falls eigentlich seinem Freund, Chiefinspector Grover, überlassen will, kommt er nicht umhin, weitere rätselhafte Vorkommnisse zu bemerken. Steckt vielleicht Aimee Upjohn dahinter, die als gefeiertes Medium die feine Gesellschaft in die Welt des Okkulten einführt? Ist es der anwesende Reporter des Daily Telegraph, der eine Sensationsstory wittert? Oder vielleicht der opernliebende Museumsdirektor aus Mailand? Wer oder was es auch ist, sein teuflisches Spiel scheint tödlich zu sein … Der vierte Fall für Lord Danby, den unfreiwilligen Detektiv der englischen Upper Class. Jeder Band in dieser humorvollen Murder-Mystery-Reihe kann unabhängig gelesen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Skipton Castle in North Yorkshire, 1936. Als der berüchtigte, Crenshaw-Saphir – auf dem, wie es heißt, ein alter Fluch liegt – nach England überführt wird, kann Lord Danby sich dieses Spektakel natürlich nicht entgehen lassen. Doch der erhabene Anlass wird schon bald von einem pietätlosen Vorkommnis erschüttert: Man findet den rechtmäßigen Erben des Edelsteins, Sir Godfrey Lyndhurst, tot in seinem Arbeitszimmer. Hat der Fluch ihn dahingerafft? Oder war es Mord? Während Danby niedere Dinge wie die Aufklärung des Falls eigentlich seinem Freund, Chiefinspector Grover, überlassen will, kommt er nicht umhin, weitere rätselhafte Vorkommnisse zu bemerken. Steckt vielleicht Aimee Upjohn dahinter, die als gefeiertes Medium die feine Gesellschaft in die Welt des Okkulten einführt? Ist es der anwesende Reporter des Daily Telegraph, der eine Sensationsstory wittert? Oder vielleicht der opernliebende Museumsdirektor aus Mailand? Wer oder was es auch ist, sein teuflisches Spiel scheint tödlich zu sein …
Über den Autor:
Guy McLean ist ein Pseudonym des Autors Stefan Lehnberg. Er ist ein wahres Multitalent. Schauspiel, Regie, Schriftstellerei – in all diesen (und zahllosen weiteren) Bereichen ist der Wahlberliner unglaublich erfolgreich. Er ist nicht nur der Verfasser der Lord-Danby-Reihe und mehrerer Theaterstücke, sondern war unter anderem als Autor für Harald Schmidt und Anke Engelke tätig. Seine tägliche Radiocomedy »Küss mich, Kanzler«, bei der Lehnberg als alleiniger Autor, Regisseur und männlicher Hauptdarsteller fungierte, brachte es auf über 3000 Folgen, und sein Roman »Mein Meisterwerk« wurde mit dem Ephraim-Kishon-Satirepreis ausgezeichnet. Weitere Höhepunkte seiner Karriere markieren die Veröffentlichung von »Das persönliche Tagebuch von Wladimir Putin«, »Comedy für Profis – Das Praxisbuch für Autoren und Comedians« sowie die drei Goethekrimis »Durch Nacht und Wind«, »Die Affäre Carambol« und »Die Briefe des Ikarus«. Außerdem sieht er gut aus, ist hochintelligent und verfügt über einen edlen Charakter. Doch ist ihm nichts davon zu Kopf gestiegen. Im Gegenteil: Er ist immer der sympathische Kumpel von nebenan geblieben, der sich auch keineswegs zu schade ist, mal ein paar biographische Zeilen über sich selbst zu schreiben.
Die Website des Autors: www.Lehnberg.com/
In der Reihe um »Lord Danby« erschienen bisher bei dotbooks als eBook- und Printausgaben die Bände:
»Lord Danby – Mord auf Asher Castle« – auch als Hörbuch bei Thalia erhältlich
»Lord Danby – Die Deauville-Affäre« – auch als Hörbuch bei Saga Egmont erhältlich
»Lord Danby – Der mysteriöse Passagier«
Weitere Bände sind in Vorbereitung.
Unter dem Pseudonym T. H. Lawrence erschien außerdem im St. Benno Verlag »Der Teufel von Dublin«, eine Anthologie neuer Father-Brown-Krimis.
***
Originalausgabe Januar 2025
Copyright © der Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
Syndikat-Logoverwendung: SYNDIKAT e.V.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98952-642-6
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Guy McLean
Lord Danby – Der indische Saphir
Der vierte Fall
dotbooks.
Bei der Herstellung dieses Buches sind
keine Mitglieder des Britischen Königshauses
zu Schaden gekommen.
Der Verfasser
Dramatis Personae
Lord Percival Danby
Basil Grover – Chief-Inspector bei Scotland Yard
Sir Godfrey Lyndhurst – Familienoberhaupt
Frederick Lyndhurst – sein jüngerer Bruder
Vivian Lyndhurst – seine noch jüngere Schwester
Dr. Quain – sein Rechtsanwalt
Adrian Crisp – sein Sekretär
Colonel Westinghouse – sein bester Freund
Ludovic Melville – Reporter
Aimee Upjohn – Medium
Dottore Lorenzetti – Museumsdirektor
Barnes – Butler
Eileen – Haushälterin
Constable Merriweather
»Man kann nie zu reich oder zu dünn sein.«
Wallis SimpsonDuchess of Windsor
Prolog
Ich erinnere mich noch recht gut an jenen Abend im September 1936, als die Ereignisse, von denen ich hier berichten will, ihren Anfang nahmen. Es war ein überaus anstrengender Tag gewesen und entsprechend erschöpft war ich, als ich die Räumlichkeiten des legendären Athenæum-Clubs in London betrat, jenes Refugiums für den gehobenen Gentleman an der Pall Mall, welches nicht nur mich, sondern auch schon Persönlichkeiten wie Walter Scott, Charles Darwin, Rudyard Kipling und etliche Nobelpreisträger zu seinen Mitgliedern zählen durfte und über das Spötter (in Wahrheit jedoch heimliche Bewunderer, die von plebejischem Neid zerfressen sind) sagen, dass man, wenn die Fenster offenstehen, draußen das Geld riechen kann.
Den Nachmittag hatte ich im Oberhaus verbracht. Eine lästige Verpflichtung, der wir Lords nun einmal nachzukommen haben und auf die jeder von uns nur allzu gern verzichten würde, wenn es nicht gleichzeitig den Verlust eines alten Privilegs bedeuten würde, was natürlich niemand wollen kann.
Thema der Oberhausabstimmung war die Zweite Londoner Flottenkonferenz. Wenn ich es richtig verstehe, habe ich für dasjenige Ding gestimmt, das dort beantragt wurde.
Den frühen Abend verbrachte ich dann gemeinsam mit Onkel Albert und Tante Millicent in Covent Garden, wo ich die beiden in das dortige Opernhaus eingeladen hatte. Nun dürfte ja allgemein bekannt sein, dass ich keineswegs ein Freund der Oper bin; das dramatische Gehabe auf der Bühne, mit dem inneren Befindlichkeiten dort Ausdruck verliehen wird, muss einen jeden Briten peinlich berühren, aber die beiden Verwandten hatten mich einige Zeit zuvor in ihr Heim geladen, was selbstverständlich mit einer Gegeneinladung pariert werden musste, und da die Alternative darin bestanden hätte, mich mehrere Stunden lang mit den beiden zu unterhalten, schien mir eine Oper doch das kleinere Übel zu sein, zumal niemand daran Anstoß nimmt, ja, es in manchen Kreisen schon fast zum guten Ton gehört, wenn man eine solche im seligen Theater-Schlummer verbringt, was hingegen in einem Gespräch vis-à-vis nicht so gern gesehen wird. Zudem war mir das Glück hold, wurde doch an diesem Abend zu meiner freudigen Überraschung keine Oper gegeben, sondern ein Ballett, was eindeutig vorzuziehen ist, da ich anmutigem Gehopse von schönen jungen Damen durchaus einiges abgewinnen kann.
Etwa gegen elf betrat ich dann den Athenæum-Club, bereit, den Abend in aller Ruhe mit ein paar perfekt gemixten Drinks ausklingen zu lassen. Noch ahnte ich nicht, dass ich bereits wenige Minuten später erneut in eine Kette unerquicklicher verbrecherischer Ereignisse verwickelt werden würde, wie ich sie unglücklicherweise bereits mehrfach erleben musste.
Gemäß meiner Gewohnheit, blieb ich kurz in der Eingangshalle stehen, um die dort angeschlagenen Bekanntmachungen zu überfliegen, und musste zu meinem Schrecken feststellen, dass unser Clubmitglied Sir Peregrine Drake verstorben war. Diese Tatsache war keineswegs verwunderlich, da der alte Peregrine jemand war, der ... nun, wie soll ich es ausdrücken? Ich wüsste nicht, dass es ein Wort dafür gibt. Am ehesten könnte man wohl sagen, dass er das Gegenteil eines Hypochonders war: Er selbst hielt sich für kerngesund, obwohl für jeden anderen unübersehbar war, dass der Mann ein gesundheitliches Wrack darstellte, dessen Dahinscheiden nur noch eine Sache von wenigen Minuten sein konnte. Infolgedessen war auch ich ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass Sir Peregrine seit Jahren tot war, doch nun wurde mir bewusst, dass ich mich in einer völlig ungerechtfertigten Sicherheit gewiegt hatte und diesem unangenehmen Patron theoretisch jederzeit hätte begegnen können. Durchaus ein kleiner Schock für mich, lediglich dadurch abgemildert, dass seine rückwirkende Auferstehung gleichzeitig mit seinem (diesmal endgültigen) Ableben verbunden war.
Alsdann zog ich mich in die legendäre Bibliothek des Clubs zurück, welche achtzigtausend Bücher umfasst – alle in tadellosem Zustand, noch nie habe ich ein Clubmitglied eines davon lesen sehen – ließ mich in einen der schweren Lederfauteuils fallen sowie mir einen Singapore Sling servieren und vertiefte mich in die Lektüre des frisch gebügelten Daily Universal Registers. (Unter diesem Namen wurde die Zeitung ursprünglich gegründet. 1788 wurde sie in Times umbenannt, doch in unserer Familie war es schon immer Tradition, Wert auf Traditionen zu legen, und wir waren von jeher der Ansicht, dass man nicht jede x-beliebige Veränderung gleich Hals über Kopf mitmachen muss.)
Nachdem ich mich – weniger der Neigung als der Pflicht gehorchend – über die neuesten glänzenden Erfolge des Britischen Empires und in der allseits beliebten Kolumne des Court Circular über die Nachrichten vom Hofe informiert hatte, wandte ich mich der in aller Regel wesentlich unterhaltsameren London-Rubrik zu. Auch heute wurde ich nicht enttäuscht. Ich fand einen weiteren ausführlichen Bericht über den mysteriösen Verbrecher, der seit einiger Zeit des nachts in Londoner Leichenschauhäuser einbrach und dortselbst den Leichen mit einem schweren Gegenstand die Schädel zertrümmerte. Offenbar war dieser Mann – die Presse hat bereits einen recht hübschen Namen für ihn gefunden: Jack the Hammer – vollkommen wahnsinnig oder zumindest fast vollkommen, denn es war immerhin ein feiner Zug von ihm, dass er seine Taten an Toten ausführte und nicht an Lebenden.
Zusätzlich erfreulich war, dass ich mit George Fenwick, einem weiteren Clubmitglied, eine Woche zuvor eine Wette über fünfzig Guinees abgeschlossen hatte, die genau diese Taten zum Inhalt hatte. Der gute George hatte den Standpunkt vertreten, dass Scotland Yard den Mann binnen einer Woche dingfest machen würde, während ich hingegen davon ausgegangen war, dass genau das nicht geschehen würde. Der Zeitungsartikel von heute erklärte mich zum Gewinner.
(Übrigens ist der Gewinn bis heute nicht an mich ausgezahlt worden. Also Georgie, alter Knabe, falls du das hier liest, bring mir das Geld doch bei Gelegenheit vorbei. Du weißt ja, ich bin fast jeden Abend im Club, es sollte also kein Problem darstellen. Nicht, dass ich das Geld benötigen würde, aber es geht ums Prinzip.)
Soeben wollte ich die Zeitung umblättern, als der Saaldiener plötzlich neben mir auftauchte und sich mit einem dezenten Räuspern zu mir herunterbeugte. »Ein Telegramm für Eure Lordschaft.«
Dies war keineswegs ein ungewöhnlicher Vorgang. Da ich viel unterwegs bin und mich eher selten zu Hause aufhalte, senden Leute, die mich kennen, Telegramme, die an mich gerichtet sind, lieber gleich in den Athenæum-Club, weil ich hier am zuverlässigsten anzutreffen bin. Neugierig nahm ich das Telegramm vom Silbertablett und riss den Umschlag auf. Der Inhalt des Schreibens lautete wie folgt:
Lieber Percy – Stopp
Einlade dich Sonnabend achtzehn Uhr Skipton – Stopp
Crenshaw anwesend! – Stopp
Mitbringe Freund Grover – Stopp
RSVP umgehend!!! – Stopp
Hochachtungsvoll Lyndhurst – Stopp
Ich muss zugeben, dass mich dieses Telegramm zunächst ein wenig überraschte, denn ...
Doch nein, vielleicht sollte ich meiner ratlosen Leserschaft zuvor jene Teile des Telegramms erläutern, die vermutlich etwas rätselhaft anmuten: Mit Skipton war der Wohnort von Sir Godfrey Lyndhurst gemeint: Skipton Castle, eine normannische Burg aus dem zwölften Jahrhundert, etwa zweihundert Meilen nördlich von London in North Yorkshire gelegen. Bei Crenshaw handelte es sich nicht um eine Person, sondern um den berühmt-berüchtigten Crenshaw-Saphir. Dieser Stein hatte eine faszinierende Geschichte. Entdeckt wurde er im Jahre 1889 in einer Mine auf Madagaskar. Es handelte sich um einen sogenannten Padparadscha-Saphir, und somit – aufgrund seiner extremen Seltenheit – um einen der wertvollsten Edelsteine der Welt. Sein erster Besitzer war ein amerikanischer Millionär namens William Crenshaw gewesen, der ihn seiner bildhübschen Ehefrau zur Hochzeit schenkte. Drei Tage darauf verstarb die blutjunge und bis dato kerngesunde Frau an einer rätselhaften Krankheit. Gebrochenen Herzens veräußerte Crenshaw alles, was ihn an seine dahingeschiedene Liebe erinnerte, darunter auch den Padparadscha-Saphir. Und spätestens hier fangen die Dinge an, mysteriös zu werden. Auch der neue Besitzer, ein Mr. Valentine aus Rhode Island, segnete innerhalb von zehn Tagen das Zeitliche. Das Schiff wiederum, das den Saphir dem neuen Besitzer, seinem Sohn, überbringen sollte, die H.M.S. Olympia, geriet in einen für die Jahreszeit völlig unüblichen Hurrikan und sank. Nur wenige Passagiere konnten sich in die Boote retten, unter ihnen auch der Mann, der mit dem Transport des Saphirs betraut war. Er starb eine Woche später an einer Lungenentzündung, die er sich in der feuchtkalten Nachtluft des Atlantiks zugezogen hatte. Ich will hier nicht die ganze Geschichte des Saphirs wiedergeben, daher sei nur Folgendes gesagt: Jedem, in dessen Besitz der Saphir in den nächsten vierzig Jahren kam, unter ihnen ein leibhaftiger Maharadscha, stießen furchtbare Unglücksfälle zu. Viele starben, manche verarmten oder wurden von anderweitigen Schicksalsschlägen getroffen. Es hieß, dass ein Fluch auf dem Juwel lastete, was aber kurioserweise den Wert des Steins nicht etwa minderte, sondern ihn mit jedem neuen Unglücksfall nur weiter erhöhte.
Schließlich und endlich gelangte der Crenshaw-Saphir vor neun Jahren in den Besitz von Lord Ellsworth Lyndhurst, Vize-Gouverneur von Bombay und Vater von Sir Godfrey Lyndhurst. Alarmiert durch die unheilvolle Geschichte des Steins stiftete Lord Lyndhurst diesen umgehend als Dauerleihgabe dem Indischen Nationalmuseum in Bombay, wo er hinfort ohne jeden weiteren Zwischenfall verblieb.
Zumindest bis vor drei Monaten, als Lord Ellsworth Lyndhurst in gesegnetem Alter von dreiundsiebzig Jahren verschied und der Saphir nun in den Besitz von Godfrey Lyndhurst überging. Dieser forderte das Museum in Bombay auf, den kostbaren Stein umgehend nach England zu überstellen, doch das Museum weigerte sich und zog sich auf obskure indische Gesetze zurück. Hierauf sah sich Lyndhurst veranlasst, den Anwalt der Familie, einen gewissen Dr. Quain, nach Bombay zu entsenden, welcher dortselbst Kontakt mit dem Amt des Gouverneurs aufnahm und mit dessen Hilfe in einem zähen juristischen Kleinkrieg schließlich die Herausgabe des Juwels erstreiten konnte. Ich weiß über all diese Vorgänge deshalb so genau Bescheid, weil die gesamte englische Presse wochenlang über kaum etwas anderes berichtet hatte. Die gesamte Nation hatte jedes noch so unbedeutende Detail dieses juristischen Scharmützels begierig aufgesogen und je länger die Sache andauerte, desto mehr entwickelte sie sich in den Köpfen der Leute zu einer Frage, bei der Englands Prestige auf dem Spiel stand, und als schließlich die Übersendung des Saphirs mit der Jubel-Schlagzeile
Endlich! Crenshaw kehrt heim!
angekündigt wurde, empfanden viele große Erleichterung und tiefe Genugtuung.
Offenbar war der siegreiche Dr. Quain inzwischen im Begriff, nach Skipton zurückzukehren und den Saphir seinem neuen Besitzer zu überreichen. Selbstredend war ich entzückt, dass es nun ausgerechnet mir vergönnt sein sollte, die geheimnisumwitterte Preziose persönlich in Augenschein zu nehmen. Allerdings war ich – wie bereits weiter oben angedeutet – durchaus ein wenig überrascht, dass mir diese Ehre zuteilwurde, denn Lyndhurst und ich waren keineswegs Freunde, eher entfernte Bekannte, wir hatten uns bestimmt an die sechs Jahre nicht gesehen und hielten im Wesentlichen nur durch die Übersendung der üblichen Kiste Wein anlässlich von Verpflichtungen wie Geburtstag und Weihnachten die Verbindung, doch bald wurde mir klar, dass die nächsten beiden Zeilen des Telegrammes bereits die Auflösung des Rätsels verhießen: Lyndhurst forderte mich auf, »Freund Grover« mitzubringen. Für diejenigen unter den Lesern, welche aus unerfindlichen Gründen mit meinen früheren Berichten nicht vertraut sind, sei kurz erläutert, dass es sich bei besagtem Grover um Chief-Inspector Basil Grover von Scotland Yard handelt, der jedoch – wie ich ausdrücklich feststellen möchte – keineswegs ein »Freund« von mir ist, sondern den ich bei irgendeinem, mir längst entfallenen, gesellschaftlichen Anlass, mal kennengelernt habe. In seiner griesgrämigen Art hatte er keinen besonderen Eindruck bei mir hinterlassen, allerdings mochte ich seinen Hund, einen Bernhardiner namens Snubby, und ich verbrachte die nächste Stunde – und danach noch einige weitere Male – damit, für den vierbeinigen Racker Stöckchen zu werfen. Anschließend waren wir noch bei ein oder zwei Gelegenheiten zufällig gemeinsam in einen Kriminalfall verwickelt, aber von Freundschaft kann da wahrlich nicht die Rede sein. Der tatsächliche Grund, warum ich Grover mitbringen sollte, war ganz zweifellos ein anderer. Sir Godfrey bat zu einem Empfang, bei dem er mit dem Crenshaw-Saphir gehörig rumprotzen wollte, war sich jedoch nicht nur der Tatsache bewusst, dass so eine Zusammenkunft möglicherweise auch lichtscheues Gesindel anlocken konnte, sondern auch der traurigen Wahrheit, dass das Engagieren von Sicherheitspersonal leider mit pekuniären Belastungen verbunden war, wohingegen ein privat eingeladener Chief-Inspector den gleichen Zweck erfüllte, jedoch nur mit den Aufwendungen für Verpflegung zu Buche schlug. Ein Umstand, den Sir Godfrey, der in diesem Leben im Grunde nur drei große Leidenschaften pflegte, zu denen auch das Geldsparen gehörte (die anderen beiden waren Puzzles-lösen und Leute-beleidigen), außerordentlich befriedigend wirken musste. Und dies war zweifellos auch der Grund, warum Lyndhurst auf eine umgehende Rückantwort bezüglich meines – oder wohl doch eher Grovers – Erscheinens so dringend Wert legte. Er musste schnellstens wissen, ob der Chief-Inspector kommen würde, oder ob doch noch ein Sicherheitsmann engagiert werden musste.
Grovers Einverständnis voraussetzend – es gab damals in ganz England keinen Mann und keine Frau, die nicht Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hätten, an jedem beliebigen Ort zu erscheinen, wenn die Besichtigung des Crenshaw-Saphirs in Aussicht stand – sandte ich umgehend ein Antwort-Telegramm, in dem ich unser Kommen bestätigte.
Dass diese Einladung schon bald eine Reihe von grauenvollen Wendungen nehmen sollte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
Erster Teil
Kapitel 1
Zwei Tage später, um zehn Uhr fünfundfünfzig, betrat ich an der Victoria Station das Erste-Klasse-Abteil des ersten Zuges in einer Reihe von Umsteigezügen, die mich vorbei an Oxford, Peterborough, Stoke-on-Trent, Manchester und Leeds nach Skipton bringen würde, wo man, wie ich inzwischen durch ein weiteres Telegramm von Sir Godfrey erfahren hatte, mich und alle anderen anreisenden Gäste abholen und zur Burg heraufbringen würde.
Pünktlich um zehn Uhr neunundfünfzig ertönte der Pfiff des Bahnhofvorstehers und der Zug setzte sich fauchend in Bewegung.
Neben mir saßen zwei Jungspunde, die eifrig darüber diskutierten, welche Art von Geschenk wohl am geeignetsten wäre, ihre Angebeteten zu betören. Ich hatte Mitleid mit den beiden Galanen, zunächst natürlich schon bei dem Gedanken, dass die Damen ihres Herzens in Leeds lebten, so dass wohl nicht allzu viel mit diesen los sein konnte, aber auch auf Grund der kompletten Unerfahrenheit der beiden und der haarsträubenden Ideen, die sie von sich gaben. Schließlich konnte ich es nicht länger ertragen und erbarmte mich der beiden Grünschnäbel. »Was Frauen betrifft«, so klärte ich die beiden auf, »gibt es nur ein Geschenk. Und bei diesem handelt es sich ganz simpel um Blumen.« (Und natürlich um Schmuck, aber so weit waren die beiden noch lange nicht, also schwieg ich von diesem Thema still.) »Als normalem Menschen«, so fuhr ich fort, »kann einem natürlich nicht einleuchten, was denn an Blumen so bemerkenswert sein soll, doch Frauen empfinden das anders. Sicher, Blumen sind ganz hübsch anzusehen, doch kein Mann würde – sollte er plötzlich aus unerfindlichen Gründen den Drang verspüren, sein Heim zu dekorieren – auf die Idee verfallen, sich Blumen hinzustellen. Er würde sich, ganz normal, ein Ölgemälde eines stolzen Dreimasters in sturmumtoster See an die Wand hängen. Oder eines von einem stolzen General, der mit hoch erhobenem Säbel auf einem sich aufbäumenden Pferd sitzt – soeben im Begriff, den Befehl an seine Truppen zu geben, eine freche Nation in ihre Schranken zu weisen. Das ist etwas Solides, das nicht an Wert verliert, sondern eines Tages sogar vererbt werden kann und dann im Laufe der Jahrhunderte immer mehr an Wert gewinnt. Blumen hingegen sind wertlos und nutzlos. Man kann sie nicht trinken, niemanden damit schlagen und nach wenigen Tagen sind sie auch als Raumzierde unbrauchbar. Während jeder Mann all diese Eigenschaften als Nachteile sieht, sind es für eine Frau jedoch Vorteile. Wenn ihnen ein Mann Blumen verehrt, kann sie sich völlig sicher sein, dass der Mann ihr nicht etwas schenkt, das er sowieso schon zu Hause herumliegen hat und nicht mehr braucht, so wie beispielsweise einen Regenschirm, den er während eines unerwarteten Regengusses bei einem Straßenhändler erworben hat und dessen Griff ihm nicht gefällt, oder ein Buch, welches in seiner Bibliothek zufällig doppelt vorhanden ist. Auch darf sie davon ausgehen, dass er die Blumen nicht selbst als Geschenk erhalten hat, das er nun weiter verschenkt. Nein, bei Blumen muss er die Mühe auf sich nehmen und sie kaufen, was schon auf eine gewisse Ernsthaftigkeit seiner Absichten schließen lässt. Doch damit nicht genug, die Frau möchte sich sicher sein, dass sie nicht nur jetzt geliebt wird, sondern auch, dass es in Zukunft so bleibt, daher erscheint Frauen auch das Verwelken der Blumen nicht als Nachteil, sondern als ein weiterer wichtiger Vorteil. Der Mann soll niemals denken dürfen, dass er mit einem einmaligen Geschenk von Blumen nun seine Pflicht und Schuldigkeit auf alle (oder auch nur auf einige) Zeit getan hätte, wohingegen ja das Regenproblem mit dem Geschenk eines Regenschirms auf ewig gelöst wäre, nein, die Frau verlangt ständig neue Liebesbeweise, da die alten schon nach wenigen Tagen nichts mehr wert sind. Und die Geschenke dürfen – sollten die beiden bereits verheiratet sein – auch keinesfalls mit dem geheimen Hintergedanken des Mannes erworben werden, dass jedes Geschenk von bleibendem Wert, wie zum Beispiel Schmuck, auch gleichzeitig eine Wertanlage für ihn selbst darstellt. Kurz und gut, meine jungen Freunde, vergesst alle anderen Geschenke, mögen sie auch noch so originell, geistreich, ja sogar wertvoll sein. Es geht der Frau nicht um das Geschenk an sich, sondern darum, dass der Mann die Mühe auf sich nimmt, ständig neue – für ihn völlig nutzlose – Geschenke herbeizuschaffen.«
Atemlos hatten die beiden jungen Herrn diese Perlen der Weisheit begierig in sich aufgesogen und als sie in Leeds schließlich ausstiegen, befanden sie sich, berechtigterweise, in vortrefflichster Stimmung.
Ursprünglich war mein Abteil bis zum letzten Platz gefüllt gewesen, doch je weiter wir in den Norden vorgedrungen waren, desto mehr hatte es sich naturgemäß geleert. Menschen, die nicht den Vorzug haben, in England leben zu dürfen, ist es wahrscheinlich nicht bewusst, aber praktisch alles, was irgendwie von Bedeutung ist, befindet sich bei uns im Süden des Landes und es gibt kaum einen vernünftigen Grund, sich an Orte zu begeben, die nördlich von Oxford und Cambridge liegen, insbesondere nicht in das kleine Örtchen Skipton, das ursprünglich Sheep-Town hieß, weil es dort von Schafen nur so wimmelt, was nun wahrlich kein Anlass ist, eine beschwerliche Reise auf sich zu nehmen, und so kam es, dass mir, nachdem wir Manchester passiert hatten – und ich, eingeschläfert durch die reizlose Gegend vor dem Fenster und dem monotonen Rattern des Zuges, wieder erwachte – mittlerweile nur noch ein einziger Passagier gegenübersaß. Ein äußerst wohlbeleibter Gentleman, um die dreißig mit pomadigem schwarzem Haar, Menjoubärtchen, Kinnbart und einem, für meine Begriffe, allzu schwülstigen Rasierwasser, dessen Anzug eindeutig von keinem englischen Schneider stammte, mir aber dennoch von guter Qualität zu sein schien. Eine Weile lang hatte er sich mit einer – inzwischen ausgestiegenen – Dame unterhalten, wobei mir bei ihm ein recht starker Akzent aufgefallen war, der mich mit einiger Sicherheit vermuten ließ, dass es sich bei ihm um einen Italiener handelte. Unverkennbar ein Opernsänger. Kurz nach Leeds wurde uns beiden in Ermangelung anderer Reisemöglichkeiten fast gleichzeitig bewusst, dass wir beide auf der Gästeliste von Sir Godfrey standen, und wir machten uns bekannt. Der Herr stellte sich als Dottore Lorenzetti vor, Direktor des Museo Civico di Storia Naturale di Milano, was zwar kolossal pompös klang, aber – wie er auf mein insistierendes Nachfragen schließlich doch einräumen musste – lediglich Naturhistorisches Museum von Mailand bedeutete.
Ferner gab er zu, ein sehr großer Opernliebhaber zu sein, was meinen ursprünglichen Verdacht hinsichtlich seiner Profession zumindest einigermaßen bestätigte. Er verriet mir sogar, dass er im Gepäck eine Schallplatte mit einer Aufnahme von Enrico Carusos Pagliacci an der Mailänder Scala mit sich führe, die als Gastgeschenk für Sir Godfrey bestimmt sei.
Er lächelte mit italienischer Hintergründigkeit, so dass sein dünnes Schnurrbärtchen sich schief in die Breite zog. »Schließlich ist dies das wichtigste Augenblick für Museen in aller Welt seit die Jahr 1920.«
Da sein Tonfall verriet, dass er völlig selbstverständlich davon ausging, dass jeder normale Mensch wissen musste, was es mit den alle Museen betreffenden Ereignissen von 1920 auf sich hatte, nickte ich kennerhaft, da ich mir vor einem Ausländer keine Blöße geben wollte. Dennoch schickte er eine Erläuterung hinterher. »In Russische Revolution wurden die Reichen enteignet, in Folge von das die Depots der Eremitage in Leningrad quollen uber von kostbaren Gemälden. Es waren so viele, dass die Kommunisten das Ubersicht verloren und gerne bereit waren, unzahlige Bilder, die sie ja hielten ohnehin für bourgeois, ins Ausland zu verkaufen, zu große Teil weit unter das echte Wert. Auch Tate-Galerie von England hat damals gekauft viele, viele Bilder.«
Dies war in der Tat eine interessante Information, zumal es das allererste Mal war, dass ich erfuhr, dass Kommunismus doch zu etwas nützlich war.
»Und nun es ist wieder so weit«, fuhr Lorenzetti fort. Er klopfte aufgeregt mit seinem Spazierstock auf den Boden. »Der Crenshaw-Saphir. Berühmt und berüchtigt. Wussten Sie, dass er hat sagenhafte neununddreißig Karat?«
Ich nickte ironisch. Das wusste nun wirklich jeder, weil es hunderte von Malen in der Zeitung gestanden hatte.
»Alle wollen ihn«, fuhr Lorenzetti mit einem seltsamen Glanz in den Augen fort, »aber ich werde ihn bekommen. Meine Museo ist bereit, ein astronomisch hohes Summe für diese Juwel zu zahlen.«
Sofort wurde mir der Mann ein wenig unsympathisch. Einmalige Juwelen sollten nicht außer Landes gebracht werden. Zumindest nicht, wenn es sich bei dem Land um England handelt. Es stand zu hoffen, dass Sir Godfrey sich nicht vom schnöden Mammon blenden lassen würde, doch was das betraf, war ich durchaus zuversichtlich. Godfrey Lyndhurst war ein sturköpfiger Widerborst von besonderem Format, der, wenn er andere nicht aus einem vernünftigen Grund vor den Kopf stoßen konnte, es einfach aus Lust an der Sache tat.
Nachdem wir schon eine Weile durch grüne Wiesen voller blökender Schafe gefahren waren, kam der Zug schließlich mit einem kreischenden Geräusch zum Stehen.
Wir waren in Skipton.
Kaum, dass wir ausgestiegen waren – was im Falle von Dottore Lorenzetti ein recht umständliches Unterfangen war, da er, wie ich nun entdeckte, ein steifes Bein hatte und seinen Stock tatsächlich benötigte – und wir durch den kräftigen Wind, der hier blies, umgehend Bekanntschaft mit dem charakteristischen Duft des Städtchens (verursacht von den überall herumliegenden natürlichen Hinterlassenschaften der Schafe) gemacht hatten, entdeckte ich auf dem Bahnsteig einen hoch aufgeschossenen, dünnen Mann in einem zerknitterten braunen Mantel, mit einem zerknitterten Hut, einem zerknitterten Gesicht und einem müde herunterhängenden Schnurbart – kurzum: Chief-Inspector Grover.