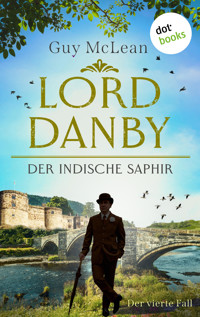5,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein britischer Gentleman und ein Scotland-Yard-Inspector ermitteln in verzwickt mörderischen Fällen … DER ERSTE FALL: England, 1936. Als spontanen Gefallen begleitet Lord Danby seinen Freund Chief Inspector Grover zu einem Dinner auf Asher Castle. Dort sind allerdings noch elf andere illustre Gäste geladen – und unter ihnen ein skrupelloser Mörder! Doch was könnte sein Motiv sein, die Gäste einen nach dem anderen aus dem Weg zu räumen? Als das Schloss durch heftigen Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten wird, spitzt die Lage sich bedenklich zu … DER ZWEITE FALL: 1936 in einem Kurort der Normandie. Nur auf die Einladung eines alten Schulfreundes hin ist Lord Danby bereit, in das Land der grässlichen Zigaretten und absurd geformten Brotlaibe zu reisen. Doch als Danby sich auf einer Yachtparty von all dem Elend ablenken will, stirbt der Gastgeber direkt vor seinen Augen! Die Ursache: Gift. Und plötzlich zählt Danby zu den Verdächtigen … Humorvolles Cosy Crime für Fans von Agatha Christie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Ähnliche
Über dieses Buch:
DER ERSTE FALL: England, 1936. Als spontanen Gefallen begleitet Lord Danby seinen Freund Chief Inspector Grover zu einem Dinner auf Asher Castle. Dort sind allerdings noch elf andere illustre Gäste geladen – und unter ihnen ein skrupelloser Mörder! Doch was könnte sein Motiv sein, die Gäste einen nach dem anderen aus dem Weg zu räumen? Als das Schloss durch heftigen Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten wird, spitzt die Lage sich bedenklich zu …
DER ZWEITE FALL: 1936 in einem Kurort der Normandie. Nur auf die Einladung eines alten Schulfreundes hin ist Lord Danby bereit, in das Land der grässlichen Zigaretten und absurd geformten Brotlaibe zu reisen. Doch als Danby sich auf einer Yachtparty von all dem Elend ablenken will, stirbt der Gastgeber direkt vor seinen Augen! Die Ursache: Gift. Und plötzlich zählt Danby zu den Verdächtigen …
Über den Autor:
Guy McLean ist ein Pseudonym des Autors Stefan Lehnberg. Er ist ein wahres Multitalent. Nicht nur ist er der Verfasser der »Lord Danby«-Reihe und mehrerer Theaterstücke, sein Roman »Mein Meisterwerk« wurde auch mit dem Ephraim-Kishon-Satirepreis ausgezeichnet. Weitere Höhepunkte seiner Karriere markieren die Veröffentlichung von »Comedy für Profis – Das Praxisbuch für Autoren und Comedians« sowie drei Goethekrimis. Außerdem sieht er gut aus, ist hochintelligent und verfügt über einen edlen Charakter. Doch ist ihm nichts davon zu Kopf gestiegen. Im Gegenteil: Er ist immer der sympathische Kumpel von Nebenan geblieben, der sich auch keineswegs zu schade ist, mal ein paar biographische Zeilen über sich selbst zu schreiben.
Die Website des Autors: www.Lehnberg.com/
Bei dotbooks erscheint unter Guy McLean die Reihe um »Lord Danby« mit den Romanen:
»Lord Danby – Mord auf Asher Castle«
»Lord Danby – Die Deauville-Affäre«
»Lord Danby – Der mysteriöse Passagier«Weitere Bände sind in Planung.
Die Kurzgeschichte »Lord Danby – Das Verbrechen des Jahrhunderts« ist außerdem in der Anthologie »Kerzenschein und Schneegestöber« erhältlich.
***
Sammelband-Originalausgabe April 2024
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Die Originalausgabe von »Lord Danby – Mord auf Asher Castle« erschien erstmals 2022 bei dotbooks; Copyright © 2022 dotbooks GmbH, München.
Die Originalausgabe von » Lord Danby – Die Deauville-Affäre« erschien erstmals 2023 bei dotbooks; Copyright © 2023 dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-099-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Lord Danby Sammelband« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Guy McLean
Lord Danby – Mord auf Asher Castle & Lord Danby – Die Deauville-Affäre
Zwei Krimis in einem Band
dotbooks.
Lord Danby – Mord auf Asher Castle
Der erste Fall
England, 1936: Eigentlich sollte es nur ein Gefallen für seinen Freund Chief Inspector Grover sein, als Lord Danby ihn spontan zu einem Dinner auf Asher Castle begleitet. Dort sind allerdings noch elf andere illustre Gäste geladen – und einer von ihnen ist ein eiskalter Mörder! Doch was könnte sein Motiv sein, sie einen nach dem anderen aus dem Weg zu räumen – und was sollten etwa eine versnobte Adelsdame, ein hitzköpfiger Argentinier, ein Bankier und ein Kommunist gemeinsam haben? Durch heftigen Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten, kann Inspector Grover nicht verhindern, dass sich die exzentrischen Gäste auf mannigfaltige Art in Gefahr begeben. Derweil sinniert Danby an der Weinbar darüber, dass der Täter, der bald erneut zuschlägt, mit einem nicht gerechnet hat – nämlich mit ihm!
Dramatis Personae
Lord Percival Danby
Basil Grover – Chief-Inspector bei Scotland Yard
Jack Prowley – Kommunist
Lady Edwina St. Clair – Lord Ashers Cousine
Miss Briggs – Lady Edwinas Krankenschwester
Rupert Massey – Immobilienhändler
Sardar – Indischer Sekretär von Rupert Massey
Eduardo Casares – Argentinier
Augustus Badel – Physikprofessor
Emerald Tate – Schauspielerin
Sir Randolph Woolridge – Bankier
Hyacinth Smith – Schriftstellerin
James Morton – Kapitän zur See a. D.
Cecil Galloway – Schauspieler
Metcalfe – Butler
sowie
???
Zitat
»Sparen ist eine sehr schöne Sache.
Besonders, wenn es die Eltern für einen erledigt haben.«
Winston Churchill
Erster Teil
Kapitel 1
»Es gibt in der Tat nichts Langweiligeres auf der Welt als einen Kriminalroman«, sagte ich zu Chief-Inspector Grover, der neben mir auf dem Beifahrersitz saß, während wir in meinem schwarzen 1935 Rolls Royce Phantom Jonckheere Coupé durch die verschneiten Landschaften von Wiltshire brausten und ... Doch halt! Wo bleiben meine Manieren? Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Lord Percival Danby. Ich bin – und werde es immer sein – ein Jahr jünger als das glorreiche Jahrhundert, in dem wir leben. Wir schreiben das Jahr 1936 (nun wird es Ihnen ein Leichtes sein, mein Alter zu errechnen) und das Britische Weltreich wird seit einem Monat von seiner Majestät Edward VIII. regiert. Möge es noch etliche Jahrzehnte so weiter gehen. Ich selbst bin zwar auch weitläufig mit der Königsfamilie verwandt, doch mein momentaner Platz auf der Liste der Thronfolger ist die Nummer 299, was es zwar nicht gänzlich unmöglich macht, dass ich mich dereinst Heinrich IX. von Gottes Gnaden König des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland und ihrer anderen Königreiche und Territorien, Kaiser von Indien, Oberhaupt des Commonwealth und Verteidiger des Glaubens nennen darf, aber eben doch sau-unwahrscheinlich. Was im Übrigen gänzlich in meinem Sinne ist. Ein Leben, das vornehmlich daraus besteht, seine Zeit damit zu verplempern, auf Balkonen huldvoll mit der Hand zu wedeln, huldvolle Reden zu halten und mit stumpfen Schwertern irgendwelchen Leuten huldvoll auf die Schulter zu patschen, ist nichts für den alten Percy Danby. Verstehen Sie mich nicht falsch, irgendwer sollte das schon erledigen – wo wäre Großbritannien ohne diesen edlen Klimbim? – aber eben nicht ich. Ich habe auch ohne ständiges Verbreiten von Huldvolligkeit mit Tonnen von Ungemach zu kämpfen. Es ist schon unerquicklich genug, dass ich mich anlässlich jedes Weihnachtsfestes und zu verschiedenen weiteren Anlässen im Buckingham Palace (oder wie die Personen, die dort reindürfen, es nonchalant nennen: »Buckhouse«) einzufinden habe. Wobei ich damit selbstredend in keiner Weise etwas gegen seine Majestät und ebenso wenig gegen die charmante Dame seines Herzens, Mrs. Wallis Simpson, gesagt haben will. Im Gegenteil! Es ist die übrige Verwandtschaft, die mir solche Besuche zur Höllenqual werden lässt. Langweilige Langweiler, die so unfassbar langweilig sind, dass es sich nicht mit Worten (und auch nicht mit etwas anderem) beschreiben lässt. Schlimmer noch als die Langweiler sind nur noch zwei Teufel in Menschengestalt, deren einziger Lebenszweck darin zu bestehen scheint, liebenswerten, harmlosen Zeitgenossen, die ihre Schnürsenkel unter dem Tisch nicht angezündet haben möchten (hier wäre in erster Linie ich zu nennen), das Leben durch solch infernalische Streiche zu vergällen. Sie haben wahrscheinlich längst erraten, von wem ich spreche. Richtig: von den beiden Nichten seiner Majestät, Lilibet und Margaret, zehn und sechs Jahre alt. Gewiss, es sind Kinder, aber ist das eine Entschuldigung für ein derart kindisches Verhalten? Nicht, wenn man zur königlichen Familie gehört! Gottlob sind es nicht die Töchter seiner Majestät, sondern nur die seines Bruders, aber man stelle sich nur einmal vor, was los wäre, wenn einer dieser Satansbraten jemals auf den Thron gelangen würde. Noch ehe fünf Jahre (eher vier oder drei, wenn nicht gar nur eins) ins Land gegangen wären, würde das einstmals stolze Empire in Trümmern liegen. Eine Katastrophe!
Apropos Katastrophe, das bringt mich auf das Problem, zu dem Chief-Inspector Grover und ich in diesem Moment unterwegs waren. Das Problem war sechsundzwanzig Jahre alt, blond, hörte auf den Namen Lucilla Davenport und war davon überzeugt, dass wir beide verlobt seien. Miteinander! Wie dieser Gedanke sich in ihr (durchaus) hübsches Köpfchen einnisten konnte, soll hier nicht lang und breit zum Thema gemacht werden. (Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass ich ihr so eine Art Antrag gemacht habe; man sagt so manches, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat.) Entscheidend war vielmehr, dass dieser Gedanke nun um jeden Preis wieder aus besagtem Köpfchen ausgenistet werde musste. Und zwar endgültig, unwiderruflich und mit Stumpf und Stiel! (Ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus.) Im Grunde ist gegen besagte junge Dame nichts zu sagen, mit Ausnahme vielleicht des Umstandes, dass sie aufgrund ihrer Vernarrtheit in Zigaretten aus größerer Entfernung nur schwerlich von einem Schornstein zu unterscheiden ist, und natürlich kann man es einer jungen Dame auch nicht verargen, wenn sie nach einem jungen reichen Lord, der überdies auch noch zu den bestaussehenden Junggesellen des britischen Adels gehört, schmachtet. Doch bei allem verständlichen Rumgeschmachte darf keinesfalls übersehen werden, dass die Ehe zwar eine feine Sache ist, die durchaus von zahlreichen Leuten fleißig betrieben werden sollte – wo wäre Großbritannien ohne die Ehe? – aber eben nicht von mir. Nun ist bei Damen, die praktisch ihre gesamte Freizeit mit Schmachten verbringen (für das Rauchen benötigt Lucilla keine eigene Zeit, da sie es versteht, gleichzeitig zu rauchen und zu schmachten) mit vernünftigen Argumenten kein Blumentopf zu gewinnen. Aus diesem Grund hatte ich meinen alten Freund Chief-Inspector Basil Grover mitgenommen. Nun ja, »Freund« mag vielleicht ein wenig übertrieben sein. Als wir uns vor einigen Jahren zum ersten Male über den Weg gelaufen waren – der genaue Anlass ist mir entfallen – hatte er wenig Eindruck bei mir hinterlassen. Nachdem sich jedoch unsere Pfade einige weitere Male gekreuzt hatten, kam es zu meiner Kenntnis, dass Grover einen großen Bernhardiner namens Snubby sein Eigen nannte, der zwar im Aussehen ein wenig – genaugenommen sogar sehr stark – Grover ähnelte, den ich jedoch trotzdem sogleich ins Herz schloss. Ich liebe Hunde, aber wiewohl ich es befürworte, dass viele Menschen einen Hund halten – wo wäre Großbritannien ohne seine berühmten Hunde? – ist das für mich persönlich nicht das Wahre. Man ist doch zu sehr angebunden. Nicht der Hund – der natürlich auch – sondern der Halter. Dagegen allerdings, den Hund eines anderen Halters gelegentlich zu besuchen und ein oder zwei Stöckchen zu werfen und Ähnliches, ist nichts zu sagen, und das ist im Grunde die Geschichte meines Verhältnisses zu Chief-Inspector Grover, wenn es auch nicht zu leugnen ist, dass im Laufe der Jahre ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten sein dürfte, den schwärmerische Naturen vielleicht sogar als so etwas wie eine Freundschaft bezeichnen wollten. Es sei ihnen vergönnt.
Lucilla hatte mich also zu einem Weekend auf dem Landsitz ihrer Eltern eingeladen, zweifellos Romantisches, wenn nicht gar Hochzeitplanendes, im Schilde führend, was sich geradezu diametral entgegengesetzt zu meinen eigenen Interessen verhielt. Nun hätte ich natürlich die Einladung schnöde ablehnen können, doch eine solche Handlungsweise ist etwas für blutige Anfänger. Mein Plan hingegen sah vor, die Einladung anzunehmen und – quasi als besondere Surprise – Chief-Inspector Grover mitzubringen, der allein durch sein äußeres Erscheinungsbild jeglichen Gedanken an Romantik flächendeckend im Keim ersticken würde. Er strahlt grundsätzlich eine missmutige Resigniertheit aus (oder ist es eine resignierte Missmutigkeit?), sein Blick ist trübe (hierin gleicht er Snubby am meisten), seine Frisur – eigentlich kann man es nicht Frisur nennen, also seine Haare liegen graubraun und müde auf seinem Kopf herum, so dass Grovers ganzes Erscheinungsbild bestens geeignet ist, selbst den ausgelassensten Springinsfeld stante pede in tiefste Betrübnis zu versetzen, woran auch Grovers prächtiger Schnurrbart (seine Worte, nicht meine) nichts zu ändern vermag.
Zur hoffentlich größten Enttäuschung Lucillas stand also kein Tête à Tête zu zweit auf dem Programm, sondern ein Höflichkeitsbesuch mit Anstandswauwau, was in diesem Fall keine Anspielung auf Grovers Ähnlichkeit mit Snubby sein soll. Aus meiner Sicht ein perfekter Plan, um der jungen Dame durch die Blume zu verstehen zu geben, wo der Hammer hing, und ihr zarte Herzensregungen jeglicher Art gründlich madig zu machen.
Natürlich ist es nicht Chief-Inspector Grovers Hauptanliegen, jungen Damen zarte Herzensregungen jeglicher Art madig zu machen, ihm obliegen wichtigere Dinge, und daher musste ich ihm im Gegenzug ebenfalls einen Gefallen erweisen: Einen gewissen Lord Asher dürstete es offenbar nach dem Rat eines waschechten Londoner Chief-Inspectors, und da der Lord zufällig auch ein Schulfreund des Chief-Superintendents war (dem Vorgesetzten von Grovers Vorgesetzten), hatte sich der gute Chief-Inspector dieser Bitte nicht ernstlich erwehren können. Natürlich verspürte er keinerlei Lust auf diese Einladung und da Lord Ashers Anwesen einige Meilen hinter Glastonbury und somit fast auf dem Wege zum Ort der Einladung lag, zu der ich keine Lust verspürte, waren wir übereingekommen, dass er nicht nur in den Genuss einer Fahrt mit meinem prächtigen Automobil und meiner exzellenten Fahrkünste kommen würde, sondern dass ich überdies als zwingender Grund für seine alsbaldige Weiterreise nach höchstens zwei Stunden herhalten würde.
All dies eingedenk, sausten wir also mit meinem Rolls Royce Grovers Gastgebern entgegen. Ich hatte immer noch mit einem Kater vom Vortag zu kämpfen, den ich mir anlässlich des Besuches einer Schiffstaufe zugezogen hatte. (Ich glaube zumindest, dass es eine Schiffstaufe war, irgendetwas wurde jedenfalls geworfen.) Wir unterhielten uns über dieses und jenes, wobei Grover irgendwann äußerte, dass er dann und wann einen Kriminalroman von Agatha Christie oder Dorothy Sayers durchaus zu schätzen wusste und dass diese von unbestreitbarer Qualität seien. Da ich es nicht gutheiße, wenn in meiner Gegenwart Unzutreffendes geäußert wird, sah ich mich veranlasst, die Dinge richtig zu stellen, was schließlich in jenem bereits oben erwähnten Ausspruch meinerseits gipfelte: »Es gibt wirklich nichts Langweiligeres auf der Welt als einen Kriminalroman.« Da dies Grover noch nicht gänzlich zu überzeugen schien, fuhr ich fort: »Es ist doch schon unerquicklich genug, dass im wirklichen Leben alle fünf Minuten jemand dahingemetzelt wird. Man sollte alles tun, um das schnellstmöglich zu vergessen, und nicht auch noch genüsslich darauf herumreiten. Wobei man jedem echten Mörder zugutehalten muss, dass er in der Regel einen guten Grund hat, der es ihm ratsam erscheinen lässt, eine solche Tat zu begehen, sonst würde er die damit häufig verbundenen Unannehmlichkeiten ja gar nicht auf sich nehmen. Auch sind die meisten Mörder auf äußerste Diskretion bedacht. Niemals würde es einem von ihnen einfallen, seine Mitmenschen (mit Ausnahme des Opfers natürlich) damit zu belästigen. In Paraphrasierung eines alten Spruchs bin ich beinahe versucht zu sagen: Der Gentleman erschießt und schweigt. Verfasser von Kriminalromanen hingegen können diese mildernden Umstände nicht für sich geltend machen. Legionen unschuldiger Leser werden mit allen unappetitlichen Details behelligt, was umso überflüssiger ist, da der Mord ohnehin nur ausgedacht ist. Betrüblicherweise kommt hinzu, dass man einen Mörder aufhängen kann, einen Krimischreiberling jedoch nicht. Das heißt, man könnte es natürlich schon, aber ich sage jetzt schon voraus, dass man sich auf die eine oder andere erhobene Augenbraue gefasst machen sollte und von einigen Herrschaften sogar durchaus schief angesehen würde.«
In dieser Art redete ich noch ein ganzes Weilchen munter auf Grover ein, versuchte bei dieser Gelegenheit, ihn für die Vorzüge der Philosophie der Vorsokratiker zu gewinnen, über die ich gerade kürzlich ein ganz famoses kleines Büchlein gelesen hatte, und schließlich konnte er nicht umhin, mir vollumfänglich zuzustimmen, was er mir, etwas stoffelig, wie es nun mal seine Art ist, vermittels eines brummigen Schweigens zu verstehen gab.
Nach etwa einer weiteren Stunde kam mir der Gedanke, dass es durchaus begrüßenswert wäre, wenn sich unsere Fahrt nun langsam dem Ende zuneigte, denn seit einiger Zeit hatte heftiges Schneetreiben eingesetzt, welches das Steuern des Wagens selbst für einen erprobten Automobilisten wie mich zu einer Herausforderung machte. Zudem stand das Thermometer auf zehn Grad minus und es ist wohl nicht übertrieben, wenn ich sage, dass der Entschluss, an diesem Tage eine Spritztour aufs Land zu unternehmen, die dusseligste Idee war, seit Julius Cäsar seinem Freund Brutus zum Geburtstag einen Dolch geschenkt hatte. Endlich – als ich einmal kurz die Gelegenheit hatte, zwischen zwei nicht so eng nebeneinander fallenden Schneeflocken hindurch zu spähen – sah ich in der Ferne, inmitten unendlicher Schneelandschaft, die Silhouette unseres ersten Zieles auftauchen: Asher Castle. Ein reiner Betrug, wenn Sie mich fragen. Es handelt sich um ein, zugegebenermaßen großes, Herrenhaus, das auch einen ausreichend abweisenden Eindruck vermittelt, aber ein Castle ist es nun wirklich nicht. Daran ändert auch der kleine Turm nichts, den man auf die linke Seite gesetzt hat wie einen unpassenden Bauklotz und der ganz offensichtlich lediglich dazu dient, den Namen Castle in letzter Sekunde doch noch irgendwie zu rechtfertigen. Castle! Dass ich nicht lache! Dieses »Castle« würde ich Ihnen noch nach einer ganzen Flasche Brandy mit einem Holzschwert in fünf Minuten erobern. Aber wie auch immer, die Ashers schienen mit diesem Schwindel nun schon seit einigen Jahrhunderten durchzukommen, was vielleicht zu einem nicht unbeträchtlichen Anteil darin begründet lag, dass dieses Anwesen so abgelegen war, dass sich hier Fuchs und Hase gute Nacht sagten. Wobei ich sogar vermute, dass der Fuchs – und selbst der Hase – viel zu schlau sind, um sich ausgerechnet hier gute Nacht zu sagen, und dass sie das in Wirklichkeit an einem viel besseren Ort tun.
Nach ein paar Minuten erreichten wir ein kleines Flüsschen, über das eine alte Holzbrücke führte, die so schmal war, dass mein Automobil gerade so eben darauf Platz fand, und die überdies so alt war, dass sie unter dessen Last höchst bedenklich knarrte und ächzte. Mir graute bereits davor, auf dem Rückweg ein zweites Mal darauf zu fahren – man soll sein Glück nicht über Gebühr herausfordern – aber es würde sich wohl nicht vermeiden lassen, solange ich nicht vorhatte, mit meinem Rolls Royce meilenweit über verschneite und hartgefrorene Äcker zu rumpeln und unweigerlich mit gebrochener Achse liegen zu bleiben.
Wir hatten die Brücke soeben überquert, als uns aus dem undurchdringlichen Schneegestöber ein weiteres Automobil entgegenkam und ich nur durch ein scharfes Herumreißen des Lenkrades und ein noch schärferes Treten des Bremspedals
einen Frontalzusammenstoß in letzter Sekunde verhindern konnte. Der Fahrer des anderen Wagens, offenbar ein Taxi, schien ein ähnliches Manöver vollführt zu haben, denn unsere beiden Gefährte kamen nebeneinander, wenn auch in entgegengesetzten Richtungen, zum Stehen. Am anderen Steuer saß ein Mann mit Schiebermütze, der mich dümmlich (was mir passend erschien), aber keineswegs schuldbewusst (was mir weniger passend erschien) anstierte. Nachdem er mit dem Stieren fertig war, fuhr er weiter und ich sah ihn sich im Rückspiegel über die Holzbrücke entfernen. Auch ich setzte meinen Weg fort und parkte schließlich seitlich vom Schloss, wo bereits zwei Automobile standen. Alsdann stiegen Grover und ich aus und stapften mit knirschenden Schritten durch den tiefen Schnee in Richtung Schlosseingang. Der Wind aus Nordost blies so heftig, dass wir uns mit aller Kraft dagegenstemmen mussten, um voranzukommen. Der herumwirbelnde Schnee machte uns praktisch blind und die Kälte ließ uns schlottern wie Eiswürfel in einem Cocktail-Shaker. Obwohl es nicht mal eine Minute gedauert haben mochte, bis wir das Schloss erreicht hatten, kam sie mir wie eine halbe Ewigkeit vor und reichte völlig aus, um mir absolute Gewissheit darüber zu verschaffen, wie Robert Scott sich beim Erreichen des Südpols gefühlt haben musste. Da ich nicht nur ein Automobil gesteuert, sondern, was erschwerend hinzukam, dies im Beisein (um nicht zu sagen unter Aufsicht) eines Chief-Inspectors von Scotland Yard getan hatte, war ich, ganz gegen meine Gewohnheit, nüchtern wie ein Bischof und sehnte mich mit jeder Faser meines Körpers danach, mir einen oder besser noch zwei wärmende Grogs aus Lord Ashers hoffentlich makellos sortierter Hausbar einzuverleiben. Vorzugsweise an einem Kamin stehend, oder besser noch an zwei Kaminen. Vor Kälte zitternd erklommen wir die Freitreppe vor dem mächtigen Hauptportal und ich sah zu, wie Grover den schweren Türklopfer betätigte. Als ich zufällig einen Blick auf den Weg warf, den wir soeben genommen hatten, bemerkte ich, dass unsere Spuren im Schnee bereits wieder von zahllosen weiteren Flocken ausgelöscht worden waren.
Kapitel 2
»Willkommen, Genossen!« Mit diesen Worten begrüßte uns der Mann, der die Tür geöffnet hatte. Nicht gerade die Begrüßung, die man vom Butler eines Lords erwartet, aber Grover und ich waren inzwischen so durchgefroren, dass wir uns notfalls mit Josef Stalin persönlich verbrüdert hätten, wenn er uns dafür nur in seine geheizte Stube eingeladen hätte. So drängelten wir uns also irgendwelche Grüße murmelnd an ihm vorbei ins warme Innere des Hauses und vernahmen mit grimmiger Genugtuung, wie die Tür krachend hinter uns geschlossen wurde und somit die Eishölle da draußen nicht länger unser Problem war. Die Eingangshalle von Asher Castle entsprach weit mehr meiner Vorstellung von einem Schloss als das Äußere des Hauses. Sie maß etwa vierzig mal vierzig Fuß im Quadrat und eine gewaltige Freitreppe in der Mitte führte in den ersten Stock. An den Wänden hingen Gobelins und Gemälde von Lord Ashers illustren Ahnen. Außerdem Schwerter, Streitäxte, Hellebarden, Schutzschilde und ausgestopfte Jagdtrophäen. Irgendwo schlug eine Uhr einmal. Es war viertel nach zwölf. Bildete ich es mir nur ein oder hing ein Geruch von köstlichem Mittagessen in der Luft? Während wir mit den Füßen stampften und unsere Mäntel abklopften, um uns vom Schnee zu befreien, nahmen wir den Mann, der uns geöffnet hatte, näher in Augenschein. Er war Mitte dreißig und trug einen groben, braunen Anzug, der dringend des Bügeleisens bedurft hätte. Seine Krawatte war liederlich gebunden, sein struppiges rötlichbraunes Haar schlecht gekämmt und ein buschiger Vollbart sowie eine krumme Körperhaltung vollendeten den unvorteilhaften Gesamteindruck. Natürlich kann sich nicht jeder so formidable Schneider leisten, wie es mir nun einmal vergönnt ist, und erst recht versteht es nicht jeder, seine Anzüge mit der dazu erforderlichen eleganten Weltläufigkeit zu tragen, aber ein Mindestmaß an Bemühen darf man doch wohl erwarten. War es nicht Marcel Proust, der gesagt hat: »Die Eleganz des Engländers liegt weniger in seiner Kleidung als in seinem Körper und dieser scheint sie von der Seele zu bekommen«. Für mich stand somit fest: Dieser Mann war kein Gentleman und wahrscheinlich nicht wirklich ein Engländer.
Mit einer ungelenken Armbewegung streckte er uns die Hand entgegen und verkündete mit tiefer Stimme: »Jack Prowley, Liverpool.«
Grover und ich warfen uns einen befremdeten Blick zu.
Wer war dieser Mann? Abgesehen davon, dass er Jack Prowley hieß, aus Liverpool kam und offenbar, was ich aus der Art, wie er uns als Genossen bezeichnet hatte, schloss: Kommunist. Etwas das mir völlig fremd war. Aus purer Neugier (wir Danbys sind berühmt für unsere Neugier) hatte ich mir vor einigen Jahren mal das Buch »Das Kapital« von diesem Karl Marx besorgt, war aber nach der ersten halben Seite eingeschlafen. Dies war also das erste Mal, dass ich einem leibhaftigen Kommunisten Aug in Aug gegenüberstand – nicht eingerechnet die Tochter von Lord und Lady Bosworth. Die Kleine war bis dato durchaus ein süßer Fratz gewesen, doch bald nach Erreichen ihrer Volljährigkeit litt sie urplötzlich an Kommunismus und traktierte nicht nur ihre geplagten Eltern, sondern auch mich und einige weitere Gäste einen halben Nachmittag mit einem Vortrag darüber, dass die Produktionsmittel in die Hand des Proletariats gehörten und Pipapo. Glücklicherweise war Lady Bosworth geistesgegenwärtig genug, schließlich zu erklären, dass das Proletariat ohne Abendessen ins Bett müsse, wenn es nun nicht den Mund halte. Das bewirkte eine Spontanheilung und wie ich hörte, widmet sich die kleine Bosworth inzwischen mit einigem Talent der Aquarellmalerei.
Allerdings waren durchaus Zweifel angebracht, dass die gleiche Methode auch bei Mr. Prowley so schöne Erfolge zeitigen würde. Daher – und weil die Wärme des Hauses nur langsam in unsere durchgefrorenen Knochen drang – ließen ich und Chief-Inspector Grover es ebenfalls bei der kürzestmöglichen Vorstellung bewenden:
»Grover.«
»Danby.«
Prowley maß uns mit einem Blick, als seien wir seine besten Freunde und eben aus einer zehnjährigen Zuchthaushaft entlassen worden. Es fehlte nicht viel und er hätte uns umarmt.
Da sich seltsamerweise noch immer kein Butler blicken ließ, entledigten wir uns unserer Hüte und Mäntel und warfen sie auf eine riesige alte Holztruhe, auf der schon einige andere Mäntel lagen. Dann führte Prowley uns durch einen Vorraum und öffnete eine große Tür.
Wir traten ein und fanden uns einer Gesellschaft bestehend aus zehn Damen und Herren gegenüber, die um eine lange und reich gedeckte Speisetafel saßen und deren zehn Köpfe nun, gewissermaßen mit einem einzigen Ruck, zu uns herumfuhren und uns anstarrten. Aus einigen Gesichtern las ich Neugier, aus anderen Freude und aus wieder anderen Verärgerung. Besonders das Vorhandensein der letztgenannten Gefühlsregung verwunderte mich ein wenig, denn normalerweise muss man mich hierfür zumindest einige Minuten kennen. Ein älter Herr mit weißem Backenbart erhob sich und sah mich fragend an. »Lord Asher?«
Bevor ich antworten konnte, schaltete sich eine totenblasse Lady in einem schwarzen Seidenkleid, die ich auf Mitte sechzig schätzte, ein. Sie trug eine zweifellos überaus kostbare goldene Brosche, die mit Diamanten besetzt war, und hatte vermittels eines Lorgnons zuerst strenge Blicke auf Grover und mich gerichtet und verkündete nun mit einer Stimme, die dem Klang eines Nebelhorns nicht unähnlich war: »Nein, das ist er nicht.« Dann fasste sie wieder mich ins Auge. »Lady Edwina St. Clair. Und mit wem haben wir die Ehre?«
»Lord Danby«, antwortete ich mit einer kleinen Verbeugung.
Die Neugier und Freude, die eben noch auf einige Gesichtern vorhanden gewesen war, erstarb augenblicklich, so dass nun aus sämtlichen Mienen Enttäuschung sprach. Konsterniert wandte man sich wieder dem Essen zu. Auch dass der Chief-Inspector ein hölzernes »Grover« in die Runde warf, wurde schweigend zur Kenntnis genommen. (Wenn überhaupt.) Unser neuer bester Freund, Jack Prowley, klopfte Grover auf die Schulter und machte eine wegwerfende Handbewegung, die wohl besagte, dass wir die unfreundliche Begrüßung der anderen Tischgäste nicht so wichtig nehmen sollten, und forderte uns auf, Platz zu nehmen. Da es nur noch zwei freie Stühle gab und ich nicht eingeladen war, blieb Grover nichts anderes übrig, als sich an die Stirnseite der Tafel zu setzen, üblicherweise der Platz des Hausherrn. Grover tat es mit sichtlichem Unbehagen. Nervös schielte er zur Tür, offenbar um bereit zu sein, seinen Stuhl stante pede zu räumen, sollte Lord Asher erscheinen. Da uns die anderen Gäste nicht mehr beachteten und sich nach wie vor kein Bedienter blicken ließ, füllten wir uns selbst die Teller und aßen. Nachdem ich einige Bissen zarten Kalbsbraten verspeist und ein Glas eines recht guten Clarets geleert hatte, kehrten meine eingefrorenen Lebensgeister langsam zurück und ich begann mich zu fragen, was der Anlass für diese ungewöhnliche Zusammenkunft sein mochte. Ich wusste, dass Lord Asher den Rat Scotland Yards in Gestalt von Chief-Inspector Grover erheischte, aber aus welchem Grunde mochten sich wohl die anderen Gäste hier aufhalten? Denn um solche handelte es sich eindeutig. Die Art, wie man uns begrüßt hatte, ließ keinen Zweifel daran zu, dass niemand der Anwesenden hier zu Hause war. Weit mehr noch als dies fragte ich mich allerdings, warum weder der Gastgeber noch Personal anwesend war. Es stand zu hoffen, dass Lord Asher bald erscheinen würde, um dann unverzüglich Grovers Expertise einzuholen, so dass wir unsere Reise würden fortsetzen können und so noch vor Einbruch der Dunkelheit unser eigentliches Ziel erreichen würden. Doch einstweilen mussten wir uns wohl noch in Geduld fassen und in dieser Tischgesellschaft ausharren, die mir mit jedem Moment kurioser erschien. Es wurde nur das Allernötigste gesprochen, beispielsweise, wenn man seinen Sitznachbarn bat, das Salz herüberzureichen, und ansonsten war das Klappern des Bestecks fast das Einzige, was man vernahm. Stattdessen musterte man sich mit verstohlenen Blicken. Manche dieser Blicke waren neugierig, manche misstrauisch und es waren auch ängstliche Blicke darunter. Auf einigen Lippen glaubte ich ein kleines wissendes Lächeln zu erkennen, ganz so, als ob die jeweilige Person mehr Informationen über den Zweck dieses Treffens besaß, nicht aber vorhatte, diese mit den übrigen zu teilen. Ich fand das Ganze einigermaßen belustigend und nun begann auch ich, den einen oder anderen diskreten Blick schweifen zu lassen, um mir einen Überblick über die anderen Gäste zu verschaffen, zumindest über diejenigen, die ich von meinem Platz aus sehen konnte, ohne mich neugierig vorbeugen zu müssen.
Mir gegenüber saß ein Mann, der etwa fünfzig sein mochte.
Er war stämmig, aber eher muskulös als dick. Sein Gesicht war kantig und cholerisch gerötet. Er trug sehr kurzgeschorenes dunkelblondes Haar, was ihn zusammen mit seinen eng zusammenstehenden kleinen Augen, einer tiefen Zornesfalte über der Nase und einem harten Mund gefährlich aussehen ließ. Ein Mann, den man besser nicht wütend machte, wozu angesichts seiner offenbar dreiviertelwütenden Grundstimmung wahrscheinlich nicht allzu viel gehörte. Er trug einen teuren, aber nicht besonders geschmackvollen grauen Anzug. Wenn nicht die Art seiner messerscharfen Blicke, die von Zeit zu Zeit bei ihm aufglühten, einigen Scharfsinn verraten hätte, würde ich ihn als einen ehemaligen Berufsringer eingeschätzt haben, der reich geerbt hatte.
Neben ihm saß ein sehr hagerer Inder, ich schätzte ihn auf Ende zwanzig, der auf mich einen ängstlichen Eindruck machte. Er sah fast nie von seinem Teller auf, nahm nur winzige Bissen und hielt beim Schneiden des Fleisches die Ellenbogen dicht an den Körper gepresst.
Als nächster folgte der ältere Herr mit dem weißem Backenbart. Er hatte ein wettergegerbtes Gesicht, aus dem zwei hellblaue Augen listig hervorblitzten. Ich hätte meinen Rolls Royce gegen einen verbeulten Zylinder gewettet, dass dieser Mann viele Jahre zur See gefahren war.
Zu seiner Rechten wurde mein Blick durch eine sehr schöne Dame mit flammend rotem Haar und ebensolchen Lippen erfreut, die mir kokett zulächelte (was ich mit einem vielsagenden Heben der linken Augenbraue erwiderte) und die eindeutig etwas Künstlerisches ausstrahlte.
Rechts von mir wiederum saß eine ungeschminkte und nachlässig gekleidete Frau mit neugierigen Glubschaugen, dunkelblonden Haaren und burschikosen Bewegungen. Sie war mittleren Alters, hatte ein paar Pfund zu viel auf den Rippen, trug einen Trauerflor am Arm und säbelte herzhaft an ihrem Braten herum.
Schließlich war der Hauptgang restlos verspeist und man bediente sich von einer Platte mit Erdbeertörtchen. Die leichte Süßspeise schien die Stimmung zu lockern und die Runde verfiel nach und nach in ein angeregtes Parlieren. Es wurde gescherzt und gelacht. Der Einzige, der sich nicht an der ausgelassenen Unterhaltung beteiligte, war mein Freund Grover, was mich keineswegs überraschte. Ohne ihm zu nahe zu treten, darf man wohl behaupten, dass er nicht gerade der Meister des geschliffenen Apercus ist, sondern eher ein maulfauler Muffelkopp mit dem Esprit einer Schale Haferbrei vom Vortag. Da ich davon ausging, dass der Trauerflor meiner Sitznachbarin seiner Majestät Georg V. galt, die einige Wochen zuvor verstorben war, kam ich auf ihren Nachfolger, König Edward VIII. zu sprechen, und bald entspann sich am Tisch eine muntere Diskussion über dessen Herzensdame, Wallis Simpson, die zu heiraten er beabsichtigte, was im ganzen Königreich heftigste Kontroversen ausgelöst hatte. Da waren zum einen diejenigen, angeführt von Premierminister Stanley Baldwin, dem Erzbischof von Canterbury und der Königinmutter, Queen Mary, die allein schon die Idee für höchst verwerflich hielten, da Mrs. Simpson nicht nur die Geschmacklosigkeit besaß, Amerikanerin zu sein, sondern bereits einmal geschieden und nun das zweite Mal verheiratet war, was es ihrer Ansicht nach dem König unmöglich machte, sie zu ehelichen, da er als Monarch zugleich auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche war. Auf der anderen Seite standen – außer Edward selbst, Winston Churchill, dem einflussreichen Zeitungsverleger Lord Beaverbrook und mir – all diejenigen, die der Ansicht waren, dass Wallis Simpson eine ziemlich flotte Biene sei und der König heiraten könne, wen immer er wollte. Auch hier am Tisch waren die Meinungen geteilt und die jeweiligen Differenzen in den Standpunkten unüberwindlich. Insbesondere Lady Edwina schien den Gedanken an eine solche Hochzeit ebenso zu verabscheuen wie jede Person, die diese Ansicht nicht teilte. Um die Stimmung ein wenig zu lockern, steuerte ich eine amüsante Anekdote über seine Majestät bei, eine Begebenheit, als dieser noch der Prince of Wales gewesen war: Sein Vater hatte ihn nach Frankreich geschickt, auf dass er dort Französisch lerne, und ihm zu diesem Zwecke einen Französischlehrer engagiert, der auf Wunsch des Königs auch daraufhin ausgewählt worden war, dass er kein Wort Englisch beherrschte, ein Detail, das ganz sicher zum Erfolg führen musste. Er hatte recht: Nach drei Monaten sprach der Französischlehrer perfekt Englisch und wie man hört, soll der Prince of Wales auch das eine oder andere Wort Französisch aufgeschnappt haben.
Einige lachten, am meisten meine Sitznachbarin, die geradezu kreischte vor Amusement. Dann offenbarte sie mir, dass ihr Trauerflor keineswegs seiner Majestät galt, sondern Rudyard Kipling, der zwei Tage vor seiner Majestät verstorben war, was sie mir sofort sympathisch machte, da ich Kipling für einen der bedeutendsten britischen Schriftsteller hielt, der je gelebt hat. Leider war er in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Dabei hatte der Mann großartige Romane wie »Kim« oder »Der Mann, der König sein wollte« verfasst. Von ihm stammten Aussprüche wie »Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges«. Weniger literarisch Interessierte hatten allerdings bestenfalls sein »Dschungelbuch« gelesen; Grover wahrscheinlich nicht einmal das. Das Einzige, was er von Kipling kannte, war ein Zitat, das er dafür allerdings umso häufiger anbrachte, besonders, wenn Damen anwesend waren: »Von einem Mann geküsst zu werden, der seinen Schnurrbart nicht wachsen lässt, ist wie ein Ei ohne Salz zu essen.« Nun ja, jeder nach seinen Fähigkeiten. An dieser Stelle wurde unser Gespräch abrupt unterbrochen, denn plötzlich hallte ein lautes Pochen durch das Schloss. Offenbar begehrte jemand Einlass. Erneut stand gespannte Erwartung in den Mienen der Anwesenden und Jack Prowley sprang auf, um die Tür zu öffnen. Ich überlegte, warum er nun schon zum zweiten Male diese Aufgabe übernahm, und kam zu dem Schluss, dass er als Kommunist der einzige unter Lord Ashers Gästen war, der diese normalerweise dem Butler obliegende Aufgabe nicht für unter seiner Würde befand.
Im Speisesaal war nun vollständige Stille eingetreten und wir lauschten alle, ob wir vernehmen konnten, wer dort an der Tür erschienen war. Wir konnten es nicht, doch nach etwa einer Minute kehrte Prowley zurück. Nicht durch die Tür, durch die er uns verlassen hatte, sondern durch einen holzgetäfelten kleinen Korridor, der in ein Nebenzimmer führte, und forderte alle Anwesenden auf, sich in den Großen Salon zu begeben. Zweifellos in der Erwartung, dass Lord Asher nun eingetroffen sei, erhoben sich alle unverzüglich und folgten Prowleys Aufforderung. Da mich die Belange dieser Veranstaltung als nicht geladener Gast weder etwas angingen noch sonderlich interessierten, ließ ich mir Zeit. Ich zückte mein silbernes Zigarettenetui, zündete mir eine türkische Zigarette an und nahm dabei die Gäste in Augenschein, die meiner Aufmerksamkeit bislang entgangen waren.
Ganz vorne ging ein Mann mit rabenschwarzen, pomadisierten Haaren und einem ebensolchen Schnurbärtchen. Er war zweifellos Ausländer, womöglich Italiener, und legte ein arrogantes Gehabe an den Tag. Er war um die vierzig, hielt sich kerzengerade, möglicherweise ein Offizier, und trug einen Spazierstock mit Silberknauf in der Hand, was ich reichlich albern fand. Wer trägt innerhalb des Hauses einen Stock mit sich herum? Es war offensichtlich, dass er sich für die wichtigste Person unter den Anwesenden hielt. Wobei letzteres wohl auch auf Lady Edwina zutraf, die gleich hinter ihm war. Einen halben Schritt hinter ihr ging eine sehr dünne Frau um die fünfzig mit einem Gesicht, das, wenn man es auf Flaschen hätte ziehen können, einen tadellosen Magenbitter abgegeben hätte. Ihre Kleidung erinnerte an eine Krankenschwestertracht, allerdings war diese schlichter als die, die man aus Hospitälern kannte. Sie trug eine schwarze Doktortasche bei sich. Um die Gesundheit von Lady Edwina schien es offenbar nicht zum Besten zu stehen. Außerdem bemerkte ich, dass die Krankenschwester ein Kruzifix an einer Kette um den Hals trug, welches sie die ganze Zeit mit zwei Fingern fest umfasst hielt. Ihre Lippen waren zusammengepresst. Sie schien das ganze Leid der Welt auf ihren Schultern zu tragen und gleichzeitig großen Wert darauf zu legen, dass die Welt ihr Opfer auch bemerkte. Sie war in dieser Runde eindeutig nicht meine Lieblingsperson. Ihr folgten Jack Prowley, dann der backenbärtige Seebär, Chief-Inspector Grover, die schöne rothaarige Dame, die mir mit ihren grünglitzernden Augen erneut einen vielversprechenden kleinen Blick zuwarf, ein Herr in einem grüngrauen Tweedanzug, mit einem grauen Ziegenbärtchen, der eine Brille mit runden Gläsern auf der Nase trug und den ich mir gut als Verfasser von sentimentaler Lyrik oder etwas ähnlich Fürchterlichem vorstellen konnte, und – gemeinsam mit dem Inder – der zu Geld gekommene Berufsringer, der sich eine Zigarre angesteckt hatte. An seiner rechten Hand fiel mir ein goldener Ring mit einem klobigen Diamanten auf. Schließlich machte auch ich mich auf den Weg. Direkt vor mir, weit hinter den übrigen, ging, oder genauer gesagt, wälzte sich ein ungeheuer dicker Mann schnaufend voran. Er war so schwer, dass seine Beine diese Last offenbar nicht allein zu tragen vermochten, weshalb er nicht nur einen Spazierstock benutzte, sondern derer zwei, von denen nach meiner Einschätzung jeder einzelne immer noch doppelt so viel tragen musste wie der Stock eines jeden anderen Mannes. Er schien mir um die vierzig zu sein, aber das konnte täuschen, er mochte auch bedeutend jünger oder älter sein. Er schwitzte stark und kam nur im Schneckentempo voran. Ich versuchte, ihn zu überholen, doch seine Körperfülle machte es unmöglich. Schließlich gelangten auch wir in den Großen Salon. Dieser machte seinem Namen alle Ehre. Im hinteren Drittel des großen Raumes befand sich ein Podest, auf dem ein alter Broadwood-Konzertflügel stand. An den Wänden hingen zahlreiche kleinere Musikinstrumente, wie Violinen und Klarinetten, sowie antike Notenblätter. Auch ein gerahmtes und von Franz Liszt signiertes Programmheft anlässlich seines Auftrittes 1866 in London bemerkte ich. In einer Ecke stand eine große goldene Harfe. Am anderen Ende befand sich ein Billardtisch und die Mitte bildete den eigentlichen Wohnsalon, in dem sich diverse Sessel und Canapés und einige Beistelltische befanden. Es stimmte mich ein wenig melancholisch, sehen zu müssen, dass ein britischer Lord gezwungen war, einen Wohnsalon, einen Musiksalon und einen Billardsalon zu einem einzigen Raum zusammenzufassen.
Alle anderen Gäste hatten sich bereits versammelt. Einige saßen, andere standen. Die burschikose Kipling-Verehrerin ließ ihre Wurstfinger über die Harfensaiten gleiten und erzeugte ein mysteriös klingendes Glissando, das die rätselhafte Situation noch einmal unterstrich. Ich bezog einen strategisch günstigen Platz direkt an der hervorragend sortierten Hausbar, die nach einer ersten Sichtung meinerseits keine Wünsche offenließ, goss mir einen Brandy ein und harrte mit vorbildlicher Geduld der Dinge, die da kommen mochten.
Kapitel 3
Das Zentrum des allgemeinen Interesses war ein überdurchschnittlich gutaussehender, ein wenig aufgeregt wirkender junger Mann in einem modischen Anzug und etwas Schnee auf dem Kopf, der sich angesichts der draußen herrschenden Kälte so nah wie möglich an den lodernden Kamin gestellt hatte und mit beiden Händen feierlich einen versiegelten Brief hielt. Nachdem sich der dicke Mann mit den zwei Stöcken unter einigem Geächze und Gestöhne in einen tiefen Sessel hatte plumpsen lassen (ich fragte mich, wie er da je wieder rauskommen wollte) und Ruhe eingekehrt war, räusperte sich der junge Mann, blickte mit strahlendem Blick in die Runde und richtete mit wohltönender Stimme das Wort an uns: »Ladies und Gentlemen, mein Name ist Cecil Galloway, ich gehöre zur Schauspieltruppe des Theaters von Bristol. Vielleicht hat mich der eine oder andere noch als Benvolio in Romeo und Julia oder als Sbrigani in Molieres Der Herr von Pourceaugnac in Erinnerung.«
Ich weiß nicht, ob er erwartete, dass wir nun in entzückte Jauchzer des freudigen Wiedererkennens ausbrechen würden, aber zumindest machte er an dieser Stelle eine Pause, die dies ermöglichte, und fuhr erst nach einigen Augenblicken peinlicher Totenstille fort: »Der Herr des Hauses, Lord Asher, suchte mich einige Tage zuvor auf und beauftragte mich, heute zu diesem besonderen Anlass hier zu erscheinen und Ihnen allen einen Brief von ihm zu verlesen, was ich hiermit tun will.« Er griff in seine Jackentasche, brachte einen verzierten Theaterdolch zum Vorschein und begann, beinahe feierlich, das Couvert aufzuschlitzen, wobei er sich bemühte, bedeutungsvolle Blicke in die Runde zu werfen. Ich gähnte diskret und blickte aus dem Fenster. Die unendlichen Schneelandschaften, aus denen als einzig wahrnehmbares Detail die kleine Brücke herausstach, hatten etwas überaus Friedliches an sich.
Galloway zog einen dicken Pergamentbogen hervor, entfaltete ihn, räusperte sich erneut und begann, voller Gefühl zu lesen:
»Ladies und Gentleman, verehrte Gäste! Ich danke Ihnen allen, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind, ganz besonders Ihnen, Chief-Inspector Grover von Scotland Yard, denn Sie sollen heute mein Ehrengast sein.«
Grover, der sich aus alter Polizistengewohnheit neben der Tür positioniert hatte, von wo aus er alles gut überblicken konnte, sah überrascht auf und nickte dann etwas verlegen in die Runde. Galloway machte eine kleine Kunstpause, dann fuhr er fort:
»In den Einladungen, die ich Ihnen allen zukommen ließ, habe ich Sie gebeten, den anderen Gästen gegenüber Stillschweigen bezüglich des jeweiligen Grundes Ihres Besuches zu bewahren. Von dieser Verpflichtung entbinde ich Sie hiermit und will Ihnen gleichzeitig ein Geständnis machen: Der wahre Grund Ihres Hierseins ist ein gänzlich anderer. Zunächst einmal: Ich bin nicht Lord Asher. Asher Castle steht – wie jedes Jahr über den Winter – leer und seine Lordschaft weilt mit der Dienerschaft in seinem Landhaus in Antibes. Wer ich in Wirklichkeit bin, wird jedem von Ihnen in den kommenden Stunden einzeln enthüllt werden, doch leider erst wenige Augenblicke vor Ihrem Tode. Ja, Sie haben richtig gehört: Vor Ihrem Tode, denn ich habe vor, Sie einen nach dem anderen umzubringen. Bitte nehmen Sie es nicht persönlich, ich hege keinerlei Groll gegen Sie; ich hatte noch andere Personen für heute hierher eingeladen, doch betrüblicherweise begingen nur Sie, Ladies und Gentlemen, den Fehler, meiner Einladung auch Folge zu leisten. Nur zwei der hier Anwesenden werden morgen früh noch am Leben sein. Der eine dieser beiden sind Sie, Chief-Inspector Grover. Ich hasse Sie! Es mag viele Jahre her sein, doch ich habe niemals vergessen, was Sie mir angetan haben. Doch hatten Sie das nicht Ihrem Können zu verdanken, sondern es war reines Glück, ja purer Zufall! Seit diesem Tage haben wir noch eine Rechnung offen und nun endlich soll sie beglichen werden. Hilflos werden Sie mitansehen müssen, wie ich den hier Anwesenden einem nach dem anderem das Leben nehme, jedem auf eine andere Weise. Übrigens muss niemand befürchten, dass die Speisen und Getränke hier im Hause vergiftet sind; das wäre doch gar zu einfach und eines Sportsmannes unwürdig. Nein, Grover, Sie erhalten Ihre faire Chance, doch das wird Ihnen nichts nützen. Und zum Schluss, wenn nur noch Sie übrig sind, wird aller Welt Ihre totale Unfähigkeit deutlich vor Augen geführt sein und Sie werden den Rest Ihrer Tage mit Ihrem Versagen leben müssen.
Die andere Person, die überleben wird, bin ich selbst, denn ich befinde mich in diesem Augenblick unter Ihnen.
Ich denke, damit ist alles gesagt. Mir bleibt nur noch, Ihnen zu wünschen, dass Sie die letzten Augenblicke, die Ihnen noch vergönnt sind, genießen werden.
Mögen die Spiele beginnen.«
Kapitel 4
Cecil Galloway ließ den Brief sinken und blickte unsicher lächelnd in die Runde. Eine ratlose Stille hatte sich wie eine sämige Soße im Salon verbreitet.
»Dekadente, bourgeoise Narreteien«, murmelte jemand, wahrscheinlich Jack Prowley.
»Ist das ein Witz?«, stieß schließlich der Rotgesichtige, der wie ein ehemaliger Berufsringer aussah, in scharfem Tonfall hervor, worauf sich zustimmend-empörtes Gemurmel unter den Anwesenden erhob, das sich in Ermangelung eines anderen Zieles gegen den armen Schauspieler richtete, der etwas blass geworden war und zweifellos wünschte, er hätte Bristol niemals verlassen. »Es … es ist ein Spiel«, stammelte er schließlich mit erzwungener Fröhlichkeit, »eine Scharade.« Aber seine Erklärung vermochte keine Heiterkeit auf die Gesichter der anderen zu zaubern. Ich habe schon Beerdigungen erlebt, auf denen mehr Stimmung war.
»Wenn Sie erlauben«, meldete sich der arme Mime erneut zu Wort,
»werde ich nun meine Gage in Empfang nehmen, die, wie man mir mitteilte, in jener Vase dort für mich bereitliegt.« Offenbar erwartete er eine allgemeine Zustimmung, doch als diese sich nicht einstellen wollte, schritt er etwas befangen zu einem goldlackierten Sideboard, auf dem eine reichlich verzierte chinesische Vase mit Deckel stand und die ich eindeutig als aus der Ming-Dynastie stammend erkannte, da mir alle anderen chinesischen Dynastien unbekannt sind. Er hob den Deckel ab und wollte eben in das Gefäß greifen, als Chief-Inspector Grover sich einschaltete. »Einen Moment bitte, junger Mann! Wie ist Ihnen dieser Auftrag erteilt worden? Per Brief? Telephonisch? Oder persönlich?«
Galloway zögerte. »Nun, persönlich. In Bristol, aber ich glaube, ich sollte nicht ...«
»Das heißt, Sie haben die Person, die diesen Brief verfasst hat, mit eigenen Augen gesehen.«
»Schon, ja, aber ...«
»Und befindet sich diese Person hier tatsächlich unter uns?«
Galloway krümmte sich vor Unbehagen. »Also, darüber sollte ich wirklich nicht ...« Er blickte hastig in die Runde, dann wandte er sich wieder an Grover. »Wenn Sie erlauben, nehme ich nur schnell meine Gage an mich und dann bin ich auch schon verschwunden.« Er steckte seinen Arm tief in die Vase, um nach dem Geld zu greifen, doch plötzlich hielt er mitten in der Bewegung inne, riss erst erschrocken die Augen auf und dann seine Hand hervor. Sie war leer. Im nächsten Augenblick verfiel er in ein schweres Keuchen, gleich darauf stürzte er zu Boden und begann sich, wie in Krämpfen, zu winden, wild mit den Augen zu rollen und unartikulierte Laute von sich zu geben. Ich muss gestehen, dass ich von dieser Darbietung nicht sonderlich angetan war. Für Bristol mag so ein Schmierentheater wohl gut genug sein, aber für das verwöhnte Londoner Theaterpublikum, das im Old Vic Theatre exquisite künstlerische Leistungen wie John Gielguds Hamlet erleben durfte, keineswegs. Ich nahm einen weiteren Schluck Brandy und wartete darauf, dass er mit seiner exaltierten Grimassenschneiderei fertig sein würde. Endlich war es soweit, Galloway gab einen letzten Seufzer von sich, verdrehte übertrieben die Augen und lag völlig still da. Das gefiel mir schon besser; ich weiß aus meiner Collegezeit in Eton, wo ich an diversen Amateuraufführungen mitwirkte, dass es geradezu übermenschlicher Selbstbeherrschung bedarf, eine Leiche darzustellen, ohne dabei sichtbar zu atmen und vor allem, ohne dabei zu kichern, doch Galloway hatte sich, was das anging, hervorragend in der Gewalt, was ich neidlos anerkennen musste. Auch auf die übrigen Anwesenden schien seine Vorstellung einigen Eindruck zu machen, denn sie starrten ihn wie gebannt an. Schließlich trat Chief-Inspector Grover an ihn heran, beugte sich hinunter und tastete nach seiner Halsschlagader. Dann richtete er sich auf und stellte mit trockener Stimme fest: »Der Mann ist tot.«
Kapitel 5
Einige Augenblicke herrschte entsetztes Schweigen, dann redeten alle durcheinander. Grover hob ernst die Hand, wie es nur britische Polizisten können, und sofort verfielen alle in stumme Regungslosigkeit und blickten auf ihn. Nur der junge Inder, der gerade im Begriff war, an die Vase heranzutreten, hatte es nicht mitbekommen. Er kippte das teure Stück etwas zu sich und sah hinein, nur um sofort erschrocken wie ein aufgescheuchtes Kaninchen einen gewaltigen Satz rückwärts zu machen. Das edle Blumengefäß kippte vom Sideboard und zerbarst mit einem lauten Knall auf dem Boden. Einige zuckten zusammen. Dann gellte ein Schrei durch den Salon. Die schöne Rothaarige stand mit aufgerissenem Mund und vor Angst geweiteten Augen da und zeigte auf die zerstörte Vase. Auch ich sah hin und wollte meinen Augen nicht trauen: Die Scherben bewegten sich. Einige Momente starrten alle mit einer Mischung aus Furcht und Faszination auf das seltsame Schauspiel, dann kroch plötzlich etwas aus dem Scherbenhaufen hervor. Es war ein schwarzer Skorpion, der sich nun mit erschreckender Geschwindigkeit auf Lady Edwinas Krankenschwester zubewegte. Starr vor Entsetzen saß sie hochaufgerichtet da, umklammerte ihr Kruzifix und blickte hilflos auf das grausige Wesen, das sie nun bereits fast erreicht hatte. In diesem Augenblick sprang der pomadisierte Italiener vor, zog einen Degen aus seinem Spazierstock, stieß ihn mit einer blitzartigen Bewegung in den Skorpion und nagelte ihn damit auf dem Boden fest. Fast eine Minute sahen wir auf den fürchterlich anzusehenden Todeskampf der tückischen Bestie. Während dieser Zeit entschied ich, dass der Italiener aufgrund seiner Tat, mit der er es an Kaltblütigkeit und Geschick mit jedem Matador hätte aufnehmen können, in Wirklichkeit Spanier sein musste, und dass das Mitführen seines Spazierstockes im Hause nicht Ausdruck überkandidelten Verhaltens, sondern kluger Umsicht war. Mit dem immer noch aufgespießten Ungetüm näherte er sich dem Kamin und beförderte es hinein, was das Feuer für einen Moment schaurig auflodern ließ. Ein bitterer Geruch verbreitete sich im Salon.
»Danke!«, keuchte die Krankenschwester schließlich, während sie sich bekreuzigte. Nach meiner Einschätzung galt ihr Dank aber nicht dem Spanier, sondern Gott selbst, der den Spanier in diesem Moment zu seinem Werkzeug gemacht und ihn zu ihrer Rettung entsandt hatte.
»Es war mir ein Vergnügen«, antwortete der Spanier nichtsdestotrotz mit scharfem Akzent, wobei er sich mit spanischer Grandezza verbeugte. Dann wischte er das Blut des Skorpions an der Kante seines Schuhs von der Degenklinge ab und schob sie zurück in seinen Spazierstock.
»Ich bleibe nicht eine Minute länger in diesem Haus!«, stellte Lady Edwina resolut fest. Dann wandte sie sich an ihre Krankenschwester: »Briggs, suchen Sie das Telephon und rufen Sie ein Taxi. Wir fahren zurück zum Bahnhof. Und machen Sie es dringend!«
»Ich denke, ich werde mich Ihnen anschließen«, ließ sich der sehr dicke Mann aus den Tiefen seines Sessels vernehmen. »Das Ganze gefällt mir ganz und gar nicht.«
»Wir gehen alle!«, rief Prowley, worauf sich allgemeine Zustimmung erhob, und ich wollte eben zu Chief-Inspector Grover hinübergehen, um ihn darauf hinzuweisen, dass nun auch für uns der perfekte Augenblick gekommen sei, sich zu verabschieden, als dieser vortrat und sich an die Anwesenden wandte: »Einen Augenblick bitte, Ladies und Gentlemen. Ich muss Sie alle ersuchen, genau dort zu bleiben, wo Sie sind.«
»Was fällt Ihnen ein?« herrschte ihn der rotgesichtige Ringer an. Er war aufgesprungen und wirkte kampfeslustig. »Sie haben nicht das Recht ...«
»Das hab ich als Mitarbeiter von Scotland Yard sehr wohl!«, unterbrach ihn Grover scharf. »Hier wurde soeben ein Mann getötet und ehe ich nicht weiß, wer der Täter ...«
»Der Täter wurde bereits gerichtet.« Der Ringer zeigte auf den toten Skorpion auf dem Boden.
»Der Skorpion war lediglich ein Mittel zum Zweck«, erklärte Grover ruhig. »Die Frage ist, wer tat ihn in die Vase? Und zwar ausgerechnet in jene Vase, in der Mr. Galloways Gage deponiert sein sollte?«
Der Ringer zuckte verächtlich die Schultern. »Zufall. Tragisch, gewiss – aber Zufall. Der Skorpion ist wahrscheinlich aus einem Terrarium des Hausherrn entwischt und da reingekrochen.«
»Hat der Skorpion auch anschließend den Deckel auf die Vase gesetzt?« fragte Grover sarkastisch.
»Also gut. Dann war es also Mord!«, schnauzte der Ringer. »Ein Grund mehr für mich, hier zu verschwinden. Kommen Sie, Sardar«, wandte er sich an den jungen Inder und machte Anstalten, zur Tür zu gehen.
Mit einem schnellen Schritt vertrat ihm Grover den Weg und blickte ihm kalt in die Augen. Seine Stimme war leise, aber gefährlich. »Sie werden bleiben, verstanden?«
»Was wollen Sie tun, Chief-Inspector? Uns alle verhaften?«, fragte nun die sehr attraktive Dame mit den roten Haaren in mokantem Tonfall. »Wenn es stimmt, was in dem Brief steht, sind wir hier alle in Gefahr, Sie können unmöglich von uns verlangen ...«
»Grundgütiger, was ist denn das?«, entfuhr es dem alten Mann mit dem Backenbart, von dem ich immer noch annahm, dass es sich um einen Seefahrer handeln musste. Fassungslos blickte er in Richtung des Fensters. Dann sahen wir es alle. Die Brücke über den Fluss brannte lichterloh.
Kapitel 6
Das Feuer inmitten einer unendlichen weißen Ebene bot einen bizarren Anblick. Die Flammen mochten an die zehn Yards hoch lodern und waren dabei, die gesamte Holzbrücke zu verschlingen.
Alle Anwesenden blickten stumm auf das Schauspiel, das sich da vor ihren Augen abspielte. Auf einigen Gesichtern bemerkte ich blankes Entsetzen; nur auf die attraktive Rothaarige schien der schaurig-schöne Feuerschein beinahe schon eine hypnotische Faszination auszuüben.
»Nun sitzen wir hier fest«, sagte der sehr dicke Mann in düsterem Tonfall mehr zu sich selbst als zu den anderen. Er hatte verdammt recht. Die Brücke war die einzige Verbindung zur Landstraße. Es würde unmöglich sein, mit dem Wagen über die gefrorenen und tiefverschneiten Äcker zu kommen, und Fußmärsche über fünfzehn Meilen bis nach Glastonbury (falls man sich nicht auch noch verirrte) bedeuteten angesichts der Minusgrade und des heftigen Schneegestöbers den sicheren Tod durch Erfrieren. Wir waren gefangen.
»Jemand muss etwas tun!«, entfuhr es dem Mann, der wie ein Lyriker aussah, in hilflosem Tonfall, während er fahrig an seinem grauen Ziegenbärtchen herumzupfte. Nun richteten sich alle Augen auf Grover, der den Brief vom Boden aufgehoben hatte und nun im Begriff war, sich im Salon umzusehen, als ob er etwas suche. Gleich darauf hatte er es entdeckt: einen Telephonapparat auf einem kleinen Tischchen. »Ich werde mich mit dem Polizeirevier in Glastonbury verbinden lassen«, teilte er uns mit. »Dort wird man alles Nötige in die Wege leiten.« Er nahm den Hörer ab und wartete auf die Vermittlung. Dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck. »Hallo?« Er wartete. »Hallo?«
»Da werden Sie kein Glück haben«, bellte der Ringer und zeigte auf etwas unter dem Tischchen. Ich brauchte einen Moment, bis ich erkannte, worum es sich handelte: Das Telephonkabel war aus der Wand gerissen worden und lag auf dem Boden. Grovers Miene verhärtete sich. Der Spanier war aufgesprungen und starrte mit funkelnden Augen auf die übrigen Gäste. »Wer ist das gewesen?«, zischte er. Er machte den Eindruck, als wünsche er den Verantwortlichen mit bloßen Händen zu erwürgen. Alle blickten nervös um sich und natürlich meldete sich niemand. Ich fand es an der Zeit, das Offensichtliche auszusprechen. (Für den Fall, dass es für den einen oder anderen doch nicht so offensichtlich war.) »Nun, ich fürchte, es war derselbe, der die Brücke in Brand gesteckt hat.«
»W-was?« Der Mund des Lyrikers zuckte nervös.
»Natürlich«, antwortete ich. »Brücken fangen nicht von selbst an zu brennen. Schon gar nicht im Winter, wenn alles voller Schnee ist. Nein, jemand muss die Brücke angezündet haben. Wahrscheinlich mit mehreren Kanistern Benzin.«
Dem Lyriker fiel die Kinnlade hinunter.
»Vielleicht werden wir in diesem Moment beobachtet«, hauchte die glubschäugige Kipling-Verehrerin. »Vielleicht durch eine geheime Öffnung in der Wand.« Sie blickte vorsichtig um sich.
Der Spanier richtete sich zu voller Größe auf und trat vor: »Ich fordere den Verantwortlichen auf, sich zu erkennen zu geben! Zeigen Sie sich! Stellen Sie sich dem Kampf Mann gegen Mann«, schnarrte er pathetisch. Erneut rührte sich niemand. Der Spanier durchbohrte die männlichen Gäste nacheinander mit seinen Blicken. »Ich dachte es mir schon: Sie sind kein Ehrenmann, Sie sind ein Feigling«, rief er in den Raum hinein. »Sie haben diesen Mann ermordet«, er deutete auf den toten Schauspieler, »und unsere Verbindungen zur Außenwelt gekappt. Doch konnten Sie das nur tun, weil wir unvorbereitet waren. Doch nun sind wir es und ich warne Sie: Wer sich mit einem heißblütigen Argentinier anlegt, hat schon verloren. Und wer Eduardo Casares herausfordert, ...«, er schlug sich mit der Faust gegen die Brust, » ... ist schon so gut wie tot!« Wie zur Bekräftigung seiner Worte zog er den Degen einige Inches aus seinem Stock hervor und blickte drohend in die Runde. Die meisten sahen weg, nur der Ringer hielt seinem Blick herausfordernd stand.
»Setzen Sie sich, Mr. Casares«, forderte Grover den Argentinier mit bewundernswerter Ruhe auf.
Casares fuhr hitzig herum. »Ich werde mich nicht setzen!«
»Gut, dann bleiben Sie eben stehen«, brummte Grover und zuckte gleichgültig die Schultern. Casares funkelte ihn wütend an. Dann setzte er sich mit provozierender Langsamkeit. Grover wandte sich nun auch an die anderen: »Wir müssen bis auf Weiteres mit dem Schlimmsten rechnen und davon ausgehen, dass dieser Brief der Wahrheit entspricht. Es ist jemand unter uns, der plant, Sie alle zu ermorden. Einen Mord hat er bereits ausgeführt. Außerdem hat er uns die Möglichkeit genommen, diesen Ort zu verlassen oder Hilfe herbeizuholen.« Langsam ließ er seinen Blick über die Anwesenden wandern, erst dann fuhr er fort: »Wir sind also vollkommen auf uns allein gestellt. Ich muss Sie daher noch einmal alle bitten, zu bleiben, wo Sie sind, und vor allem nicht den Salon zu verlassen. Falls dieser Mörder tatsächlich unter uns ist, sind wir nur so sicher.«
»Was, wenn wir Ihrer Bitte nicht nachzukommen wünschen?«, verlangte der Ringer zu wissen.
»Dann ist es keine Bitte, sondern eine behördliche Anordnung«, antwortete Grover höflich.
»Wer sagt denn, dass Sie überhaupt von Scotland Yard sind?«, traute sich nun sogar der Lyriker zu fragen, wenn auch sein dreister Tonfall durch seine heftig flatternden Augenlider konterkariert wurde.
Grover zog seine an einer Kette befindliche Polizeimarke aus der Westentasche und schwenkte sie einmal durch den Raum, so dass jeder einen Blick darauf werfen konnte.
»Sowas kann man auch fälschen«, bemerkte der Lyriker mit den letzten Restbeständen von Trotz, aber niemand beachtete ihn.
»Und wenn der Mörder einen Revolver hat?«, warf Prowley aufrührerisch in die Runde. Mehrere stimmten ihm bei. Grover wedelte mit dem Brief. »Hier steht, dass es zu einfach wäre, Sie zu vergiften. Daraus darf man schließen, dass es auch zu einfach