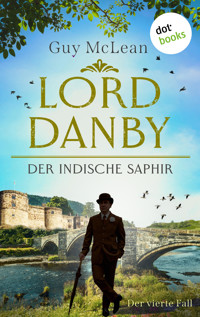4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lord Danby
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Bei den Franzosen ist der Teufel los: Der höchst humorvolle Kriminalroman »Lord Danby – Die Deauville-Affäre« von Guy McLean als eBook bei dotbooks. 1936 in einem Kurort der Normandie: Percival Danby ist ganz gewiss nicht auf eigenen Wunsch hierher gereist, in das Land der grässlichen Zigaretten und absurd in die Länge gezogenen Brotlaibe. Doch was tut man nicht alles, um einen alten Schulfreund glücklich zu machen – und wenigstens ist der Wein gut. Aber als er in Deauville eintrifft, fehlt von seinem Freund jede Spur, und als Danby sich auf einer Cocktailparty vergnügen will, stirbt der Gastgeber vor seinen Augen! Die Ursache: Gift. Die Verdächtigen: alle Gäste auf der Yacht – auch Danby. Die Anklage: Mord. Diese Impertinenz und Unfähigkeit der französischen Gendarmerie kann Lord Danby so nicht stehen lassen und er beschließt, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Wie gut, dass er mit Basil Grover einen englischen Chief Inspector zum Freund hat, denn die Familie des Toten scheint mehr als ein pikantes Geheimnis zu hüten … Ein Krimi wie von Agatha Christie – nach dem Genuss mehrerer Gläser ausgezeichneten Portweins! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Kriminalroman »Lord Danby – Die Deauville-Affäre« von Guy McLean ist der zweite Fall dieses ikonischen Ermittlers mit Schirm, Charme und Marotten. Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Ähnliche
Über dieses Buch:
1936 in einem Kurort der Normandie: Percival Danby ist ganz gewiss nicht auf eigenen Wunsch hierher gereist, in das Land der grässlichen Zigaretten und absurd in die Länge gezogenen Brotlaibe. Doch was tut man nicht alles, um einen alten Schulfreund glücklich zu machen – und wenigstens ist der Wein gut. Aber als er in Deauville eintrifft, fehlt von seinem Freund jede Spur, und als Danby sich auf einer Cocktailparty vergnügen will, stirbt der Gastgeber vor seinen Augen! Die Ursache: Gift. Die Verdächtigen: alle Gäste auf der Yacht – auch Danby. Die Anklage: Mord. Diese Impertinenz und Unfähigkeit der französischen Gendarmerie kann Lord Danby so nicht stehen lassen und er beschließt, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Wie gut, dass er mit Basil Grover einen englischen Chief Inspector zum Freund hat, denn die Familie des Toten scheint mehr als ein pikantes Geheimnis zu hüten …
Über den Autor:
Guy McLean ist ein Pseudonym des Autors Stefan Lehnberg. Er ist ein wahres Multitalent. Schauspiel, Regie, Schriftstellerei – in all diesen (und zahllosen weiteren) Bereichen ist der Wahlberliner unglaublich erfolgreich. Er ist nicht nur der Verfasser der Lord-Danby-Reihe und mehrerer Theaterstücke, sondern war unter anderem als Autor für Harald Schmidt und Anke Engelke tätig. Seine tägliche Radiocomedy »Küss mich, Kanzler«, bei der Lehnberg als alleiniger Autor, Regisseur und männlicher Hauptdarsteller fungierte, brachte es auf über 3000 Folgen, und sein Roman »Mein Meisterwerk« wurde mit dem Ephraim-Kishon-Satirepreis ausgezeichnet. Weitere Höhepunkte seiner Karriere markieren die Veröffentlichung von »Das persönliche Tagebuch von Wladimir Putin«, »Comedy für Profis – Das Praxisbuch für Autoren und Comedians« sowie die drei Goethekrimis »Durch Nacht und Wind«, »Die Affäre Carambol« und »Die Briefe des Ikarus«. Außerdem sieht er gut aus, ist hochintelligent und verfügt über einen edlen Charakter. Doch ist ihm nichts davon zu Kopf gestiegen. Im Gegenteil: Er ist immer der sympathische Kumpel von nebenan geblieben, der sich auch keineswegs zu schade ist, mal ein paar biographische Zeilen über sich selbst zu schreiben.
Die Website des Autors: www.Lehnberg.com/
In der Reihe um »Lord Danby« veröffentlichte Guy McLean bisher die Romane:
»Lord Danby – Mord auf Asher Castle«
»Lord Danby – Die Deauville-Affäre«
Alle Romane sind als eBooks, Printausgaben und Hörbücher erhältlich. Weitere Bände sind in Vorbereitung.
Unter T. H. Lawrence erschien außerdem »Der Teufel von Dublin«, eine Anthologie neuer Father-Brown-Krimis.
***
Originalausgabe März 2023
Copyright © der Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-493-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Lord Danby 2«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Guy McLean
Lord Danby – Die Deauville-Affäre
Der zweite Fall
dotbooks.
Dramatis Personae
Lord Percival Danby
Sweeney Eliot – im französischen Exil lebender Freund Danbys
Tallulah Quayle – Medium
Julius C. Hartford III. – Amerikanischer Millionär aus Pittsburgh
Jean und Jacques – Kellner im Hotel Normandy Barrière
Sir Horace Avondale – Geschäftsmann aus London
Lady Arleen Avondale – seine Gattin
Major Terry Bishop – der beste Freund von Sir Horace
Clifford Marsh – Avondales Kompagnon
Sheila Nesbitt – Lady Avondales Nichte
Nigel Unsworth – Prokurist bei Avondale & Marsh
Capitaine Henrí Cabillaud – Police municipale Trouville-sur-Mer
Basil Grover – Chief-Inspector bei Scotland Yard
»Wenn Sie mein Mann wären,
würde ich Ihnen Gift in den Tee schütten.
Lady Astor
»Und wenn Sie meine Frau wären,
würde ich diesen Tee trinken.«
Winston Churchill
Erster Teil
Kapitel 1
Jeder weiß, dass wir Danbys schon immer einen ausgeprägten Sinn für Fairplay hatten. Ich bin stolz darauf, sagen zu dürfen, dass es in der über achthundertjährigen Geschichte unserer Familie ehrwürdige Tradition ist, sich niemals eine Meinung zu bilden, bevor nicht alle Argumente und Gegenargumente wohl erwogen wurden. Es liegt mir daher fern, in die lauten Rufe des Abscheus einzustimmen, die aus den Kehlen meiner britischen Landsleute erschallen, wenn das Gespräch auf das Thema Frankreich kommt. Diese einseitige Betrachtungsweise behagt mir nicht. Ich vertrete den Standpunkt, dass auch die guten Seiten Frankreichs gesehen werden müssen. Als da wären die Weine und die Frauen. Beide sind dort oft in solch exquisiter Qualität vorzufinden, dass ich ihnen gegenüber ihren englischen Pendants in aller Regel den Vorzug geben würde. Eine Ansicht, von der bekannt ist, dass sie auch von den meisten meiner illustren Ahnen geteilt wurde, wobei der berüchtigte Charme der Danbys, unser traditionell unverschämt formidables Äußeres sowie Reichtum und Adelstitel behilflich waren, dass man in den Genuss des Letzteren kam, und unsere berühmte eiserne Danbyleber dafür sorgte, dass man den reichlichen Genuss des Ersteren außergewöhnlich gut vertrug.
Nachdem nun die Vorzüge Frankreichs gewürdigt sind, dürfen natürlich auch die Nachteile nicht verschwiegen werden, wobei an erster Stelle der folgende zu nennen wäre: Frankreich ist einfach furchtbar.
Seit Jahrhunderten sind wir Briten mit Frankreich verfeindet, ja wir haben im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert sogar einen hundertjährigen Krieg gegen die Franzosen geführt. Der genaue Anlass ist mir entfallen, aber ich vermute, wir werden uns schon etwas dabei gedacht haben. Am Rande sei vermerkt, dass auch die Danbys stets zur Stelle waren, wenn es darum ging, Englands Ehre gegen die frechen Franzosen zu verteidigen. Sei es bei der Schlacht bei Azincourt, dem Seegefecht von Trafalgar oder einer anderen Gelegenheit; wir Danbys standen immer an vorderster Front und dies bis in unser Jahrhundert. Es ist gerade einmal einundzwanzig Jahre her, dass mein Großonkel Charles im Weltkriegsjahr 1915 im Alleingang ein französisches Munitionsdepot in die Luft sprengte und fast sämtliche Offiziere der dort stationierten Einheit gefangen nahm. Dass er im Eifer des Gefechts außer Acht gelassen hatte, dass die Franzosen diesmal ausnahmsweise unsere Verbündeten waren, mag als Schönheitsfehler dieser Aktion gesehen werden, ändert aber nichts an ihrer Kühnheit und militärischen Brillanz.
(Möglicherweise hatte mein Großonkel Charles bei seinem Angriff auf das französische Munitionsdepot statt auf deutsche Stellungen auch daran gedacht, dass sowohl unser Monarch, Georg V., als auch der Monarch der Deutschen, Wilhelm II., Enkel unserer Königin Victoria waren und dass dieser Krieg somit im Grunde in der Familie blieb.)
Was nun die zahllosen weiteren Gründe für die Furchtbarkeit Frankreichs angeht, weiß man gar nicht, wo man da anfangen soll. Bei dem grotesken Essen? (Froschschenkel, Schnecken, absurd in die Länge gezogene Brotlaibe), bei der lächerlichen Sprache, die klingt, als würde man mit vollem Munde reden? Beim Eiffelturm, einer völlig sinnlosen Konstruktion, welche die ganze Hauptstadt verschandelt – und selbst manchem Franzosen peinlich ist; so bezeichnete Èmile Zola ihn als die durchlöcherte Giraffe und Guy de Maupassant speiste jeden Tag im Restaurant des Turms zu Mittag, da dies der einzige Ort in Paris war, von dem aus man das scheußliche Ungetüm nicht sehen konnte. Fairerweise muss natürlich bemerkt werden, dass auch wir Engländer uns hoch hinaufragende Konstruktionen in unsere Hauptstadt gestellt haben, zum Beispiel die Säule am Trafalgar Square. Aber bei uns steht mit Lord Nelson auf ihrer Spitze ein siegreicher Kriegsheld. So ergibt das Ganze Sinn. Aber lediglich die Stützkonstruktion ohne die Statue aufzustellen, ist so, als würde man im Museum nur die Rahmen ohne die Bilder aufhängen. Allerdings haben die Franzosen ja auch niemanden aufzubieten, den sie dort oben draufstellen könnten. Der einzige »Franzose«, der in dieser Hinsicht Respektables geleistet hat, war Korse.
Kurz und gut, bislang hat mir noch niemand schlüssig darlegen können, weshalb es dieses Land überhaupt geben muss.
Dennoch befand ich mich an jenem Tage, an dem mein Bericht beginnt – man schrieb den einunddreißigsten Mai 1936 – auf dem Weg nach Frankreich. Nicht aus eigenem Antrieb. Weiß Gott nicht! Ein alter Schulfreund aus meinen Tagen in Eton namens Sweeney Eliot hatte den fatalen Fehler begangen, seine herrliche englische Heimat gegen die Tristesse Frankreichs einzutauschen, und lebte (kann man das überhaupt »leben« nennen?) an der Riviera (welche die Herzensdame unseres Königs, Wallis Simpson, so treffend als den Tummelplatz der Nichtsnutze bezeichnete) in Nizza und versuchte, die Folgen seiner Wahnsinnstat dadurch zu mildern, indem er auf Teufel komm raus seine britischen Freunde zu sich einlud, und nun – offenbar waren alle seine sonstigen Freunde aufgebraucht – hatte es auch mich ereilt. Mehrfach hatte ich sein Ansinnen abzuschmettern gewusst, indem ich behauptet hatte, keine Zeit zu haben, um ganz Frankreich zu durchqueren, was bisher auch akzeptiert worden war, doch drei Wochen zuvor hatte mir Sweeney telegraphisch mitgeteilt, dass er einen kleinen Urlaub plane und zwar in Deauville, einem hübschen Städtchen in der Normandie, das nur einen Katzensprung von Calais entfernt läge, also praktisch noch in Sichtweite Englands, und dass ich nun endgültig keinen Grund mehr hätte, ihn nicht zu treffen. Dann hatte er mir in den höchsten Tönen von Deauville vorgeschwärmt. Er sprach von der unvergleichlichen Eleganz des mondänen Badeorts, von den prominenten Gästen, die dort seit jeher verkehrten, Persönlichkeiten wie Napoleon III., Camille Saint-Saëns, Coco Chanel, Maurice Chevalier, André Citroën (was nicht allzu viel zu bedeuten hat, das sind schließlich alles Franzosen, denen das nichts ausmacht – gleich den Bewohnern Ägyptens, die das Wasser dort problemlos trinken können, während wir davon schwer krank würden). Er schwärmte von dem Spielcasino, das architektonisch teilweise dem Opernhaus von Schloss Versailles nachempfunden sei, von den (gleich) zwei Pferderennbahnen, von dem modernen Yachthafen und dem herrlichen Strand mit feinstem Sand (ich ziehe den ehrlichen Kies der Strände unser englischen Seebäder jederzeit französischem Sand vor!), er rühmte die schönen Parkanlagen des Parc des Enclos, die herrlichen historischen Villen, die säulen- und mosaikgeschmückten Pompeiischen Badeanlagen und nicht zuletzt das stilvolle Hotel, in dem wir logieren würden, das Normandy Barrière, das zu den besten Luxushotels Frankreichs gehöre. Last but not least ließ er durchblicken, dass Deauville in der Sommersaison traditionsgemäß fast vollständig in der Hand englischer Touristen sei und man – von den nun einmal unentbehrlichen Kellnern abgesehen – erfreulich wenigen Franzosen begegnete.
Dies alles eingedenk und da der alte Sweeney früher ein überaus unterhaltsamer Freund gewesen war, mit dem ich so mancher Kiste vorzüglichen (und auch weniger vorzüglichen) Weines den Garaus gemacht hatte, ließ ich Gnade vor Recht ergehen und sagte zu. Dennoch bedarf es keiner Erwähnung, dass es sich hierbei um einen jener Urlaube handelte, von denen ich mir nicht allzu viel erwartete.
Kapitel 2
In entsprechend melancholischer Verfassung saß ich also an diesem Sonntagmorgen in jenem Taxi, das mich zum Bahnhof bringen sollte; neben mir nur mein handlicher Gladstonekoffer, in dem ich nebst James Boswells großartigem Buch »Samuel Johnson – Leben und Meinungen« nur eine Notration schottischen Whiskys und einige persönliche Utensilien mit mir führte – meine beiden Überseekoffer hatte ich bereits am Tag zuvor aufgeben lassen – und blickte durch den Nebel, der – so wie der hauchzarte Schleier vor dem Antlitz einer bezaubernden Frau – meinem geliebten London auch heute wieder eine Aura von geheimnisvoller Schönheit verlieh.
An der Kings Cross Station bestieg ich den Zug 11.01 Uhr nach Dover. Während ich mich auf der Suche nach meinem Erste-Klasse-Abteil mit allerlei Volk durch den Gang quetschte, bemerkte ich eine Dame, die mich anstarrte. Nun ist es keineswegs ungewöhnlich, dass Damen mich anstarren, ich habe nun einmal diese gewisse Wirkung auf das schwache Geschlecht (erwähnte ich bereits das unverschämt fabelhafte Aussehen der Danbys?), ob ich allerdings dieses Anstarren auch »bemerke«, hängt von der Attraktivität der Starrerin ab. Die komplett in violetten Samt gewandete Dame war zwar auf den ersten Blick durchaus nicht hässlich, doch ein Blick in ihre grünen Augen ließ in mir den Verdacht aufkeimen, dass in ihr der Wahnsinn loderte oder dass sie auf dem Weg dorthin zumindest schon einen Großteil der Strecke erfolgreich zurückgelegt hatte. Mithin zog ich es in vorliegendem Fall vor, nichts zu bemerken, und setzte meinen Weg fort.
Die nächsten drei Stunden verliefen ereignislos. Während ich aus dem Fenster, gegen das von außen unser berühmter flüssiger Sonnenschein prasselte, auf die herrlichen Landschaften Südenglands blickte, gedachte ich meiner Collegejahre in Eton, in denen ich mir mit Sweeney Eliot eine Stube geteilt hatte. Sweeney war stets zu schrulligen Streichen aufgelegt gewesen, so dass mir nun zahlreiche längst vergessene Anekdoten und amüsante Erlebnisse wieder in den Sinn kamen. Ich musste an sein ansteckendes Lachen und seine unverwüstliche gute Laune denken und plötzlich lag mir auch wieder der unverwechselbare Geschmack der berühmten Eton Mess auf der Zunge, ein in Eton erfundenes Dessert, das aus Erdbeeren, zerbrochenen Baisers und Schlagsahne (und, wenn kein Vertreter des Lehrkörpers in Sicht war, einem gehörigen Schuss Likör) bestand. Es würde gut tun, den alten Schweinepriester wiederzusehen und in vergangenen Zeiten zu schwelgen.
Schließlich erreichten wir Dover, wo ich, nachdem mein Pass mit britischer Gründlichkeit ausgiebig überprüft worden war, die Fähre nach Calais bestieg.
Während ich so an der Reling stand und voller Wehmut zusah, wie die weißen Klippen Dovers unaufhaltsam im Meeresdunst entschwanden, kam ich ins Grübeln. Es war fast so, als ob – nun wo ich keinen festen Boden mehr unter den Füßen hatte – mein Verstand im Gegenzug alles daran setzte, sich mit jeder Minute mehr auf dem Boden fester Tatsachen zu befinden und mich mit strenger Miene darauf hinwies, dass ich die Dinge bislang wohl in einem allzu rosigem Lichte betrachtet hatte: Sweeney Eliot war keineswegs ein enger Freund gewesen, sondern lediglich irgendwer, den mir das Schicksal (in Gestalt der Schulleitung) willkürlich als Zimmergenossen zugeteilt hatte. Sicher, für uns blutjunge Narren hatte es sich wohl so ähnlich angefühlt wie Freundschaft, aber doch nur, weil das in diesem Alter nicht allzu viel zu bedeuten hat. Im reifen Mannesalter wählt man seine Freunde mit Bedacht, indem man auf den Charakter, die Ansichten und Überzeugungen achtet; als junger Mensch hingegen lässt man bei der Wahl seiner Freunde wenig Sorgfalt obwalten, sondern ist einfach mit dem Erstbesten befreundet, der gerade in der Nähe rumsteht. Sicher, Sweeney Eliot mochte damals ein mehr oder weniger netter Bursche voll guter Laune gewesen sein, aber je näher die Küste von Calais rückte, desto deutlicher kam mir zu Bewusstsein, dass wir uns bei unserem Wiedersehen wohl nicht besonders viel zu sagen haben würden.
Ein eisiger Wind, der aus Frankreich herüberblies, riss mich aus meinen Gedanken und veranlasste mich, unter Deck zu gehen. Während ich mir einen Platz suchte, wurde ich erneut des Wahnsinns in Violett gewahr, der mich bereits erspäht hatte und mir aus der Ferne mit einem verkrampften Lächeln zunickte. Leider hatte die Dame bereits scharfäugig registriert, dass ich sie ebenfalls bemerkt hatte, so dass ich mich aus Anstand genötigt sah, ihr ebenfalls zuzunicken, wenn auch in der schroffsten Form, die mir zu Gebote stand.
An dieser Stelle ist ein grundsätzlicher Rat angebracht: Wer noch nie den Ärmelkanal überquert hat, sollte sich glücklich schätzen und es dabei belassen. Manchen mag die scheinbar gemütliche Zurückgezogenheit diese Gewässers – gelegen zwischen zwei äußert dicht beieinander liegenden Ländern – zu dem Trugschluss verleiten, dass es dort, abgesehen von einem gelegentlich beschaulichen Plätschern, ruhig zugeht. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein: Der Ärmelkanal verbindet die Nordsee mit dem Atlantischen Ozean und bedient sich bei beiden Meeren gierig mit allem, was diese an Tücke und Wildheit auf Lager haben. Der Wellengang auf dem Ärmelkanal kann nur als monströs bezeichnet werden und bietet Passagieren, die zur Seekrankheit neigen, reichlich Anlass, dieser Neigung zur frönen – und denen, die bisher nicht darunter gelitten hatten, die Gelegenheit, etwas dazuzulernen. Ich ziehe es daher vor, über den Rest der Überfahrt den barmherzigen Mantel des Schweigens auszubreiten. Es genügt zu sagen, dass wir Calais mit vierzig Minuten Verspätung erreichten und nachdem auch mein Pass mit französischer Umständlichkeit ausgiebig überprüft worden war, lag die Verspätung bereits bei einer vollen Stunde. Der Zug nach Deauville war jedoch nicht fahrplanmäßig abgefahren, sondern hatte auf uns gewartet. (Eines muss man den Franzosen lassen: Warten können sie.)
Nun war ich also unwiderruflich in Frankreich und während ich aus dem Fenster meines Abteils gegen die blendende Sonne auf die trübsinnige Landschaft der französischen Küste blickte, fielen die letzten verklärten Erinnerungen von mir ab und mir kam nun kristallklar zu Bewusstsein, was für ein unangenehmer Patron dieser Mr. Eliot schon immer gewesen war (auch wenn ich es früher nicht richtig bemerkt hatte.). Ich erinnerte mich wieder schmerzvoll an sein schrilles und höchst enervierendes Gelächter, in das er alle Naselang, ohne erkennbaren Grund, ausbrach, sowie an seine üblen Streiche, deren Opfer mehr als einmal ich selbst gewesen war, und verfluchte den Tag, an dem ich ihm zum ersten Mal begegnet war. Unter anderen Umständen wäre ich am nächsten Bahnhof ausgestiegen und hätte mich stante pede auf die Rückreise gemacht, doch leider hatte ich ihm mein Kommen nun einmal zugesagt und jeder weiß, dass wir Danbys – komme was da wolle – ein einmal gegebenes Wort niemals brechen.
Solche und ähnlich düstere Gedanken in mir bewegend, fuhr ich weiter gen Deauville, das, wie ich inzwischen erfahren hatte, im Department Calvados gelegen ist – ein, wie ich einräumen muss, geschickter Schachzug der Franzosen. Da ihnen die Mängel ihres Landes natürlich tief im Inneren schmerzlich bewusst sind, haben sie sich auf die raffinierte, ja man muss schon fast sagen perfide Strategie verlegt, Städte, ja ganze Landstriche, dadurch aufzuwerten, indem sie diese nach Alkoholsorten wie Calvados, Armagnac, Champagne, Burgunder, Cognac, Chablis, Chardonnay, Beaujolais oder Bordeaux benennen, was diese Gegenden dem ahnungslosen Fremdling natürlich auf den ersten Blick ungemein attraktiv erscheinen lässt, aber letztlich natürlich nicht das Geringste an dem bösen Erwachen ändert, das ihn unverzüglich ereilt, wenn er dort eintrifft.
Apropos böses Erwachen: Das monotone Rattern des Zuges, gepaart mit der grundsätzlichen Langeweile Frankreichs, hatte mich in einen tiefen Schlummer fallen lassen, aus dem ich erst kurz vor Honfleur erwachte. Erfrischt schlug ich die Augen auf, doch angesichts dessen, was sie zu sehen bekamen, fuhr mir sofort gehörig der Schreck in die Glieder: Mir gegenüber saß jetzt die wahnsinnige Dame und fixierte mich wie eine Katze (eine absolut wahnsinnige Katze!), die vor dem Mauseloch lauert.
»Wünsche, wohl geruht zu haben«, gurrte sie scheinbar freundlich, aber doch mit einem gewissen Unterton, ganz so, als müsste ich ein schlechtes Gewissen haben, dass ich in ihrer Anwesenheit geschlafen hatte. Ich nickte knapp und bedauerte so sehr wie selten zuvor in meinem Leben, dass ich keine Times mit mir führte, hinter die ich mich nun hätte retten können.
»Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich mich zu Ihnen ins Abteil gesetzt habe?«, fragte sie und fuhr klugerweise sogleich fort, so dass ich keine Gelegenheit hatte, etwas darauf zu entgegnen. »Sie sind in diesem Zug die einzige Person mit Niveau«, versuchte sie mir erfolglos zu schmeicheln (denn das war mir natürlich schon vorher klar gewesen). Sie rümpfte die spitze Nase. »Ansonsten sind überall nur Franzosen und was die Engländer hier betrifft, handelt es sich offenkundig sämtlich um Hohlköpfe.« (Auch das lag auf der Hand, warum sonst sollten sie wohl nach Frankreich reisen?) Ich nickte so knapp, dass man schon ein ausgesprochen leistungsstarkes Mikroskop benötigt hätte, um die Bewegung zu entdecken, doch offenbar immer noch nicht knapp genug, um die Dame zu entmutigen, denn nun hielt sie mir ihre mit drei Ringen (verziert mit billigen Klunkern) geschmückte Hand hin. »Tallulah Quayle.«
Ich übersah die Aufforderung zum Handkuss (wir Danbys sind berühmt für unser Talent, Dinge zu übersehen) und schüttelte ihr kurz die Hand nach der Art, wie man es auf Beerdigungen tut, ein einzelner knapper Ruck, nebst eines ernsten Zunickens. »Danby.«
Doch offenbar sind nicht nur wir Danbys gut im Übersehen von Offensichtlichem, Tallulah Quayle stand uns in dieser Fähigkeit um kein Jota nach.
»Angenehm, Mr. Danby. Sind Sie nicht auch der Ansicht, dass nichts über ein gutes Gespräch zwischen Menschen von Niveau geht?«
»Zweifellos«, erwiderte ich höflich, »doch sind es nur noch wenige Meilen bis Deauville, wo ich leider aussteigen muss.«
Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie mich an. »Das ist ja unglaublich. Ich auch!«
»Ach, was für ein Zufall«, kommentierte ich die unerfreuliche Offenbarung.
»Zufall?« Tallulah Quayle lehnte sich weit vor und blickte mir tief in die Augen. »Es gibt keine Zufälle. Ich hab es gleich gespürt. Erst befanden wir uns im selben Zug, dann auf derselben Fähre, und nun erneut im selben Zug.«
Das ist nun einmal der Weg von London nach Deauville, dachte ich, und es trifft auf hunderte von weiteren Personen ebenfalls zu.
»Das ist Kismet«, fuhr die wahnsinnige Miss (einen Ehering hatte ich nicht entdecken können, es hätte mich auch sehr gewundert) Quayle fort. »Sie müssen Jungfrau sein.«
»Bitte was?« Die Dame schien nun gänzlich in die Gefilde des Irrsinns übergewechselt zu sein.
»Jungfrau. Das Sternzeichen. Hab ich recht?«
Nun hab ich noch nie etwas für diesen Astrologie-Mumpitz übriggehabt, aber im Laufe von fünfunddreißig Lebensjahren bleibt es nun mal nicht aus, dass man – buchstäblich gegen seinen Willen – erfährt, unter welchem Sternzeichen man geboren ist. Es war auch nur deshalb in meinem Gedächtnis haften geblieben, weil es zufällig das einzige Zeichen war, welches, zumindest von der Symbolik her, etwas taugte. »Ich bin Löwe«, versetzte ich.
»Löwe!«, jauchzte sie. »Ich wusste es! Und ich bin Skorpion. Es ist Schicksal, dass wir ein gemeinsames Ziel haben.«
»Das halte ich für recht unwahrscheinlich.«
Sie sah mich mitleidig an. »Die Sterne lügen nicht, Mr. Danby. Die Sterne lügen nicht.«
»Richtig, Miss Quayle. Aber doch nur deshalb, weil sie nicht reden können.«
Auch das ignorierte Miss Quayle ostentativ. Stattdessen grapschte sie nach meiner Hand und bevor ich sie wegziehen konnte, hatte sie sich schon tief über meine Handfläche gebeugt und studierte mit gierigen Blicken, die einem Vampir alle Ehre gemacht hätten, die darauf befindlichen Linien. Mit einem Mal erschrak sie. Sie spießte meine Hand mit ihrem Zeigefinger auf und blickte mir tief betroffen in die Augen. »Hüten Sie sich vor einem Mann, der nicht lebt, sonst werden Sie Deauville nicht lebend verlassen.«
Ich zog ironisch eine Augenbraue hoch. »Ich soll mich vor einem toten Mann hüten? Was könnte der mir schon tun?« (Dass ich Handleserei ohnehin für Humbug hielt, erwähnte ich erst gar nicht.)
»Kein Toter Mann«, wisperte sie dramatisch. »Ein Mann, der nicht lebt!«
In diesem Augenblick quietschten schrill die Bremsen unseres Zuges und wir rollten langsam in den Bahnhof von Deauville ein.
Kapitel 3
Obwohl mir das zweifelhafte Vergnügen, die Anwesenheit von Miss Quayle zu genießen, nur kurz vergönnt gewesen war, hatte es mir doch vor Augen geführt, dass im Vergleich zu ihr der gute alte Sweeney die beste Gesellschaft war, die man sich nur wünschen konnte, und meine finsteren Beurteilungen seiner Person lösten sich in Wohlgefallen auf. Ja, ich freute mich nun geradezu darauf, ihn wiederzusehen. (Man darf auch nicht vergessen, dass er abgesehen von Miss Quayle der einzige Brite war, den ich hier im französischen Exil kannte.) Sweeney hatte in seinem letzten Brief angekündigt, dass er mich am Bahnhof erwarten würde, also verabschiedete ich mich eilig von meiner verrückten Reisebekanntschaft, stieg aus dem Zug und hielt Ausschau nach meinem Freund. Da er sich nicht auf dem Bahnsteig befand, verließ ich das Bahnhofsgebäude, doch auch dort war weit und breit keine Spur von ihm zu entdecken. Also nahm ich ein Taxi und ließ mich zum Hotel Normandy Barrière chauffieren. Wenn ich’s recht überlegte, hätte es ohnehin nicht zu Sweeney gepasst, wenn er daran gedacht hätte. Wahrscheinlich planschte er gerade selig im Meer herum, spielte Tennis oder (die wahrscheinlichste Variante) schlürfte gerade Cocktails mit einigen charmanten Damen.
Als ich dem Taxi entstieg, war ich angenehm überrascht. In diesem Falle hatte Sweeney nicht zuviel versprochen. Das Normandy Barrière machte äußerlich einen hervorragenden Eindruck und dieser verstärkte sich noch, als ich die luxuriöse Hotellobby betrat, die es – wie mir schien – beinahe mit der eines britischen Grand Hotels aufnehmen konnte.
Doch die Freude war nur von kurzer Dauer; bereits an der Rezeption erlebte ich eine weitere unangenehme Überraschung: Der Concierge teilte mir in kaum verständlichem Englisch (der Mann hatte einen starken französischen Akzent) mit, dass Mr. Eliot noch nicht eingetroffen sei. Das verstimmte mich ein wenig, aber gemäß der alten Devise des englischen Adels »Never complain, never explain« ließ ich mir nichts anmerken und bezog zunächst mein Zimmer im ersten Stockwerk des Hotels. Es verfügte über einen prächtigen Marmorboden aus schachbrettartig verlegten schwarzen und weißen Kacheln, Chintzvorhängen an der Balkontür und war luxuriös im Louis-Quinze-Stil eingerichtet. Nur die vielen gerahmten kleinen Zeichnungen und Photographien, die Deauville in der Zeit zeigten, als es noch ein einfaches Fischerdorf gewesen war, wollten nicht recht dazu passen. Mit Wohlgefallen registrierte ich, dass mein Gepäck nicht nur bereits eingetroffen, sondern auch ausgepackt und eingeräumt worden war. Plötzlich klopfte es an der Tür. Ich öffnete; draußen stand ein Page mit einem Silbertablett, auf dem ein Telegramm für mich lag. Es lautete wie folgt:
Verärgert trat ich ans Fenster, grübelte vor mich hin und blickte eine Weile auf das Meer hinaus.
Trotz größten Bemühens war es mir nicht möglich, England von hier aus zu erkennen, und ich beschloss, bei nächster Gelegenheit einen Feldstecher zu erwerben.
Kapitel 4
Der Abend kam. Wer nicht kam, war Sweeney. Stattdessen erreichte ich mich ein weiteres Telegramm des Inhalts, dass er erneut aufgehalten worden sei und nun erst gegen morgen Mittag eintreffen würde. Ich muss zugeben, jetzt war ich ernstlich verstimmt. Falls dies einer von Sweeneys berüchtigten Streichen sein sollte, war es eindeutig der übelste, den er mir je gespielt hat. Mein erster Impuls war, augenblicklich abzureisen, doch ich tat es nicht. Zum einen, weil ich die Auffassung vertrete, dass man als Engländer unvorhergesehene Misshelligkeiten mit Würde zu tragen hat, zum anderen, weil, wie ich anhand eines an der Rezeption ausliegenden Fahrplanes feststellte, der letzte Zug von Deauville nach Calais bereits vor vierzig Minuten abgefahren war und dass es zwar am folgenden Tag zwei Züge gab – 10.57 Uhr und 18.57 Uhr (außer montags) – jedoch in Calais erst am übernächsten Tag um 15.20 Uhr wieder eine Fähre nach Dover abfuhr, was einen ganzen Tag Aufenthalt in Calais bedeutet hätte, so dass mir ein weiterer Tag in Deauville als das kleinere Übel erschien.
Hätte ich geahnt, dass ich schon sehr bald in einen höchst ominösen Mordfall verwickelt werden würde, bei dem auch mein eigenes Leben auf dem Spiel stand, wäre ich notfalls auch zu Fuß nach Calais gelaufen. Doch der Reihe nach: Von den Ereignissen des Tages ermattet, begab ich mich in das Hotelrestaurant – einen prächtigen Saal mit einem riesigen Kristalllüster – der bereits zum Bersten mit elegant gekleideten Gästen gefüllt war, so dass ich Glück hatte, den letzten noch freien Tisch zu ergattern. Aus dem Stimmengewirr hörte ich viel Englisch heraus, was mich verwunderte. Mich hatte man moralisch unter Druck gesetzt, hierherzureisen, welche Entschuldigung all die anderen hatten, konnte ich mir nicht denken.
Da mein Französisch zwar recht brauchbar ist, jedoch wiederum nicht so brauchbar, dass es den Spezialitäten einer französischen Speisekarte Paroli bieten könnte, beging ich den Fehler, auf das Angebot des Kellners hereinzufallen – eines hochgeschossenen Burschen, der sich als Jacques vorstellte und einen hochgezwirbelten Schnurrbart trug, der eher zu einem Maler oder Bildhauer gepasst hätte – und mir die örtliche Spezialität servieren zu lassen. Ein unentschuldbarer Fauxpas meinerseits, hatte ich doch in meiner Erschöpfung vergessen, dass örtliche Spezialitäten grundsätzlich nichts taugen, denn taugten sie etwas, hätten sie sich ja weltweit durchgesetzt und wären keine örtlichen Spezialitäten geblieben. Der vorliegende Fall war das beste Beispiel dafür. Der Kellner brachte mir einen Camembert und einen Apfelwein namens Cidre doux, den ich nach dem ersten Schluck nicht einmal als Wein erkannte, sondern mich erst anhand des Etikettes vergewissern musste, dass es wirklich welcher war, genauer gesagt: wirklich welcher sein sollte. Der Alkoholgehalt betrug gerade einmal blamable 2,5 %, was dieses Getränk meiner Ansicht nach zu einem reinen Übungswein für Kinder macht, der von Rechts wegen an Erwachsene gar nicht abgegeben werden dürfte.
Hinter meinem Rücken vernahm ich ein sonores Lachen. »Spezialitäten der Normandie bestellt, was? Anfängerfehler, Kumpel. Aber trösten Sie sich, ist mir auch passiert.«
Ich drehte mich um und erblickte am Nebentisch einen stark übergewichtigen, rotgesichtigen Mann in einem zweifellos teuren, aber doch etwas geschmacklosen Anzug.
»Wie meinen?«