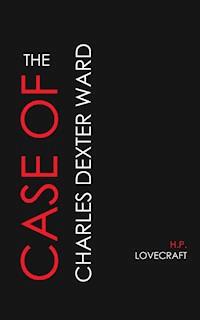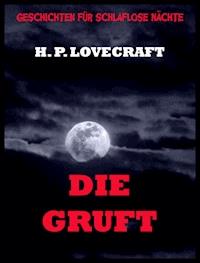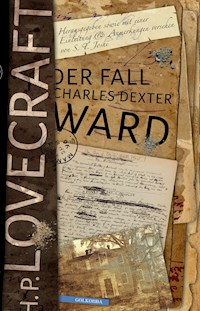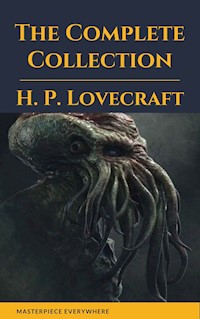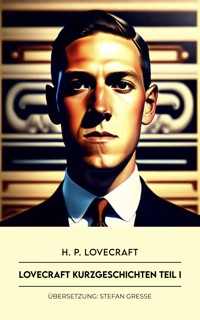
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Tempel – Polaris – Die Farbe aus dem All – Die Aussage von Randolph Carter – Das Weihnachtsfest - Das Unsagbare – Der Nachkomme – Kühle Luft – Das Unheil, das nach Sarnath kam – Das Biest in der Höhle. Zehn Kurzgeschichten von Howard Phillips Lovecraft in neuer Übersetzung. Fünf Stunden schauderhafte und fantastische Unterhaltung. Tauchen Sie ein in die dunklen Welten von H.P. Lovecraft und lassen Sie sich von seiner Erzählkunst in den Bann ziehen. In zehn meisterhaft erzählten Geschichten entfaltet sich Lovecrafts einzigartiges Universum kosmischer Schrecken, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft lauern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
Der Tempel
Polaris
Die Farbe aus dem All
Die Aussage von Randolph Carter
Das Weihnachtsfest
Das Unsagbare
Der Nachkomme
Kühle Luft
Das Unheil, das nach Sarnath kam
Das Biest in der Höhle
Der Tempel
The Temple (1920)
(ein Manuskript, aufgefunden an der Küste von Yucatan)
von H. P. Lovecraft
Übersetzung:Stefan Gresse (2023)
Am 20. August 1917 deponierte ich, Karl Heinrich Graf von Altberg-Ehrenstein, Leutnant der Kaiserlichen Deutschen Marine und Kommandant des Unterseebootes U-29, diese Flaschenpost an einer mir unbekannten Stelle im Atlantischen Ozean, wahrscheinlich bei etwa 20° nördlicher Breite und 35° westliche Länge, wo mein Schiff funktionsuntüchtig auf dem Meeresboden liegt. Ich tue das, weil ich gewisse ungewöhnliche Fakten öffentlich klarstellen möchte. Ich kann dies nicht persönlich tun, da ich selbst sehr wahrscheinlich nicht überleben werde, denn die Umstände, in denen ich mich befinde, sind so bedrohlich wie außerordentlich, da die U-29 hoffnungslos außer Gefecht gesetzt wurde, aber auch weil mein eiserner Wille auf die verheerendste Weise beeinträchtigt ist.
Wie wir U-61, das auf dem Weg nach Kiel war, über Funk berichteten, hatten wir am Nachmittag des 18. Juni den britischen Frachter Victory auf seinem Weg von New York nach Liverpool bei 45° 16‘ nördlicher Breite und 28°34‘ westlicher Länge torpediert. Wir erlaubten der Mannschaft, in ihre Rettungsboote zu steigen, um gute Filmaufnahmen für die Admiralität zu machen. Das Schiff sank recht spektakulär mit dem Bug zuerst, wobei es das Heck hoch aus dem Wasser hob, während die Hülle senkrecht auf den Meeresboden sank. Unsere Filmkamera nahm alles perfekt auf und ich bedaure zutiefst, dass diese großartige Rolle Film Berlin wohl nie erreichen wird. Danach haben wir die Rettungsboote mit unseren Kanonen versenkt und sind wieder abgetaucht.
Als wir bei Sonnenuntergang zur Oberfläche aufstiegen, wurde auf unserem Deck die Leiche eines Seemannes gefunden, dessen Hände auf merkwürdige Weise die Reling umklammerten. Der arme Kerl war noch jung, dunkelhaarig und gut aussehend; wahrscheinlich ein Italiener oder Grieche, und gehörte zweifellos zur Mannschaft der Victory. Er hatte sich wohl genau auf das Schiff flüchten wollen, das sich gezwungen sah, sein eigenes zu zerstören – ein weiteres Opfer des ungerechten Angriffskrieges, den die englischen Schweinehunde gegen unser Vaterland führen. Unsere Leute durchsuchten ihn nach Souvenirs und fanden in einer seiner Jackentaschen ein ganz besonderes Stück geschnitztes Elfenbein, das den Kopf eines jungen Mannes mit einem Lorbeerkranz darstellte. Mein Offizierskollege Leutnant Klenze meinte, es sei sehr alt und habe großen künstlerischen Wert, also nahm er es an sich. Weder er noch ich konnten uns vorstellen, wie es in den Besitz dieses einfachen Seemannes gelangen konnte.
Als der Tote dann über Bord geworfen wurde, geschahen zwei Dinge, die bei der Mannschaft für große Unruhe sorgten. Die Augen des Mannes waren zunächst geschlossen gewesen, aber als wir seinen Körper über die Reling zerrten, riss er sie auf und viele Besatzungsmitglieder schienen den seltsamen Eindruck zu haben, dass sie ständig und geradezu spöttisch Schmidt und Zimmer anstarrten, die sich über die Leiche gebeugt hatten. Der Bootsmann Müller, ein älterer Mann, der es eigentlich besser wissen sollte, wäre er nicht so ein abergläubisches Schwein aus dem Elsass, regte sich bei diesem Eindruck dermaßen auf, dass er die Leiche im Wasser genauestens beobachtete und danach schwor, dass sie die Arme ausstreckte, nachdem sie etwas herabgesunken war und unterhalb der Wellen schnell nach Süden zu schwimmen begann. Klenze und mir gefiel diese Zurschaustellung bäuerlicher Ignoranz gar nicht, und wir rügten die Männer ernsthaft, besonders Müller.
Am nächsten Tag entstand eine sehr problematische Situation durch das Unwohlsein einiger Mannschaftsmitglieder. Sie litten offensichtlich wegen unserer langen Reise unter starker nervlicher Belastung und hatten böse Träume. Einige der Männer schienen benommen und gefühllos zu sein und nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass sie ihre Schwäche nicht nur vortäuschten, befreite ich sie von ihren Pflichten. Die See war ziemlich rau, daher gingen wir auf eine Tiefe, in der die Wellen weniger lästig waren. Hier lag das Boot verhältnismäßig ruhig – trotz einer eigenartigen, nach Süden gerichteten Strömung, die wir auf unseren Seekarten nicht identifizieren konnten. Das Stöhnen der kranken Männer war äußerst lästig; aber da sie den Rest der Mannschaft nicht weiter demoralisierten, brauchten wir keine besonderen Maßnahmen zu ergreifen. Unser Plan war, dazubleiben, wo wir waren und den Liniendampfer Dacia anzugreifen, der in den Informationen unserer Agenten in New York erwähnt wurde.
Am frühen Abend tauchten wir zur Oberfläche auf und fanden die See weniger bewegt vor. Man sah den Rauch eines Schlachtschiffes am nördlichen Horizont, aber wegen der großen Entfernung und unserer Fähigkeit abzutauchen, fühlten wir uns sicher. Was uns mehr beunruhigte, waren die Geschichten des Bootsmannes Müller, die immer wilder wurden, während die Nacht heranbrach. Er war verachtenswert kindisch und faselte über die Wahnvorstellung von Leichen, die unter Wasser vor den Bullaugen vorbeitrieben. Angeblich starrten ihn diese Leichen eindringlich an. Sie waren schon aufgequollen, aber er erkannte in ihnen die Toten, die wir bei einer unserer siegreichen deutschen Heldentaten hinterlassen hatten. Er sagte, der Mann, den wir gefunden und über Bord geworfen hatten, sei ihr Anführer gewesen. Das war grauenhaft albern und nicht mehr normal, also ließen wir Müller Handschellen anlegen und kräftig auspeitschen. Die Mannschaft war über diese Bestrafung gar nicht erfreut, aber Disziplin war unbedingt notwendig. Wir lehnten auch den Antrag einer Delegation unter der Führung von Seemann Zimmer ab, dass der so eigenartig geschnitzte Elfenbeinkopf ins Meer geworfen werden müsse.
Am 20. Juni 1920 wurden die Seeleute Böhm und Schmidt, die am Tag zuvor krank gewesen waren, geistesgestört und gewalttätig. Ich bedauerte, dass kein Arzt unter den Offizieren an Bord war, denn deutsche Leben sind kostbar, aber die ständigen Fantasien der beiden über einen schrecklichen Fluch untergruben die Disziplin. Wir mussten daher drastische Maßnahmen ergreifen. Die Mannschaft akzeptierte das mürrisch, aber Müller schien es zu beruhigen, der uns danach keinen Ärger mehr machte. Am Abend ließen wir ihn frei und er tat schweigend seine Pflicht.
In der Woche danach waren alle sehr nervös und hielten Ausschau nach dem Schiff Dacia. Die Spannung steigerte sich noch durch das Verschwinden von Müller und Zimmer, die ohne Zweifel Selbstmord begangen hatten, wahrscheinlich wegen der Ängste, die sie anscheinend befallen hatten, auch wenn niemand beobachtet hatte, wie sie über Bord gesprungen waren. Ich war ziemlich froh, Müller los zu sein, denn selbst sein Schweigen hatte sich ungünstig auf die Mannschaft ausgewirkt. Alle schienen nun eher dazu zu neigen, Ruhe zu bewahren, wenn sie sich auch insgeheim fürchteten. Viele von ihnen waren krank, aber niemand wurde unruhig.
Leutnant Klenze litt unter der Anspannung und regte sich wegen jeder Kleinigkeit auf – zum Beispiel über eine Gruppe von Delfinen, die sich in immer größerer Zahl um die U-29 versammelt hatten und auch die immer stärker werdende Strömung in südlicher Richtung, die auf unseren Karten nicht verzeichnet war.
Es wurde langsam klar, dass wir die Dacia inzwischen völlig verpasst hatten. Solche Pannen sind nicht ungewöhnlich und wir waren eher erfreut als verärgert, denn unserer Rückkehr nach Wilhelmshaven stand nun nichts mehr im Weg. Am Mittag des 28. Juni nahmen wir Kurs in nordöstlicher Richtung und trotz der eher komischen Verwicklungen mit der ungewöhnlichen Anzahl von Delphinen waren wir schon auf dem Weg nach Hause.
Die Explosion im Maschinenraum um zwei Uhr nachts kam dann auch vollkommen überraschend. Wir hatten keinen Defekt an der Maschine bemerkt und es hatte auch keine Unachtsamkeit seitens der Mannschaft gegeben, als das Schiff plötzlich von einem Ende zum anderen von einem gewaltigen Schlag durchfahren wurde. Leutnant Klenze eilte in den Maschinenraum und stellte fest, dass der Treibstofftank und ein Großteil der Maschine zerschmettert worden waren, wobei die Ingenieure Raabe und Schneider ums Leben kamen. Unsere Situation war urplötzlich lebensgefährlich geworden, denn auch wenn die chemischen Lufterneuerer noch intakt waren und wir die Anlagen zum Auf- und Abtauchen noch benutzen konnten und es daher noch möglich war, die Luken zu öffnen, solange noch Druckluft vorhanden war und die Batterien hielten, so waren wir doch ohne Antrieb, um das U-Boot anzutreiben und auf Kurs zu halten. Der Versuch, in die Rettungsboote umzusteigen, hätte uns dem Feind ausgeliefert, der erbittert gegen das große Deutsche Reich kämpfte, denn unsere Funkanlage funktionierte seit der Geschichte mit der Victory auch nicht mehr und wir konnten uns daher auch nicht mit einem anderen U-Boot der Kaiserlichen Marine in Verbindung setzen.
Seit dem Augenblick des Unfalls bis zum 2. Juli trieben wir fortwährend nach Süden – planlos und ohne irgendein anderes Schiff zu sichten. Die Delfine umkreisten die U-29 noch immer; eigentlich bemerkenswert bei der Entfernung, die wir inzwischen zurückgelegt hatten. Am Morgen des 2. Juli sichteten wir ein Kriegsschiff unter amerikanischer Flagge und die Männer wurden unruhig und wollten sich ergeben. Am Ende sah Leutnant Klenze sich gezwungen, einen Seemann namens Traube zu erschießen, der besonders heftig auf dieser undeutschen Handlungsweise bestanden hatte. Das beruhigte die Mannschaft eine Weile und wir konnten unbemerkt abtauchen.
Am nächsten Nachmittag tauchte von Süden her ein großer Schwarm Seevögel auf und der Ozean begann bedrohlich zu rollen. Wir schlossen die Luken und warteten ab, bis wir einsahen, dass wir abtauchen mussten, wenn wir nicht von den immer größeren Wellen überflutet werden wollten. Unsere Druckluft und Elektrizität verringerten sich zusehends und wir wollten den unnötigen Einsatz unserer geringen mechanischen Hilfsmittel vermeiden, aber in diesem Fall hatten wir keine Wahl. Wir tauchten nicht tief ab und als sich die See einige Stunden später beruhigte, entschlossen wir uns, an die Oberfläche zurückzukehren. Hier gab es dann allerdings erneut Ärger, denn trotz aller Anstrengungen der Mechaniker ließ sich das Schiff nicht mehr steuern. Die Männer wurden angesichts dieser unterseeischen Gefangenschaft noch ängstlicher und einige von ihnen begannen wieder, wegen Leutnant Klenzes Elfenbeinschnitzerei zu murren, aber der Anblick einer Maschinenpistole beruhigte sie sofort. Wir beschäftigten die armen Teufel so gut es ging und bastelten an der Maschine herum, obwohl wir wussten, dass das nutzlos war.
Klenze und ich schliefen normalerweise zu unterschiedlichen Zeiten und während ich schlief – es war etwa fünf Uhr morgens am 4. Juli – brach überraschend eine allgemeine Meuterei los. Die sechs übrig gebliebenen Seemannsschweine dachten, wir seien nun verloren und gerieten wegen unserer Weigerung, uns dem Schlachtschiff der Yankees zu ergeben, plötzlich irrsinnig in Rage und schlugen fluchend alles kurz und klein. Sie brüllten wie Tiere, die sie waren, und zerschlugen unterschiedslos Instrumente und Mobiliar. Sie schrien und erzählten solchen Unsinn wie den Fluch des Elfenbeinkopfes des dunkelhaarigen, jungen Toten, der sie ansah und dann wegschwamm. Leutnant Klenze schien gelähmt und überfordert zu sein, wie es von einem weichen, weibischen Rheinländer nicht anders zu erwarten war. Ich erschoss alle sechs Männer, weil es nötig war, und stellte sicher, dass niemand mehr am Leben war.
Wir stießen die Leichen durch die doppelten Luken ins Wasser hinaus und waren dann allein in der U-29. Klenze schien überaus nervös zu sein und begann heftig zu trinken. Ich war entschlossen, solange wie möglich am Leben zu bleiben und die großen Vorräte an Verpflegung und die chemische Sauerstoffversorgung zu nutzten, die von den Schweinehunden der Seeleute nicht angerührt worden waren. Unser Kompass, Tiefenmesser und die anderen empfindlichen Messgeräte waren ruiniert, daher konnten wir von nun anstatt zu berechnen nur noch raten. Dabei mussten wir uns auf unsere Armbanduhren, den Kalender und auf die scheinbare Strömung verlassen. Die Strömung konnten wir nur an Objekten abschätzen, die wir von den Bullaugen der Kommandobrücke aus vorbeitreiben sahen. Glücklicherweise waren die Batterien geladen und wir konnten sie noch lange nutzen – sowohl für die Innenbeleuchtung als auch für den Suchscheinwerfer. Wir beleuchteten damit oft die Umgebung des Schiffes, sahen aber nur die Delphine, die neben uns her schwammen, während wir dahintrieben. Ich war an diesen Delphinen wissenschaftlich interessiert, denn der gewöhnliche Delphinus delphis ist ein ähnliches Säugetier, wie der Wal, dass ohne Atemluft nicht überleben kann. Trotzdem beobachtete ich einen der großartigen Schwimmer annähernd zwei Stunden lang, ohne dass dieser irgendwann auftauchen musste.
Während die Zeit verging, entschlossen Klenze und ich uns, weiter nach Süden zu treiben, während wir tiefer und tiefer sanken. Wir beobachteten die Meeresfauna und Flora und sahen zu diesem Thema in den Büchern nach, die ich für meine Freizeit mitgenommen hatte. Ich kam dabei nicht umhin festzustellen, dass die wissenschaftlichen Kenntnisse meines Begleiters doch recht mangelhaft waren. Ihm fehlte der preußische Geist und er hatte sich wertlosen Vorstellungen und Spekulationen gewidmet. Die Tatsache, dass wir sterben würden, berührte ihn seltsamerweise stark. Er betete oft voller Reue wegen der Männer, Frauen und Kinder, die wir auf den Meeresgrund geschickt hatten, und vergaß dabei völlig, dass alles, was dem deutschen Staat diente, ehrenhaft war. Nach einiger Zeit wurde er spürbar unausgewogen, starrte stundenlang auf seinen Elfenbeinkopf und erfand fantasievolle Geschichten über verlorene und vergessene Dinge auf dem Meeresgrund. Manchmal begleitete ich ihn auf diesen Wanderungen und hörte mir seine endlosen poetischen Zitate und Erzählungen über versunkene Schiffe an. Er tat mir wirklich leid, denn ich sehe einen Deutschen nicht gerne leiden, aber er war kein guter Mann, um mit ihm zu sterben. Ich war jedenfalls stolz darauf zu wissen, dass mein Vaterland mein Andenken ehren würde und meinen Söhnen beigebracht werden würde, richtige Männer so wie ich zu werden.
Am 8. August untersuchten wir den Meeresgrund und beleuchteten ihn mit unserem starken Suchscheinwerfer. Es war eine riesige, wellenförmige Ebene, zumeist von Seegras bedeckt und voller Gehäuse kleiner Mollusken. Hier und da sah man schlammige Objekte mit verwirrenden Umrissen, mit Algen bewachsen und verkrustet, bedeckt von Seepocken und Entenmuscheln. Klenze erklärte, dass müssten versunkene Schiffe sein, die in ihren Gräbern ruhten. Er war irritiert von einer soliden herausragenden Felsspitze, die knapp einen Meter emporragte, mit glatten Seiten, die in einem stumpfen Winkel zuliefen. Ich sagte, es sei eine herausragende Felsspitze, aber Klenze meinte, er könne darauf Schnitzereien erkennen. Nach einer Weile begann er zu erschaudern und wandte sich ab, als hätte er es plötzlich mit der Angst bekommen. Er konnte sich das nicht erklären; er war nur überwältigt von der Unermesslichkeit, Dunkelheit, Entfernung, dem Alter und dem Mysterium der ozeanischen Abgründe. Sein Geist war müde, aber als Deutscher verstand er zwei Dinge sehr bald: Dass die U-29 dem Wasserdruck ausgezeichnet standhielt und dass die eigenartigen Delfine immer noch bei uns waren, sogar noch in einer Tiefe, wo Naturforscher die Existenz höheren Lebens für unmöglich gehalten hätten. Ich war mir sicher, dass ich die Tiefe, in der wir waren, überschätzt hatte, aber wir mussten uns doch schon in einer Tiefe befinden, in der diese Phänomene bemerkenswert waren. Die Geschwindigkeit, mit der wir nach Süden trieben, war etwa so groß wie ich vorher angesichts der in geringerer Tiefe treibenden Organismen geschätzt hatte.
Um Viertel nach 3 Uhr morgens wurde der arme Klenze dann vollkommen verrückt. Er war auf der Kommandobrücke und hatte den Suchscheinwerfer benutzt. Ich sah ihn dann in die Bücherabteilung kommen, wo ich gerade saß und las. Sein verzerrtes Gesicht verriet ihn sofort. Ich werde hier nur wiederholen, was er sagte und die Worte unterstreichen, die er besonders betonte: „Er ruft! Er ruft! Ich kann ihn hören! Wir müssen zu ihm gehen!“ Während er das sagte, nahm er das Elfenbein-Ding vom Tisch, steckte es sich in die Tasche, packte mich am Arm und zog mich durch den Gang aufs Deck. Einen Moment später wurde mir klar, dass er die Luke öffnen und draußen mit mir ins Wasser springen wollte; ein Anfall von mörderischer und selbstmörderischer Raserei, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Als ich versuchte, ihn zu beruhigen, wurde er noch gewalttätiger und sagte: „Kommen Sie schon, warten Sie nicht noch länger. Es ist besser zu bereuen, damit einem vergeben wird, als sich zu widersetzen und verflucht zu werden.“ Da gab ich es auf, ihn zu beruhigen und sagte ihm, er sei ja verrückt – bedauernswert wahnsinnig. Aber er ließ sich nicht beeindrucken und schrie: „Wenn ich verrückt bin, dann ist das eine Gnade. Mögen die Götter Mitleid mit einem Mann haben, der in seiner Gefühllosigkeit bis zum bitteren Ende geistig gesund bleibt! Kommen Sie und seien Sie verrückt, solange er uns noch gnädig ruft!“
Dieser Gefühlsausbruch schien den Druck in seinem Gehirn zu verringern, denn als er das gesagt hatte, wurde er sanfter und bat mich, ihn doch alleine gehen zu lassen, wenn ich ihn schon nicht begleiten wollte. Mir wurde nun klar, was ich tun musste. Er war zwar Deutscher, aber eben nur ein Rheinländer, ein Bürgerlicher, der inzwischen schon ein möglicherweise gefährlicher Wahnsinniger war. Als ich mich scheinbar mit seinem Selbstmordversuch einverstanden zeigte, konnte ich mich sofort von ihm befreien, denn er war jetzt kein Gefährte mehr, sondern nur noch eine Bedrohung. Ich bat ihn, mir die Elfenbeinschnitzerei zu geben, bevor er hinausging, aber diese Bitte brachte ihn so unheimlich zum Lachen, dass ich es vorzog, nichts mehr zu sagen. Dann fragte ich ihn, ob er ein Andenken oder eine Haarlocke für seine Familie in Deutschland zurücklassen wolle, für den Fall, dass ich gerettet würde, aber darauf lachte er erneut wieder nur so unheimlich. Während er die Leiter hinaufstieg, bediente ich die Hebel, die die Maschinerie in den richtigen Zeitabständen in Gang setzte, die ihn in den Tod schicken würde. Nachdem ich festgestellt hatte, dass er nicht mehr an Bord war, leuchtete ich mit dem Suchscheinwerfer nach ihm, um ihn ein letztes Mal zu sehen, denn ich wollte wissen, ob der Wasserdruck ihn zusammengepresst hatte, was theoretisch zu erwarten war oder ob der Körper unverändert blieb wie bei diesen außergewöhnlichen Delfinen. Ich konnte ihn jedoch nicht erkennen, denn die Delphine hatten sich dort in großen Mengen versammelt und verdeckten die Kommandobrücke.
An diesem Abend bedauerte ich, dass ich das Elfenbeinbild nicht heimlich aus der Tasche des armen Klenze gezogen hatte, bevor er hinausging, denn es war faszinierend. Ich konnte den jugendlichen, wunderschönen Kopf mit seinem Lorbeerkranz nicht vergessen, auch wenn ich eigentlich keine Künstlernatur bin. Es tat mir auch leid, dass ich jetzt niemanden mehr hatte, mit dem ich mich unterhalten konnte. Klenze war, auch wenn er mir nicht ebenbürtig gewesen war, doch immer noch viel besser als überhaupt niemand. Ich konnte diese Nacht nicht gut schlafen und fragte mich, wann das Ende wohl kommen würde. Ich hatte sicherlich nur eine sehr geringe Chance, gerettet zu werden.
Am nächsten Morgen stieg ich auf die Kommandobrücke und startete mit den üblichen Untersuchungen mit dem Suchscheinwerfer. Nach Norden war der Anblick der gleiche wie nun schon seit den ganzen vier Tagen, die ich den Meeresgrund absuchte, aber ich bemerkte, dass die U-29 jetzt langsamer dahintrieb. Als ich den Scheinwerfer nach Süden richtete, bemerkte ich, dass der Meeresboden dort vor mir stärker abfiel und es lagen da an manchen Stellen merkwürdig regelmäßige Steinblöcke herum, die definitiv ein Muster bildeten. Das Boot tauchte nicht sofort tiefer, um sich der größeren Tiefe anzupassen, also musste ich den Suchscheinwerfer bald nachjustieren, damit er senkrecht nach unter leuchtete. Bei dieser plötzlichen Bewegung wurde die Kabelverbindung unterbrochen, was ich erst wieder instand setzen musste, aber nach einer Weile ging das Licht wieder an und beleuchtete das unterseeische Tal, das unter mir lag.
Ich gab mich keinerlei Emotionen hin, aber ich war wirklich erstaunt, als ich erblickte, was da plötzlich im Licht des Scheinwerfers auftauchte. Und da ich in der besten preußischen Kultur erzogen worden war, hätte ich nicht erstaunt sein dürfen, denn sowohl die Geologie als auch die Tradition lehren uns von Verschiebungen bei den ozeanischen und kontinentale Platten. Was ich da sah, war eine große Fläche bedeckt von verfallenen Gebäuden; alle von großartiger, wenn auch ungeordneter Architektur und unterschiedlich gut erhalten. Die meisten schienen aus Marmor zu bestehen, der im Licht des Scheinwerfers weißlich funkelte und man hatte den allgemeinen Eindruck einer großen Stadt auf dem Grund eines engen Tales mit vielen einzelnen Tempeln und an steilen Abhängen angelegten Landhäusern unterhalb dieser Tempel. Die Dächer waren eingefallen und die Säulen zerbrochen, aber sie bewahrten immer noch den uralten Glanz, den nichts hatte auslöschen können.
Ich stand nun endlich dem Atlantis gegenüber, das ich vorher für einen Mythos gehalten hatte und ich hatte große Lust, es zu erforschen. Auf dem Grund dieses Tales war einst ein Bach geflossen, denn bei genauerer Untersuchung entdeckte ich die Überreste von Brücken aus Stein und Marmor, Ufermauern, Terrassen und Deichen, die einst schön begrünt gewesen waren. In meiner Begeisterung wurde ich fast so verrückt und sentimental wie der arme Klenze und bemerkte recht spät, dass die nach Süden gerichtet Strömung endlich aufgehört hatte, was der U-29 erlaubte, langsam über der versunkenen Stadt anzuhalten wie ein Flugzeug, das oben auf der Erde über einer Stadt schwebte. Nach einer Weile bemerkte ich auch, dass die Gruppe ungewöhnlicher Delfine inzwischen verschwunden war.
Nach etwa zwei Stunden setzte ich das Boot auf einem gepflasterten Platz in der Nähe der felsigen Wand des Tales aufgrund. Auf einer Seite sah ich die ganze Stadt, die sich den Abhang hinab von dem Platz bis zu den Ufern eines Baches erstreckte und auf der anderen Seite sah ich ganz in der Nähe die reich geschmückte und vollständig erhaltenen Fassade eines großartigen Bauwerks – offenbar ein Tempel, der aus dem Felsen herausgehauen worden war. Über den Bau dieses riesigen Gebäudes kann ich nur Vermutungen anstellen. Die Fassade von enormer Größe bedeckte anscheinend eine durchgehend ausgehöhlte Vertiefung, die viele und weiträumig verteilte Fenster hatte. Im Zentrum befand sich eine große offene Tür, die man über eine eindrucksvolle Freitreppe erreichte und die von vorzüglichen Schnitzereien umgeben war, wie die erhaben ausgearbeiteten Figuren des Bacchanals.
Vor all dem standen großartige Säulen und Friese, die mit Skulpturen von unbeschreiblicher Schönheit dekoriert waren, die offenbar Hirtenszenen und Prozessionen von Priestern und Priesterinnen darstellten, die fremdartige zeremonielle Geräte zur Anbetung eines strahlenden Gottes mit sich führten. Die Kunst war von phänomenaler Vollkommenheit, größtenteils in Hellenischem Stil, jedoch fremdartig und einzigartig. Sie machte den Eindruck, enorm alt zu sein, als sei sie der antike Vorgänger der altgriechischen Kunst. Zweifellos war jede Einzelheit dieses gewaltigen Konstrukts aus dem jungfräulichen Felsen gefertigt worden. Alles war spürbar ein Teil der Felswand des Tales, obwohl ich mir kaum vorstellen kann, wie das gewaltige Innere jemals ausgehoben werden konnte. Vielleicht befanden sich im Inneren vorher schon eine oder mehrere Höhlen. Weder ihr Alter noch das umgebene Wasser hatten die makellose Erhabenheit dieses schaurigen Tempels zerstört, denn ein Tempel musste es wohl sein, der heute auch nach tausenden von Jahren noch makellos und unberührt in der endlosen Nacht und Stille einer Schlucht im Ozean ruhte.
Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit zubrachte, die versunkene Stadt mit ihren Gebäuden, Bögen, Statuen und Brücken und dem gewaltigen Tempel mit seiner Schönheit und seinem Mysterium zu betrachten. Obwohl ich wusste, dass ich dem Tode nahe war, verzehrte mich meine Neugier und ich leuchtete mit meinem Suchscheinwerfer eifrig überallhin. Der Lichtstrahl erlaubte mir, alle Einzelheiten zu erkennen, aber ich konnte nicht durch die weit offen stehende Tür ins Innere des in den Felsen gehauenen Tempels blicken und nach einiger Zeit stellte ich den Strom ab, denn ich war mir bewusst, dass ich elektrischen Strom sparen musste. Die Leuchtkraft hatte sich während der Wochen, die ich dahingetrieben war, bereits merklich abgeschwächt. Aber mein Wunsch, die Geheimnisse dieser Unterwasserwelt zu erforschen, wurde durch den sich ankündigenden Mangel an Beleuchtung nur noch stärker. Ich, ein Deutscher, sollte der Erste sein, der diese seit Jahrhunderten vergessenen Wege betrat!
Ich konstruierte und überprüfte einen Tiefsee-Tauchanzug aus zusammengesetzten Metallplatten und experimentierte mit dem tragbaren elektrischen Licht und dem Lufterneuerer. Auch wenn es schwierig werden würde, die doppelte Luke allein zu bedienen, glaubte ich, alle Schwierigkeiten mit meiner wissenschaftlichen Geschicklichkeit überwinden und tatsächlich selbst in der toten Stadt umherwandern zu können.
Am 16. August stieg ich aus der U-29 und bahnte mir mühevoll den Weg durch die verfallenen und schlammigen Straßen zu dem antiken Bach. Ich fand keine Skelette oder andere menschliche Überreste, sammelte jedoch massenweise archäologische Überreste in Form von Skulpturen und Münzen. Darüber darf ich aber noch nicht sprechen, außer von meiner Hochachtung vor einer Kultur auf dem Höhepunkt ihres größten Glanzes zu einer Zeit, als die Menschen in Europa noch in Höhlen lebten und der Nil noch unbesehen ins Meer floss. Geleitet von diesem Manuskript, falls es jemals gefunden wird, müssen dann andere Leute die Geheimnisse lüften, die ich nur andeuten kann. Ich kehrte zum Boot zurück, als meine Batterien immer schwächer wurden und war entschlossen, den Felsentempel am nächsten Tag weiter zu erforschen.