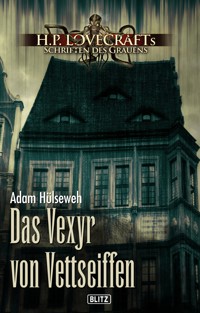
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lovecrafts Schriften des Grauens
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Vettseiffen, Vettseiffen, da scheißt der Teufel Fett und Seifen, so lautet der Beginn eines alten Abzählreims, der sich in den umliegenden Dörfern der Region bis heute erhalten hat.Den reizlosen Ort Vettseiffen mit seiner kargen Vegetation und den eigentümlichen Bewohnern betritt von jeher nur derjenige, der muss. Widernatürliche Kräfte sind dort am Werk. Sie legen Krankheit und Düsternis auf Fremde, die zu lange verweilen. Wer das überlebt, dem offenbart Vettseiffen sein uraltes Geheimnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Ähnliche
Adam HülsewehDas Vexyr von Vettseiffen
In dieser Reihe bisher erschienen:
2101 William Meikle Das Amulett
2102 Roman Sander (Hrsg.) Götter des Grauens
2103 Andreas Ackermann Das Mysterium dunkler Träume
2104 Jörg Kleudgen & Uwe Vöhl Stolzenstein
2105 Andreas Zwengel Kinder des Yig
2106 W. H. Pugmire Der dunkle Fremde
2107 Tobias Reckermann Gotheim an der Ur
2108 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Xulhu
2109 Rainer Zuch Planet des dunklen Horizonts
2110 K. R. Sanders & Jörg Kleudgen Die Klinge von Umao Mo
2111 Arthur Gordon Wolf Mr. Munchkin
2112 Arthur Gordon Wolf Red Meadows
2113 Tobias Reckermann Rückkehr nach Gotheim
2114 Erik R. Andara Hinaus durch die zweite Tür
2115 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo
2116 Adam Hülseweh Das Vexyr von Vettseiffen
2117 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 2
2118 Alfred Wallon Salzburger Albträume
Adam Hülseweh
Das Vexyr von Vettseiffen
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KleudgenTitelbild: Erik R. AndaraUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierZeichnungen: Jörg KleudgenSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-926-3Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Zum Behufe der Bettelei
Jener Hans Scheibler, von dem im Folgenden die Rede sein soll, war, auch wenn er selbst sich nie – nicht einmal in der Aufrichtigkeit innerer Einkehr – auf diese Weise gesehen oder beschrieben hätte, ein Mann ohne Leidenschaft. Von Kindheit an hatte seinem Gemüt etwas eigenartig Ungewürztes angehaftet, das er jedoch durch rasche Auffassungsgabe und überdurchschnittliche Anpassungsfähigkeit dergestalt wettzumachen verstand, dass sein Mangel, oder vielmehr das, was andere für ein Fehlen oder gar einen Fehler hätten halten können, stets verborgen blieb. Diese früh erworbene und intuitiv eingesetzte Technik der gemäßigten Mimese ließ ihn leicht Anschluss finden. Hans war nie Außenseiter, und es würde seine Kameraden mit ungläubigem Staunen erfüllt haben, wenn man ihnen gesagt hätte, dass der Knabe ihre Interessen und Vorlieben lediglich nachahmte, ohne sie je selbst durch den Ausdruck eines lebendigen Gefühls empfunden zu haben. Das Spiel der Freunde war für Hans ein Strom, in dem er, den Kopf über Wasser haltend, mitschwamm, während die anderen abtauchten. Dessen ungeachtet genoss er das Treiben und befand sich sogar in der Lage, Ideen einzubringen. Er glühte nur nie von innen heraus für etwas und verlor sich keinen Moment in der Selbstvergessenheit, die er bei den anderen beobachtete. Er akzeptierte diese diffuse Abwesenheit, ohne sie zu hinterfragen, was sich als durchaus günstiger Winkelzug seiner Psyche erwies. Das Lauwarme seiner Gefühle stand seiner geistigen und gesellschaftlichen Entwicklung nämlich nicht im Wege, und über manches hatte er vereinfachte Annahmen, die er nicht allzu sehr prüfte. So war er beispielsweise bis zu seiner verhängnisvollen Reise nach Vettseiffen, die sich diese Aufzeichnung zum Thema gemacht hat, immer davon ausgegangen, dass Anflüge von Todessehnsucht jedem Menschen innewohnten und gelegentlich beim Überqueren von Brücken oder anlässlich einer Autofahrt entlang einer Allee mit großem, altem Baumbestand ihren leisen Lockruf aussandten. Über solche Dinge zu sprechen, wäre ihm aber vernünftigerweise nie in den Sinn gekommen, nicht einmal anlässlich der schluchzenden Beichte eines Schulfreunds, der aufgrund einer unglücklichen Liebschaft mit Selbsttötung drohte. Hans Scheibler kannte die Begierden anderer und vermochte sie problemlos zu dechiffrieren, teilte aber nichts von dem, was die anderen bis zur Raserei treiben konnte. Fußball, Autos, Musik, Wissenschaft, Geld, Statussymbole, Sexualität – all dem konnte er nicht mehr als vages Interesse entgegenbringen, während andere bereit waren, sich dafür innerlich und äußerlich zu zerfleischen. Überhaupt wuchs er zu einem Mann mit gemäßigtem Wesen und moderater Weltsicht heran, in dessen Gegenwart sich niemand unbehaglich zu fühlen brauchte. Mit Mitte zwanzig, also eigentlich in einem Alter, noch als junger Mann zu gelten, war er bereits geistig ausgereift, und als ob sein Körper dies eingesehen hätte und nach außen spiegeln wollte, verblasste sein ehemals feuerrotes Haar zu einem ausgewaschenen Ton, der Haaransatz kroch nach hinten und seine Haltung bekam einen Hang zum Altväterlichen, was vom umständlichen Ineinanderwringen seiner langen sommersprossigen Finger unterstrichen wurde, eine Marotte, die immer dann zu Tage trat, wenn er, der äußerlich Unbewegte, innerlich in Unbehagen geriet. In solcher Stimmung neigte er unwillkürlich dazu, sich in besonderem Maße gestelzt und antiquiert auszudrücken, was ihm seitens seiner Bekannten gutmütigen Spott einbrachte, von der eigenen Familie jedoch gar nicht bemerkt wurde.
„Du willst mich also“, sagte er nach dem Abendessen im Arbeitszimmer zu seinem Vater, „einzig zum Behufe der Bettelei nach Vettseiffen schicken?“ Nichts in der Haltung des Vaters ließ erkennen, ob er in Kenntnis des Begriffs zum Behufe war oder ihn die Bemerkung seines ältesten Sohns verärgert hatte. Möglicherweise war sein größtes, wenn nicht sogar einziges Talent, das Wunder ein perfektes Pokerface jederzeit hervorbringen zu können. Ob er selbst noch zwischen sich und dieser Fassade unterscheiden konnte, blieb Hans, wie manches andere, das seinen Vater betraf, ein Rätsel. Der Vater zog sein Jackett aus, warf es auf die Lehne des Canapés und lockerte seine Krawatte mit der geübten Geste desjenigen, der ein Signal zum unbedingt Informellen ausschickte. Um seinem Ansinnen von vertrauter Behaglichkeit weiteren Ausdruck zu verleihen, kredenzte er mit Schwung Cognac, wie er sagte. Dujardin, dachte Hans. Der Vater war Lokalpatriot und seine Überzeugung, dass man in der heimatlichen Region alles genauso gut oder sogar besser als im Ausland herstellen konnte, machte nicht mal vor Cognac halt, selbst wenn der aus Gründen der Herkunftsbezeichnung in Deutschland zu seinem Leidwesen Weinbrand heißen musste. Ob diese Geisteshaltung ihn für die Probleme der Firma blind gemacht hatte oder er lediglich den äußeren Eindruck des Status Quos wahrte, konnte Hans nicht sagen. Wohl aber kannte er die Bücher und wusste um die finanzielle Schieflage, in der sich das Familienunternehmen seit Jahren befand. Die Textilfabrik ging, wie es bereits vielen anderen in den letzten Jahren ergangen war, allmählich vor der asiatischen Konkurrenz in die Knie. Der Vater ignorierte das Unken der Branche und war davon überzeugt, neue Maschinen vermöchten das Ruder herumzureißen und die Wende bringen. „Wir stammen von den Monschau-Scheiblers ab“, pflegte er die Einwände seines Sohns zu parieren, als hätte dieser morsche Schläger noch die Kraft von einst, als im achtzehnten Jahrhundert die Tuchmanufaktur der Scheiblers weltbekannt gewesen war. Und selbst sie, die richtigen Scheiblers hatten vor acht Jahren die Bude dichtgemacht.
Monschau – Hans konnte nicht anders als mit Schaudern an diesen Ort denken, die verrotteten, schiefen Häuser, die gegen jede Logik nicht in den Fluss stürzten, über dem sie sich, wie von bösen Mächten gehalten, wölbten. Für den Vater waren die Ausflüge zum Roten Haus, dem Stammsitz der Scheiblers, Pilgerfahrten gewesen, den jungen Hans hatten sie das Fürchten gelehrt, und er erinnerte sich gut des Gefühls der Erleichterung, das sich jedes Mal eingestellt hatte, wenn er das Städtchen wieder verlassen durfte, welches sich da so arglistig ins Tal duckte, als ob es finstere Geheimnisse zu verbergen hatte.
„Trinken wir einen, mein Junge“, sagte der Vater und hob das Glas.
„Wie du wünschst, Vater“, erwiderte Hans steif und trank dann so zügig und gewissenhaft, wie er all seinen Pflichten nachzukommen pflegte.
„Hör mal, Hansi“, sprach der Vater in vertraulichem Ton, „von Bettelei kann doch gar nicht die Rede sein. Du sollst deiner Tante bloß ein bisschen unter die Arme greifen und dich dafür entsprechend entlohnen lassen. Seit dem Tod von ihrem Otto scheint sie mit dem Verlag etwas überfordert zu sein.“ Hans Scheibler lag es nicht, zynisch zu sein, doch er konnte sich die flapsige Bemerkung zu äußern nicht erwehren, dass ihm keine Frau auf dem Erdball einfiele, auf die die Beschreibung überfordert schlechter passen würde. Seine Tante Lilly verkörperte trotz ihrer geringen körperlichen Ausmaße geradezu den Archetypen beherzter Unverwüstlichkeit, nicht einen Moment war sie ihm bei der Beerdigung vor zwei Jahren hinfällig oder gar hilflos erschienen.
„Meine Schwester wird alt, genau wie ich“, sagte der Vater und schenkte Weinbrand nach. „Wer weiß, vielleicht fehlt ihr bloß etwas Gesellschaft. Fest steht, dass sie um unsere Hilfe ersucht hat. In diesem Brief“, er streckte seinem Sohn das dicke Büttenpapier entgegen, „wie du weißt.“ Dieser Umstand war in der Tat nicht von der Hand zu weisen. Tante Lillys präzise Handschrift gab darüber Auskunft, dass es in der Druckerei häufiger zu Fehlern kam und sie die Unterstützung von jemandem mit gesundem Sachverstand gut gebrauchen könnte.
„Ich bin im Betrieb unabkömmlich, Vater. Wir können einen unserer Techniker schicken.“ Hans ergriff großes Unbehagen, wenn er an eine Reise mit womöglich längerem Aufenthalt bei seiner Tante dachte. Dieses gottverlassene Vettseiffen mit den sauertöpfischen Bewohnern, das einen irgendwie krank machte, sobald man die Ortsgrenze überschritt! Das mindeste, das man sich dort holte, war ein Schnupfen, nach der Beerdigung war es eine ausgewachsene Grippe gewesen. Und obwohl Hans’ Mutter als Kind während der Spanischen Grippe die Hälfte ihrer Familie verloren hatte und um jede Krankheit großes Getöse veranstaltete, gab sie dem Vater recht, dass es in Vettseiffen eine Art Reizklima gäbe, welches lediglich bei Kurzbesuchen schade, bei längerem Aufenthalt der Gesundheit jedoch äußerst zuträglich sei. „Alles bloß Zufall“, urteilte der jüngere Bruder lapidar über einen möglichen Zusammenhang von Krankheit und Vettseiffen. Er konnte sich seine lässige Haltung leisten, da er frisch verheiratet und gerade dabei war, in den Kohlenhandel des Schwiegervaters einzusteigen, was ihn aus der Schusslinie familiärer Verpflichtungen gebracht hatte. Kohlenhandel – noch so ein Geschäftsmodell, dem mittelfristig der Untergang bevorstand. Die Unruhen im Limburger Steinkohlerevier und die drohenden Streiks im Ruhrbergbau wurden in der Familie genauso totgeschwiegen wie der Bau von Wohnungen mit erdölgespeisten Zentralheizungen. Den Scheiblers war, so hatte Hans immer wieder bitter erkennen müssen, die Gabe zu vorausschauendem Denken und Handeln offenbar nicht in die Wiege gelegt worden.
„Hansi, hör mal. Wir können da nicht irgendwen hinschicken, das verstehst du doch. Jetzt mal Tacheles. Wenn du der Tante zur Hand gehst und dich unentbehrlich machst, stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie dich zum Geschäftsführer macht und du zu unseren Gunsten Einfluss auf sie nehmen kannst. Und jetzt Schluss damit, dass das unredlich sein soll. Hat doch keine Kinder, die Gute. Im Gegensatz dazu hab’ ich gleich drei, für die ich sorgen muss.“ Der Vater trank und redete sich in einen seiner Monologe, die Hans beinahe körperlich unangenehm waren. Die Vertraulichkeiten seines Vaters bedeuteten ihm keine Auszeichnung, sondern äußerste Peinlichkeit. „Wir brauchen einen Investor für neue Maschinen, und nun halt mir keinen Vortrag über Lohndumping in Asien und wie das ganze clever klingende Zeug heißt, das sie dir da an der Universität eingetrichtert haben. Ich weiß immer noch, was für meine Firma gut ist, glaub deinem alten Herrn mal was.“ Hans machte keine Anstalten, dem Vater ökonomische Fakten darzulegen und schwieg. Der Senior beugte sich vor und flüsterte: „Wenn du’s nicht hinkriegst, geht hier alles in die Binsen. Die Angestellten, die Familie. Das Unternehmen kann sich dich als Mitarbeiter im Grunde gar nicht leisten. Und dann deine Schwester. Was muss die denn ausgerechnet diesen Hallodri heiraten, diesen Herrn Studenten, und sich von dem ein Kind machen lassen? Das ganze Geschwafel von Revolution und Sozialismus. Hat keine Ahnung, der Bengel, bloß ne große Klappe. Alles reine Provokation! Der wird sie doch nie ernähren können, dieser Gammler. In spätestens einem Jahr zieht sie wieder hier ein und liegt uns den Rest aller Tage auf der Tasche. Deine Tante ist reich. Die hat nicht nur den Verlag und die Druckerei, sondern noch in ganz anderen Sachen ihre Finger drin. Geheime Sachen. Waffenhandel, Unterstützung von Spionen, ob Ost oder West, was weiß ich. Leuten im Grenzgebiet war schon immer alles zuzutrauen. Du kannst jedenfalls ordentlich was lockermachen bei ihr, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, Junge.“
„Ich kann deinem Wunsch nicht entsprechen, Vater“, antwortete Hans mit ruhiger Stimme, „ich lehne es rundweg ab, nach Vettseiffen zu fahren und mich derartig ehrabschneidend aufzuführen.“
„Einen Dreck lehnst du ab“, sagte da der Vater, dessen freundlicher Ton den Inhalt Lügen strafte. Er lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. „Und es handelt sich nicht um einen Wunsch. Du hast immer ein komfortables Leben geführt. Sogar studieren haben wir dich lassen. Es ist an der Zeit, was zurückzugeben, mein Sohn.“ Der Vater öffnete eine Schublade und legte Hans mit würdevollem Ernst einen Groschenroman hin, eine Geste, die in größtmöglichem Gegensatz zu all den Verächtlichkeiten stand, die er im Laufe der Jahre für diese Art Druckerzeugnisse kundgetan hatte.
„Sieh her“, sagte er und blätterte durch die Seiten billigen Papiers, die Hans unwillkürlich an heimliche Lesevergnügen seiner Kindheit und Jugend erinnerten. Sofern es ihm, den Geschwistern oder der Mutter gelungen war, einige der von Tante Lilly bei Besuchen mitgebrachten Heftromane heimlich vor dem Vater in Sicherheit zu bringen. „Hier sind Löcher im Text, die sich deine Tante nicht erklären kann. Du kennst dich doch mit Lochkarten aus. Da kannst du ihr bestimmt weiterhelfen. Ist doch ein Klacks für dich.“
„Muster von Loch■arten können sich nicht auf den Druck übertragen“, entgegnete Hans, obwohl er längst wusste, dass die Schlacht verl■ren war.
„Na, das findet sich dann alles vor Ort.“ Der Vater rieb sich zufrieden die Hände. Hans nahm das Heft und trug es in sein altes Kinderzi■■er, welches er aus Kostengründen bei seiner Heimkehr ins Elternhaus widerwillig bezogen hatte. Im Schein eines funzeligen Nachttischlichts grübelte er lange über die fehlerhaften Seiten nach. Aus einem seltenen Gefühl der Nostalgie heraus erwog er, die Geschichte zu lesen, verwarf den Gedanken aber wieder und hatte in jener Nacht auch ohne Mithilfe eines Gespenster-Krimis finstere Träume. „Komm nach Vettseiffen!“, hörte er es in seinem Kopf brummen, als er sich am nächsten Morgen aus dem Schlaf quälte und zerschlagen in sein Schicksal fügte.
Während er im Bade■immer nacheinander notwendigen und gesellschaftlich geforderten hygienischen Verrichtungen nachging, kam ihm beim Rasieren ein alter Kinderreim in den Sinn. „Vettseiffen, Vettseiffen, da scheißt der Teufel Fett und Seifen“, la■tete die erste Zeile, an die er sich derart lebhaft erinnern konnte, dass er beinahe das Erschallen rhythmisch-kindlichen Schreigesangs zu hören vermeinte. Doch so sehr er auch nachdachte, konnte er die weiteren Zeilen nicht zusammenbringen. Wachs, Nebel, Leichen und Schleifen blieben Fragmente, die sich nicht fügten. Als sich Hans Scheibler später an den Frühstückstisch setzte und seine Mutter danach fragte, tat sie unwissend und gab vor, von einem solchen gesch■acklosen Abzählreim noch nie etwas gehört zu haben. Danach begann das vertraute Frühstücksritual, bei dem jeder der drei Anwesenden während des Verzehrs von Brot, Ei und Kaffee etwas mitteilte, auf das die verbliebenen zwei nicht reagierten. Der Vater räsonierte, nachdem er die Ze■tung weggelegt hatte, über Starfighter, Lockheed und Franz-Josef Strauß, Hans beklagte die bevorstehende Reise nach Vettseiffen, und die Mutter, welche oft und ausführlich mit ihrer Tochter in West-Berlin telefonie■te, monierte wortreich, dass niemand bereit war, mit ihr über Mao zu diskutieren.
Erstaunlicherweise kam es dann doch noch zu einem Moment der Verbundenheit, als sich die Eltern nämlich darüber einig wurden, dass der frisch begonnene Tag unbedingt derjenige von Hans’ Abreise sein müsste. Da man der Einladung Tante Lillys, sie an Pfingsten in Vettseiffen zu besuchen, nicht gefolgt und seitdem bereits eine Woche ins Land gegangen war, sollten weitere Peinlichkeiten möglichst vermieden werden und Hans’ Aufbruch unmittelbar erfolgen. Die Mutter packte daraufhin seinen Koffer, bürstete den hellen Sommermantel ab, packte Proviant ein und reichte ihm ein Gesteck Kunstblumen, das als Gastgeschenk dienen sollte. „Frische Blumen welken bloß“, beendete sie die Einwände ihres Sohns und sein „gewiss gutgemeintes Angebot“, unterwegs einen Strauß zu besorgen. Beim Verstauen des Gestecks auf der Rückbank seines beigefarbenen VW Variants fragte sich Hans, ob die filigranen Kunstfasern der Blüten womöglich aus genau jener Art von Fabrik in Asien stammten, die dem väterlichen Betrieb früher oder später den Garaus machen würde.
„Hast du einen Regenschirm dabei, Hänschen?“, fragte die Mutter und beugte sich von hinten über seine Schulter. Das Wetter war in den letzten Tagen unbeständig gewesen und würde erwartungsgemäß in der Region von Vettseiffen noch kälter und regenreicher ausfallen.
„Ich bin ordnungsgemäß mit allem Nötigen versehen, Mutter“, sagte Hans und schob sie sanft zurück. Die Mutter küsste ihn trotzdem auf die Wange, der Vater verabschiedete sich mit geschäftsmäßigem Handschlag. Und so fuhr Hans Scheibler am sechsten Juni 1966, einem Montag, bei grauem Himmel und leichtem Nieselregen nach Vettseiffen. Auf seinem Weg lagen Brücken und baumbestandene Alleen. Er widerstand allem und fügte sich in das, was er für seine Pflicht hielt.
Schlachtvieh, Porzellan und ein Oktopus
Wenn Hans Scheibler sich dazu entschloss, ein Auto zu steuern, so tat er es mit Bedacht, Genauigkeit und derselben Sorgfalt, mit der er etwa seine Fersen nach einem Fußbad mit dem Hornhauthobel bearbeitete, ein Prozedere, bei dem er exakt so viel Unnötiges entfernte, zukünftige Schrundenbildung zu vereiteln und dabei nie so tief feilte, das Gegenteil vom Gewünschten zu erreichen und eine nässende Verletzung hervorzurufen. Sobald der Rand, an dem die bläulich marmoriert schimmernde Haut des Knöchels in die Fußsohle mündete, den minimal möglichen Craquelé-Effekt aufwies, wechselte er die Seite und beendete seine Arbeit erst, wenn vollständiger Gleichstand zwischen den Fersen erreicht war. Hans verrichtete alltägliche Dinge gern nach bewährter Methode und gründlich genug, sich nicht unnötigerweise vor der Zeit erneut mit ihnen beschäftigen zu müssen. Trotz dieser vermeintlich starken Ergebnisorientiertheit wohnte seinem Wesen noch etwas anderes inne, das Freude an der Harmonie des Nebeneinanders von Aktionen empfand. Als Jugendlicher hatte er sich abgewöhnt, die Komponenten seines Essens nacheinander zu verzehren, und was ihm anfangs missvergnüglich gewesen war, entwickelte sich zu einem Gefühl von Ausgleich und Vollendung. Diese Kombination von Geisteshaltungen machte ihn zu einem umsichtigen und reaktionsstarken Fahrer, der seine Hände, außer wenn er die rechte zum Schalten benötigte, auf vorbildliche und genau bemessene Weise auf zehn und zwei Uhr am Lenkrad hielt. Wenn Hans Scheibler Raucher gewesen wäre, hätte er nie unterwegs geraucht, sondern diese Aktivität stets auf eine Pause verlegt. Da er aber nicht rauchte, verbrachte er, als der Himmel für einen Augenblick aufklarte, seinen Autostopp mit Blick auf wogende Felder und dem Verzehr der von der Mutter geschmierten Butterbrote und eines Apfels, dessen Gehäuse er in weitem Bogen in die Landschaft schleuderte. Einen zweiten wog er eine Weile in der Hand, steckte ihn dann aber in die Papiertüte zurück und legte diese auf den Beifahrersitz. Er setzte seine Fahrt fort und unterbrach sie nur noch ein weiteres Mal, um nämlich an genau der Tankstelle zu tanken, die er „zu diesem Behufe“, wie er eventuell vor sich hinmurmelte, zuvor in der Auto-Karte dafür ausersehen hatte. Während er bezahlte, verschluckte der graue Himmel die letzten lichten Flecken wie leicht auszumerzende Irrtümer, um eine massive trübe Decke zu errichten, unter der Scheibler in ebensolcher Stimmung weiterfuhr. Die Landstraße schlängelte sich durch Felder und an pittoresken Dörfern vorbei, deren Anblick manch anderen Reisenden mit Wohlgefallen erfüllt hätte, nicht aber Hans, den die kunstvoll gestutzten haushohen Buchenhecken der Region lediglich daran erinnerten, dass von dieser Pracht gezähmter Natur in Richtung Vettseiffen nichts übrig blieb, wo klägliche Gezüchte krüppeliger Dornengewächse die Grenzen der Grundstücke markierten und dunkle Nadelbäume den Eindruck allgegenwärtigen Graus nur verstärkten. Die Einheimischen erklärten die dörfliche Flora mit der Nähe zum Hochmoor, was geografisch jedoch nicht haltbar war.
„Alle Wege führen nach Rom, wie viele nach Vettseiffen? – Keiner!“, lautete ein Spruch, mit dem man in den umliegenden Dörfern einen besonderen Umstand verspottete, der sich gegen Ende des zweiten Weltkriegs zugetragen hatte. Obwohl Vettseiffen nicht im eigentlichen Sinne am Westwall lag, war es, vermutlich aufgrund eines planerischen Fehlers der Wehrmacht, massiv mit Panzersperren versehen worden, sodass das Dorf, welches ohnehin in einer brückenlosen Kurve des Flusses lag und zusätzlich durch einen Berghang begrenzt war, derart zugebaut wurde, dass es eine Weile keinen Weg mehr hinein gegeben hatte, der für einen Wagen oder ein Fuhrwerk befahrbar gewesen wäre. Diesen Missstand hatte man nach Kriegsende zwar behoben, jedoch mit derart minimalem Aufwand, dass, nach der Verjüngung der einzigen Straße nach Vettseiffen, der Ortseingang einem Durchschlupf glich, der jeden Fremden, der ein Vehikel hineinsteuerte, ein letztes Mal tief Luftholen und den Atem zu einem Seufzer ausstoßen ließ. Und auch Hans Scheibler atmete am Steuer seines VW Variants vor dem Ortseingang unwillkürlich ein und entsandte seinen Lungen nach dem Übertritt ein bleischweres Seufzen, eine Begrüßung, die Vettseiffen von jeher als Demutsbekundung entgegennahm und als Gegengruß über Kopf, Lungen und Gemüt jene eigenartige Schwere legte, deretwegen kluge Menschen normalerweise versuchten, einen Aufenthalt im Dorf zu vermeiden. „Nach Vettseiffen kommt nur der, der muss“, urteilte man seit alten Zeiten in gehässigem oder furchtsamem Ton und jeder, der geschäftlich dorthin fuhr, konnte nicht anders – selbst, wenn er sich äußerlich alle Mühe gab, gelassen und frei von Aberglauben zu erscheinen – als dem innerlich schaudernd zuzustimmen.
Und auch Hans Scheibler spürte augenblicklich in seinem Rücken ein Ziehen wie von plötzlichen Gliederschmerzen, dass die Schultern nach vorn krümmte und den Griff seiner Hände ums Lenkrad ohne sein willentliches Zutun verstärkte. Sein Kopf reckte sich wie der einer der Not gehorchenden Schildkröte nach vorn, und er starrte durch die Windschutzscheibe wie ein nackensteifer Greis auf die Straße, deren einzig erkennbare Bewegungen durch die Schwünge der Scheibenwischer trughaft verursacht wurden. Im historischen Ortskern hockten schimmlig wirkende Fachwerkhäuser beisammen, als ob sie ein schadhaftes Gebiss imitieren wollten, und selbst die Vorhänge in den Fenstern – in anderen Dörfern ja oftmals Ausdruck heiterer Gemütlichkeit – hatten die Farbe und Beschaffenheit aufgegebener Träume. Abgesehen von diesen Häusern gab es in Vettseiffen nicht ein Gebäude, das nicht grau gewesen wäre, sei es, weil das die Farbe des Natursteins war, aus dem es erbaut wurde oder die des Schiefers, mit dem die Fassaden verklinkert oder sich jede ursprünglich andere Wandfarbe in den letzten Jahrzehnten ergeben und zum gleichen nebelhaften Ton verwaschen war. Die Häuser schienen Hans Scheibler wie von Regen absichtsvoll durchspeichelt zu sein, um auch die letzten Unterschiede unkenntlich zu machen. Schwer vorstellbar, dass unter jedem Dach jemand lebt, dachte er. Denn wenn er es nicht besser gewusst hätte und nicht hier und da aufsteigender Rauch oder ein Licht zu sehen gewesen wäre, hätte er leicht dem Irrglauben aufsitzen können, sich in einer Wüstung zu befinden. Wie um diesen Eindruck zu verstärken, sah Hans auf dem Weg zur Tante keine Menschenseele, nur ein einziges Mal wurde ein Fensterladen just in jenem Moment zugeschlagen, da er vorbeifuhr.
In Vettseiffen gab es neben einer Handvoll heruntergekommener kleiner Geschäfte und einer Kneipe mit unbestimmten Öffnungszeiten nur drei größere Betriebe, die gemeinsam beinahe das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben prägten. Abgesehen von einer alten Seifenfabrik und dem Schlachthof waren Verlag und Druckerei der Tante eine nicht wegzudenkende Größe im merkantilen Geschehen des Ortes. Entsprechend leicht fiel es dem Neffen, den Weg durch Nieselregen und unbeschriftete Straßen zu ihrem Anwesen zu finden. Er lenkte den Wagen auf das Rondell der Einfahrt und kam unter einem, wie er meinte, irgendwie zu weichen Knirschen von Kies vor dem Portal des Herrenhauses zu stehen. Noch bevor er die Fahrertür öffnen konnte, stürzte ein junger Mann herbei, der kräftig am Griff zog, die Tür aufriss und ihn unter schwungvollem Dienern zum Aussteigen ermunterte. Der Mann hatte eine merkwürdig elastische Körperhaltung, einen mühevoll gezogenen Scheitel und vollständig durchregnete Jackettschultern.
„Herzlich Willkommen, Herr Scheibler. Die Frau Tante wartet schon“, plapperte er aufgeregt vor sich hin und konnte sich nicht entschließen, länger als drei Sekunden mit dem Gast Blickkontakt zu halten. Sein Blick rollte in verschiedene Richtungen und erinnerte Hans an die Augen einer defekten Spielzeugpuppe, die geschüttelt wurde. Im Rückspiegel sah er einen weiteren Mann herbeieilen, einen vierschrötigen Kerl, wie er urteilte, der nun breitbeinig dastand und sich an der Kofferraumklappe zu schaffen machte. Und als Scheibler eben gegen diese Übergriffigkeiten protestieren wollte, hörte er die Stimme der Tante, die mit einem japanischen Schirm an der Balustrade des Eingangs stand.
„Heinrich, Herbert, na aber!“, rief sie, und Hans sah, wie s■e drohend den Zeigefinger erhob. Ihre Art, die Männer zure■htzuweisen, hatte etwas davon, unartige Hunde zurückzupfeifen, was Hans eher verblüffte als befremdete. Und bevor ihm die beiden Gesellen alles aus den Händen reißen konnten, griff er nach dem Kunstblumengesteck und eilte der Tante auf der Treppe entgegen, welche sie würdevoll hinabzusteigen begonnen hatte.
„Hans, mein lieber Neffe!“, rief sie begeistert. Sc■eibler verbeugte sich auf eine Weise, die bei einem dynamischeren Mann seines Alters als amüsante Parodie hätte verstanden werden können, nun aber ge■einsam mit Wetter und seinen Worten haltlos in pure Förmlichkeit absoff:





























