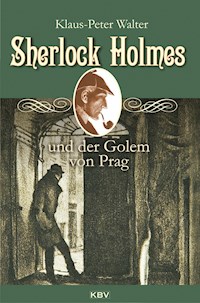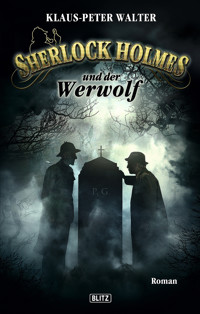4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lovecrafts Schriften des Grauens
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
1906 steht der britische Geheimdienst vor einer seinen größten Herausforderungen.Eine Maschine mit sechs Beinen versetzt die Bevölkerung in Angst. In Russland, destabilisiert durch politische Revolutionen, findet man ein gefrorenes Wesen unbekannter Herkunft. Und der totgeglaubte Professor Moriarty nimmt Kontakt zu Sherlock Holmes auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Ähnliche
Klaus-Peter WalterSherlock Holmes gegen Cthulhu
In dieser Reihe bisher erschienen:
2101 William Meikle Das Amulett
2102 Roman Sander (Hrsg.) Götter des Grauens
2103 Andreas Ackermann Das Mysterium dunkler Träume
2104 Jörg Kleudgen & Uwe Vöhl Stolzenstein
2105 Andreas Zwengel Kinder des Yig
2106 W. H. Pugmire Der dunkle Fremde
2107 Tobias Reckermann Gotheim an der Ur
2108 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Xulhu
2109 Rainer Zuch Planet des dunklen Horizonts
2110 K. R. Sanders & Jörg Kleudgen Die Klinge von Umao Mo
2111 Arthur Gordon Wolf Mr. Munchkin
2112 Arthur Gordon Wolf Red Meadows
2113 Tobias Reckermann Rückkehr nach Gotheim
2114 Erik R. Andara Hinaus durch die zweite Tür
2115 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo
2116 Adam Hülseweh Das Vexyr von Vettseiffen
2117 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 2
2118 Alfred Wallon Salzburger Albträume
2119 Arno Thewlis Der Gott des Krieges
2120 Ian Delacroix Catacomb Kittens
2121 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 3
2122 Tobias Reckermann Gotheims Untergang
2123 Michael Buttler Schatten über Hamburg
2124 Andreas Zwengel Finsternacht
2125 Silke Brandt (Hrsg.) Feuersignale
2126 Markus K. Korb Treibgut
2127 Tobias Reckermann (Hrsg.) Drommetenrot
2128 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 4
2129 Peter Stohl Das Hexenhaus in Arkheim
2130 Silke Brandt (Hrsg.) Das Kriegspferd
2131 Anton Serkalow Berge des Verderbens
2132 Klaus-Peter Walter Sherlock Holmes gegen Cthulhu
Klaus-Peter Walter
Sherlock Holmes gegen Cthulhu
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Mario HeyerUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierVignette: Jörg KleudgenSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-942-3
Da wäre erstens der Fall des ehrenwerten James Phillimore, der einen Schirm aus seinem Haus holen wollte und nie mehr gesehen ward, zweitens das Verschwinden des Kutters Alicia und seiner gesamten Besatzung in einer urplötzlich aufkommenden Nebelbank, und drittens der des bekannten Journalisten und Duellanten Isadore Persano. Er saß, unheilbarem Wahnsinn verfallen, da und starrte in eine Schachtel mit einem Wurm, der der Wissenschaft völlig unbekannt war.
Das Problem der Thor-Brücke
… und schließlich die einmaligen Abenteuer der Familie Grice-Paterson auf der Insel Uffa …
Die fünf Orangenkerne
I
Eine kalte Märznacht des Jahres 1906 lag wie ein klammes Tuch über der Stadt. Big Ben hatte schon lange zwei Uhr geschlagen. Stille und Dunkelheit lagen über der sonst so brodelnden Metropole London. Die letzten Besucher der Opernhäuser, Theater oder Ballsäle waren längst heimgekehrt. Die Nacht gehörte den Elementen, die das Licht des Tages scheuten. Was mochten sie planen? Wem wollten sie als nächstes Schaden zufügen? Das war das Geheimnis der Großstadt, das jede Nacht erneuert wurde!
Ein Mann mit einem steifen Hut und einem langen Mantel aus glattem Leder, wie ihn die Chauffeure der ersten Motorwagen zu tragen pflegten, lief eilig durch die Straßen der Stadt auf die Siddons Lane zu. Er wollte zunächst die breite Park Road erreichen. Dann war es nicht mehr weit bis zu seinem Ziel, wo er in Sicherheit wäre. Er blieb zum Atemholen kurz stehen, und um zu prüfen, ob seine Verfolger ihm schon auf den Fersen waren. Aber so oft er sich auch umsah, er bemerkte niemanden Verdächtiges, doch das musste nichts heißen. Der Verfolger war gewieft. Sein einziger Vorteil war, dass er sich im Gegensatz zu ihm in London gut auskannte. Hier war er geboren und aufgewachsen. Allerdings war er schon mehr als ein Jahrzehnt nicht mehr hier gewesen. Seine Füße hatten jedoch ihr eigenes Gedächtnis. Sie fanden ihren Weg fast ohne sein Zutun.
Wäre ich nur in der Droschke sitzen geblieben!, dachte er bei sich. Aber er kannte die Droschkenkutscher und wusste, dass sie jedem, der ein paar Penny Handgeld zahlte, Auskunft über ihre Fahrgäste zu geben pflegten. Und er wollte unter allen Umständen verhindern, dass ihm sein Verfolger auf die Spur kam, bevor er die Baker Street erreicht hatte, eine Straße, die er zuzeiten gemieden hatte wie die Pest. Aber er musste dorthin gelangen. Er hatte dem Chef doch sein Wort gegeben!
Beim Überqueren der Park Road wäre er beinahe von einem jener Motorwagen überfahren worden, an die er keineswegs gewöhnt war, und dann hastete er in die Baker Street. Schon begann er die Nummern aufwärts zu zählen, 215, 217, 219. Gleich war es geschafft, und er blickte sich noch einmal um. Niemand war hinter ihm! Er ging dicht an den Hauswänden und Gartenzäunen entlang. Das schien ihm sicherer. Wie leicht könnte man ihn sonst mit einem Fuhrwerk oder gar einem Automobil überfahren. Der Chef hatte ihn eigens vor diesem neumodischen Teufelszeug gewarnt.
„Diese Vehikel sind schneller als du denkst“, hatte er gesagt. „Schneller als du laufen kannst!“
Dass es ein Fehler war, dicht an den Häusern entlangzugehen, merkte er, als aus einem schmalen Durchgang eine kräftige Hand nach ihm griff, sich ihm um Mund und Nase legte und er im nächsten Moment im Rücken einen Schmerz verspürte, der sich rasch tiefer bohrte und fast sein Herz erreichte. Er kannte die Qualen, die ein Messerstich verursachte, denn er hatte schon viele davon abbekommen, aber keinen so tiefen. Und noch viel größer wurde der Schmerz, als der Angreifer das Messer mit einem kurzen Ruck aus der Wunde zog.
Der Mann hatte einen kurzläufigen Revolver in der Tasche, wollte ihn hervorziehen, aber es gelang ihm nicht mehr. Seine Hand gehorchte seinem Willen nicht mehr. Mit einem Mal ergriff ihn eine unendliche Müdigkeit, und sein Auftrag war ihm völlig egal. Er wollte sich nur noch hinlegen und ausruhen. Schlafen.
Dem Mann knickten die Knie ein, und er fiel schwer auf das Pflaster der dunklen Nebenstraße. Sein Hut rollte davon. Der letzte Gedanke des Sterbenden galt den Steinen, auf denen er trotz allem so gut lag. Endlich konnte er schlafen! Das tat er ohne zu träumen und bemerkte nicht, wie zwei kundige Hände die Taschen seines Mantels, seiner Joppe sowie seiner Hose und Weste leerten. Sein Mörder suchte auch seine Kleidung nach eingenähten Schriftstücken ab, fand aber nichts. Die Waffe ließ er ihm. Nur die Uhr nahm er mit, denn in die war ein verräterisches Monogramm eingraviert. Diese musste er dem Eigentümer zurückgeben, schließlich war er kein Dieb!
Als der Mann die Augen wieder aufschlug, wusste er nicht, wie lange er bewusstlos hier gelegen hatte, ob es Stunden, Tage oder nur Minuten gewesen waren. Es war dunkel, bis auf den matten Schein einer Gaslaterne weiter vorne. Jetzt wusste er wieder, wo er war! Baker Street 219! Es war nicht mehr weit. Notfalls wollte er auf allen vieren kriechen. Er hatte ja einen Auftrag, Mr. Holmes etwas auszurichten. Sein geliebter Revolver, den er in der Tasche fühlte, gab ihm die Kraft zurück, die er brauchte. Wo war sein Hut, den er nur im Bett abzulegen pflegte? Er schien ihm auf einmal nicht mehr so wichtig, und so kroch er ohne ihn los, langsam, Hand vor Hand, Knie vor Knie.
Wie ein Säufer, dachte er und begann zu lachen. Das Gelächter ging sofort in ein Husten mit rötlichem Auswurf über. Das Blut spuckte er auf den Gehsteig. Damals, als Sanitätssoldat, hatte er viele Männer sterben sehen, aber er glaubte nicht, dass er es nun selber musste, und kroch unbeirrbar weiter.
Sein Leben lang hatte er die Polizei gehasst. Heute wäre er froh, wenn ein Constable aufgetaucht wäre, dem er sein Geheimnis hätte anvertrauen können. Einer, der mit einem schrillen Pfiff seiner kleinen silbernen Pfeife Hilfe herbei holte. Einer, der ihm die Last von den Schultern nehmen könnte. Aber es kam keiner, noch nicht einmal eine von diesen verdammten Motorkutschen. Ein Milchwagen klapperte vorbei, aber der Fahrer beachtete ihn nicht.
Immer wieder musste der Verletzte innehalten. Nein, er brauchte sich nicht mehr umzusehen. Niemand Gefährliches war hinter ihm. Sie hatten ihn heimlich überholt und waren von der Seite gekommen. Damit hatte er nicht gerechnet. Mehrfach musste er sich anlehnen, um auszuruhen und das Blut auszuspucken, das ihm dauernd im Munde zusammenlief. Oh, hätte er doch besser aufgepasst! Dann hätte er seinen Revolver ziehen und auf die Mörder schießen können, so, wie er damals in Afghanistan auf die Mudschahedin geschossen hatte. Bei diesem Gedanken stieg Wut in ihm auf, und sie verlieh ihm noch einmal Kraft, sich vorwärts zu schleppen. Wenn er ausgeschlafen hatte, dann würde er sie töten, ganz langsam und quälend. Voller Vorfreude auf seine Rache bewegte er sich weiter.
Als er sich die vier, fünf Stufen zur Tür des Hauses 221B hinaufzog, dämmerte der Morgen noch immer nicht über den Giebeln. Aber er war am Ziel! Gleich würde der Mann mit der Hakennase vor ihm stehen, und alles würde gut werden. Als er nach oben blickte, musste er erkennen, dass er den Klingelzug nicht betätigen konnte. Nicht mehr in diesem Leben. Darum zog er den Revolver aus der Tasche und begann mit dem Griff gegen das Holz zu klopfen, so fest und so lange er konnte. Bevor ihn die Kraft verließ, ging die Tür auf. Vor sich sah er ein Paar Pantoffel und den Saum eines Nachtgewandes. Eine Frau. Hilfesuchend streckte er die Hand nach ihr aus und wollte ihr das Wort zurufen, das er im Auftrag seines Bosses ausrichten sollte. Aber statt dessen entrang sich seinem Mund nur ein Schwall warmen Blutes, das ihn würgen ließ. Er hörte einen spitzen Schrei. Offenbar hatte sein Anblick die Frau erschreckt. Das tat ihm leid, er war immer gut zu den Frauen gewesen. Das Gesicht seiner Mutter entstand vor seinen Augen, und dann wurde es Nacht um ihn. Es war eine, die nie mehr weichen sollte.
„Mr. Holmes, Dr. Watson, schnell!“
Mrs. Hudson musste wahnsinnig geworden sein! Mitten in der Nacht erschien sie bei uns im Flur, klopfte an unsere Schlafzimmertüren und rief immer wieder unsere Namen. Mein erster Gedanke beim Aufwachen war, mir so schnell wie möglich eine neue Bleibe zu suchen.
„Ein Toter, schnell!“
„Wenn er tot ist, hat es keine Eile mehr, Mrs. Hudson.“ Ich rief es unfreundlicher durch die verschlossene Tür, als ich beabsichtigt hatte, warf mir einen Morgenmantel um, fuhr mir kurz übers Haar und trat in den Flur hinaus. Gegenüber erschien gähnend mein Freund, in der gleichen Aufmachung wie ich. Mrs. Hudson hatte einen selbstgehäkelten Umhang über ihr Rüschen-Nachthemd geworfen, und sie trug eine abscheuliche Nachtmütze, bei der ich ohne böse Absicht an einen Kaffeewärmer denken musste. Der Anblick versöhnte mich etwas mit dem rüden Weckruf, und ich wandte den Blick von unserer Vermieterin ab, so wie es sich für einen Gentleman gehört.
„Ein Toter. Vor der Haustür!“, wiederholte sie.
„Ach, kommen Sie, Mrs. Hudson, der Milchmann wird einen über den Durst getrunken haben!“
Meine Worte erzürnten Mrs. Hudson. „Dok-tor Wat-son! Es ist nicht der Milchmann, und er liegt auf der Treppe in einer riesigen Blutlache, die ich wahrscheinlich nie wieder werde wegwischen können.“
„Doch, aber Sie sollten nur kaltes Wasser verwenden“, empfahl mein Freund, der aus seinem Schlafzimmer in den Flur getreten war. „Sonst gerinnt es und ist nicht mehr zu entfernen. Guten Morgen allerseits!“ Seine Worte klangen erstaunlich munter. „Aber vorher wollen wir uns die Bescherung einmal anschauen.“
Wir folgten Mrs. Hudson, die mit einer Petroleumlampe in der Hand vorausging, die Treppe hinunter. Der Regulator über dem Treppenknie schlug viermal.
Mrs. Hudson schüttelte voller Entsetzen unablässig den Kopf. „Wie ich schon immer sagte, Mr. Holmes, ich bin vieles gewöhnt, und ich habe mich nie beklagt, wenn die merkwürdigsten Leute Sie aufgesucht haben. Aber das geht wirklich zu weit! Eine Leiche vor meiner Haustür! Sehen Sie nur! Was werden die Nachbarn denken!“
Mit einer theatralischen Geste riss sie die Haustür auf und präsentierte uns, die Lampe am ausgestreckten Arm haltend, die Bescherung. Ein Mann lag auf dem Bauch vor uns. Blut, vielBlut hatte sich unter ihm ausgebreitet und war die Treppenstufen hinuntergelaufen. Ich beugte mich hinunter, legte dem Verletzten den Finger an den Hals, fühlte keinen Puls mehr und schüttelte stumm den Kopf.
„Er blutete offenbar bereits stark, als er zu uns kroch“, stellte Holmes fest und zeigte auf die verschmierten Spuren auf dem Gehweg, die noch schwarz und feucht im Schein der Gaslaterne vor dem Haus glänzten. „Watson, wenn es nicht zu viel verlangt ist, holen Sie bitte ihren ständigen Begleiter!“
„Meine alte Webley?“
„Ihre Bergheil-Camera! Mit einigen Platten. Und das Magnesiumlicht. Und wenn Mrs. Hudson so freundlich wäre, nach Lestrade zu schicken!“
„Wie Sie wünschen!“
Ich nickte und ging nach oben, um mich rasch anzuziehen.
Als ich wieder nach unten kam, griff Holmes gerade nach der Morgenzeitung und legte sie sorgfältig neben den Toten in die Blutlache. Vorsichtig trat er auf das Blatt und ging mit gerafftem Morgenmantel in die Hocke, um den Toten zu untersuchen.
„Meine Morgenzeitung!“, schimpfte Mrs. Hudson, als sie das sah. „Mein Daily Herold! Was fällt Ihnen ein, Mr. Holmes?“
„Ich möchte die Verunreinigung meiner Pantoffeln und Ihres geschätzten Fußbodens vermeiden. Der Daily Heroldgehört erfreulicherweise zu den drei saugfähigsten Zeitungen Londons.“
Das verschlug sogar Mrs. Hudson die Sprache, und sie entfernte sich erschüttert.
Wir hatten wahrlich schon viele Klienten unter den seltsamsten Umständen kennengelernt, aber tot auf unserer Treppe hatten wir noch keinen gefunden. Ich machte eine Aufnahme vom Gesicht des Toten. Bevor ich sie entwickelte, musste ich Holmes noch ein Stück Blumendraht bringen.
„Was um Himmels willen, Holmes, fangen Sie denn mit dem Draht an?“
„Später, Watson, später!“
Später, es war inzwischen hell geworden, Holmes hatte sich angezogen und die Leiche war abtransportiert worden, saßen wir zusammen mit Inspector Lestrade, der wie immer seinen abgewetzten Donegal trug, in unserem Wohnzimmer. Seine Leute waren der Blutspur des Mannes gefolgt und hatten seinen Hut gefunden. Jetzt lag die Kopfbedeckung vor uns auf dem Teetisch, auf dem leider kein Tee stand. Mrs. Hudson hatte keine Zeit zum Servieren. Sie beaufsichtigte das Mädchen beim Putzen der Treppe. Mehrfach wies sie mit energischer Stimme sehr nachdrücklich auf die Notwendigkeit der Verwendung kalten Wassers hin, was bei den winterlichen Temperaturen dieses Morgens sicherlich kein Vergnügen bedeutete. Ich hielt einige in Holmes‘ Auftrag angefertigte und bereits entwickelte und vergrößerte Aufnahmen bereit.
„Zweifelsohne haben Sie gelegentlich, im Zusammenhang mit einigen merkwürdigen Kriminalfällen, durchaus Verdienste erworben, Mr. Holmes“, wies Lestrade meinen Freund zurecht. „Aber wir sollten vielleicht vereinbaren, dass Sie in Zukunft auf unser Eintreffen warten, ehe Sie sich an einer Leiche zu schaffen machen. Selbst wenn sie vor Ihrer eigenen Haustür liegt.“
Holmes überging die Zurechtweisung. „D‘accord, cher ami“, gab er ironisch zurück. „Sie haben dasselbe gesehen wie ich. Fangen Sie an!“
Ich sagte lieber nichts.
Mit einem unsicheren Lächeln begann Lestrade. „Der Mann ist unbestritten Ausländer, möglicherweise Niederländer, Belgier oder Luxemburger. Auf seinen Unterarm ist sehr dilettantisch ein Wappen mit einem Löwen tätowiert. Der Tote ist nicht unbegütert, denn sein Mantel ist aus Leder und wurde, wie das Etikett des Schneiders zeigt, vor etlichen Jahren in Indien gefertigt. Der Unbekannte hatte keinerlei Papiere bei sich und starb durch einen Stich in den Rücken. Sicherlich wurde er ausgeraubt. Mehr wissen wir nicht.“
Holmes lächelte. „Erlauben Sie, Lestrade, dass ich Sie korrigiere. Der Mann war mitnichten Ausländer, sondern Brite. Watson, die Bilder mit den Tätowierungen, bitte.“
„Gerne!“ Ich hielt Sherlock Holmes das Gewünschte hin.
„Der Künstler, wenn man ihn denn so nennen darf, der die Tätowierung anfertigte, erlaubte sich einige Freiheiten, die das Bild trüben. Hier, das Schwert in der rechten Löwenpranke! Ein Beiwerk, das geeignet ist, Sie zu falschen Schlussfolgerungen zu verführen. Ein Schwert schwingt tatsächlich der niederländische Löwe, der finnische übrigens auch, aber beide tragen Kronen auf dem Kopf, die hier fehlen, und der niederländische Löwe hält zusätzlich ein Pfeilbündel in der linken Pranke. Der finnische Leu steht außerdem auf einem Schwert. Ein solches ist nicht einmal angedeutet. Mit der Lupe erkennbar sind jedoch die Worte der Wappendevise. In defence. In Verteidigung. Von dem orthographischen Fehler einmal abgesehen, denn es muss ja In defenslauten, ist das seit jeher das Motto des schottischen Königshauses. Die unbekleidete Dame namens Rosie auf dem linken Unterarm hat sicherlich keinerlei heraldische Bedeutung. Die Arabesken um ihren Leib entpuppen sich bei näherem Hinsehen jedoch ebenfalls als Schrift. Scotland foreverund O Danny Boysteht da. Glauben Sie immer noch an einen Niederländer oder Belgier, Lestrade?“
Holmes wartete die Antwort nicht ab und fuhr fort. „Was wieder einmal beweist, welch gar nützliche Instrumente Camera und Lupe sogar in Händen der Polizei sein könnten. Die Lupe bringt aber noch mehr ans Licht! In die Tätowierung auf dem linken Arm hatte der Mann mit Tinte und winzig klein noch Agourth 35geschrieben. Was das bedeutet, da bin ich im Moment überfragt. Vielleicht ein Ort in Arabien. Nun gut! Der Mann war auch keineswegs begütert, denn sein ohne Frage teurer, nur mäßig abgetragener Mantel stand in eklatantem Gegensatz zu seinen Stiefeln. Sie befanden sich in einem ähnlich schlechten Zustand wie seine Zähne. Die Stiefel waren dunkelbraun, aber mit Schnürsenkeln in zwei unterschiedlichen Farben, dunkelbraun und schwarz, geschnürt. Sie hätten längst neue Sohlen gebraucht, die Absätze waren schief gelaufen. Der Mantel passte dem Toten nicht, denn er war für einen Mann etwa von meiner Statur gefertigt worden. Auch war er, wie seine Hände beweisen, nicht wohlhabend genug, um sich körperlicher Arbeit enthalten zu können. Er nähte, allerdings wohl nicht sehr gut. In der Haut seiner linken Hand befinden sich unzählige kleine Einstiche, weil er sich oft eine Nadel in die Hand stach, die das Nähgut hielt. Möglicherweise musste er Sattelzeug oder Ähnliches anfertigen oder instand halten, vielleicht gelegentlich Wunden notdürftig versorgen, ohne es wirklich zu können. Wir wissen es nicht.
Ungewöhnlich ist der vollständig geladene Revolver, mit dessen Knauf er sterbend gegen unsere Haustür klopfte. Ungewöhnlich jedenfalls für einen Schneider, Sattler oder Täschner. Sein Mörder hat ihn jedoch hinterrücks niedergestochen und liegenlassen, ohne ihm den Revolver abzunehmen. Die Waffe interessierte ihn offensichtlich nicht. Führte der Ermordete ein Schriftstück mit sich, das nun verschwunden ist? Eine wichtige Nachricht für uns, möglicherweise? Ich zweifle fast! Vielmehr glaube ich, dass, von Agourth 35einmal abgesehen, der niedergestochene Mann selbst die Nachricht war. Man wollte verhindern, dass er sie überbringt, stach ihn nieder und ließ ihn, in der Annahme, er sei tot, liegen. Er hätte beim Aufwachen um Hilfe rufen oder sogar den Revolver ziehen und in die Luft schießen können, um auf seine Notlage aufmerksam zu machen. Das hat er aber nicht getan. Statt dessen kroch er unter Aufbietung seiner letzten Kräfte ausgerechnet zur Baker Street 221B und jagte unserer guten Mrs. Hudson den Schrecken ihres Lebens ein. Sagen Sie jetzt nicht, Lestrade, er habe lediglich unseren guten Dr. Watson aufsuchen wollen, um seinen Messerstich behandeln zu lassen! Wir dürfen vielmehr als gesichert gelten lassen, dass er den Anwesenden bekannten beratenden Detektiv aufsuchen wollte. Bis hierher irgendwelche Einwände?“
Lestrade schüttelte den Kopf.
Ich wagte eine Frage. „Was mag er bei uns, bei Ihnen, gewollt haben?“
„Wenn er sich im Angesicht des Todes herschleppte, dann musste sein Anliegen von allerhöchster Wichtigkeit für ihn oder seinen Auftraggeber sein. Wichtiger als sein eigenes Leben. Er wollte uns etwas mitteilen, was er, wohl aus Angst, es zu vergessen oder falsch wiederzugeben, unauffällig auf der eigenen Haut notiert hatte. Aber da wir mit Agourth 35vorerst nichts anfangen können, werfen wir zunächst einmal einen kurzen Blick auf den Hut! Sie erlauben, Lestrade?“
Ohne eine Antwort abzuwarten, ergriff Holmes die verbeulte Melone und untersuchte sie ausdauernd mit seiner Lupe. „Mm, kein Schweißband mehr, Schmieröl an der Krempe und offenbar auch Blut, Kalkstaub überall, obendrauf frischer Ruß. Der Mann muss mit der Eisenbahn nach London gekommen sein. Zu dumm, dass er keine Fahrkarte bei sich trug. An einer Stelle wurde die Kopfbedeckung schon vor längerer Zeit durchbohrt, wie ich sehe von einem Messer, keinem Dolch, denn die Klinge war lediglich auf einer Seite scharf. Ich schließe daraus, dass sein Besitzer ein Kleinkrimineller war. Allem Anschein nach dürfte es sich um Andy McCullen handeln, genannt The Hat!“
„Steht der Name im Hut, Holmes, oder sind Sie unter die Hellseher gegangen?“, empörte ich mich. „Woher wollen Sie das wissen?“
„Ja, woher wollen Sie das wissen?“, echote Lestrade.
Holmes feixte. „Watson, würden Sie mir bitte die photographische Aufnahme vom Gesicht des Toten reichen!“
„Gerne!“
Ich reichte Holmes vorsichtig die Aufnahme. Er hatte inzwischen eines seiner Scrapbooks aus dem Regal geholt. Mit einer triumphalen Geste schlug er es auf und legte es auf den Tisch. Lestrade und ich angelten in perfekter Synchronität nach unseren Zwickern.
Donnerwetter!
Neben einem Zeitungsartikel aus dem vorigen Jahrhundert über eine Gerichtsverhandlung war die Illustration eines Gerichtszeichners eingeklebt. Sie zeigte niemand anderen als unseren Toten, natürlich um etliche Jahre jünger.
Da stand in Balkenlettern: ANDREW MCCULLEN VERURTEILT!
„Die akribische Führung meines Verbrecheralbums zahlt sich hin und wieder doch aus!“
Holmes labte sich sichtlich an unserer Verblüffung.
„Was aber die Presse niemals meldete, war, dass McCullen einer der engsten Vertrauten von Professor Moriarty war. Er gehörte zu dessen sogenannter family.Ehemaliger Sanitätssoldat. Nach dem Ende seiner Militärzeit trat er in Moriartys Dienste, ließ sich dann wegen Bankraubs verurteilen, damit er nicht wegen Mordes unter den Galgen treten musste. Aus diesem Grund bin ich auch überzeugt, dass es um Wichtigeres ging als nur ein paar mindere Gaunereien. Bon! Sie verzeihen bitte meine Neigung zum Theatralischen, meine Herren!“ Holmes schlug sein Verbrecheralbum so fest zu, dass Staub aufwirbelte. „Und Sie haben in der Kleidung McCullens wirklich nichts gefunden, Lestrade? Auch nicht in seiner, verzeihen Sie, Unterkleidung, die ich mit Rücksicht auf Mrs. Hudson und die Öffentlichkeit auf der Treppe natürlich nicht in Augenschein nehmen konnte?“
„Das hätte ich umgehend erfahren! Er hatte nichts außer seinem Revolver bei sich. Anscheinend hat man ihn völlig ausgeplündert. Aber wieso ließ man ihm ausgerechnet den Revolver?“
„Weil er seinem Mörder nicht wichtig war. Er hielt McCullen offenkundig für tot! Mochte er seine Schusswaffe behalten! Aber konzentrieren wir uns zunächst einmal auf die Person des Mörders. McCullens Leichnam gibt Hinweise, die mehr als deutlich sind!“
„Mr. Holmes!“ Lestrade war und blieb ein ungläubiger Thomas. „Bitte, was für Hinweise?“
„Ganz einfach! Überall in der Welt außer bei Scotland Yard wird bei der Untersuchung eines Ermordeten ein Bleistift in die Todeswunde eingeführt, um ihre Tiefe und den Winkel des Wundkanals festzustellen. Das verrät alles über den Standort und die Größe des Täters, über die Position des Opfers sowie über die verwendete Waffe.“
Lestrade schüttelte sich. Bevor er irgendetwas in die Wunde eines Toten gesteckt hätte, müsste man ihm eine Vollnarkose verabreichen. Holmes wusste das und lächelte konziliant.
„Mein Bleistift ließ sich aber nur etwa einen Zoll tief in die Wunde einführen. Der Wundkanal war gekrümmt. Daher bat ich meinen erstaunten Freund Dr. Watson um ein Stück Blumendraht. Der ist so biegsam, dass er sich beim Einführen in eine Wunde ihrem Verlauf anpasst. Das Ergebnis sieht so aus!“
Er hielt ein blutverschmiertes, halbmondförmiges Stück Blumendraht hoch.
„Etwa neun Zoll lang, ich habe es mit einem Bindfaden ausgemessen. McCullen wurde mit einem Krummdolch getötet. Die Klinge war etwa ein dreiviertel Zoll breit. Eine Waffe, wie man sie vornehmlich im Orient, in Arabien findet.“
„Und was sagt uns das?“
„Dass wir nach einem Araber oder mehreren Arabern suchen. Und dass wir die Hilfe meines Bruders brauchen werden. Die aufgeriebenen Regimenter Moriartys sammeln sich wieder!“
II
Einige Tage später suchte Holmes noch immer vergebens nach McCullens Mörder, so wie Lestrade, obwohl er rastlos unterwegs war. Meist waren Bibliotheken sein Ziel. O nein, nicht die ehrwürdige British Library mit ihrem wunderbaren Kuppelsaal, sondern die oft kaum bekannten Bibliotheken von Sammlern und Raritätenjägern. Oft musste er dazu in die Vororte Londons oder gar ins Umland der Stadt, aber mir fiel auf, wie schnell er zumeist von diesen Ausflügen zurückkehrte. Fast schien es, als habe er einen Flugapparat zur Verfügung! Manchmal kündigte er an, dass er sich an weit entfernte Orte begeben wolle, und ich rechnete mit einer Abwesenheit von einem halben Tag und mehr. Oft war er schon nach kurzer Zeit zurück und berichtete mir, dass auch dieser Ausflug zu eben dem genannten weit entfernten Ort vergebens gewesen sei. Ich wunderte mich nur, sagte aber nichts. Auch kommentierte ich es nicht, dass er nie mehr ohne eine kleine C-Flöte ausging, auf der ich ihn allerdings noch nie hatte spielen hören. Vielleicht wurde mein Freund auf seine alten Tage wunderlich?
Über das Wort Agourthhatte er ebenfalls noch nichts Entscheidendes herausgefunden. Er war gerade wieder einmal außer Haus, als Lestrade, wie immer in äußerst fragwürdiger Verfassung, in der Baker Street erschien. Ich hatte gerade die Mittagspost sortiert und Holmes einen Brief aus Sussex auf den Schreibtisch gelegt, der uns, das sagte mir meine Erfahrung, bestimmt einen neuen, spannenden Fall bescheren würde. Doch zunächst galt es, unsere polizeiliche Nemesis zu begrüßen.
„Mein lieber Lestrade“, begann ich, „nehmen Sie Platz. Sherlock Holmes ist nicht zu Hause. Leider weiß ich auch nicht, wann er wiederkommen wird. Sie kennen ihn ja. Wenn er bis über die Ohren in einem Fall steckt, bekomme ich ihn oft tagelang nicht zu Gesicht.
Aber wenn Sie möchten, kann ich ihm etwas ausrichten.“
„Das wird nicht nötig sein, lieber Doktor.“ Lestrade ließ sich in den Besuchersessel fallen, der ächzend protestierte. „Ich benötige auch Ihren Rat. Als Mediziner, meine ich.“
„Grundgütiger Himmel, Lestrade, Sie werden doch nicht etwa krank sein?“
„Da sei Gott vor! Nein, ich wollte den Rat auch nicht für mich persönlich. Mehr allgemein, wenn Sie verstehen, was ich meine.“
„Noch nicht völlig.“
„Dann will ich von vorne anfangen.“
„Bitte, gerne.“ Ich klingelte Mrs. Hudson, um Tee kommen zu lassen.
Derweil begann Lestrade zu berichten. „Sagt Ihnen der Name Persano etwas?“
„So hieß meines Wissens der italienische Flottenchef, der 1866 von Admiral Tegetthoff bei Lissa vernichtend geschlagen wurde. Von einem Österreicher! Der nicht einmal einer seefahrenden Nation angehörte! Es war eine Schmach!“
„Äh … diesen Persano meine ich nicht. Isadore Persano ist Journalist, keiner, der in einem guten Ruf stünde. Er gehört zu jener Sorte, die gerne Menschen mit Schmutz bewerfen, wenn Sie verstehen, was ich meine.“
„Dieses Mal verstehe ich durchaus. Darf ich?“
Mrs. Hudson hatte den Tee gebracht und ihr Tablett mit einem kurzen, freundlichen Nicken auf das Tischchen zwischen mir und Lestrade gestellt. Als er mir die Teetasse hinhielt, goss ich ihm, mich leicht vornüberbeugend, ein.
„Danke verbindlichst. Also, Persano war ein Meister der üblen Nachrede. Meist ging er so geschickt zu Werke, dass das Opfer nichts machen konnte, denn er benutzte gewöhnlich eine raffinierte Form des Konsump … Konjump …“
Wie immer, wenn Lestrade über ein Fremdwort stolperte, zog er sein Notizbuch hervor und begann, wie wild darin herumzublättern.
„Konjunktiv“, schlug ich vor.
„Wie ich sage. Wenn ihn das Opfer verklagte, stellte sich vor Gericht heraus, dass er gar nicht schrieb, was er meinte. Also, er hatte es durchaus geschrieben, aber so, dass, also, da nicht …“
„Mir ist die Art des Schreibens nicht unvertraut, lieber Inspektor. Fahren Sie ruhig fort.“
„Nicht immer zog das Opfer vor Gericht. Oberst O‘Neill, dessen durchaus anrüchiges Verhältnis mit einem Chormädchen Persano ans Licht gebracht hatte, musste den Dienst bei den Irish Fuseliers quittieren und forderte Persano kurzerhand zum Duell. Bei dieser Gelegenheit verlor Persano mehrere Finger sowie die volle Beweglichkeit seines linken Arms.“
„Ich erinnere mich, dass mir Holmes von dem Vorfall im Zusammenhang mit einer Klage über den zunehmenden Sittenverfall in unserer Gesellschaft berichtete.“
„Später forderte ihn Lord Hascott-Thortescomb auf Säbel, weil er als Gentleman mit dem, was Persano über das Vorleben von Lady Hascott-Thortescomb geschrieben hatte, nicht einverstanden sein konnte.“
„Mit welchem Ergebnis?“
„Die Ehre der Lady wurde durch ihren noblen Gatten wiederhergestellt, und Persano muss seitdem auf seine rechte Ohrmuschel verzichten.“
„Recht so!“
„Ja, Sie verstehen noch etwas von der Ehre des Mannes, Doktor!“
Ich nippte befriedigt über dieses Kompliment am Tee.
„Persano hat aber außer dem Duellieren noch eine andere Leidenschaft. Er glaubt an Gespenster und Geister und solches Zeug und schreibt in obskuren Postillen darüber, unter anderem in den Blättern dieser thesischen ...“
Er begann wieder in seinem Notizbuch zu blättern.
„... theosophischen“, korrigierte ich.
„... Gesellschaft. Unter anderem.“
„Madame Blavatsky“, ergänzte ich.
„Ja, der Name steht auch hier. Also, er glaubt an das Übersinnliche. Wie Ihr Kollege, dieser Doktor Doyle. Meiner Meinung nach völliger Unsinn. Ich habe noch nie einen Geist gesehen.“
„Davon bin ich wirklich überzeugt, Lestrade.“
Wie immer verstand er die Boshaftigkeit der Anspielung nicht.