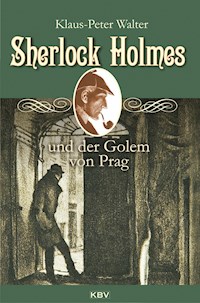
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sherlock Holmes
- Sprache: Deutsch
Sherlock Holmes meets Franz Kafka Ein burleskes Abenteuer, in dem Klaus-Peter Walter den Leser in augenzwinkernder Manier mitten hinein in die Literatur- und Weltgeschichte entführt. Sherlock Holmes plant überraschend eine Reise nach Prag. Lockt ihn etwa die Nachricht des Versicherungs-Concipisten und Schriftstellers Dr. Franz Kafka? Der nämlich glaubt, einem leibhaftigen Golem, jener furchterregenden Gestalt aus der jüdischen Legende, begegnet zu sein. In Wahrheit schickt sein Bruder Mycroft, der ein hohes inoffizielles Amt in Whitehall bekleidet, ihn auf geheime Mission. Jemand verkauft militärische Geheimnisse – auch solche aus Großbritannien – nach Russland. Und so geraten der Detektiv und sein treuer Begleiter Dr. Watson kurz vor dem Ersten Weltkrieg im winterlichen Böhmen in ein lebensgefährliches Komplott voller geheimnisvoller Erfindungen, finsterer politisch-militärischer Planspiele und Verrat. Ihre Ermittlungen führen sie zu der russischen Kriminalschriftstellerin Marietta Schaginjan und zu dem zwielichtigen Oberst Redl vom k.u.k.-Geheimdienst. Und schließlich sogar zu einem Golem – aber diese Begegnung verläuft gänzlich anders als erwartet ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus-Peter Walter Sherlock Holmes und der Golem von Prag
Klaus-Peter Walter… Dr. phil., geboren 1955 in Michelstadt im Odenwald, studierte Slawistik, Philososophie und osteuropäische Geschichte in Mainz und promovierte 1983. Er lebt als freier Autor in Bitburg in der Eifel. Von 1993 bis 2014 war er Herausgeber des Lexikons der Kriminalliteratur LKL und schrieb neben zahlreichen Kurzgeschichten in diversen Anthologien auch für FAZ, Kindler und Reclam. Seit 2008 schreibt er Sherlock-Holmes-Romane, -Erzählungen und -Hörbücher.
Klaus-Peter Walter
Sherlock Holmesund der Golem von Prag
Originalausgabe © 2016 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.de E-Mail: [email protected] Telefon: 0 65 93 - 998 96-0 Fax: 0 65 93 - 998 96-20 Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung von: Hugo Steiner-Prag »Der Student Charousek«, Illustration zu Gustav Meyrinks »Der Golem« (1915) Redaktion: Volker Maria Neumann, Köln Print-ISBN 978-3-95441-287-7 E-Book-ISBN 978-3-95441-301-0
Heinrich Wimmer, meinem treuen Verleger von 1992 bis 2014
Ich glaubte zum erstenmal in meinem Leben in dieser leichten Weise aus dem Fenster einen mich nahe betreffenden Vorgang unten auf der Gasse beobachtet zu haben. An und für sich ist mir solches Beobachten aus Sherlock Holmes bekannt.
Franz Kafka
Der landarme Idiot
Es ist möglich, dass einige Menschen mit Hans Wanka Mitleid empfunden hätten, hätten sie von seinem Schicksal erfahren. Das ist jedoch wenig wahrscheinlich. Hans arbeitete als Maschinist in einer der Spinnereien der hageren Baronin. Er hatte deren Missfallen erregt, als sie ihm entschieden zu nahe trat – und damit war sein Schicksal besiegelt. Nicht zu Unrecht argwöhnte die Baronin, dass Hansens offen zutage getretene Abscheu beim Anblick ihres halb entblößten Leibes, und das anschließende Versagen seiner Männlichkeit, als sie ihn wie eine Spinne ihre Beute zu packen versuchte, an ihrem Alter liege. Sie hatte bereits vor einigen Jahren ihren siebzigsten Geburtstag begangen, und das waren sicherlich fünfzig Jahre zu viel für den verzagten Jüngling.
Hans war noch ein Knabe gewesen, als seine Mutter starb. Sein Vater Hermann, der als Einbeiniger aus einem Krieg in einem fernen Land zurückgekehrt war, nahm daraufhin das Waisenmädchen Fanny in seine Dienste, das sich um das Wohlergehen des Sohnes zu kümmern hatte. Gleichermaßen kümmerte sich Fanny auch um das leibliche Wohlergehen des Vaters. Hans wusste das, denn er hatte das blonde, bei aller Schönheit aber einfältige Mädchen schon mehrfach heimlich beim Waschen durch die beschlagenen Scheiben ihrer Kammer beobachtet und gesehen, wie sie hernach in das Schlafgemach des Vaters geschlichen war. Obwohl sie sich dabei immer sorgfältig im Flur umzublicken pflegte, ob jemand anwesend sei, der sie hätte sehen können, hatte sie Hans nie bemerkt.
Eines Nachts belauschte er einen Streit zwischen dem Vater und Fanny. Ohne einzelne Worte zu verstehen, hörte er Fanny schluchzen und die barsche Stimme des Vaters. Kurz darauf kam Fanny in Hanses Kammer, sagte »Pscht« und legte sich zu ihm unter die Bettdecke. Mit heißen Fingern umfasste sie seinen klammen Körper. Hans wusste nicht, wie ihm geschah. So schnell, wie Fanny von ihm Besitz nahm, so schnell hatte sich das Mädchen seines Leibes bedient und war wieder verschwunden.
Einige Tage später war der Vater wieder sehr zornig. Er schrie Hans an, der nicht verstand, was geschehen war. Welche Schande meinte der Vater? Nach und nach wurde aber sogar ihm klar, dass Fanny ein Kind erwartete. Der Vater beschuldigte Hans, dieses Kind gezeugt zu haben. Obwohl Hans genau wusste, dass Fanny schon vor dem kurzen Besuch bei ihm im verwaisten Bett der Mutter neben dem Vater gelegen hatte, wagte er keinen Widerspruch zu erheben und verteidigte sich nicht. Selbst dann noch schwieg er mit fest zusammengekniffenen Lippen, als Fanny weinend mit dem Finger auf ihn wies. »Er war so wild, ich konnte mich nicht wehren!«, rief sie. Hans ahnte in seiner Arglosigkeit gar nicht, dass Fanny und der Vater sich abgesprochen hatten, um ihn ins Verderben zu führen.
Der Vater schimpfte von Unmoral und kündigte strengste Bestrafung an. Wiederum ein paar Tage später eröffnete er Hans, dass dieser in die Dienste der Baronin gegeben würde, die, seit Langem Witwe, wegen ihrer Härte von jedermann halb ehrfürchtig, halb hasserfüllt »die eiserne Baronin« genannt wurde. »Du bist deiner Herrin Gehorsam schuldig, so wie du mir Gehorsam schuldig bist!« Das war der Leitspruch, den der Vater seinem Sohn mit auf den Weg gab. Auf eine herzliche Umarmung verzichtete er zur Erleichterung des Sohnes.
Zwei Jahre mochten ins Land gezogen sein, als Hans einmal überraschend seine Heimatstadt besuchte. Vom Bahnhof aus ging er durch die Straßen, die zu seinem Elternhaus führten. Als er dort den Klingelzug betätigte und dem vertrauten Klang der Hausglocke lauschte, öffnete zu seiner großen Verwunderung niemand anderes als Fanny die Haustür, ihren Sohn, den kleinen Gebhart, auf dem Arm.
»Gu- guten Tag, Fanny«, stotterte Hans.
»Ich heiße jetzt Frau Hermann Wanka, junger Mann, und mein Gatte Hermann ist nicht zu Hause. Ich darf Sie nicht einlassen. Danke für Ihren Besuch und auf Wiedersehen!«
Dann schlug sie energisch die Tür vor Hans zu. Stumm, ohne Widerspruch kehrte Hans an seinen Arbeitsplatz zurück. Weitere zwei Jahre später erhielt er einen Brief Fannys, der ihn vom Tod seines einbeinigen Vaters unterrichtete. In einem Jahr, so die junge Witwe, wolle sie ihren Cousin heiraten, der Gebhart ein guter Vater zu sein versprochen habe.
Nun war Hans, der keinerlei Trauer über den Verlust des Vaters verspürte, allein auf der Welt, doch er hatte ein knappes Auskommen.
Was er freilich konnte und tat, tat er, ohne es erlernt zu haben. In den altertümlichen, hochempfindlichen Selfaktor-Spinnmaschinen, die nur von den geschicktesten Arbeitern fehlerfrei bedient werden konnten, fand er jenen mechanischen Takt und jene automatische Regelmäßigkeit vor, die er im wirklichen Leben so sehr vermisste. Auf Anhieb vermochte er den Grund zu erkennen, aus dem die Rädchen, Hebel, Getriebe und Spindeln einer Spinnmaschine den Dienst versagten. Mit geschickten Fingern behob er dann rasch den Schaden. Niemandem jedoch hätte er erklären können, was er da gerade gemacht hatte. Er war wie ein seiner selbst nicht bewusster Bestandteil der Maschine, ein Zahnrädchen ohne eigenen Willen.
Das kalte Auge der Baronin fiel eines Tages bei einer Inspektion auf den wohl gebauten, jungen Mechaniker, und sie schickte ihren Diener in die Spinnerei, ihn nach der Arbeit abzuholen. Hans wurde von einer kessen, blonden Zofe, die sich mit dem Namen Marie vorstellte, ihn aber auf fatale Weise an die verräterische Fanny erinnerte, in die gräfliche Wohnung und dort sogleich ins Badezimmer geführt, das bis hoch über seinen Kopf mit blau-weißen Kacheln ausgeschlagen war. Die Familie Wanka hatte über kein Badezimmer verfügt. Hier wurde samstags immer in der Küche gebadet. Zuerst der Vater, dann die Mutter und schließlich der Sohn. In einem hölzernen Badezuber, den der Vater schimpfend und fluchend aus dem Keller heraufzuschleppen pflegte.
»Na, was ist?«, fragte Marie. »Hast du noch nie eine Badewanne gesehen? Du musst ordentlich gewaschen sein, bevor du zur Baronin vorgelassen wirst. Nun zieh dich schon aus!«
»Ganz?«, fragte Hans, unsicher was zu tun sei. Vor einem Fräulein oder auch nur einer Bediensteten die Kleider abzulegen, das war ihm so unvorstellbar wie eine Reise an den Nordpol.
»Ja, alles! Nun mach schon! Ich habe nicht stundenlang Zeit. Die Baronin wartet schon.«
Langsam drehte er sich um und begann, seine Weste und die schmutzigen Arbeitshosen auszuziehen.
»Leg deine Kleider auf den Schemel«, befahl Marie. »Mein Gott, bist du genant! Da!«
Sie warf ihm ein weiches, weißes Handtuch über die Schulter, das er sich sofort vor den Unterleib presste.
»Na, was ist?«, fragte Marie. »Nun steig schon in die Wanne.«
Immer bemüht, der Zofe den Rücken zuzuwenden, tat Hans wie Marie ihm geheißen. Weil ihn, von seiner Mutter abgesehen, noch keine Frau je ohne Kleider gesehen hatte, setzte er sich rasch in die Wanne, sprang aber sofort wieder auf und hielt sich wieder das Handtuch vor den Leib. »Au« zu rufen, wagte er nicht.
»Ist es zu heiß?«, fragte Marie mit einem spöttischen Grinsen. Hans nickte, ohne ihr ins Gesicht zu sehen.
»Aus dem Hahn mit dem blauen Punkt kann man kaltes Wasser zufließen lassen, aus dem Hahn mit dem roten Punkt heißes. Versuch es selbst.«
Weil Hans, ratlos, keine Anstalten machte, die Wassertemperatur selbst einzustellen, drehte Marie an dem Porzellanstern mit dem blauen Punkt in der Mitte. »Wird es besser?«, fragte sie.
Hans nickte, einen scheuen Blick in ihre Richtung werfend. Aus einer Kristallkaraffe mit silbernem Stopfen goss Marie nun eine blumig duftende, blaue Flüssigkeit in die Wanne. Ohne Scheu vor dem noch immer starr im Wasser stehenden Hans begann sie, mit der Hand im Wasser zu rühren. Sofort bildete sich ein dicker, weißer Schaum auf der Wasseroberfläche. Marie drehte den Hahn wieder zu.
»Jetzt kannst du dich setzen, du genanter, junger Mann!«
Das Handtuch noch immer an sich gepresst, ließ sich Hans zurück ins Wasser fallen.
»Na, na, du kleiner Spritzer!«, lachte Marie, deren schwarzes Kleid bei Hansens hastigem Hinsetzen einige Tropfen abbekommen hatte. »Seife liegt in der Muschel.« Als sich Hans suchend umsah, deutete sie mit dem Finger auf eine muschelförmige Porzellanschale, die an den blau-weißen Kacheln der Wand befestigt war. »Vergiss die Haare nicht. Wenn du fertig bist, zieh die Pantoffeln und den Morgenmantel an. Sonst nichts. Hier hängt er. An der Tür, du Dummerjan! Ich bin in einer Viertelstunde wieder da und bringe dich dann zur Baronin.«
Als Marie wiederkam, hatte sich Hans schon abgetrocknet und den Morgenmantel angelegt. Seine nackten Beine waren ihm ebenso peinlich wie die Tatsache, dass er keinen Kamm gefunden hatte.
»Na, prachtvoll!«, begrüßte ihn Marie, nachdem sie ihn kritisch in Augenschein genommen hatte. »Komm mit!«
Marie führte ihn in einen kalten Flur, den Gemälde von Soldaten mit vielen Orden an der Brust und tief dekolletierte Damen mit Perücken auf dem Kopf zierten.
Vor einer schweren Tür blieb Marie stehen, um anzuklopfen.
»Entrez!«, ertönte es von drinnen.
Marie öffnete die Tür, knickste und schob Hans hinein. Er fand sich in einem Schlafzimmer wieder, das die Baronin später mehrmals »Boudoir« nennen sollte. Sie lag auf einer Récamiere und trug rote Pantöffelchen mit goldenen Bordüren an den nackten Füßen. Ihr Morgenmantel war nachlässig geschlossen. Hans konnte die Beine der Baronin und ihr faltenreiches Dekolleté sehen.
»Ich brauche dich nicht mehr, Marie!«, sagte die Baronin herablassend.
Marie knickste und schloss die Tür von draußen.
Die Baronin erhob sich, um Hans einer sehr strengen Inaugenscheinnahme zu unterziehen. Was sie sah, schien ihr zu gefallen, denn auf ihre Züge trat etwas, das man als Lächeln hätte bezeichnen können, hätten ihre Augen nicht an die Augen einer Schlange erinnert, die ein Kaninchen fixiert, bevor sie es verschlingt.
Auf einem Tischchen neben der Récamiere stand ein golden glänzendes Tablett mit zwei kristallenen Gläsern und einer ebensolchen Karaffe darauf. Die Baronin schenkte beide Gläser voll und drückte eines davon Hans in die Hand. Das andere nahm sie selbst.
»Santé, mon chéri!«, sagte sie. Dabei stieß sie mit ihrem Glas gegen seines.
Fast hätte Hans es vor Schreck fallen lassen. Die Baronin trank den Wein in einem Zug aus. »Trink, mon petit!«, forderte sie auf.
Hans verstand kein Französisch.
Er hatte nur weilchenweise einmal einen Krug Bier getrunken, aber noch niemals roten Wein. Weil der ihm gut schmeckte, tat er es der Baronin nach und trank das Glas ohne Innehalten aus. Sofort stieg eine angenehme Wärme in ihm auf. Seine Ängste flohen, und er fühlte sich nicht mehr ganz so wie ein Schaf, das der Schlachtbank des Metzgers entgegengetrieben wird. Das ungewohnte Getränk schien ihn willfährig und fügsam zu machen.
Staunend beobachtete er die Baronin, wie sie ihren Morgenmantel ablegte, unter dem sie nichts als ein Fischbein-Korsett, Strümpfe und Strumpfhalter trug. Er wehrte sich auch nicht, als sie den Gürtel seines Bademantels aufzog und ihm sein einziges Kleidungsstück von den Schultern streifte. Der in Fischbein eingeschnürte Körper der Baronin vermochte jedoch sein Verlangen nicht zu wecken, denn mehr noch als alles andere auf der Welt verabscheute Hans die Berührung durch fremde Menschen. Die Baronin, deren trockene, kalte Hände über seine Brust und Schultern strichen, versuchte auf jede nur erdenkliche Weise, seine Lust zu wecken. Als ihr Bemühen nichts fruchtete, schickte sie ihn fort.
»Quel dommage! Du bist ein durch und durch unfähiger, junger Mann«, schimpfte sie.
Hans verstand nicht, was sie damit meinte.
Noch auf dem Nachhauseweg beschloss er, Einladungen der Baronin nie wieder Folge zu leisten. Wenn der Diener ihn abzuholen käme, sagte er entschlossen zu sich selbst, wollte er sich weigern mitzugehen.
Allein, es kam kein Diener mehr.
Die eiserne Baronin war keine Frau, die sich Insubordination und Kränkungen auch nur ein einziges Mal hätte gefallen lassen.
»Wir brauchen dich hier nicht mehr«, beschied ihm zwei Tage später vor Beginn der Arbeit der Vorarbeiter. Hans durfte nicht einmal mehr an die geliebten Selfaktor-Maschinen treten, die er bis dahin einzurichten und zu pflegen hatte. »Geh nach Hause und komm nie wieder hierher!«
Als er in seinem möblierten Mansardenzimmer ankam, wartete schon der Hauswirt auf ihn. Der Diener der Baronin hatte ihn längst aufgesucht und ihm aufgetragen, was er zu tun hatte.
»Pack deine Sachen und geh! Die Miete für den Rest des Monats behalte ich. Ich muss ja die Schweinerei beseitigen, die du mir hinterlassen hast!«
Hans fand bei einer mitleidigen Witwe für ein paar Tage ein kostenloses Unterkommen in einer Rumpelkammer unter einer Stiege. In allen Fabriken, die er zu Fuß erreichen konnte, fragte er nach Arbeit. Er vergaß auch nicht sein technisches Geschick zu erwähnen, doch da alle Fabriken im Umkreis der Baronin gehörten, schickte man ihn überall gleich wieder fort oder ließ ihn gar nicht erst vor einen wichtigen Herren treten.
Die Baronin ließ sich voller Rachedurst von ihren Untergebenen über die vergebliche Arbeitssuche des Jungen berichten. Als ihr das langweilig wurde, benachrichtigte sie den Sanitäts-Inspektor Schloemann. Dieser bescheinigte, ohne Hans auch nur von Ferne je gesehen zu haben, was die rachsüchtige Baronin bescheinigt zu haben wünschte. Der Sanitäts-Inspektor hatte durch Nachforschungen von Fanny und dem kleinen Gebhart erfahren und beurkundete etwas, was er »sexuelle Depravation« und »chronische Unmoralität« nannte.
Nun stand Hans, der keinerlei Vorstellung vom Sinn dieser Worte und ihrer Konsequenz für sein zukünftiges Leben hatte, mit Inspektor Schloemanns Bescheinigung in der Hand am Schalter des Bahnhofes von Höxter. Ausweis zur Erlangung einer Eisenbahn-Fahrpreisermäßigung war auf das Papier gedruckt. Auf die punktierte Linie darunter hatte der Secretarius des Inspektors in seiner klaren Schrift die Worte für den landarmen Idioten H. Wanka gesetzt. Der Ausweis berechtige, so stand da weiter zu lesen, zu einer einmaligen Fahrt dritter Klasse nach Ö. Als Zweck der Reise wurde die Unterbringung in der Idiotenanstalt zu V. angeben. Diese Idiotenanstalt war der 1887 gegründete Wittekindshof, wo wohlmeinende Menschen mit Blöden und Schwachsinnigen arbeiteten.
Warum wehrte Hans sich nicht? Warum floh er nicht? Warum zerriss er nicht die Bescheinigung des Inspektors und wanderte zu Fuß irgendwohin, wo ihn niemand kannte? Hätte man ihn befragt, er hätte keine Antwort darauf gewusst. Demütig fuhr er dritter Klasse seinem Unglück entgegen …
* * *
Hans Wanka lebte drei lange Jahre in der Anstalt Wittekindshof. Drei Jahre lang bekam er täglich Sturzgüsse mit eiskaltem Wasser und wurde auf Cox’ Schaukel gezwungen, ein besonderes Folterinstrument. Es handelte sich um einen geneigt aufgehängten Stuhl, auf dem der Patient festgeschnallt wurde. Dann wurde der Stuhl in eine schnelle Drehung versetzt, bis Nase und Ohren zu bluten begannen, dem Patienten übel wurde und er in Ohnmacht fiel. Der Anstaltsleiter Professor Hüttler war ein überzeugter Anhänger dieses Verfahrens, obwohl es keineswegs wissenschaftlich erwiesen war, dass es irgendeinen Nutzen brächte. Er verteidigte sein Methode mit scharfer Zunge und spitzer Feder gegen alle, die es wagten, Zweifel zu äußern. Er war ein ausgesprochener Tyrann, herablassend gegenüber jedermann und jederzeit bereit, drakonische Strafen für mangelnden Respekt seiner hohen Person gegenüber zu verhängen.
Hans Wanka beobachtete das alles, ohne viele Worte zu verlieren. Er litt schweigend, ohne Hoffnung, schickte aber jeden Abend seine verzweifelten Gebete gen Himmel.
»Lieber Gott«, betete Hans, »hol mich zu Dir!«
Es kommt nicht oft vor, aber manchmal werden Gebete erhört. Nein, Hans Wanka starb nicht. Stattdessen beging Professor Hüttler einen Fehler. Den schwersten Fehler, den ein Arzt begehen kann. Er setzte nämlich eine junge Patientin auf Coxens Schaukel, befahl den Stuhl so lange zu drehen, bis die Patientin völlig die Orientierung verloren hatte, und befriedigte hernach seine Lust an ihr. Zu seinem Pech beobachtete das sein Stellvertreter Oberarzt Huldrich, der zusammen mit der Schwester Oberin Carmilla in einem Nebenraum Akten bearbeitet hatte. Da auch Oberarzt Huldrich Grund hatte, Professor Hüttler nicht nur zu fürchten, sondern auch zu hassen, war nun das Schicksal des Anstaltsleiters besiegelt. Huldrich holte aus seinem Schreibtisch den Revolver, den er dort für alle Fälle deponiert hatte, und stellte, von der empörter Schwester Oberin begleitet, Professor Hüttler noch am Orte des Geschehens in actu. Huldrich ließ ihm Zeit, seine Kleidung zu ordnen, und diktierte ihm die Kündigung. Als Grund befahl er, gesundheitliche Gründe zu nennen, denn Ausdruck einer Krankheit war es ohne Zweifel, was Hüttler der Patientin angetan hatte. Zwar wollte der Professor die Unterschrift verweigern, doch als Huldrich drohend den Hahn spannte, erkannte er, dass ihm zum Verhandeln kein Raum mehr blieb, und setzte seinen Namen mitsamt allen akademischen Titeln unter das Schriftstück.
Wer nun denkt, Doktor Huldrich wäre für sein mutiges Eintreten für die geschundene und missbrauchte Patientin belohnt worden, der irrt. Ein Arzt, der dafür sorgt, dass sein Vorgesetzter unter Zwang ein Abschiedsgesuch unterschreibt – so berechtigt dieses auch sein mochte – wird von seinen Standesgenossen gnadenlos bestraft. Es war Dr. Huldrichs Bleiben nicht mehr in der Anstalt. Er wurde gezwungen, ebenfalls seinen Abschied zu nehmen und musste eine abgelegene Landarztpraxis mit Patienten übernehmen, die jegliche Arztbesuche mieden.
Und dennoch hatte Hans Wanka Glück, denn Dr. Huldrich nahm seinen Groll in seine neue Landarztpraxis mit. Ihm war bereits während seiner Arbeit im Wittekindshof aufgefallen, wie viele Patienten eingewiesen wurden, denen allen der Sanitäts-Inspektor Schloemann Geisteskrankheiten, Monomanie oder Schwachsinn bescheinigt hatte, die er, Dr. Huldrich, an ihnen nicht feststellen konnte – ganz im Gegensatz zum Professor, für den der pathologische Befund immer zweifellos war. Huldrich, der sein Schicksal hatte kommen sehen, hatte die verdächtigen Akten der Patienten abgeschrieben, diese Abschriften aufbewahrt und bei seinem schmählichen Abgang mitgenommen.
Dann fuhr er nach M., der Stadt der Wiedertäufer. Er wollte einen Spezialisten aufsuchen. In M. gab es Dr. Heyms. Er war ein solcher Spezialist. Er war kein Arzt, sondern Musikwissenschaftler. Dr. Huldrich meldete sich telegraphisch bei ihm an.
»Sie sind Mediziner«, sagte Dr. Heyms, kaum dass Huldrich in sein Studierzimmer eingetreten war. »Und Sie haben Ihre Stellung verloren. Aber Sie wollen die Stellung nicht wieder zurückerlangen. Sie sind wegen etwas anderem hier.«
»Das stimmt genau«, antwortete Dr. Huldrich. »Woher wissen Sie das?«
»Dass Sie Mediziner sind, erkenne ich an zwei Dingen. Erstens an dem Aeskulapstab, der in den Deckel Ihrer Uhr eingraviert ist. Sie steckten sie gerade wieder ein, als Sie diesen Raum betraten. Sie hatten sich wohl noch einmal der Uhrzeit vergewissert, die wir vereinbart hatten.
»Und das zweite?«, wollte Huldrich wissen.
»Ihr Arztkoffer wurde lange nicht benutzt, das Leder ist rissig, das Messing der Beschläge ist angelaufen. Sie haben ihn lange nicht benutzt, ihn aber nun wieder hervorgeholt und das Leder großzügig frisch eingefettet. Das Fett hat Ihren Mantel verschmutzt. Was darauf schließen lässt, dass Sie eine Weile, sagen wir in einem Hospital arbeiteten, diese Stelle aber aus irgendeinem Grund verloren und nun wieder als praktischer Arzt praktizieren.«
»Aber wieso will ich nicht wieder auf meine verlorene Stelle zurück?«
»Sie sind zufrieden mit Ihrem neuen Leben. Sonst hätten Sie wohl kaum ein Liedlein gepfiffen, während Sie die Treppen zu mir hinaufstiegen. Außerdem tragen Sie einen Verlobungsring. Das spricht nicht gerade von Unzufriedenheit mit Ihrer gegenwärtigen Situation.«
»Sie haben in allem recht, Doktor Heyms.«
»Und was kann ich für Sie tun?«
Huldrich schilderte ihm den Eifer, mit dem der Sanitäts-Inspektor Schloemann Menschen in die Anstalt einwies, die selbst bei wenig wohlwollender Einschätzung keineswegs geistig oder seelisch krank waren.
»Ich selbst kann Ihnen nicht helfen«, erklärte Heyms. »Aber ich kann Ihnen jemanden empfehlen, der Ihnen sicher wird helfen können. In diesem Fall kommt ein Detektiv nicht weiter, selbst wenn er einen Doktortitel führen darf. Zwar ist es Ausdruck von verbrecherischer Energie, was da den Patienten angetan wurde, aber wie wollen Sie den Sanitäts-Inspektor Schloemann zur Verantwortung ziehen? Man müsste herausfinden, ob er Geld für seine falschen Attestate bekommen hat. Oder ob er in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Personen steht, die ein Interesse an einer falschen Diagnose haben. Das sind alles nicht mehr als bloße Verdächtigungen, für die handfeste Beweise zu erbringen nicht einfach ist. Für einen Gerichtsprozess dürfte das wohl kaum ausreichen. Jeder Jurist wird Ihnen meine Ansicht sicherlich bestätigen. Ich empfehle Ihnen daher einen anderen Spezialisten. Mein Rat wird Sie auch nichts kosten. Hier!«
Dr. Huldrich hörte auf den Rat und begab sich zu dem Manne, den Dr. Heyms genannt hatte. Es war Dr. Hundgeburth, Redakteur bei der M.schen Zeitung. Dr. Hundgeburth hörte sich alles an, ließ sich das von Dr. Huldrich gesammelte Material geben, prüfte alles auf das Sorgfältigste und gelangte zu dem Schluss, dass dem Treiben des Sanitäts-Inspektors Schloemann ein Ende gesetzt werden müsse.
Kurz darauf machte ein umfangreicher Artikel in der M.schen Zeitung die fragwürdigen Diagnosen des Sanitäts-Inspektors Schloemann öffentlich. Zahlreiche Leser meldeten sich daraufhin bei dem Redakteur Dr. Hundgeburth, um zu berichten, dass auch ihre Angehörigen aufgrund der Expertisen Schloemanns in irgendwelchen Irren- und Idiotenanstalten verschwunden seien. »Ja«, meinte eine Leserin, »genauso erging es meiner Schwester Klara, die nach der Geburt ihres vierten Kindes gemütskrank wurde. Auch sie wurde auf einer Coxschen Schaukel gequält und fand nie wieder zu sich!« Ein anderer berichtete von einem Vater, der mit zunehmendem Alter merkwürdig geworden und ebenfalls dem Sanitäts-Inspektor Schloemann in die Hände gefallen war.
Weitere Artikel folgten, auch in anderen Zeitungen, sodass schließlich eine ärztliche Kommission aus der Landeshauptstadt zu einer Untersuchung ausgeschickt wurde. Zwei Herren erschienen unangemeldet im Wittekindshof, prüften die Krankenunterlagen und nahmen die inkriminierten Patienten persönlich in Augenschein. Auch Hans Wanka wurde aus seiner Zelle geholt, musste sich entkleiden und wurde nackt, wie Gott ihn geschaffen hatte, vor zwei weißbärtige Herren geführt, die ihn untersuchten und einem jungen Secretarius ihre Erkenntnisse diktierten. Hans Wankas Herz wurde abgehört, seine Lungen abgeklopft und in seine Augen und Ohren geleuchtet. Dann durfte er sich auf einen Holzschemel vor dem Tisch setzen, der den beiden Herren als Schreibtisch diente, und seine Geschichte erzählen. In den drei Jahren im Wittekindshof hatte er sie sich selbst an langen Tagen und in schlaflosen Nächten, unhörbar murmelnd, wieder und wieder selber erzählt, sich die Worte zurechtgelegt und sie passend geschliffen. Nun musste er gar nicht mehr über sie nachdenken. Wie Wasser flossen sie aus seinem grindigen Mund, und er schämte sich ihrer nicht. Und so berichtete er den weißbärtigen, mit ungerührten Mienen lauschenden Herren von dem verräterischen Vater, der nicht minder verräterischen Fanny, von der strengen Baronin, die ihn vergeblich zu verführen versucht hatte, und von ihrer Rache und wie er, sich demütig ins vermeintlich Unvermeidliche schickend, mit dem »Ausweis zur Erlangung einer Eisenbahn-Fahrpreisermäßigung« dritter Klasse ohne Rückfahrmöglichkeit nach Ö. gereist war, womit sein Unglück begonnen hatte.
Die beiden weißbärtigen Herren blickten einander kurz an.
»Ist zu entlassen«, diktierte dann der Ältere der beiden, der offenbar auch der Ranghöhere war, dem Schreiber.
Am nächsten Morgen wurde Hans Wanka in seinen abgerissenen Kleidern, die ihm viel zu groß geworden waren, durch das große Tor geführt in eine Welt, die er nicht verstand. Was hatte er gewonnen? Wohin sollte er gehen? Er hatte sich keine Worte zurechtlegen können für all das Neue, das ihm zu begegnen drohte und in dem er sich nicht zurechtfinden würde. Die kalte Hand der Angst legte sich um sein Herz. Er wandte sich um, um in die Anstalt zurückzukehren, wo er Zuflucht finden würde vor der Welt. Da aber war das große Tor bereits zugeschlagen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























