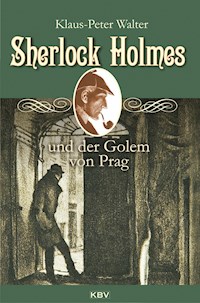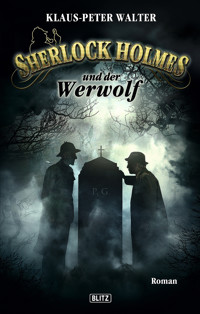
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sherlock Holmes - Neue Fälle (Historische Kriminalromane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wir schreiben das Jahr 1897.Dr. Watson liest mit Begeisterung den gerade erschienenen Roman Dracula von Bram Stoker.Als wenig später in London eine blutleere Leiche gefunden wird, glaubt Watson an Vampire. Und dann begegnet ihm im Londoner Nebel ein Werwolf.Gemeinsam mit Sherlock Holmes, dem messerscharf deduzierenden Meisterdetektiv aus der Baker Street, begibt sich Watson auf eine phantastische Irrfahrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE NEUEN FÄLLE DES MEISTERDETEKTIVS
SHERLOCK HOLMES
In dieser Reihe bereits erschienen:
3001 – Sherlock Holmes und die Zeitmaschine von Ralph E. Vaughan
3002 – Sherlock Holmes und die Moriarty-Lüge von J. J. Preyer
3003 – Sherlock Holmes und die geheimnisvolle Wand von Ronald M. Hahn
3004 – Sherlock Holmes und der Werwolf
Klaus-Peter Walter
SHERLOCK HOLMES
und der Werwolf
– EINE FÄLSCHUNG –
Basierend auf den Charakteren von
© 2014 by BLITZ-Verlag
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Lektorat: Dr. Richard Werner
Titelbildgestaltung: Mark Freier
Satz: Winfried Brand
All rights reserved
www.BLITZ-Verlag.de
Print ISBN: 978-3-89840-338-2 E-Book ISBN: 978-3-95719-203-5
Vorrede des Herausgebers
Schon seit 1993 gebe ich nun das im Corian-Verlag in Meitingen erscheinende Loseblatt-Lexikon der Kriminalliteratur LKL heraus. Inzwischen sind zwölf Ordner leidlich gefüllt, ich habe Reclams Kriminalromanführer herausgegeben, mich als Juror bei Krimiwettbewerben betätigt und bin selbst einmal für eine Krimikurzgeschichte mit einem Blutigen Messer ausgezeichnet worden; ich habe Krimis in DIE WELT besprochen, bin Mitglied bei der Sherlock-Holmes-Gesellschaft von Herder Airguns Ltd. und werde gelegentlich vom Fernsehen zu Fragen der Kriminalliteratur interviewt. Verlage bedenken mich so bedenkenlos mit Rezensionsexemplaren, dass das Haus, in welchem ich mit meiner lieben Frau und unserem Sohn wohne, sicherlich bald den Hang hinunterrutschen wird.
Vor einiger Zeit reichte mein treuer Verleger Heinrich Wimmer einen an mich zu Händen des Corian-Verlages adressierten 4-Gigabyte-USB-Stick der Firma Verbatim an mich weiter. Ein romaneskes Werk mit dem Titel Sherlock Holmes und der Werwolf war darauf abgespeichert. Ich legte ihn beiseite. Tage später entsann ich mich seiner und begann ernsthaft zu lesen, obwohl ich das nicht gerne am Laptop tue. Ich scheute jedoch die Kosten eines Ausdrucks. Ein gesondert gespeichertes Begleitschreiben wies es als Übersetzung der Abschrift eines angeblichen Originalmanuskripts von John H. Watson, M.D., aus, gefunden natürlich in einer alten Kiste auf einem verlassenen Speicher in London, und natürlich mit dem Zusatz versehen, es dürfe erst nach dem Tode des Verfassers veröffentlicht werden. Unterzeichnet war dieses Begleitschreiben von einem gewissen Ulysses B. Rudd.
Um es kurz zu machen: Ich zweifle daran, dass es noch unveröffentlichte Manuskripte des guten Doktors geben kann. Ich zweifle sogar daran, dass er alles selbst geschrieben hat, was ihm zugeschrieben wird. Allein die physische Leistung ist kaum vorstellbar, ganz abgesehen davon, dass Sherlock Holmes in seiner Zeit als aktiver beratender Detektiv zwanzig bis dreißig spektakuläre Fälle pro Jahr hätte lösen müssen. Man müsste einmal zusammenzählen, was allein im legendären Jahr 1895 alles anlag! Selbst James Bond kommt höchstens nur jedes zweite Jahr auf die Leinwand; meist befindet er sich dazwischen in der Obhut von Qs Medizinalabteilung, die ihn nach erfolgter Weltenrettung wieder zusammenflickt. Wahrscheinlich war Dr. Watson – ähnlich wie einer beliebten Theorie zufolge William Shakespeare – vier fleißige ledige Schwestern, die sich die Arbeit aufteilten.{1}
Sherlock Holmes und der Werwolf ist jedenfalls dem Gestaltungsprinzip des sampling mehr verpflichtet als dem des originären Schreibens, denn der Text enthält zahlreiche zum Teil wörtliche, zum Teil leicht veränderte, weil möglicherweise aus dem Gedächtnis wiedergegebene, literarische Zitate, die der vermutlich 1929 verstorbene Dr. Watson schlechterdings nicht gekannt haben kann, etwa aus Erzählungen des sowjetischen Erzählers Daniil Granin, aus Hans Leberts Wolfshaut, aus Graham Greens Der dritte Mann, aus einer modernen Übersetzung von Mary W. Shelleys Frankenstein, aus Yoshida Kenkos Betrachtungen aus der Stille, aus Samenspende von Peter Hänni oder sogar aus meinen eigenen Sherlock-Holmes-Geschichten. Lateinisch wird eine solche Literatur, die Passagen aus Texten anderer Autoren kompiliert, Cento genannt, was eigentlich ein aus Flicken zusammengenähtes Kleidungsstück bezeichnet.
Zahlreiche Werke dienten also gleichsam als Steinbruch für diesen Roman, was angesichts des Themas und der überraschenden Auflösung vielleicht gar keine so schlechte Idee war – Form und Inhalt weisen so eine gewisse Kongruenz auf.
Nachdem ich seinen Inhalt auf meinem Laptop gespeichert hatte, schickte ich den USB-Stick zu meiner Entlastung an das Literaturarchiv in Marbach. Auf dem Postweg ging er leider verloren. Von Ulysses B. Rudd habe ich nie etwas gehört. Mein Konfrater in Baker Street und geschätzter Gesinnungsgenosse Christian Endres, Verfasser von Sherlock Holmes und das Uhrwerk des Todes, verneinte die Frage, ob er mit dem Verfasser identisch sei, kategorisch; in ähnlichem Sinne äußerten sich andere Holmesianer.
Den Romantext habe ich in Fußnoten erläutert und kommentiert. Einige Verleger, denen ich das Manuskript anbot, argwöhnten mit Hinweis auf meinen Roman Sherlock Holmes im Reich des Cthulhu, ich selbst sei der Verfasser. Ich weise diese Unterstellung auf das Energischste zurück. Der Verfasser ist zweifellos ein äußerst belesener Mensch, ein wahrer Born an Zitaten, aber für die Kompilation eines solchen Werkes bin ich doch ein klein wenig zu faul. Trotzdem allen Lesern viel Spaß mit dieser Räuberpistole!
Klaus-Peter Walter,
im August 2012
Vorrede von Dr. Watson
Manchmal fahre ich meinen Rollstuhl ans Fenster. Mit der gesunden Hand ziehe ich mich am Griff etwas hoch, stütze mich ein wenig auf die andere, die kranke Hand, und schaue hinunter in den Garten, wo Holmes mit seinen Bienen beschäftigt ist oder die Rosen schneidet. Ja, da unten im Garten steht mein Holmes. Er hat den Kittel an, den er immer trägt, wenn er zu seinen Bienen geht, hat den Hut mit dem Netz auf dem Kopf und raucht seine Gartenpfeife, die aus einem Maiskolben geschnitzt ist. Eben hält er inne und blickt versonnen durch die Büsche in die untergehende glutrote Sonne. Bald wird er zum Abendbrot hereinkommen. Ich höre May{2}, unser schottisches Mädchen, schon den Tisch decken.
Es schmerzt mich, wenn ich Holmes so sehe. Vor fünf Jahren, da war ich noch gesund, haben wir seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert, und noch immer ist sein Rücken gerade wie der eines königlichen Gardeoffiziers; zwar ist sein Haar im Laufe der letzten Jahre schneeweiß geworden, aber sein Verstand ist beweglich und frisch geblieben wie vor dreißig Jahren. Ich dagegen verfalle täglich mehr seit diesen Ereignissen in den Sussex Grounds, als der Uranmotor von Professor Moriartys Laufmaschine explodierte und dieses Ungeheuer zerriss, das ein wahnsinniger Araber beschworen hatte. Die Kollegen sagen, meine Erkrankung rühre von der damals freigesetzten Radioaktivität her. Ted Malone wurde ebenfalls krank und starb qualvoll unter unsäglichen Schmerzen. Holmes, der Glückspilz, erschien damals erst später auf der Bildfläche und blieb gesund. Seltsam sind des Glückes Launen …{3}
Vor zwei Jahren hat er Babylonisch gelernt, nur weil er das Gilgamesch-Epos im Original lesen wollte. Seit er aus Tibet zurück ist, sind seine Interessen noch breiter gestreut als früher. Er liest enorm viel. Es vergeht wohl kaum eine Woche, in der nicht der Postbote neue Bücher für ihn bringt. Es sind Werke über die merkwürdigsten Themen, ich verstehe kaum mehr die Titel. Im Moment interessiert ihn Russland besonders, wo ein Armenier oder Georgier die Nachfolge dieses kleinen, glatzköpfigen Spitzbartes angetreten hat, dieses Wladimir Lidin oder wie er hieß, den wir einmal kennengelernt haben. Holmes legt diese Bücher dann auf den Beistelltisch neben dem Sessel am Kamin, wo er sich am Abend darüber hermacht. Was ihm wichtig erscheint, liest er mir laut, mit erhobener Stimme vor (vielleicht wird da doch ein wenig sein Alter spürbar, denn er merkt nicht mehr, dass ich nicht mehr huste, weil ich meistens längst eingeschlafen bin; sein Gemurmel macht mich müde, ich höre wohl auch nicht mehr so gut, seit ich krank bin).
Um zehn Uhr kommt dann das Mädchen, um mich für die Nacht fertig zu machen.
„Gute Nacht, Watson!“, ruft mir Holmes stets hinterher, wenn May mich hinausrollt, aber ich winke meistens ab. Die Nächte sind nicht gut, denn mit der Nacht kommen die Schmerzen, und die rauben mir den Schlaf. Meinem verfallenden Körper hilft auch nicht mehr dieser selbst gebraute Bienenfraß, den Holmes mir immer einflößen will. Er selber löffelt ihn eimerweise, und er bekommt ihm bestens.
Holmes braucht fast keinen Schlaf mehr. Gegen zwölf nämlich kommt May noch einmal ins Wohnzimmer, um ihm eine letzte Kanne Tee zu bringen, dann geht sie selber zu Bett.
Vor drei Uhr geht Mister Holmes nie schlafen, hat sie mir einmal verraten. Sie weiß das, weil sie selbst um drei Uhr auch nicht schläft, sondern mit dem Chauffeur unseres Nachbarn ganz andere Dinge tut, die ich früher, also bevor ich krank wurde, selber ganz gern getan habe. Früher …
Natürlich weiß auch ich, wann Holmes zu Bett geht, denn in einem nächtlich stillen Haus hört sogar ein alter, halb tauber Tattergreis wie ich, wenn sich der Chauffeur auf Strümpfen, die Stiefel in der Hand, durchs Treppenhaus hinaufschleicht, wo May auf dem Flur stehend lauscht, ob jemand etwas gehört hat, dann sachte die Tür hinter sich zuzieht, und wie gleich darauf die Federn des alten Dienstbotenbettes zu ächzen beginnen. Ich frage mich, warum Holmes das Treiben nicht bemerken und ihm ein Ende setzen will, aber ich kann ja nichts sagen; May würde es sicherlich nicht übersetzen, und dann würde sie mir abends beim Waschen vor dem Schlafengehen auch nicht … aber das tut nichts zur Sache. Unsere gute Mrs Hudson, Gott schenke ihr himmlischen Frieden, war da ganz anders.
Vor ein paar Jahren konnte ich noch viel lesen. Allein bei seiner Lampe sitzen, Bücher vor sich aufgeschlagen und so Menschen zu Freunden haben, die nicht mehr auf dieser Welt weilen – es konnte nichts Schöneres geben!{4}
Die vielen gehaltvollen Bände des William Shakespeare, die Werke von Charles Dickens wie der Martin Chuzzlewitt oder die Pickwick Papers, und, je älter ich wurde, auch die Heilige Schrift – wie viel fand ich doch in diesen alten Büchern, was zu meinem Herzen sprach! Diese neumodischen Schreiber, die sich Dichter zu nennen erfrechen wie der Ire James Joyce mit seinem Ulysses, diesem Roman voller Unflat und Langeweile – die verstehe ich nicht und will sie auch gar nicht mehr verstehen. Ich bin viel zu müde.
Aber zurück zu Holmes! Ich höre es, wenn er dann endlich das Buch zuschlägt, das er eben ausgelesen hat, es auf den Tisch fallen lässt (absichtlich polternd, um mich zu ärgern). Ich höre, wie er die Treppe hinaufgeht – wiederum polternd, damit ich nicht einschlafen kann (klar, der Chauffeur muss jetzt einen Moment innehalten, gut kann er das, schon seit sechs Monaten geht das so) –, wie Holmes sich ins Bett fallen lässt, wo er zu meinem Ärger sofort einschläft, um vier Stunden später frohgelaunt zu erwachen und mich beim Frühstück mit seinem blöden Spruch Na, Watson, geht es uns besser? zu ärgern. Es geht mitnichten besser, es geht jeden Tag schlechter. Meine Tage sind gezählt. Ich versuche zu lächeln und antworte etwas Unanständiges.
May, die die Einzige ist, die meine Worte noch versteht, übersetzt ihm dann etwas, was ich gar nicht gesagt habe. Danke, Mister Holmes, pflegt sie zu sagen, Dr. Watson fühlt sich heute Morgen schon viel besser.
Holmes lächelt nur boshaft vor sich hin, vielleicht versteht er mich doch, ich weiß es nicht. Jeden Morgen treibt er dieses würdelose Spielchen, mir graut schon beim Aufstehen davor. Wenn sie Holmes Tee eingeschenkt hat, gießt May mir Fruchtsaft in meine Schnabeltasse und streicht Butter auf mein Toastbrot, weil ich vor lauter Zittern das Messer nicht mehr richtig halten kann.
Nach dem Frühstück holt Holmes das am Vorabend ausgelesene Buch, geht an seine Ordner und macht Notizen, und dann stopft er das Buch irgendwo zwischen meine Bücher in meinen Bücherschränken und vergrößert die Unordnung, die ich zeitlebens an ihm gehasst habe. Und natürlich raucht er dabei Pfeife (damit ich huste und mich ärgere), summt Lieder (was ich nicht ausstehen kann) und erzählt mir zwischendurch ausführlich, was er gerade denkt (es interessiert mich schon lange nicht mehr!). Danach beantwortet er Post.
Holmes bekommt nach wie vor viel Post, viel mehr als ich (ich bekomme überhaupt keine mehr). Hin und wieder sind, wie früher, hochherrschaftliche Wappen auf den Umschlägen (deren oftmals erlauchte Absender wie immer mein Geheimnis bleiben müssen). Wenn Holmes im Garten und May auf dem Markt ist, fahre ich manchmal an den Papierkorb, um mir die Umschläge anzusehen oder um die Briefmarken für meine Sammlung abzuschneiden. Die Menschen schreiben aus aller Welt, um meinen Freund um Rat zu fragen oder um Hilfe zu bitten. In den allermeisten Fällen antwortet er mit einer gedruckten Karte, auf der steht, er habe sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und arbeite nicht mehr als beratender Detektiv. Ganz, ganz selten nimmt er auch einmal einen Fall an, meist in London, wo sein Bruder Mycroft noch immer, trotz seines hohen Alters, manchmal die Regierung selbst ist. Dann fährt Holmes fort und bleibt zwei, drei Tage, manchmal auch länger.
Sie brauchen nicht zu weinen, Doktor Watson, tröstet mich May dann immer, Mister Holmes kommt ja bald wieder. Klingeln Sie einfach, wenn Sie etwas brauchen. Ich bin in der Küche und koche das Mittagessen.
Ich ärgere mich dann wieder, weil ich ja gar nicht weine, mir tränen nur immer die Augen, und ich sage oft zu spät, dass ich zu John’s auf meinen Leibstuhl möchte. May muss mich dann saubermachen und umziehen. Ständig habe ich Angst, dass May es Holmes bei seiner Rückkehr erzählt und dass er wieder so boshaft lächelt, wie er immer lächelt, wenn ich zu spät sage, dass ich zu John’s muss, oder wenn ich mir Ei auf den Ärmel kleckere.
Und dann muss ich mich wieder ärgern. Ich sehne mich täglich mehr nach Mary, meiner armen kleinen Mary. Sie ruft mich, ich höre es ganz deutlich. Ach, dürfte ich doch schon bei ihr sein, wie wohl wäre mir dann, wie sorglos könnte ich mich fühlen …
Die Kräfte im gesunden Arm verlassen mich; ich kann gerade noch sehen, wie Holmes die Gartengeräte zusammenräumt, dann muss ich mich zurück in den Rollstuhl fallen lassen. Er quietscht zu laut. Jetzt muss ich schnell in mein Zimmer fahren, es liegt neben unserem Wohnzimmer, des Rollstuhles wegen, wir haben keinen Aufzug. In meinem Zimmer steht die große Blechkiste mit meinen Briefmarken drin und allem, was ich je geschrieben habe. Auch diese hastig hinzugekritzelten Zeilen werde ich darin verstecken. Wenn der Herrgott mich abberuft, soll alles fünfzig Jahre lang in den unterirdischen Tresoren meiner alten Hausbank verwahrt bleiben, aus Diskretion denjenigen gegenüber, die einst bei meinem Freund Rat und Hilfe gesucht und gefunden haben. Das ist testamentarisch so verfügt, aber ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle schon einmal ausgeführt. Ach Mary, wenn man nur wüsste … wenn man nur wüsste.{5}
Gottes Segen allen Lesern dieser Zeilen!{6}
Sussex, im Juni 1929
John H. Watson, M.D.
SHERLOCK HOLMES UND DER WERWOLF VON LONDON
In dem dreiteiligen Spiegel aus dem Ankleidezimmer, den Mutter mir hinterlassen hat, kann ich mich in ganzer Größe und sogar von der Seite sehen. Wenn diese drei Spiegel sprechen könnten, was würden sie berichten? Sicherlich würden sie von dem weißen Körper meiner Mutter erzählen, der unsagbar vollendet war. Ich weiß das, denn außer dem Porträt von Casimiro Castro, das früher im Speisezimmer hing und das meine Mutter in großer Toilette und mit einem Brillantencollier in ihrem hinreißenden Dekolleté zeigt, malte Castro noch ein weiteres, nur für die Augen ihres Ehemannes – meines Vaters – bestimmtes Bild. Es hing an der Innenseite des Kleiderschranks im ehelichen Schlafzimmer, wo er es betrachten konnte, wann immer er dazu Lust verspürte – oder wann immer er Lust verspüren wollte.
In geradezu mythologisch wirkender Nacktheit, mit gelösten Haaren, tritt Mutter wie eine antike Göttin auf diesem Bild auf mich zu. Schau her, so bin ich!, scheint sie zu sagen. Dabei zeigt sie ihre geöffneten Handflächen. Sie lenken den Blick des Betrachters auf ihren Schoß, den sie von allen Haaren befreit hat. Ungeschützt scheint er in ihren Händen zu liegen wie etwas kostbar Zerbrechliches, das gleichwohl stark ist. Heimlich schaue ich es mir an, wann immer ich Gelegenheit dazu finde.
Nun steht ihre Tochter vor diesem Spiegel. Himmel, welchein Unterschied! Der Anblick treibt mir die Tränen in die Augen. Ganz unbewusst nehme ich dieselbe Haltung ein wie sie auf dem geheimen Bild. Schau her, so bin ich!, sage auch ich, aber ich bin nicht zu sehen. Was da zu sehen ist, ist ein unglückliches Tier in einem Pelz, den es nicht ausziehen kann.
Meine gesamte Haut ist mit schwarzem Fell bedeckt, meine Schenkel, mein Gesicht, mein Rücken, sogar die Ohren. Kahl sind nur die Fußsohlen, die Handflächen und die Augenlider. Ich gleiche einer Äffin. Meine Zähne scheinen lang wie bei einem Wolf, aber nur, weil mein Zahnfleisch zurückweicht. Die Augen, die so oft weinen, sind die einer Menschenfrau. Sie bitten Gott um Gnade und stellen ihm furchtbare Fragen. Warum hast Du mich, Du schrecklicher Gott, so entsetzlich aussehen lassen? Warum durfte ich keine gewöhnliche Frau sein? Einen guten Mann finden, der in Liebe um mich freit? Kinder haben? War DAS, Gott, Dein Wille?
Ich brauche meine Aufzeichnungen nicht zur Hand zu nehmen, denn das Jahr, in dem sich der folgende Fall zutrug, hat sich erstens unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt und kann zweitens in jeder Literaturgeschichte nachgelesen werden. Alles begann mit dem Erscheinen eines inzwischen weltberühmten Romans. Es war das Jahr 1897, und der Held des Romans war ein widernatürliches Scheusal, ein untoter Blutsauger aus Transsilvanien, mit einem Wort, ich spreche von Bram Stokers Dracula.
Leider gab es nur wenige Leser, denen das Buch auf Anhieb gefiel. Zu diesen Lesern gehörte ich. Die Kritiker dagegen waren sich einig. Sie lehnten den Roman als gotteslästerlich ab und behandelten ihn, als wäre er ein Werk von Marie Corelli.{7} Eine besonders dümmliche Kritik entdeckte ich kürzlich beim Durchblättern meiner Dracula-Ausgabe wieder. Ich hatte sie aus irgendeiner Zeitung minderer Qualität herausgerissen und hineingelegt. Der Rezensent M. Arilane verriss den Roman auf das Gründlichste, gab aber unumwunden zu, ihn überhaupt nicht zu Ende gelesen zu haben. Zu der Auflösung der ganzen Mysterien kann ich nichts sagen, denn nach 120 Seiten hatte ich genug.
Obwohl es sich bei M. Arilane möglicherweise um eine schreibende Amazone handelte, so denke ich noch heute, was ich damals dachte, nämlich dass ein hohles Geräusch, das beim Zusammenstoß eines Buches mit einem Kopf zustande kommt, nicht notwendigerweise vom Buch herrühren muss.{8} Oder wie unser Freund George Bernard Shaw schon so richtig sagte: Wer kann, der kann. Wer nicht kann, wird Kritiker.
Ich dagegen war restlos begeistert, zumal der Held van Helsing ähnliche Methoden anwendet wie mein Freund Sherlock Holmes. Van Helsing bedient sich bei der Jagd nach dem blutrünstigen Grafen unter anderem eines Phonographen, eines photographischen Apparates und sogar eines Telephons. Das Interessanteste für mich als Arzt aber war eine Idee, deren Umsetzung der Medizin damals noch gar nicht möglich war. Zur Rettung der vom Vampirismus befallenen Lucy nimmt van Helsing – wenngleich vergeblich – eine Blutübertragung vor. Ich war nicht zuletzt darum beeindruckt, weil damals die Medizin nur in äußersten Notfällen zu Blutübertragungen schritt, denn die Blutgruppen – Voraussetzung für eine erfolgreiche Transfusion und heute medizinisches Grundwissen – waren damals noch nicht entdeckt. Dracula war also nicht nur ein Schauerroman, sondern gehörte auch ein wenig in die Sparte futuristischer Literatur, wie sie Jules Verne damals in Frankreich schrieb, ein alter Bekannter von Sherlock Holmes übrigens.{9}
Leider durfte Bram Stoker – anders als Monsieur Verne – den literarischen Ruhm nicht mehr selber auskosten. Er starb 1912, vergessen und erschöpft. Erst zehn Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1922, erschien in Deutschland der Film Nosferatu, der auf Stokers Roman fußte. Und plötzlich wurde dieser von vielen gelesen. Die Leser sprachen von den Vampiren und Menschensaugern und meinten, halb im Scherz, halb im Ernst, Spuren ihres unheilvollen Wirkens am eigenen Hals entdeckt zu haben. Manche hängten Knoblauchkränze über Fenstern und Türen auf und trugen silberne Kreuze um den Hals, die geschäftstüchtige Juweliere feilboten. Unter den modebewussten jungen Herren der Gesellschaft erfreuten sich Spazierstöcke mit silbernen Griffen in Form von Wolfsköpfen und mit schweren Bleispitzen zur Abwehr der Wiedergänger wachsender Beliebtheit. Sogar angesehene Professoren der Geschichtswissenschaft, ja selbst der Theologie waren sich nicht zu schade, mit halbwegs skeptischen Vorworten versehene Auszüge aus Dom Calmets Dissertation sur les apparitions des esprits, et sur les vampires ou les revenans de Hongrie, de Moravie etc. von 1746 herauszugeben, oder entsprechende Textstellen aus dem Mercure galant von 1693 und 1694. Das Publikum schätzte sie jedoch nur um der Sensation willen.{10}
Aber so weit war es 1897 noch lange nicht! In einem Paket, das ein Botenjunge abgegeben hatte, lagen zwei druckfrische Dracula-Erstausgaben, signiert von des Autors eigener Hand. Sherlock Holmes mit Dank in tiefer Verehrung überreicht, stand da mit krakeliger Handschrift in dem einen Buch. Das war ungeachtet der Dienste, die ihm Holmes seinerzeit geleistet hatte{11}, sehr zurückhaltend formuliert. Dem lieben und verehrten Dr. Watson in immerwährender Dankbarkeit überreicht von Bram Stoker, las ich nicht ohne Befriedigung und Wohlgefallen in dem mir zugedachten Exemplar.
Und überhaupt, das Buch! Vom ersten Kapitel an schlug es mich in seinen Bann. Rot glühende Ohren hatte ich zum letzten Mal wohl bekommen, als ich zwölf- oder dreizehnjährig James Fenimore Cooper las. Jetzt saß ich wieder, jede freie Minute nutzend, im Lehnstuhl unseres Wohnzimmers. Ich vergaß über meine Lektüre Tabak, Speis und Trank, vergaß meine Umgebung und saugte, um im Bilde zu bleiben, Seite um Seite buchstäblich in mich hinein. Sherlock Holmes nahm sein Exemplar mit in sein Schlafzimmer, wo er es offensichtlich ebenfalls las, danach aber achtlos im Wohnzimmer herumliegen ließ. Als ich es versehentlich in die Hand nahm, entdeckte ich in seiner präzisen Handschrift mit Bleistift auf den Rand geschriebene Anmerkungen. Dracula gefiel ihm allerdings gar nicht.
„Genauso wenig wie diese Machwerke hier!“ Er deutete auf das Regalbrett, auf dem ich meine Privatlektüre verwahren durfte. Langsam glitt sein Finger die Buchrücken entlang. „Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein. Na ja, immerhin in der revidierten zweibändigen Ausgabe von 1823. Ann Radcliff, Der Italiäner. Frauen scheinen eine gewisse Affinität für solche Art Literatur zu haben. Hoppla, was haben wir denn da? Robert Louis Stevenson, Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr Hyde, 1886. Originalausgabe, immerhin! Ah, Sie haben 1888 hier in London die Bühnenfassung von Thomas Russell Sullivan gesehen! Schön, dass Sie die Theaterzettel immer so ordentlich in die Bücher hineinlegen. Ein wahrhaft interessantes Buch! Stevenson hat hier etwas beschrieben, was in der Wissenschaft vom Menschen noch eine große Rolle spielen wird, nämlich dass in jedem Menschen im Grunde zwei Persönlichkeiten stecken, die voneinander gar nichts wissen. In Wien forscht ein Seelenarzt daran, ein Doktor Freud. Man wird noch viel von ihm hören. Denken Sie an meine Worte, Watson!“
„Sie meinen sicher Sigmund Freud, aber das ist meiner Meinung nach ein Scharlatan!{12} Die menschliche Seele lässt sich nicht mit den Mitteln der Medizin erforschen, wie mit einem Skalpell zergliedern und wie ein unbekannter Kontinent kartographieren!“
„Wir werden sehen“, antwortete mein Freund. „Aber von dem, was Sie da lesen, wird spätestens nächstes Jahr niemand mehr sprechen.“
„Immerhin hat mein Exemplar dank der Widmung bibliophilen Wert“, gab ich zurück.
„Aber man bemerkt schon bei kursorischer Lektüre, dass Mister Stoker seinen Helden van Helsing unübersehbar mit eben jenen Zügen ausgestattet hat, die Sie in Ihren unvergleichlichen Schilderungen unserer gemeinsamen Erlebnisse mir so freigiebig zuzuschreiben geruhen. Man könnte angesichts einiger Passagen glauben, man läse Doktor Watson anstatt Bram Stoker.“
„Wenn das so wäre, würde ich mich geehrt fühlen. Aber selbst Sie dürften doch gemerkt haben, dass es sich durchaus um einen höchst originellen Roman handelt, selbst wenn ihn bornierte Kritiker nicht zu schätzen wissen.“
„Sie sollten lieber etwas Wertvolles, Instruktives lesen, Watson“, fuhr er fort, zog ein kleines Büchlein aus seiner Seite des Regals und hielt es mir unter die Nase. „Da, zum Beispiel Mark Twain, der ebenso unterhaltsam wie belehrend zu schreiben versteht. Die Geschichte vom verrückten Wilson. Für verrückt wird dieser Wilson gehalten wegen seiner von Freunden und Bekannten leider völlig verkannten Angewohnheit, die Fingerabdrücke seiner Mitmenschen auf Glasplatten zu sammeln. Eines Tages kann er mit dieser Sammlung die Unschuld eines zu Unrecht Verdächtigten beweisen, den wahren Schuldigen überführen und sogar noch nachweisen, dass man ein Kind vertauscht hat. Ich empfehle es allerwärmstens Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit.“
Ich blätterte das kleine Buch mit dem blauen Pappmaché-Einband achtlos durch. „Mein Gott, belehrend!“, antwortete ich. „Haben Sie kein Erbarmen mit einem geplagten Arzt und Autor, der wenigstens eine halbe Stunde am Tag entspannen will?“
„Doch, doch, lieber Doktor, das habe ich. Aber muss man sich als kultivierter Mensch, als promovierter Mediziner sogar, ausgerechnet bei Schundliteratur wie Dracula entspannen? Gehen Sie doch ins Konzert oder spielen Sie eine Partie Whist in Ihrem Club. Man muss sich ja seines Hausgenossen schämen!“
„Ich kenne da jemanden, der tut zur Entspannung viel üblere Dinge“, entgegnete ich bissig. „Was müssten sich dessen Hausgenossen erst schämen!“
„Sie meinen fraglos Kelberg, den Sadisten?“
„Nein“, giftete ich, „ich meine fraglos Holmes, den Kokainisten. So, und nun lassen Sie mich gefälligst in Ruhe! Gehen Sie doch selber ins Konzert oder spielen meinethalben eine Partie Whist! Ich möchte jetzt lesen.“
*
Das Jahr 1897 erlebte nicht nur die Geburt eines Stücks Weltliteratur, sondern auch einen brütend heißen Sommer, der die Stadt regelrecht zum Dampfen brachte und im Verein mit den Hunderttausenden von rußenden Schornsteinen und Essen der Stadt einen förmlichen Dauernebel verursachte, der nur gelegentlich von den heftigen Sommergewittern vertrieben wurde, in denen sich die aufgestaute Hitze entlud. Dieser Dauernebel legte sich nicht allein, Husten und Heiserkeit verursachend, dumpfig auf Lunge und Bronchien, sondern auch aufs Gemüt, besonders bei meinem Freund und Hausgenossen. Holmes, so aktiv wie schon seit Langem nicht mehr, entwickelte aber Launen wie eine Operndiva. Diese Launen reizten mich bis aufs Blut, weil ich den Abenteuern Jonathan Harkers, van Helsings und Mina Murrays zu folgen versuchte.
Vor Kurzem hatte Holmes einige schwierige, ja bizarre Probleme lösen können, darunter das des Vampirs von Sussex, über das ich sicherlich irgendwann noch einmal berichten werde. Was sich zunächst wie ein übernatürliches Phänomen ausgenommen hatte, konnte bei Licht betrachtet – leider, muss ich sagen – mit den Mitteln des Verstandes auf völlig befriedigende Weise geklärt werden.
„Ihrem Sinn für Romantik dürfte das schwerlich entgegenkommen“, spottete Holmes einige Zeit später, als die vermeintliche Vampirin beim Ordnen meiner Notizen noch einmal zur Sprache kam.
Ich konnte nicht umhin zuzugeben, dass mir zur Abwechslung ein echter Vampir durchaus nicht unwillkommen gewesen wäre. „In der Tat, die klare Kraft des Verstandes entreißt unserer Welt noch das letzte Geheimnis. Das Leben ist geradezu erschreckend nüchtern und prosaisch geworden. Und Sie, mein Lieber, tragen in nicht unerheblichem Maße dazu bei.“
„Gut, dass das so ist!“ Mein Freund zuckte verächtlich die Schultern. „Unwissenheit, Aberglaube und Vorurteil sind die schlimmsten Feinde der Menschheit. Neben dem unausrottbaren Hang zur Romantik.“
„Einverstanden, lieber Freund“, versetzte ich. „Aber ist es nicht schade um die Romantik, um die pandämonische Beseeltheit des Kosmos, und sei sie auch nur Illusion? Die Welt besteht nun einmal nicht allein aus Verstand. Sie hat auch eine affektive Seite. Es sind andere Seiten des menschlichen Geistes als der Verstand, die zum Beispiel Ihre vielgeliebte Musik hervorbringen. Und außerdem, will die Welt nicht auch ab und an umschmeichelt, umgaukelt, wenn Sie wollen, betrogen werden? Das ist nun einmal so.“
Holmes’ Gestalt war inzwischen hinter dichten Rauchwolken verschwunden. Das Letzte, was ich von ihm in den nächsten zwei Stunden zu hören bekam, waren die Worte Mein Gott, Watson! und noch einige Silben unverständlichen Gemurmels, das ich, Gott sei Dank, nicht verstand.
Holmes hatte in den vergangenen Wochen mit der Neuordnung seiner Annalen begonnen, zwei Jahrgänge Zeitungsausschnitte in seine Sammlung eingeklebt, den ersten Satz eines Violinkonzertes komponiert und eine Monographie über Die Wissenschaft vom Blut im Dienste der Kriminalistik geschrieben. Zwischendurch wäre er um ein Haar dem verrückten McArdle in dessen Zeitmaschine auf Nimmerwiedersehen in eine andere Dimension gefolgt.{13}
Die Arbeit an der Monographie über das Blut war begleitet gewesen von Experimenten mit außerordentlich üblen Gerüchen, die von seinem von Säure zerfressenen Tisch aufstiegen. In allen Regenbogenfarben schillerten darauf verschüttete chemische Substanzen. Außerdem korrespondierte mein Freund regelmäßig mit einem Arzt, den ich persönlich nicht kannte. Dr. med. Karl Landsteiner, Hygienisches Institut, Wien, hatte ich auf einem der Umschläge als Absender gelesen, aber der Name sagte mir nichts. Ich hätte meinen Freund Arthur Conan Doyle fragen sollen, denn der hatte als junger Arzt ein halbes Jahr in Wien verbracht bei dem letztendlich vergeblichen Versuch, sich auf Ophtalmologie zu spezialisieren.
*
Der Juli ging zu Ende. Ich war gerade enttäuscht aus der Stadt zurückgekehrt, nachdem ich vergeblich eine sensationelle Ausstellung in der Regent Gallery hatte besuchen wollen. Wegen Einbruchs geschlossen, hatte am Eingang gestanden. Auch gut, hatte ich mir gedacht und den illustrierten Handzettel, durch den ich auf die Ausstellung aufmerksam geworden war, eingesteckt.
Diese Handzettel verteilten kleine Jungen fast täglich auf den Straßen. Sie warben für musikalische Darbietungen, Theaterspektakel wie das Boxerdrama The House of Temperley im Adelphi-Theater, dessen Autor, Regisseur und Produzent kein Geringerer als unser guter Conan Doyle war und der bei dieser Gelegenheit nicht unbeträchtliche Verluste erwirtschaftete{14}, oder für Circusvorstellungen wie Buffalo Bill’s Wild West, der seit dem Goldenen Thronjubiläum unserer hochverehrten Queen 1887 in regelmäßigen Abständen über den Großen Teich kam. Wir hatten ihn im Zusammenhang mit dem Treiben eines russischen Nihilisten persönlich kennengelernt.{15} An Mr Codys Erfolg versuchten zahllose große und kleine reisende Circusunternehmen teilzuhaben. Man konnte geradezu von einer Seuche sprechen.
Nach Hause zurückgekehrt, warf ich den Handzettel achtlos auf den Rauchtisch und ließ mich im Sessel nieder. Gleich darauf weilte ich wieder in Transsilvanien. Holmes’ Heimkehr nahm ich kaum wahr.
Manchmal sahen wir kleine Schlösser und Türme auf steilen Hügeln, ganz wie man sie in alten Chroniken abgebildet sieht.
„Watson!“
Zuweilen passierten wir Flüsse und Bäche, die, nach den breiten Geröllstreifen zu schließen …
„Doktor Watson!“
… wohl häufig aus ihren Ufern treten.
„Ja, Holmes, was gibt’s?“
Holmes hielt den Handzettel vom Rauchtisch in der Hand.
„Die hässlichste Frau der Welt“, las er vor.
Vorne war ein Wesen abgebildet, das einem Äffchen glich, aber eindeutig menschlicher, ja sogar weiblicher Natur war und ein Frauenkleid mit wildem Muster trug.
„Die hässlichste Frau der Welt“, echote ich abwesend, noch gar nicht ganz in das Hier und Jetzt zurückgekehrt. „Das müsste Sie doch als notorischen Frauenfeind interessieren.“
„Ich bin mitnichten der Frauenfeind, als den Sie mich darzustellen belieben.“ Holmes’ Ton, zuvor noch höhnisch, wurde nun ärgerlich. „Ich bitte aus dem Umstand, dass ich unbeweibt bin und es vermutlich auch bis zum Ende meines Erdendaseins bleiben werde, keine falschen Schlüsse zu ziehen. Ich verhalte mich, selbst wenn Sie das mit großer, gelegentlich an Bösartigkeit grenzender Vorliebe leugnen, im Gegenteil Damen gegenüber stets ritterlich und zuvorkommend. Deswegen muss ich jedoch nicht gleich eine von ihnen heiraten.“
„Heiraten nicht …“, gab ich süffisant zurück, doch Holmes ging nicht darauf ein.
„Wenn ich diesen sensationell aufgemachten Handzettel recht verstehe, handelt es sich bei der angeblich hässlichsten Frau der Welt um die öffentliche Zurschaustellung eines von Geburt an verunstalteten menschlichen Wesens durch einen gewissen Theodore Lent, um die Zurschaustellung einer Laune jener Natur, deren Geheimnisse Sie um jeden Preis geschützt wissen möchten. Ich finde das Begaffen dieses unglücklichen Menschenkindes, offen gesagt, eines Gentleman für unwürdig, Watson.“
„Ich will niemanden begaffen, Holmes. Ich interessiere mich aus rein medizinischen Gründen für die Mumie. Hypertrichose ist eine sehr seltene Krankheit.“
„Mumie? Ach so, man vergönnt dieser armen Frau also nicht einmal im Tode ihren wohlverdienten Frieden?“
„Nein. Julia Pastrana war eine Mexikanerin und verschied bereits 1860. Ihr Kind starb kurz nach der Geburt und wurde ebenfalls einbalsamiert.“
Holmes’ Wangen begannen sich zu röten. Jetzt hatte sein streitbarer und kampflustiger Geist ein Thema gefunden: mich. Gleich würde er mich mit ein paar gut platzierten Florettstichen niedermetzeln.
„Soll das heißen, dass man sie noch immer zur Belustigung des hochwohllöblichen Publikums durch die Jahrmärkte und Panoptiken schleppt?“
„Ja, man tut es“, erwiderte ich verlegen. „Ich gebe Ihnen recht, Holmes, es ist im Grunde unwürdig, und wenn die Sache korrekt abgewickelt würde, so zeigte man Señora Pastrana nur einem ausgewählten medizinischen Publikum. Aber als der Elefantenmensch John Merrick von Doktor Treves 1884 in London ausgestellt wurde, war ich aus Ihnen bekannten Gründen nicht zugegen. Für einen Arzt ist das Studium eines so außerordentlich missgestalteten Menschen eine einmalige Gelegenheit! Vielleicht kann man eines Tages solchen unglücklichen Wesen einmal helfen, wenn die Behandlungsmöglichkeiten oder die Operationstechniken weitere Fortschritte gemacht haben. Natürlich wäre es mir auch lieber, ich könnte die Mumie in aller Ruhe in der ruhigen, klinischen Atmosphäre der Royal Anatomical Society ansehen und müsste mich nicht durch einen Haufen grölender Proleten in der Regent Gallery hindurchzwängen. Aber ich kann Sie beruhigen, die Ausstellung war bei meinem Eintreffen geschlossen. Wegen Einbruchs!“
„Es ist und bleibt eine Geschmacklosigkeit, Watson“, ereiferte sich Holmes. „Aber manchmal scheinen Einbrüche auch etwas Gutes zu haben. Mmh!“
„Mmh?“, fragte ich, während Holmes sich seinen Alben zuwandte.
„Ausgerechnet Julia Pastrana. Sehr seltsam!“
Ich wollte nicht weiter in Holmes dringen. Womöglich wäre der Disput noch für eine unerquickliche Weile lang weitergegangen. Über Geschmacksfragen soll man bekanntlich nicht streiten. Ich antwortete also nichts und trat nachdenklich ans Fenster, um hinauszusehen.
Ja, die Bosheit und Niedertracht des Menschengeschlechtes! Unten auf der Baker Street sah ich die Menschen vorbeihasten, ruhelos, wie ein aufgestörter Ameisenhaufen. Wie viel hatte sich seit dem Tag unseres Einzuges verändert! Das elegante Klappern der Hufe von Pferden, die Landauer oder Kutschen zogen, ging im Lärm der Automobile unter, die in Wolken von Straßenstaub und schwarzen Abgasen immer schneller ihren Weg suchten. Seit man vor einiger Zeit das Rote-Fahnen-Gesetz abgeschafft hatte und keine Diener mehr vor den Motorwagen herlaufen mussten, um die Fußgänger zu warnen, war dem Geschwindigkeitsrausch keine Grenze mehr gesetzt, und man hatte seine liebe Not, gesund die Straße zu überqueren.{16} Und wie sehr hatte sich das Verbrechen verändert! Mit dem Einzug der Technik hatte es eine neue Qualität bekommen, war schneller geworden, brutaler, durchbrach die Spielregeln, die früher gegolten hatten, und ich fragte mich, ob die Methoden meines Freundes dieser neuen Qualität noch lange gewachsen sein würden. Ja, vielleicht wohnten tatsächlich so, wie es Robert Louis Stevenson beschreibt, in der Brust eines jeden Menschen zwei Seelen, und nun war die Zeit gekommen, da die böse Seele ans Licht treten und herrschen will. Es waren dieses Mal nicht Sherlock Holmes’ Worte, die mich aus meinen Gedanken rissen, sondern das Klingeln des Postboten, den ich die Straße hatte entlangkommen sehen, ohne ihn eigentlich recht wahrzunehmen.
Gleich darauf hörten wir Mrs Hudson mit der Post die Treppe zu unseren Räumen heraufkommen. Sie brachte lediglich einen einzigen Brief. Mein Freund besah sich den Umschlag ausgiebig von außen, dann griff er zu seinem arabischen Dolch, der ihm als Brieföffner diente, trennte den Umschlag auf, entfaltete den Briefbogen, las und schüttelte den Kopf.
„Das ist ein Fall für Sie, Watson, nicht für mich“, meinte er.
„Wieso für mich? Ich bin Arzt. Ist jemand krank? Bei diesem Wetter wäre das nicht verwunderlich.“
„Krank? Physisch wohl nicht. Vielleicht eher im Kopf. Sie sind doch auch eine Art Fachmann für geistige Verrückungen … jedenfalls toben sich Ihre diesbezüglichen Neigungen an mir aus, und dies, ich wiederhole, scheint mir eher ein Fall für Sie zu sein.“ Er hielt mir das Papier hin.
„Ich bin kein Seelenarzt wie dieser Freud“, brummelte ich, dann begann ich zu lesen.
Sehr geehrter Mr Holmes, ich möchte Sie höflichst bitten, sich eines merkwürdigen Phänomens anzunehmen, das mich seit einigen Tagen beunruhigt. Es handelt sich um einen Lykanthropen. Ich werde mir erlauben, Sie umgehend aufzusuchen.
Es folgten die Adresse und der mir völlig unbekannte Name Albert Prentiss Colthroy.