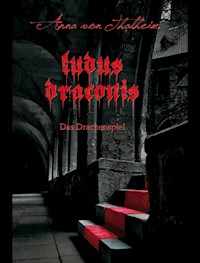
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ist das bischöfliche Drachenspiel "ludus draconis", das alljährlich um die Domburg und die Immunitätsinsel der Bistumsstadt Halberstadt herum als Prozession abgehalten wird nun ein beliebtes Freudenfest? Oder offenbart es hinter verborgenen Mauern seinen wahren berüchtigten Schrecken? Reisende lächeln lüstern. Ordensfrauen verschließen ihre Pforten, und die Bewohner der Stadt wünschen sich nichts sehnlicher, als den Drachen berühren zu dürfen. Jean stellt sich die Frage, ob er zu diesem Anlass unter den Scholaren des Johannisklosters den Einen findet, den er sucht. Der, der sich dort verborgen hält. Er sinnt auf Rache. Er umspinnt Katharina Trebeck mit vertraulichen Gesten und verschafft sich, verboten, Zutritt zum Kreuzgang des Stiftes unserer lieben Frauen und gerät dort an seine physischen und psychischen Grenzen, die erst ihr Ende finden als Jean längst nicht mehr damit rechnet. Es ist eine Episode beinahe vergessener Geschichte, in einem ganz untypischen "historischen Roman", der die Düsternis seiner Zeit beleuchtet und die Schicksale dahinter in den Vordergrund rückt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wortzähler: 123728
ludus draconis
Das Drachenspiel
von
Anna von Thalheim
Anna von Thalheim
„He, …Franzose!“ Er wurde unsanft in die Seite gestoßen, zuckte zusammen und stellte fest, dass er trotz der Kälte eingenickt war. „Jean! …Hey!“ Wieder bekam er einen Stoß. Verärgert entzog er sich. Vor Sonnenaufgang war er, gegen eine lächerlich geringe Gebühr, zu dem raubeinigen Händler auf den Bock gestiegen. Er hatte seinen Mantel eng um sich geschlagen und die Kapuze gegen den schneidenden Wind tief ins Gesicht gezogen. Er hatte geglaubt, die klirrende Nachtkälte würde mit dem ersten Morgenlicht verschwinden, aber das tat sie nicht. Sie krallte sich in seine Kleidung, wandelte sich in eine zwiebelnde Variante aus haltlosem Zittern und ermattender Resignation. Allein das Rumpeln der Räder auf den ausgefahrenen, fest vereisten Wegen verhinderte, dass seine Glieder und Muskeln gefroren. „Da, …da hinten, …euer Ziel!“ Der Mann neben ihm zeigte mit der ganzen behandschuhten Hand den erklommenen Hügel hinab. Jean starrte in die Ferne. Aus tief liegendem Nebel entragten dem ersten Morgenlicht die Türme der Kirchen. „Halberstadt! …Da wolltet ihr doch hin!“, vergewisserte sich der Händler. Sein ungepflegter Bart war schon jetzt mit Schollen gefrorenen Atems bedeckt, die Nase tiefrot, die Wangen bläulich geädert. Jean nickte und betrachtete die Silhouette. Er hatte während seiner ständig andauernden Reise viel gesehen und ebenso viel erlebt. Dieses Bild jedoch war für die Ewigkeit bestimmt. Mystisch durch die Schwaden und majestätisch in der Baukunst ragten St. Stephanus und die ungleichen Türme St. Martinis aus dem kalten Dunst. Von der Stadt selbst war nicht viel zu sehen. Sie lag in einer natürlichen Mulde, geschützt vor den Unbilden der Witterung. Man hatte ihm berichtet, Halberstadt wäre wehrhaft von einer Mauer umgeben. Nur erreichbar über Brücken die den Stadtgraben überspannten, durch Tore, die ohne Passierschein nicht zu durchqueren waren. „Genug gesehen?“, fragte der Händler und schnalzte mit der Zunge, damit der Gaul sein Gespann weiterzerren konnte. Jeans Blick haftete unverwandt an der Stadt. „Hm!“ „Die Domburg hat eine eigene Mauer und Zugänge, an denen Scholare Wache halten.“, ächzte sein Nebenmann weiter. Er sah sich bemüßigt sein spärliches Wissen über die Bistumsstadt an den seltsamen Reisegefährten, der ihm anfangs rätselhaft und düster erschien, weiterzugeben. „An Hilarii, …da sind sie ganz aus dem Häuschen.“, sinnierte er. „Habt ihr euch das schon mal angesehen?“, fragte Jean. Der Mann neben ihm schüttelte bedächtig das betuchte Haupt. „Vor etlichen Jahren war ich dieser Tage in der Stadt. Keine Chance!... Die raren Marktstände sind an Juden und Klerusgetreue vergeben, die Immunitätsinsel platzt aus allen Nähten. Da ist nichts zu machen.“ „Es ist ein Volksfest?“ „Dazu ist es wohl geworden. Es ist ein bedeutender Tag. Seit Neustem führt der Klerus die Prozession um die Domburg herum. Außerhalb der Mauern. Das Fest an sich findet nach wie vor hinter verschlossenen Stiftsmauern statt. Die Kanoniker feiern gern unter sich. “ „Ludus draconis…“, murmelte Jean. „Jäh, …das Drachenspiel!“, kicherte der Händler plötzlich, räusperte sich anzüglich und konzentrierte sich wieder auf den Weg. Jean entspannte die Schultern. Die Kälte kroch unvermindert in die Glieder. Der Wind ließ das Gesicht zu einer Eismaske gefrieren. Er hatte es satt. Die nächste Nacht, so schwor er sich, würde er an einem warmen Feuer verbringen, egal wo! Er versank in Gedanken, während die Stadt und somit das sehnsüchtig erwartete Ziel stetig näher rückte. Dem Vater nach langer Zeit begegnen wollen, war wichtig. Den, sich auf der Flucht befindlichen Mörder Thierrys aufstöbern, wichtiger. Der Zufall wollte es, dass sich beide in der Bistumsstadt befanden. Dem Vater gestand Jean es zu. Der Mann, den er seit Paris jagte, wähnte sich hinter dicken Mauern in Sicherheit. Nach Monaten, vielerlei Recherchen und andauernder Verfolgung hatte Jean der Weg bis nach Halberstadt geführt. Die Zeit war knapp. Morgen war der perfekte Tag. Die Aufregung in der Stadt das beste Alibi. Heute würde er den Vater besuchen. Und morgen entschied sich alles!
„Ich suche Feuerholz und kehre das Haus. Mach dir keine Sorgen! Sobald du zurück bist kuscheln wir uns in die Decken und tuscheln über die schaurigsten Gestalten, die unter Gottes düsteren Himmel wandeln.“, gluckste Hannah verspielt. Wie immer redete sie, ohne nur einmal nach Atem zu schöpfen. Es war ihre Art, damit gab sie Katharina die Sicherheit, ein Gefühl von Hilfsbereitschaft und die jugendliche Unbeschwertheit, derer sie so oft, auf Anlass ihrer alltäglichen Not, bedurfte. Im Grunde wusste sie, war Hannah froh, wenn man sie in Ruhe ließ. Dann zog sie ihre Runden durch die Straßen, drückte sich auf den Märkten in Nischen, lauschte den Menschen und ihren Geschichten und stillte ihren Durst nach Wissen. Hier, abgeschieden, hinter Toren, die des Nachts verschlossen wurden, nahe dieses überdimensional großen Platzes, der den vielen Ordensbrüdern vorbehalten war, die ihre Bildung, wie die Pergamentrollen, die sie einfältig und wichtigtuerisch an sich pressten, als würde jeder dahergelaufene Tropf sie ihnen diebisch entreißen wollen, vor sich hertrugen. Hannah fühlte den Hauch der Magie, die geschriebene Worte für sie ausstrahlten und nach denen sie hungerte. „Sobald ich zurück bin werden wir hoffentlich die Suppe löffeln, die die Küche seiner Exzellenz für uns übrig hat.“, entgegnete Katharina von Magenschmerzen geplagt. Seit zwei Tagen fehlte ihnen Nahrung und die üblen Krämpfe begleiteten sie dauerhaft. Auch heute musste sie ohne eine Mahlzeit durchhalten, bis sie gegen Mittag der Residenz des Bischofs zuging. Albrecht hatte sich eine schmackhafte Graupensuppe gewünscht und diese verstand sie vortrefflich zuzubereiten Er hatte sie vor einigen Tage mit einem Laib Brot aus dem Küchendienst entlassen. Jetzt gab es einen weiteren Hoffnungsschimmer, der nur in Erfüllung ging, wenn der zuständige Kaplan bereitwillig die Kosten dafür freigab und die Zutaten gegen Mittag in der kleinen Privatküche der Residenz bereit lagen. Bis dahin hieß es, Zähne zusammenbeißen. Wohl auch, weil ihr Dienst danach im Hause des Dekans von Nöten war. Inbrünstig betete sie schon jetzt, dass dieser in den Nachmittagsstunden im Kloster weilte und sie eine Begegnung vermied. Ihr schlug die Angst wie Hammerschläge durch den Körper, krampfte zusätzlich ihre Mitte und schnürte ihr den Atem ab. Mit einem stillen Gebet tat sie ein Kreuzzeichen vor der Brust und wandte den Blick an die bröcklige Zimmerdecke ihrer Behausung. „Gib auf dich Acht und lass dich nicht erwischen.“ Das gab sie Hannah stets mit auf den Weg, wenn diese sich mit einem Augenzwinkern an den Stadtwächtern vorbei, in die umliegenden Wäldchen verdrückte. Dort, so wusste Katharina, hatte sich das Mädchen schon im Sommer kleine Lager an Brennholz zugelegt, weit entfernt von den Routen, die die Händler nahmen. Sie sammelte und bündelte, bis das Gewicht der Äste und Zweige sie auf dem Rückweg in die Stadt beinahe zu Boden zwang, nur damit sie am Abend wenigstens einen heißen Tee aus getrockneten Brombeerblättern schlürfen und dem harten Winter mit den eisigen Winden, der unablässig durch die Hausritzen zog, trotzen konnten.
Der Karren des Händlers überwand, gefolgt von weiteren Gespannen, zwei, drei kleinere Hügel. Niemals jedoch verschwanden die Türme St. Stephanus. Sie wiesen den Weg, hinein in die Stadt, schnurgerade. Mit jeder Rute wanderte die Sonne höher, brachte winterliches, weißes und hellblaues Licht. Der Himmel erstrahlte in einem klaren Azur und der Nebel über der Stadt drücke sich flach in die Straßen. Die Domburg thronte über allem. Von festungsartigen Mauern umgeben, war die Stiftskirche St. Maria unserer lieben Frauen und kleinere Gebäude auszumachen. Rauch stieg aus den Schornsteinen und zeigte an, dass die Bewohner ihr Tagewerk begannen. Jean erkannte die Stadtmauern und das Tor, zu dem die Straße geradewegs führte. Der Händler brummte Unverständliches und er fragte nach. „Ich bringe euch bis zum Kloster des Burchards, zu den Zisterzienserinnen, …wird ja wohl genügen!“ „Macht euch keine Umstände! …Ist das der Komplex dort hinten?“ Jean zeigte links auf ein, außerhalb der Stadtmauern gelegenes Arial mit kleiner Basilika. Auch hier wehrten Mauern Eindringlinge ab. „Wird von Nonnen beherbergt!“, erklärte der Händler nochmals. Jean deutete nicht, mit welcher Absicht das geschah. „Lassen die keine Reisenden hinein?“ „Doch schon, … aber vor St. Hilarii?“ Er zuckte ratlos die Schultern. „Wird wohl meine Sorge sein!“, brummte Jean zurück. Dieser Kerl auf seinem Karren! Dessen Einsilbigkeit war dem ständigen Alleinsein geschuldet. „Ich fahr gleich weiter ins Stift nach Quedlinburg. Wenn ihr Zeit habt, besucht die Stadt. Is nich so imposant wie Halberstadt, aber die Weiber dort sind weniger widerspenstig.“ „Ach… ja?“ „Wenn ich’s doch sage!“ Und nun wurde er doch redselig. „Ich kuschel mich heut Abend zwischn Margas dicke Schenkel. Sie hat genug Speck auf‘n Hüftn. Da werdn de letztn Frostbeuln warm. …Wirklich!“ Jean grinste. Händler müsste man sein! Dann hatte man keine Sorgen. „Ich danke euch schon jetzt fürs Mitnehmen.“ „Gern geschehn. …Bleibt ihr länger?“ „Glaub ich nicht!“, meinte Jean. Er prüfte in Gedanken, ob er alles, was er sein Eigen nannte bei sich trug. „Passt auf euch auf, Franzose.“ „Werde ich tun. Gott beschütze euch!“ Er bekam eine schwielige Hand in die Seine und war von der Kraft überrascht, mit der der Händler den Abschied besiegelte. Kurz bevor sich die Straße vor dem robusten Tor des Klosters verengte, ließ der Mann Jean vom Kutschbock springen. Er hatte die Kälte unterschätzt und mit ihr die Steifheit seiner Muskeln. Wie ein Schwert hieb ihm der Schmerz von den Füßen her durch den Körper. Es war fast, als zersplittere jeder Knochen. Er fluchte und vom Karren kam ein belustigtes Grunzen. Dann, als wäre das schon alles, wandte sich der Händler seinem Gaul zu, schnalzte und das klapprige Tier stemmte sich in die Riemen. Zu einem letzten Gruß hob er nochmals den Arm. Dann fand sich Jean, alleingelassen, vor den Toren der Stadt.
Was tat ein Mann, siebenundzwanzigjährig, aus Paris, bewandert in Griechisch, Latein, Philosophie, Mathematik und Waffenkunst, vor den Toren einer Bistumsstadt, in dem der Klerus und nur der Klerus das Sagen hatte? Genau hier versteckte sich der, den er suchte. Hier wo er niemandem auffiel, wo er einer unter vielen war. Missmutig raffte Jean seinen Mantel um sich. Die wichtigen Dokumente, die ihm die Reise erleichterten trug er unter der Cotte geschützt in einer, eigens für ihn eingenähten Tasche. Praktisch war die zusätzlich, wenn die Hände so froren, dass er das Gefühl bekam, sie fielen von den Armen. Dann schob er sie unter den Stoff und unter die gerollten Pergamente. Seine Münzen, eine Auswahl an Silberstücken verschiedenster Grammaturen, baumelten, ebenso wie eine massivsilberne Kette, unter der Kleidung auf der nackten Haut. Ein Beutel hing ihm direkt neben dem schweren Ordenszeichen vor der Brust. Ein Kleinerer in der Krümmung der Wirbelsäule über der Hüfte und der letzte, etwas unbequem, rechts neben seinen Hoden. Wenige Handmünzen trug er offen an einem Beutel links vom Fürspan am Gürtel. Rechts davon, tief versenkt in festem Hirschleder, steckte ein schmales Stilett. Seine einzige Waffe zum Zerteilen von Essbarem und zur Verteidigung seines doch recht kostbaren Lebens. Vor dem Aufbruch in Regensburg hatte er sich bei Bischof Conrad diplomatische Freibriefe und Passierscheine für die Domstadt beschafft. Gegen Silber. Dafür bekam er jeden Wunsch erfüllt. Ein wenig halfen ihm zusätzlich sein Erscheinungsbild, seine Statur, die tiefschwarze, gut gemachte Kleidung, das wirre schon etwas zu lang gewachsene Haar, das Ordenszeichen und das Schweigen, dass ihn umgab. Wenige, wie der Händler hatten etwas Vertrauen genossen. Der Mann war zu weit gereist, zu erfahren, hatte seinen sanften Akzent erkannt. Gott Lob begnügte er sich mit seinem Vornamen und seiner Herkunft aus der Stadt an der Seine. Nun, vor dem robusten Tor des Klosters sann Jean über seine weitere Vorgehensweise nach. Wichtig war Aufwärmen, damit er diesen Tag überstand und Nahrung. Reinigen wäre nicht von Übel. Der Geruch des Händlers und der Reise haftete wie Rauch in seiner Kleidung und in seiner Nase. In der Stadt fand sich gewiss ein Badehaus. Danach die Lage peilen. Er musste unbedingt den Weg der Drachenprozession erkunden. Dann der unvermeidliche Besuch beim Vater. Und morgen kam der Tag der Abrechnung.
Lautstark ließ er seine Handknochen gegen das eichene Tor des Zisterzienserinnenklosters schlagen. Es hallte im hohen Torbogen nach. Einmal, zweimal, dreimal. Wartend sah er an der Mauer entlang und erkannte im oberen Teil Fensternischen. Weiter rechts hörte er einen Bach plätschern. Knarksend bewegte sich ein Riegel und überrascht, dass so früh am Morgen doch jemand sein Begehr erhörte, sah er auf den Torflügel vor sich. Langsam, weil so gewaltig, öffnete der sich und eine junge Ordensfrau mit fragenden runden, sanften Rehaugen blinzelte ihm entgegen. „Quid cupis? Was begehrt ihr?“, fragte sie. Jean versuchte, trotz der Kälte ein gewinnendes Lächeln. „Cupio locum apud focum sedere! Einen Platz am Feuer!“ „Quis es? Wer seid ihr?“, kam es misstrauisch. Er griff unter die Cotte und beförderte eines der Pergamente hervor. „Amicus sum! Ein Freund!“, betonte er. Die junge Ordensfrau nahm das Schreiben entgegen, entrollte es, las darin, musterte ihn und lächelte dann entschuldigend. Mit einer knappen Verbeugung trat sie zur Seite und gab ihm durch eine einladende Handbewegung zu verstehen, einzutreten. Er dankte und stieg über die hohe Schwelle unterhalb des Flügels. Die junge Ordensfrau ging still voran. Durch den gewaltigen Torbogen einmal hindurch öffnete sich vor Jean ein riesiges Gelände. Es war eingefasst in eine Rotunde aus verschiedensten Bauten, deren Rückwand die Außenmauern des Klosters bildeten. Sie umfassten einen Innenhof mit Wirtschaftsgebäuden vor ihm, einen Taubenturm rechts und eine Basilika links. Ungewöhnlich für ein Kloster. Es erschien wie eine Festung. Etwas irritiert folgte er der Ordensfrau am Taubenturm und einer tief eingelassenen, mit Ochsenkarren zu befahrenden Dunggrube entlang. Hühner pickten freilaufend Korn aus dem hart gefrorenen Boden. Alles in allem schien die Welt der Zisterzienserinnen im Reinen. Ohne zu verweilen führte ihn die Ordensschwester in eines der Wirtschaftsgebäude. Sie ließen eine Tür, einen langen Flur und einen Raum mit grob gezimmerten Tischen und Bänken hinter sich. Dann verhielten sie ihren Schritt vor einer weiteren Tür. „Voila, …la cuisine!“ Ohne Umstände verfiel sie in seine Muttersprache. „Schwester Hildburg sorgt für euch.“ Mit einem gutmütigen Lächeln und einem wahrlich verzückten Augenaufschlag, den er ihr gar nicht zugetraut hätte, verabschiedete sie sich. Still entschwand sie durch den Flur. Eine Abzweigung nach links verschluckte sie. Jean verweilte nicht länger. Ein Traum aus Geborgenheit lag direkt vor ihm. Beherzt trat er durch die massive Tür. Zusammen mit der Wärme entfachter Herdfeuer schlug ihm der Geruch von Kohl entgegen. Sofort meldete sich Hunger und sein Magen verkrampfte sich allein bei der Vorstellung nach einem Teller heißer Suppe. Etwas deplatziert sah er sich in dem gewölbeartigen Raum um. Jemand schnaufte in einem der Nebenräume und dann erschien schon eine kleine Person in Ordenstracht, ächzend beladen mit einem Halbzentnersack Getreide. Spontan sprang er hinzu und fing die Last ab, erhielt einen überraschten Aufschrei und ein beschwörendes Gemurmel. Nachdem sich die Schwester bekreuzigte und ein stilles Gebet gegen die Küchendecke gerichtet hatte, fokussierte sie ihn. „So früh am Morgen!“, stöhnte sie. „Schwester Hildburg?“ „Die bin ich!“ Auch ihr reichte er das Pergament, welches ihm am Tor Einlass gewährte. „Von Bischof Conrad! …“, murmelte sie und ihr anerkennender Blick maß ihn. „Wie geht es denn dem guten Mann? Hat er seinen Dombau endlich beendet, oder erstickt er nach wie vor in Schulden?“ Jean konnte sich eines Lächelns nicht erwehren. Das zarte Persönchen wartete nicht auf eine Antwort, schob sich die weiten Ärmel der Ordenstracht über die Unterarme und entfernte sich in Richtung Feuerstelle. „Ihr müsst halb erfroren sein. Was macht ihr bei diesem Wetter draußen vor der Stadt?“ „Hinein wollen!“ „Ah, …heute!? …Ihr kommt, um zu feiern?“ Freundlich strafend war ihr Blick. „Natürlich!“ Sie seufzte. „Wenn es euch recht ist, benötige ich lediglich einige Minuten an eurem Feuer.“ „Blau gefroren, halb verhungert und verdurstet und schmutzig noch dazu.“, schimpfte sie. „Was ihr braucht ist heißer Wein, eine Schüssel Hirse und ein reinigendes Bad … Bischof Conrad wäre nicht erfreut, würde ich euch ohne all das wieder gehen lassen. …Legt ab und ruht aus. Hier seid ihr willkommen.“ „Gott vergelt’s!“ Das hatte er in Regensburg gelernt. Schwester Hildburg dankte es ihm. Er nahm auf einem der groben Stühle neben dem Feuer Platz. Müde öffnete er die Schnallen des Mantels, ließ ihn nach hinten fallen, streckte die Beine in Richtung Feuerstelle und lehnte sich zurück. Innere Kälte ließ ihn schaudern. Schwester Hildburg schlurfte inzwischen in einen weiteren Raum, befahl dort jemanden den Zuber zu füllen und kam zurück. Das Lächeln auf ihrem alternden Gesicht war fürsorglich freundlich. „Was tut ihr so in Paris?“, plauderte sie. „Ich bin magister artium, Gelehrter, an der Sorbonne.“ Jean verfiel wie so oft in Erklärungen. „Wirklich? …Das war seine Exzellenz unser Bischof Albrecht auch. Aber dann ist er nach Wien gegangen und hat dort die Universität geleitet.“ „Tatsächlich!“ „Bis seine Heiligkeit Papst Urban ihn zu uns hier nach Halberstadt berufen hat.“ In ihren Worten schwang Stolz mit. Und während sie dampfenden, gewürzten Wein aus einem Kessel in einen Krug füllte, schnatterte sie weiter. „Kaum zu glauben! Ich hätte euch nicht für einen Gelehrten gehalten. Einen Ritter eher, …mit Verlaub, oder einen Wächter! Ihr seid in eurer Statur viel zu stattlich.“ Sie wurde sogar rot und das berührte ihn peinlich. „Nein wirklich nicht! Ich bin geübt in Sprachen, …in Mathematik, in Philosophie. Das Schwert kann ich nur mäßig führen.“ Ihr Blick schnellte auf seinen Schwertarm. Aber sie beließ es bei seinem Wort. Sorgsam stellte sie den Wein neben ihm auf den Rand der Feuerstelle. „Wärmt euch!“, murmelte sie sanft. Er sah ihr grübelnd nach. Kaum konnte sie gefährlich werden. Sie hatte in den letzten Jahren diese Räumlichkeiten gewiss nicht verlassen und würde es in den nächsten auch nicht tun. Ihr Platz war hier. Sie sorgte für den Orden. Was interessierte schon ein Reisender unter vielen? „Dieses Kloster! …Wie kommt euer Orden an so ein ansehnliches Gemäuer?“ Seine Frage schien sie nicht im Mindesten zu kränken. Sie lächelte, still dankbar und gab sofort die Erklärung. „Es gehörte einst den Templern. Sie stifteten vor fast einhundert Jahren eine Kommende. Ein Glücksfall für uns. Das Kloster liegt zum einen sehr geschützt und ist zum anderen gut zu verteidigen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es je beraubt wurde.“ Vorsichtig setzte er den Krug an die Lippen. Genussvoll schlürfte er die ersten Schlucke, dankte Gott für diesen Trank und schloss müde die Augen.
Schwester Hildburg stand nah bei ihm, legte sogar behutsam die Hand auf seine Schulter. Jean blinzelte. Er war eingeschlafen. „Der Zuber wird gleich fertig sein. …Ihr kommt doch wohl allein zu recht?“ Er wollte sich erheben, aber sein Körper war wie zerschlagen. Schuld war der Karren. Eindeutig. Und die Kälte. Mütterlich reichte sie ihm die Hand und half beim Aufstehen. „Lasst euren Mantel hier. Ich werde ihn ausbürsten.“ Sie geleitete ihn in einen benachbarten düsteren Raum, in dem ein dampfender Zuber stand. Ein großes Stück Seife lag auf dem Tisch und leinendes Tuch hing in Griffnähe an einem Haken. „Ihr habt nichts dagegen, wenn ich euch bitte die Tür von innen zu verschließen?“ Und dieses Mal war er es, der errötete. Später, als er sich all der Kleider und Utensilien entledigt hatte, die dann klamm ihren Platz vor dem Badeofen fanden, glitt er tief in angenehm heißes, nach Kräutern duftendes Wasser. Lange würde die Genugtuung nicht währen, weil es niemanden gab der es nachfüllte. Aber schon jetzt war es mehr, als er vor einer Stunde erwartet hatte. Gegen Mittag, den Reisestaub von Haut und Haar gewaschen, den stoppeligen Bart gekürzt, gewärmte, gebürstete Kleidung am Körper und den Bauch vollgeschlagen mit gebuttertem Hirsebrei, stand Jean in der Küche des Klosters, die Hand Hildburgs in die Seine nehmend. „Ihr seid immer ein gern gesehener Gast. Solltet ihr in der Nähe sein, schaut zu uns herein.“ „Das werde ich sehr gern tun. Gebt der Mutter Oberin meine Spende und richtet ihr meinen Dank aus.“ Er legte ihr zwei seiner Silberlinge in die Handfläche, auf die sie starrte und entschieden den Kopf schüttelte. „Bitte! …Nehmt es!“, bat er. „Gott sei mit euch Jean!“ Er erwiderte ihren Gruß mit einem aufrichtigen, herzlichen Lächeln. Dann warf er sich den Mantel über, schloss ihn schon im Gehen und stapfte durch den langen Flur dem Ausgang zu. Auf dem Gelände, nicht weit von der Tür, die er aufstieß, um ins Freie zu gelangen, standen Ordensschwestern beieinander. Sowie er vor sie trat, wandten sie sich scheu ab, tuschelten und kicherten und scharten sich enger zueinander. Nur eine der Schwestern schälte sich aus der Gruppe. Wieder betrachteten ihn große rehbraune Augen, versucht unschuldig, aber mit einem kecken Augenaufschlag. „Ihr verlasst uns mein Herr?“ Sie übernahm wieder seine Landessprache und er bejahte. „Wohin reist ihr von hier aus?“, fragte sie. „Nicht weit. Hinauf in die Stadt, …das ist mein Ziel!“ Sie räusperte sich. Ihre rosa Wangen und die fest aufeinandergepressten Lippen zeugten von den Gedanken, die geradewegs durch ihren Kopf surrten. Mit einem Seitenblick auf die Ordensschwestern flüsterte sie: „Ihr seid gekommen, das Spiel zu sehen?“ „Es ist weit berühmt. Selbst in Rom redet man in diesen Tagen über nichts anderes. …Das lass ich mir gewiss nicht entgehen!“, trumpfte er auf. Murmelnd bekreuzigte sie sich und schnappte nach Luft. „Ihr ward demnach noch nie zugegen?“, fragte er und als hätte er ihr ein unmoralisches Angebot gemacht, wandte sie sich schroff um und lief in Richtung Torbogen voraus. Etwas irritiert folgte er. „Ist es den Kanonikern vorbehalten? Ist es das? Man sagt, die Prozession führt schon durch die ganze Stadt, folgt der Mauer am Kanonikerkloster entlang durch einen schmalen Durchlass wieder hinauf, bis in die Stiftskirche hinein…“ „Und wenn es so wäre…“, fuhr sie herum. Hektische, rote Flecken schmückten ihre Wangen. Er starrte sie an, beschwichtigte sie und blieb stehen. „Ich war der Meinung es ist ein öffentliches Freudenfest, weshalb so pikiert?“ „Öffentlich, …einem Volksfest gleich! Aber doch nicht innerhalb der Stiftsmauern! Bischof Albrecht interveniert seit Jahren. Es gibt nur Ärger. …Und immer wieder kommen neue Scholare, wohl wissend, neben der ausgelassenen Stimmung fließt der Wein in Strömen. Sie singen Lieder, die jedem gottesfürchtigen Menschen die Haare zu Berge stehen lassen und am Ende schlagen sie dem Drachen den Kopf vom Hals.“ Sie zischte es und betrachtete ihn angewidert. Ihr Gebaren war der reinste Vorwurf „Ja nun!“ Ihm war gar nicht klar, was so tragisch daran war. „Der Klerus geht doch der Prozession voran.“ „Die ist ja auch nicht das Übel!“, zischte sie und wandte sich wieder voraus. Jean sah ihr nach, bevor er folgte. Seine Neugier fraß sich umso fester. „Ihr habt mir noch gar nicht euren Namen verraten. Schon möglich, dass ich morgen wieder vor der Pforte stehe und dann wäre es schade, wenn ich nicht mal wüsste wie ihr heißt, …Schwester!“ Er rief es, so schnell war sie vorausgeeilt. Schon hörte er den Riegel des hohen Tores knarksen. Der Wind pfiff unerträglich eisig durch den entstandenen Korridor, blähte die Ordenstracht der jungen Frau, aber sie stand unbewegt. „Ich bin unwissend, verzeiht!“, entschuldigte er. Sie ignorierte die Art, wie er sich zu ihr neigte. ‚Typisch Nonne!‘, bewertete er für sich. „Dann wünsche ich euch trotzdem noch einen angenehmen Tag, Schwester!“ Es sollte belustigt klingen. Er warf die Kapuze über den Kopf, raffte den Mantel, um ihn sich schützend um den Leib zu schlagen und stieg zurück, über die hohe Schwelle hinaus auf die Straße. „Agnes“, sagte sie. „Schwester Agnes, von Gottes Gnaden!“ „Habt meinen Dank für den Einlass, Schwester Agnes!“ Mit einem heftigen Schwung schlug das Tor direkt vor seiner Nase zu. Nach einem prüfenden Blick in die Umgebung wandte er sich nach links, den schmalen Weg entlang in Richtung Bach, dessen Plätschern er schon am Morgen vernommen hatte und der den Namen Holtemme trug, wie er zuvor von Schwester Hildburg erfahren hatte. Kaum war er über die eichene Bohlenbrücke gegangen, ragte das überdimensionale Stadttor vor ihm auf. Beide Flügel waren geöffnet. Menschen, laut lachend, oder in Zwiegespräche vertieft, kamen ihm entgegen, grüßten die Wachen salopp beim Verlassen der Stadt, ohne sich aufhalten zu lassen. Einen Moment beobachtete Jean die Lage. Jeder kam unbehelligt hinaus. Die, die hineinwollten, wurden aufgehalten. Viele zeigten Dokumente vor, die man eingehend prüfte. Aber immer fand sich ein Lächeln in den Gesichtern der Wachen. St. Hilarii, natürlich! Das Freudenfest. Jean wägte ab, welches der Papiere unter seiner Cotte ihm hier nutzte, um nur einen geringen Verdacht zu erregen. Er entschied sich wieder für das Schreiben des Bischofs aus Regensburg. Wenn man später seiner Spur folgte, war das der einzige Anhaltspunkt. „Was ist euer Begehr?“ Schon wurde er aufgehalten. Er zog das Dokument hervor. Der Wächter musterte ihn misstrauisch. Ein Blick, der Jean bei den vor ihm Durchgelassenen nicht aufgefallen war. „Tragt ihr Waffen außer dem Stilett an eurem Gürtel“, wurde er gefragt. „Keine Waffen!“ „Aus Regensburg also…“, sinnierte der Mann. Wieder wurde Jean gemustert. „Wir wollen keine Scherereien in der Stadt. Verhaltet euch ehrbar, sonst werdet ihr hinausgeworfen.“ Er versuchte etwas zu erwidern. Verärgert straffte er sich, aber der Mann gab ihm schon das Schreiben zurück, schlug es unsanft gegen seine Brust und bremste mit herausforderndem Blick seinen Zorn. Vorsicht war geboten. Wenn sich die Wache später an ihn erinnerte … Mit einem entschuldigenden Nicken umrundete Jean den Mann, ließ das Pergament wieder verschwinden und stapfte offenkundig betroffen die ersten Meter in die Stadt. „Trotzdem viel Spaß!“, wurde ihm nachgerufen. Ein leiser Fluch passierte Jeans Lippen und das gefährliche Glitzern in seinen Augen verbarg er unter der Kapuze. Erst später hob er den Kopf erneut und sah sich um. Das Tor lag weit zurück, war nur ein schmaler Durchlass in einer gewaltigen Mauer aus gehauenem Sandstein. Innen war sie von einem hölzernen Wehrgang umgeben, auf dem ebenfalls Wachen patrouillierten.
Nach zwei Stunden hatte er die Stadt durchkämmt. Er war mit etwas Hilfe der Einheimischen eine Runde durch die Straßen gelaufen, war beeindruckt stehen geblieben, weil er die Vielzahl an wohlgefälligen Häusern nicht vermutet hatte. Dann wandte er sich der Domburg zu, die links neben ihm aufwuchs. Er hob den Blick rechts von sich, entlang einer nach oben hin schier nicht enden wollenden steinernen Wand und er erkannte St. Martini. Just in diesem Moment schlug die Glocke an. Der Boden unter ihm geriet in Schwingung. Leise summten die Schläge. Dann folgte die dumpfere Glocke St. Stephanus dem Geläut und erinnerte ihn daran, dass es Zeit wurde, den Weg zur Domburg einzuschlagen. Gleich neben ihm erkannte er Stufen, die geradewegs hinaufführten. Ohne zu verweilen hielt er darauf zu, erklomm die Treppe und wurde zwischen zwei Häusern forsch von einem Mann in schwarzer Robe ausgebremst. Jean lugte an ihm vorbei, das erste Ziel nach der Stadtbesichtigung zum Greifen nah. „Quid tuum desiderium est? Was ist euer Begehr?“ Er ließ sich nicht beirren. Der junge Scholar vor ihm war kein Hindernis. Stumm zog er dieses Mal eine weitere kleine Rolle aus der Cotte und überreichte sie dem Geistlichen. Eine Minute später durchquerte er die enge Gasse, durch die der Wind unerträglich eisig pfiff. Dann auf einer Freifläche angelangt, stand er geblendet von der schräg stehenden Sonne und starrte zum majestätisch anmutenden St.Stephanus-Dom hinauf. Das riesige Kirchenschiff umrundet von einem filigranen Skelett reinster gotischer Steinmetzkunst, entlockte Jean ein begeistertes, anerkennendes Kopfnicken. Mit dieser Imposanz konnte sich ein Regensburger Dom, der wahrscheinlich niemals fertig werden würde, nicht messen. Langsamer, sich die Umgebung und die Abfolge der Gebäude, die sich an den Seiten der Burg aneinanderreihten, einprägend, steuerte Jean über den überdimensionalen Platz, direkt auf das Stift St. Maria unserer lieben Frauen zu. Er sah sich nach St. Stephanus um, dessen helle Sandsteinmauern in der Sonne strahlten. Die Basilika vor ihm war älter, die Mauern geschwärzt von den überdauerten Jahren. Deren Türme waren stattlich, ragten schon lange in dieser Anmut über den Dächern der Stadt. Niemand würde in der Zukunft auf die Idee kommen sie, wie diesen Dom, zu erneuern. Dazu war sie zu bedeutend. Die wenigen Geistlichen die Jeans Weg kreuzten, verkrochen sich in ihre weiten Roben. Keiner beachtete ihn. So fand er allein den Weg vor ein zweigeschossiges, gefachtes Haus mit kleinem Vorgarten, in dem sich verzweigte Kletterrosen knöchern an die gekalkte Hauswand lehnten. Wieder, dieses Mal, wohl wissend sich gleich verständlich zu machen, klopfte er laut an die verzierte Haustür. Ohne Umschweife öffnete sich diese und ein Mann in schwarzer Ordenstracht erschien. Er fragte, mit offenkundigem Misstrauen in der Stimme und einem abschätzigen Blick über seine Kleidung, nach Jeans Begehr. Wieder kramte er die Rolle hervor, spähte scheu in das dunkle Innere des Hauses und holte tief Luft. „Wir erwarten seine Exzellenz pünktlich zur Mette. Er ist in atimo nicht zu sprechen.“ Enttäuscht verharrte Jean. „Sprecht nächste Woche noch einmal vor!“ Schon trat der Mann zurück in den Flur, aber er streckte den Arm aus. Er nannte seinen Namen und rief, dass er am gleichen Abend wiederkommen würde. Die Türe war zu. Etwas ziellos stand er da, links neben sich die Stiftskirche der Kanoniker St. Maria, die Örtlichkeit des morgigen Drachenspiels. Er entschied sich, den Weg am Kreuzgang der Basilika entlang zu schlendern. Womöglich eröffnete sich die Chance auf einen Blick in das Innere. Hier würde die Prozession enden, das stand außer Frage. Viel entdeckte er nicht. Der Weg war wie der Rest des befestigten Burgplatzes ausgefahren, zertrampelt und steinhart gefroren. Wenn das Wetter am nächsten Tag nicht hielt, so schlimm die Kälte auch war, würde das Gefolge des Drachens im Morast stecken bleiben. Es war fraglich, ob das die Narretei schmälern würde. Wenn nur ein Bruchteil von dem stattfand, was schon jetzt an Euphorie und Ausgelassenheit in der Stadt spürbar war und neben seiner Ungeduld und Rachegelüsten, in seinen Vorstellungen Gestalt annahm, eintraf, so war ein aufgeweichter Weg das geringste Problem der Prozession. Die niedrige Pforte an der Südseite des Kreuzganges, ein Einlass nicht größer, als für einen Mann gebaut, war fest verschlossen. Jean prüfte sogar die eiserne Klinke, aber hier endeten vorerst seine Bemühungen in das Innere des Stiftes zu gelangen. Er sah den abfallenden Hang hinab. Der Weg führte an dieser Stelle durch ein Tor, einen schmalen Durchlass und einem weiteren, unteren Tor aus der Domburg heraus, in die tiefer gelegene Stadt. Links standen Gebäude, schon baufällig. Rechts schien es einen kleinen Platz zu geben. Dort knickten die Außenmauern des Stiftes ab. Jean beschloss sich das Treiben herein und hinaus für eine gewisse Zeit anzusehen. Vielleicht eröffnete sich eine passable Möglichkeit für einen Platz beim morgigen Durchzug der Prozession. Gegen den Strom hereinkommender Scholare, bewegte er sich den Hang hinab. Er erreichte, den sich vorher gedachten kleinen Hof, war aber irritiert, weil zwei der drei dort stehenden Häuser verfallen waren. Nur das Mittlere standgehalten von den Außenmauern der Ruinen. Jean verweilte, da der kalte Wind abebbte und der Ansturm der Geistlichen zunahm. Vorsorglich zog er die Kapuze tiefer ins Gesicht. Kein Mann kam unbeobachtet an ihm vorbei, aber der, nach dem er Ausschau hielt, war nicht unter ihnen. Dienstboten zogen auf die Domburg, bepackt mit Körben oder beladenen Karren, an Riemen hinter sich herziehend.
Ehrfürchtig nahm Katharina den kleinen Kupferkessel vom Fenstersims des Küchenfensters. Sie hatte bevor seine Exzellenz nach dem Süppchen verlangte zwei Portionen für sich entnehmen dürfen. Dankbar küsste sie dessen Siegelring und wisperte eilig ein Sanctus, bekreuzigte sich und eilte dann zurück in die Küche, um ihm aufzutragen. Jetzt ruhte der kleine Kessel in ihren Händen, der Inhalt angefroren von der Winterkälte, damit sie auf dem Weg hin zum Dekan und nach Hause nichts verschüttete. Schnell wickelte sie sich in die Wolldecke, die ihr als Mantel diente, zog sie quer über den Kopf. So schützte sie sich zusätzlich vor dem Ungemach der Witterung. Bruder Baltus prüfte, ob sie nicht doch mehr in den Händen hielt, bevor er ihr die Tür zur Domburg hin öffnete. Ohne ein weiteres Grußwort entließ er sie. Sofort griff die Kälte zu, biss sich in ihre Hände, zwickte sie in die Nase und fuhr ihr ungestüm unter die Kleider. Schlotternd und krampfhaft bemüht ihren Schatz unbeschadet zu retten, eilte sie voran. Das Haus des Dekans war nur wenige Schritte quer über die Domburg entfernt. Sie setzte den Kessel wieder ab, schlug hart mit den steifen Fingerknöcheln gegen die Tür der hochherrschaftlichen Behausung. „Nun komm schon!“, ächzte sie, kleine Wölkchen Atem ausstoßend. Der Riegel schlug mit einem heftigen Krachen zurück und ein junger Ordensbruder erschien, sich hinter dem Türblatt vor der Kälte schützend. „Da bist du ja!“, empfing er sie etwas gehetzt. Katharina nahm den Kessel wieder auf, huschte an ihm vorbei und schon schlug die Tür zu. „Tut mir leid. Seine Exzellenz…“ „Schon gut. Ich habe nur auf dich gewartet, um dir zu sagen, dass meine Anwesenheit im Kloster verlangt wird. Du brauchst nicht wieder zuriegeln. Seine Hochwürden werden nach dem Mahl direkt hierherkommen und sich zur Ruhe begeben. Er hat am Abend noch eine wichtige Versammlung.“ Katharina nahm es auf, mit einem mulmigen Gefühl, nicht aber ohne Sorgfalt für den Kessel, den sie in sicherer Entfernung auf dem Tisch der Küche platzierte. Sie bedachte ihn mit einem prüfenden Blick und einem hungrigen Magengrummeln, bevor sie den jungen Mann musterte, der unschlüssig hinter sie trat und ihr Tun beäugte. „Dann geh! Haben seine Hochwürden nach etwas Bestimmten verlangt? Und wann bist du wieder zurück?“ „Nichts Bestimmtes und ich kann dir nicht sagen. Ich habe noch eine Lehrstunde nach der Non. Vergib mir, aber ich darf sie nicht versäumen.“ Die Fürsorge des jungen Bruders war durchtränkt von seinem Gewissen und tief gewurzeltem Pflichtbewusstsein. Krampfhaft zerknautschte er, wie es seine Art war, vor Verlegenheit, die weiten Ärmel seine Kutte. „Ich komme schon zurecht.“, beschwichtigte sie ihn und legte sanft die Hand an dessen Schulter. „Hab Dank für deine Mühe.“ Mit einem erleichterten Blitzen in den Augen wurde er wieder agiler, nahm die Ihre und strich mit der andern darüber. „Gott sei mit dir!“ „Und mit dir!“, gab sie zurück. Schon drehte er sich weg, griff nach der Kapuze und zog sie sich über die Tonsur tief hinunter ins Gesicht, sodass die Kälte auf dem Weg bis zum Kloster ein Einsehen mit ihm haben würde. „Komm, ich lass dich hinaus!“, unterstützte sie ihn. „Gott ist mit dir!“, murmelte Bruder Caspar wieder und floh regelrecht aus dem Haus. Katharina blieb zurück, starrte ihm nach und erschauerte erneut ob der Kälte. Dann schloss sie die Türe leise und wandte sich dem stillen Flur zu, der vor ihr lag, genau wie jede Menge Arbeit, bis Dechant Wulbrecht, sicher bald, sein Haus aufsuchte. Eilig prüfte sie, ob Bruder Caspar das Feuer im Salon entfacht hatte. Wärme schlug ihr entgegen und mit einem Rundumblick erkannte sie, wie umsichtig der junge Scholar seine Arbeit verrichtete. Zeit sich dem heimeligen Kaminfeuer hinzugeben blieb ihr nicht. Wieder fiel ihr der Kessel ein, den sie dringend vor den Augen des Hausherrn in Sicherheit bringen musste, bevor dieser der Meinung war, sie hätte ihm sein Abendmahl gerichtet. Sie huschte zurück in die Küche, öffnete einen Fensterflügel und stellte die Mahlzeit hinaus. Dann entfachte sie mit steifen Händen das Herdfeuer. Sanft blies sie hinein, bis die kleine Flamme Nahrung fand und den Herd zum Leben erweckte. Flugs hastete sie in das Schlafgemach des Dekans, dessen Bett rein und die Kleider in den Truhen verstaut waren. Das kannte sie anders. Aber hier war Bruder Caspar umsichtig zu Werke gegangen. Katharina fragte sich nicht zum ersten Mal, ob die Beweggründe des Scholars dieses Haus zu hüten, aus Angst und Ergebenheit geschah, oder weil er vom Dekan wie ein hoch geschätztes Kleinod gehalten wurde. Sie verstand nur das Erstere, nicht seine Dienstbeflissenheit aus Hochachtung. Mit diesen Gedanken schleppte sie sich, müde und von einem heftigen Magenkrampf begleitet die Treppen in den oberen Stock hinauf, in dem die Schreibkammer und Wirtschaftsräume des Hauses lagen. Hier hatte Bruder Caspar nicht gewirkt. Zum einen blieb ihm die Schreibkammer verwehrt, weil Dekan Wulbrecht niemandem vertraute und ständig befürchtet, jemand las seine Korrespondenz. Zum anderen hatte der junge Mann keine Hand für Bettleinen und die organisatorischen Fähigkeiten eines geordneten Haushaltes. Dafür war Katharina zuständig. So hatte es sich zwischen Ihnen eingespielt. Sie prüfte das Schreibpult des Dekans, sortierte halb beschriebene Pergamente, sah nach, ob das Tintenfass gefüllt und wieder fest verschlossen war, spitzte den Federkiel mit dem Messer an, dass sie, wie üblich, in der kleinen Schublade fand und rückte einzelne Möbelstücke zurecht. Mitten hinein in das Scharren des schweren Sessels schlug im Erdgeschoss die Tür. Der Hausherr kam und mit ihm das erste Gebrüll. „Trag mir heißen Wein auf!“ Katharina schloss, begleitet von einem harten Herzschlag die Augen und murmele still ein Ave-Maria. „Sofort!“, hauchte sie, wissend, dass seiner Hochwürden nichts an ihrer Antwort lag. Sie begab sich in die Küche, setzte einen Kessel über das Herdfeuer und goss aus dem Tongefäß, das bis oben hin gefüllt war, den gewünschten Wein ab. Währenddessen vernahm sie angestrengtes Schnaufen aus dem Salon. Wie so oft presste sie die Lippen fest aufeinander, rettete sich so vor heftigen Gefühlen, die sie auf Grund seiner erworbenen, lasterhaften Fülle wegen, heimsuchten. Umsichtig entnahm sie dem Schrank einen Weinkrug, schöpfte das dampfende Getränk hinein und trug dem Dienstherrn auf. Dieser lag, in einem roten Samtmantel gehüllt, gewohnt schief in seinem Sessel vor dem Kamin, die Augen halb geschlossen und schnaufte. Bevor sich der Dekan in den letzten Jahren all seiner Laster hingegeben hatte, war er ein stattlicher Mann, groß, und Furcht einflößend machtvoll. Das alles war er, doch kamen zu Blasiertheit und Arroganz feiste Haut und schwabbelnde Körperpartien. Katharina unterdrückte ein Schaudern. Sie platzierte den Krug auf den Tisch neben ihren Dienstherrn. Dieser folgte ihr, lauernd und abschätzig, aber er sagte nichts. Also knickste sie beflissen und huschte erleichtert aus dem Salon. „Du schickst mir deine Tochter morgen in das Stift, hörst du? Ich habe Zeugnisse für sie.“, keifte er ihr bis zur Küche hinterher und sie zuckte doch zusammen, ob der Schroffheit mit der er ihr die Worte nachwarf. Obschon, schlug ihr Herz vor Aufregung schneller. War das nicht alles, wovon Hannah die letzten Monate geträumt hatte? Ein Zeugnis für ihre Mühen. Sie hatte darum gekämpft, erst über sie, dann eigenständig nach den vielen Lehrstunden bei ihrem Lehrmeister selbst. Dieser schien nachzugeben. Endlich waren für Katharina die schmachvollen Monate vorbei. Jetzt hatte das Kind ihre ‚Bildung’, und Katharinas Schulden waren beglichen. Sie schüttelte die bedrückenden Gefühle ab. Wann hatte seine Hochwürden Zeit Hannah das Zeugnis zu geben? Morgen an St. Hilarii, dem Festtag der Stadt und dem Umzug des Drachens? „Schick sie zur vierten Stunde des Nachmittags ins Stift. Ich erwarte sie dort.“, warf er ihr nach, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Sie bekreuzigte sich und ließ seinen Wunsch unkommentiert. Natürlich würde sie der Tochter die Befehle ausrichten. Was blieb ihr schon übrig? Es wurde still. Sie huschte auf leisen Sohlen wieder ins Obergeschoss und vernahm ein tiefes Schnarchen. Dankbar verrichtete sie weiter ihre Arbeit, schnaufte, weil schweres Leinen gestapelt und dicke Packen Wäsche geräumt werden mussten. Katharina war nicht undankbar für die Mühe. So wurde ihr wenigstens etwas warm. Sie freute sich auf die nächste Tätigkeit, dem Geschirrspülen. Nicht dass sie sich nach verschmutzten Pfannen sehnte, aber ihre klammen Finger tauchen in heißes Wasser und das war für sie eine kleine Rettung. So genoss sie wenig später das warme Nass. Das Herdfeuer durchwärmte ihre Röcke, wärmte ihre Decke, die sie für den kurzen Weg ins Zuhause vorwärmte. Emsig schürte sie das Feuer, Glut stob und die nächsten Scheite landeten im Ofenraum. Dann wische sie sich die Hände an den Röcken ab, nahm die Decke auf und schlang sie sich gehbereit um die Schultern. Jetzt das Süppchen hereinholen und es ging endlich das Haus des Dekans. „Da staunt man aber nicht schlecht holde Frau Trebeck!“, tönte es hinter ihr. Bevor sie sich umwandte, wurde sie links und rechts an der Hüfte von Pranken gepackt. Der spitze Schreckensschrei verließ zeitgleich mit tiefen Schauern aus Angst ihre Lippen. Sie sackte kurz zusammen und stemmte ihre Hände gegen die des Zupackenden, verlor den Bodenkontakt, ließ die fremden Hände los, angelte nach der eisernen Umrandung des Herdes und haschte danach. Ein Verzweiflungsschrei entfuhr ihr und seine Hände griffen ins Leere, rutschten von ihren Röcken und sie entfloh einen Schritt zurück. Ihr nächster Griff, zum Schürhaken, war die Rettung. Sie krallte ihre Finger darum und wirbelte sich ihrem Angreifer entgegen. Der Dekan stand in der Tür, grinsend, zum Sprung bereit. Sein Blick blitzte. Er fuhr sich lüstern mit dem Handrücken über Lippen und Kinn, unschlüssig, auf welche Weise er sich ihrer habhaft machen sollte. „Ein Schritt weiter und ich schlag euch den Haken über den Schädel!“, drohte Katharina. Ihr irrsinniger Mut erschreckte sie. Die bedrängende Situation ließ sie den Haken demonstrativ über ihren Kopf schweben. „Ahhh ja!“, staunte Wulbrecht, nicht überzeugt. „Keinen Schritt,“, japste sie, „...weiter.“ Sein Gegrinse wurde schief, schlug bedächtig um in Ungeduld. Eine Bewegung später, straffte sie ihre Haltung erneut gegen ihn. „Ach komm schon Trebeck, hab dich nicht so. Lass uns Spaß haben.“ Es war gelangweiltes Gemaule. Verunsichert, weil ihre Drohgebärde kaum Erfolg erzielte, ließ sie die Anspannung fahren. Genau in dem Moment griff er erneut zu, entwand ihr den Schürhaken, frohlockte schallend. Das Eisen schlug scheppernd auf den Boden, vermischt mit ihrem Wehschrei. Sie drehten sich und Kathrina floh, gefolgt vom Dekan, der an ihren Röcken zerrte, durch den Türrahmen in den freien Flur. Dort stürzte sie, fiel, schlug hart auf, wurde wieder hoch gezerrt, gegen die Wand geschupst. Er folgte ihr und presste sie schwer atmend gegen weiche Knüpfteppiche. „Das du immer so störrisch sein musst Weib!“, beklagte er sich schnaufend, ohne auf ihre Gegenwehr zu achten. Er zerrte ihr die Haube vom Kopf, griff ihr ins Haar und schob ihr sein Knie zwischen die Schenkel. Vor Katharinas Augen explodierten gleißende Kreise. Panik schnürte ihr die Kehle zu. Der Zug an ihr war fest und eindeutig. „Komm schon…“, wiederholte er und sein weinschwangerer Atem ließ ihr die Magensäure aufsteigen. Mit der freien Hand glitt er bedächtig ihren Rücken abwärts über ihren Po und er krallte seine Finger tief in ihr Gesäß, riss es aufwärts und verstärkte den Druck seines Knies zwischen ihren Schenkeln. Katharina schloss die Augen, war gefangen. „Schschscht…“, zischelte er nah neben ihrem Ohr, massierte fest ihr Fleisch. Sein wohliges Stöhnen entlockte ihr eine Gänsehaut. „Ahhh, ich weiß ja, dass du mir deine süße Punze nicht geben willst.“ Seine Hand glitt über die Röcke tiefer, traf auf die verbotene Zone, für die nur jeder Mensch selbst, laut Gott, das Recht hatte sie zu berühren. „Aber da gibt es noch so viele Möglichkeiten, glaub mir. Die sollten wir Beide jetzt endlich auch mal nutzen.“ Sein Druck gegen sie wurde stärker und in dem sie sich wand, verließ seine Hand den verruchten Platz, griff ihr in die Röcke und zerrte den Stoff aufwärts. „Dein zartes Fleisch …hat mich schon immer gereizt und wenn du nichts dagegen hast, werde ich dir jetzt mal zeigen, wie lustvoll es für mich ist, dir dein enges Loch hier hinten zu versilbern.“ Heißer Atem traf sie gemeinsam mit seinen sündhaften Worten. Überließ sie sich ihm, würde sie mit brennenden Schmerzen die nächsten Tage auf der harten Pritsche ihrer Behausung verbringen oder Hannah würde wütend toben, weil sie ihr Zeugnis nicht bekam. In Katharina schrie alles. Panik schäumte auf. In ihrer Lunge sammelte sich ein hilfloser Wutschrei und mit ihm zusammen trat sie nach hinten aus, hob den Hacken und rammte ihn zwischen Wulbrechts Beine. Sie erwischte weiche Körperteile, darüber sein schon straffes Glied. Ein Ruck sprang durch seinen Körper. Er ließ mit einem tonlosen Japsen von ihr ab. Kurz starrte sie in irre, aufgerissene Augen, in denen sich schmerzvoll Tränen sammelten. Mit einem Wimmern griff er sich an sein Geschlecht, grapschte wieder nach ihr, sank aber kraftlos in die Knie. Sie sprang von ihm fort, entriss ihm ihren Rock und fiel auf die Seite. Mühsam rappelte sie sich auf, hörte sein Schnaufen und Fluchen hinter sich und stürmte zur rettenden Tür. Mit letzter Kraft zog sie die schwere Pforte auf, japste von der Kälte getroffen und stürmte hinaus. Wie in Trance ließ sie die Tür ins Schloss krachen. Dann rannte sie, rannte, verlor unterwegs auf dem gefrorenen Boden wieder das Gleichgewicht, schluchzte und raffte die wärmende Decke um sich. Sie nahm die schneidende Kälte wahr, die Wolken hektischen Atems, Haarsträhnen, die gelöst um ihr Gesicht wehten. Sie fuhr sich mit den Händen hindurch, fingerte nach der schützenden Haube, zog sie sich zitternd über den Kopf und zerrte sich die Decke fest um den Körper. Dann starrte sie die vielen Schritte zurück zum Haus des Dekans und schluchzte sie auf. Erleichtert rang sie nach Luft, wischte Tränen fort, die sie gar nicht bemerkt hatte, die ihr aber eisig in die Wangen zwickten. Hilflos sah sie sich um, ob jemand ihre Notlage erkannte, wähnte sich allein und tat einen Schritt in Richtung zuhause. Dann plötzlich, als würde eine eiskalte Hand nach ihr greifen, kam das böse Gefühl, und mit ihr die Erkenntnis. Der Kessel mit der Suppe stand auf dem Fenstersims in Wulbrechts Haus. Sie schrie auf, erzitterte und die schmerzhafte Einsicht traf sie verletzend und brutal. Ihr Magen krampfte. Die Beine gaben nach und sie fiel, glitt hinab auf die Knie. Benommen blieb sie auf dem harten Boden hocken, vor sich das Bild der Stiftskirche unserer lieben Frauen. Gott kannte kein Erbarmen. Gott strafte unerbittlich. Sie schluchzte wieder, schloss erschöpft die Augen und überließ sich dem kalten Wind, der an ihren Kleidern riss und sie schaudern ließ. Sie hatte es nicht anders verdient.
Es war ein stetes Kommen und Gehen, aufregend, pulsierend. Die Kälte fuhr ihm unter die Kleidung. Der Mantel bot kaum Schutz. Es war Zeit für Gedanken an ein Nachtlager. „Was machst du da?“ Jean sah auf. In der Stimme des Mädchens, das wenige Schritte vor ihm auf dem Hof stand, schwang Argwohn mit. Ihre Ansprache kam forsch, so, als dulde sie keine fremden, herumlungernden Männer. Dabei zählte sie, so schätzte er, erst zwölf, dreizehn Jahre. Zu jung für derart selbstsicheres Auftreten. „Ich schaue nur!“, beruhigte er. Sein Blick, der dem Menschenstrom gefolgt war, hatte wiederholt gelangweilt den kleinen Hof überflogen, blieb aber an dem schmalen Mädchen haften. Er erinnerte sich. Sie hatte vor einer halben Stunde das Haus betreten, war vor knapp zehn Minuten auf dem Sims erschienen, hatte dabei seinen Blick gestreift und einen Eimer mit Schmutzwasser ausgeleert. Doch in die Arbeit, oder in Gedanken vertieft, war sie verschwunden. Jetzt, weitere zehn Minuten später hielt sie wieder einen Eimer zum Ausguss bereit. Sie stutzte. „Aah ja?“, frage sie. Gespielt neugierig betrachtete sie die ihr nur zu bekannte triste Umgebung und sah ihn dann herausfordernd an. „Wie heißt das hier?“, fragte er. „Was? …Der Hof?“ „Ja.“ „Katzenplan! …Weshalb?“ Ihr erschien es, als wolle er sie an der Nase herumführen. „Ist das das Tor, durch das der Drache fliegt?“ Er zeigte mit dem Kinn in Richtung Burgeingang. Ihr Blick glitt den kleinen Hang hinab. „Natürlich!“, sagte sie, als wüsste das jeder. Er nickte dankend. Im Begriff, sich von der Wand an der er lehnte abzustoßen, stellte sie den Eimer ab und hielt ihn auf. „Du willst dir das Fest morgen ansehen?“ Er wiegte abschätzig den Kopf, zuckte ratlos die Schultern und murrte: „Weiß ich noch nicht …vielleicht!“ „Woher kommst du?“ Ihr ungebührliches Interesse zerrte an seiner Geduld. Er bedachte die Kleine mit einem genervten Blick. Aber sie reckte keck die Nase. Wahrscheinlich setzte sie immer ihren Willen durch. Zudem hatte sie eine Art an sich, in der eine berührende Wärme mitschwang, die ihn aus seiner Verschwiegenheit herauslockte. „Aus Regensburg!“, gab er nach. Sie wiederholte den Namen lautlos für sich, prüfte dessen Klang, als hätte sie nie davon gehört. Dann war sie sich dessen bewusst und straffte sich. Womöglich meinte sie, er hielte sie für ungebildet. „Die Vorbereitungen laufen, …“ Sie wies salopp zum Durchlass. „Du solltest dich sputen. In zwei Stunden wird es dunkel, dann wird das Tor verschlossen.“ Er schmunzelte und gab doch seine Stellung an der Mauer auf. Er schlenderte die wenigen Schritte auf sie zu, gab ihr durch eine Handbewegung zu verstehen, sie hätte nichts Arges zu befürchten und sah mit einem nachdenklichen Blick den Hang hinab. „Kennst du ein gutes Gasthaus in der Stadt?“ „Vielleicht?“, konterte sie. Ein listiges Leuchten durchzuckte ihre Augen. Er lächelte. Sie verschaffte sich einen Vorteil, sehr gewieft. Ein halber Silberling würde draufgehen, allein, weil er sich in den engen Gassen der unteren Stadt nicht auskannte. Ärgerlich! Dann huschte ein Gedanke durch seinen Kopf, dem folgte ein nochmaliger Rundumblick. Warum sein Geld verschwenden? Die Stadt interessierte ihn nicht weiter. Die Vorbereitungen der Bevölkerung für das Drachenspiel ließen ihn unberührt. Allein dem Geschehen des nächsten Tages galt seine Aufmerksamkeit und dafür war das hier, der von Gott gegeben beste Ort. „Du bekommst ein Huhn von mir, für ein Nachtlager in eurer Küche.“, lockte er. „Da muss ich erst Mutter fragen!“, entschied sie. Ihre Antwort kam schnell, als bekäme sie an jedem Tag und zu jeder Stunde so ein verlockendes Angebot. „… und woher willst du ein Huhn nehmen?“ „Soll dir doch gleich sein! … Willst du es?“ „Stiehlst du es?“ „Seh ich aus wie ein verdammter Dieb?“, fuhr er sie an. Ihr Blick maß ihn prüfend. Es war erkennbar, wie dick und kostbar sein Mantel, und robust, mit Lammfell gefüttert, seine Stiefel waren. „Hannah!“ Der zurechtweisende Ausruf kam von rechts und mit ihm eine blonde, zierliche Frau. Sie hatte ein wollenes Tuch schützend um Kopf und schmalen Leib geschlungen. Jetzt, da schwere Mauern den Wind etwas abhielten, nahm sie den verschlissenen Stoff herunter und musterte die vor ihr stehenden und die Situation. „Mutter! … Ein Reisender.“, erklärte die Kleine nicht im mindesten überrascht. Schon wandte sie sich der Vertrauten zu, verbündete sich mit ihr, und beide betrachteten ihn argwöhnisch. „Er will uns ein Huhn geben und dafür bei uns nächtigen!“, äffte sie. „Ein Huhn! …Woher will er das nehmen? Doch nicht stehlen?“ „Nein!“, rief Jean wieder. Worauf hatte er sich da nur eingelassen? Eine Plage war anstrengend, aber zwei?! „Er sagt, er kommt aus Regensburg!“, schnatterte die Kleine weiter mit einem zweideutigen Blick zur Mutter. Sie fand sie diese Aussage allein schon völlig an den Haaren herbeigezogen. Er sah perplex zu, wie die Ältere der Beiden den Namen lautlos wiederholte. „Aus Regensburg!“, hauchte sie matt. Eine seltsame Erschöpfung schwang dabei mit. „Da seid ihr wohl wer?“ „Es war nur der Ausgangspunkt meiner Reise!“ „Er will sich das Spektakel morgen ansehen, aber ein Gasthaus ist ihm zu teuer“ Die Kleine sah ihn wieder herausfordernd an. Ihre Mutter maß ihn von Kopf bis Fuß, schien das für und wider abzuschätzen. Dann verzog sie unmissverständlich und argwöhnisch die Mundwinkel. „Wir beherbergen keine Fremden…“ Sie wandte sich schon ihrem Haus zu. „Ich kann den Silberling, den es kostet auch woanders hintragen, oder zusätzlich ein Huhn erstehen, …liegt ganz bei euch!“, schnappte Jean. Seine Entrüstung war nicht einmal gespielt. Beide, auch die Kleine, hielten ein. „Einen Silberling?“, vergewisserte die Mutter sich. Er zog die Brauen hoch. „Jean Marc Joubert…“ Seine vorgestreckte Hand, zeugte von dem Willen die Distanz zu überbrücken. Die beiden starrten ihn an, als hätten sie nie nur ansatzweise einen Namen dieser Art gehört. „Aus Paris…im Königreich Frankreich“, erklärte er und erhielt ein leichtes Aufatmen. „Katharina Trebeck, …meine Tochter Hannah.“ Die Mutter senkte den Blick. Er nahm ihre Hand und sie knickste ehrfurchtsvoll. Dann entriss sie sich wieder, raffte ihre Röcke und war schon im Begriff sich abzuwenden. „Bringt das Huhn!“ Mehr sagte sie nicht. Die Kleine stand verwirrt da, folgte dann der Mutter. Bevor sie im Haus verschwand, kippte sie das Schmutzwasser ihres Eimers erneut gegen die Mauern der Stiftskirche, wo es einen Augenblick später zu einem dunklen Klumpen gefror. Ohne sich umzuwenden, schlugen sie die Tür des Hauses zu. „Na ja!“, murmelte Jean. Da hatte ihn das Mädchen in Bedrängnis gebracht. Woher ein Huhn nehmen? Hier?
„C’est toi seigneur!“ Leuchtende Rehaugen gewährten ihm Einlass. Ein aufgedrängter Silberling ließ Schwester Hildburg gekonnt die Axt schwingen. Sorgsam verbarg sie das Federvieh in einem Jutesack, maß ihn und lächelte ihr billigendes Lächeln. „Gott vergelt’s!“, verabschiedete er sich. Die Wache am Tor stierte argwöhnisch in den Sack, erlaubte ihm ein Weitergehen, ohne erneut seine Integrität anzuzweifeln. Die Aufregung in der Stadt war deutlich greifbarer. Auf einem kleinen Platz vor dem Kanonikerkloster wurden Holzstapel errichtet. Geistliche beobachteten die Szenerie, gaben Anweisungen und gestikulierten aufgeregt. Die Stimmung blieb freudig erwartungsvoll. Jean passierte den schmalen Durchgang zur Domburg, ohne behelligt zu werden und war so, vor dem Dunkelwerden zurück am Katzenplan. Auf seinem Weg zu den Zisterzienserinnen hatte ihn das armselige Schicksal der beiden schmächtigen Frauen bewegt. Ihr Erscheinungsbild zeugte von Hunger, ihre Kleidung von Entbehrung und das Haus, in dem sie lebten ... Zuerst galt es ihm als profanes Mittel die Kleine mit einem Huhn zu ködern. Dann, im Nachhinein kamen Vorwürfe. Der resignierte Ausdruck in Katharina Trebecks Augen zeugte von der Ausweglosigkeit, die sein Angebot mit sich brachte. Also, so dachte er sich, würde er seinen Fauxpas bis zum nächsten Morgen mit Freundlichkeit und Zurückhaltung bereinigen. Vorsichtig, da die hereinbrechende Dunkelheit die Baufälligkeit der Behausung verschluckte, klopfte er an die klapprige Tür und wartete. Einen Spalt breit öffnete sie sich. Dann erschien die Kleine mit einem überraschten Grinsen und stemmte die Tür weit auf. „Siehst du? …Er ist doch da!“, rief sie ins Innere hinein und strahlte Jean gewinnend an. „Wir haben gewettet!“, erklärte sie leiser. Dann stand die Mutter neben ihr, musterte Jean skeptisch und stimmte zu. „Kommt herein!“ Er duckte sich, stieß trotzdem mit dem Kopf gegen den Türsims. Putz rieselte und er entschuldigte sich sofort für seine Ungeschicktheit. Im Gegensatz zur äußeren Fassade, war das Innere des einzigen Raumes, den es gab, sauber und strukturiert. „Ist das das Huhn?“, fragte die Kleine auf den Sack zeigend. Die Mutter schalt. Aber Jean verstand. Die großen Augen des Mädchens trogen nicht. Beide erwarteten die versprochene Bezahlung, noch bevor sie die Herberge garantierten. Ohne Umstände übergab er der Tochter das Entgelt, das ihn von einem unbekannten Eindringling zu einem gerngesehenen Gast aufsteigen ließ. Hannah wühlte auf ihrem Weg hin zum Tisch in dem Sack und jauchzte. „Aber das, …das sind ja zwei!“ „Ihr seid hoffentlich eine gute Köchin?“, meinte er an die Mutter gewand, die vor Überraschung schluckte. Katharina entwich erleichtert der Atem. Erstaunt sah Jean zu, wie Beide ehrfurchtsvoll über das geschmeidige Gefieder strichen. „Seid willkommen Herr!“ Die Mutter tat eine einladende Geste und das Mädchen neben ihr hüpfte vor Freude. „Darf ich Jean zu dir sagen?“ Und da er nicht dagegensprach, sprang sie auf ihn zu, half ihm aus dem Mantel und bot den Stuhl am Tisch an. Sie verharrte. „Wir haben nur Tee!“ Es klang etwas zaghaft. „Das klingt gut Hannah. …Ich darf doch Hannah sagen?“ Sie kicherte und wandte sich der Mutter zu, die abwartend danebenstand und zusah, wie einvernehmlich das alles geschah. Er begegnete ihrem Blick und schon zog sie sich zurück. „Nennt mich Jean, Katharina!“ Sie nickte scheu. Die nächste Stunde verbrachten sie einträglich. Jean beobachtete heimlich die vertraute und liebevolle Beziehung, die die beiden miteinander pflegten und versank in wehmütige Erinnerungen. Er ließ niemanden spüren, dass Eifersucht sich langsam, aber nachhaltig einem Gespinst gleich zwischen Gefühle wie Geborgenheit und Wärme flocht. Schmerzlich erstickte er finstere Gedanken, versuchte ab und an ein Lächeln. Hannah war ein quirliges, unbefangenes Mädchen. Jeder Schicklichkeit zum Trotz schälte sie sich aus einem dünnen Umhang, verbannte die Kappe und zeigte ihr blondes Haar. In ihrer kindlichen Neugier war sie nicht zu bremsen. Katharina verfolgte es mit gespielter Strenge. Jean kostete es aus. Es entspannte. „Wie hast du es eigentlich auf die Domburg geschafft?“, fragte Hannah später. „Mit einer Empfehlung des Bischofs aus Regensburg.“ „Ehrlich? Darf ich die mal sehen?“ Sie war hibbelig. Geschlagen gab er nach. „Du musst vorsichtig sein, das Siegel ist auf meinen Reisen von großer Wichtigkeit.“, mahnte er und sie besah sich ehrfurchtsvoll das Pergament des Bischofs, die wohlgeformten Schriftzeichen geschrieben mit echter, schwarzer Tinte und das Bischofssiegel, feuerrot, erhaben, würdevoll. Katharina strich darüber hinweg. Doch Hannah besah sich die Zeilen intensiver. „Er heißt Conrad, schau Mutter!“ Erstaunt musterte Jean das Mädchen, welches mit dem Zeigefinger auf den Namen des Bischofs wies. Aber er ließ sich nicht anmerken, wie es ihn erschrak. Katharinas Blick huschte zu ihm. Sie räusperte sich und nickte ihrer Tochter zu. „Da steht es, schau… Er ist ein Gelehrter, ein Magister, aus Paris… Er ist kein Mann von Adel, …Mutter hat behauptet, du würdest dir einen Scherz mit uns erlauben!“ „Ach hat sie das?“, fragte er. Er erkannte gleich, wie peinlich es Katharina war und lächelte. Somit war diese Barriere gefallen. „Und damit du dich nicht über all meine Geheimnisse her machst, gibst du mir das Schreiben jetzt zurück.“, befahl er. Maulig gab Hannah nach. Er steckte das Pergament unter die Cotte und erinnerte sich wieder an das Treffen, das jetzt ausstand. Entschuldigend erhob er sich. „Ich habe noch etwas zu erledigen, wenn ihr erlaubt.“ Hannah trotzte und Katharina sah enttäuscht auf den dampfenden Kessel. „Esst euch satt! Ich werde später zurückkommen.“ „Wo willst du denn …“ Katharina herrschte die Tochter an. „Ich bin bald wieder zurück!“, beschwichtigte er. Gemächlich nahm er den Mantel vom Haken neben der Tür, war gerührt, weil Hannah ihm helfen wollte. Zurück in die Kälte müssen, war kein erbaulicher Gedanke. Ihm schauderte. Was er vor Stunden so herbeisehnte, war nun zweitrangig. Aber sich martern lag ihm nicht, nicht wenn es um Unaufschiebbares ging. Er nickte zum Gruß und trat vor die Tür. Eisig schlug ihm der Wind ins Gesicht. Inzwischen war es dunkel. Bevor er aufbrach, sah er in das Elend zurück. Durch die morschen Läden erkannte er das heimelige Licht im Innern des Hauses. Einen Moment verweilte er, verspürte Einsamkeit, Verlust und sann dem Gefühl der verbrachten Stunde nach. Wann hatte er diese Geborgenheit zum letzten Mal erlebt? Es war Jahre her, eine unendlich lange Zeit. Müßig stampfte er den Hang hinauf. Frischer Reif knirschte unter seinen Stiefeln. Der Weg führte ihn wieder entlang der Mauern des Stiftes, welches in weniger als vierundzwanzig Stunden zu einem eigenen Leben erwachen würde. In verstrickte Gedankengänge gefangen, lief er eine Runde ziellos um den Domplatz. Jetzt tat die schneidende Kälte gut, rief den Zorn wieder wach, holte ihn zurück, zu dem der er war und das war gut so, erleichternd und vertraut. Vor dem Fachwerkhaus, an dem man ihm am Nachmittag den Zutritt verweigerte, stand ein Posten in Ordenstracht, dick eingepackt in einen weltlich bepelzten Wollmantel. Bei diesem Wetter war die Kleiderordnung außer Kraft gesetzt. Zusätzliche Wärme verschaffte die Fackel neben ihm und das Gebet, aus dem Jean ihn aufschreckte. Er nannte wieder seinen Namen und ein leises Leuchten flackerte in den Augen des Mannes. „Seine Exzellenz erwarten euch!“ Mit steifen Gliedern ächzte er voran. Der gleiche Ordensbruder wie am Nachmittag öffnete, verbeugte sich zum Gruß und ließ ihn eintreten. Jean sah sich kurz um, registrierte die spartanische Ausstattung und war nicht einmal überrascht. Man klopfte an eine der Türen, die zur Diele hin geschlossen waren. Der Geistliche vor ihm trat in den Raum, meldet sein Kommen an, bewegte sich vorwärts, dann rückwärts und wandte sich ihm zu. „Ihr habt eine Stunde!“, reglementierte er. Jean fegte den Mantel von den Schultern, übergab ihn dem Geistlichen, der ihm nicht die geringste Sympathie entgegenbrachte und konzentrierte sich auf die nächste Begegnung. „Jean Marc Jou…!“, meldete der Geistliche nonchalant. Ohne Umstände schob sich Jean an ihm vorbei. „Johann, …mon gars, …mein Junge, …wie wunder..., wundervoll euch zu sehen!“ „Vater!“, grüßte er mit einer ehrfurchtsvollen Verbeugung. „Lasst euch ansehen.“ Das zarte Männlein, gekleidet in eine schwarze, schmucklose Soutane missachtete jede Vorschrift von Distanz, kam auf ihn zu und nahm beide Hände in die seinen. Ein freudiges, glückliches Lächeln breitete sich in seinem faltigen Gesicht aus. Jean kniete nieder, küsste trotz der überschwänglichen Begrüßung den Bischofsring und wurde nachsichtig wieder auf die Füße gestellt. „Ihr dürft zu mir sprechen, als mein Sohn, …macht euch keine Umstände.“ Gastfreundlich wies er Jean einen weichen Sessel neben dem Ofen zu. Ihn gar nicht aus den Augen lassend, platzierte sich der Vater gegenüber. Ein strebsamer Mann, solide, ehrbar… „Danke!“ Jean war erleichtert. „Wie ich höre, habt ihr Paris verlassen und euer Glück in Regensburg gefunden? Habt ihr wieder geheiratet?“ Er verneinte, rührte nicht daran. „Wie geht es eurer Mutter?“ Des Vaters Augen leuchteten. Jean erinnerte sich an das aufrichtige, liebevolle Verhältnis, dass die Eltern hatten, als der Vater in Paris lehrte. Bevor der Papst ihn zu sich rief und die geduldete Familie auseinanderriss. Die Frage holte ihn schnell zurück in die Wirklichkeit. Er räusperte sich.





























