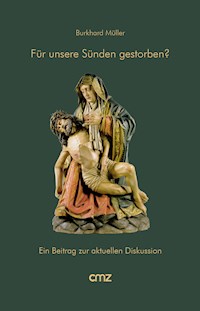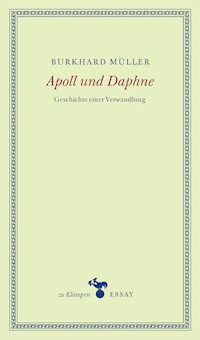Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
»Lufthunde«: In Kafkas »Forschungen eines Hundes« sind das die rätselhaften Wesen, die, je für sich und geschieden von den anderen ihres Geschlechts, hoch oben durch die Lüfte treiben und ihrer Tätigkeit nachgehen. Was sie genau tun, ist schwer festzustellen, aber jeder kann ihnen zusehen, wie sie im Äther segeln. »Lufthunde« heißt dieses Buch, weil es die Geschichte der deutschen literarischen Moderne in einer Reihe von Einzelporträts erzählt. Wichtiger als ihr Zusammenhang und wichtiger auch als das einzelne Werk ist die Gestalt des Autors, wie sie aus seinen Schriften hervortritt. Den Anfang macht Kafka mit seinen Tierparabeln; und es folgen so verschiedene Temperamente wie Musil, Rilke, Morgenstern, Gottfried Benn, auch Wilhelm Busch, unter den Frauen Irmgard Keun und Gertrud Kolmar. »Nein, wirklich, wir haben es mit einem großen Autor zu tun«, schrieb Michael Maar in der FAZ und bescheinigte dem Autor bei dessen letztem Buch, dass er sich nunmehr »endgültig in der Thronreihe der deutschsprachigen Essayisten niederlassen kann«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Müller
LUFTHUNDE
Portraits der deutschen literarischen Moderne
Burkhard Müller, Jahrgang 1959, ist Dozent für Latein an der TU Chemnitz und regelmäßiger Mitarbeiter beim Feuilleton der Süddeutschen Zeitung; er hat dieses Jahr den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik erhalten. Zuletzt sind von ihm bei zu Klampen erschienen: »Der König hat geweint. Friedrich Schiller und das Drama der Weltgeschichte«, 2005; »Die Tränen des Xerxes. Von der Geschichte der Lebendigen und der Toten«, 2006.
Reihe zu Klampen Essay,
herausgegeben von Anne Hamilton
© 2008 zu Klampen Verlag · Röse 21 · D-31832 Springe
[email protected] · www.zuklampen.de
Umschlag: Matthias Vogel (paramikron), Hannover
Umschlagabbildung: Albo - Fotolia.com
Satz: thielenVERLAGSBÜRO, Hannover
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2016
ISBN 978-3-86674-211-6
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über ‹http://dnb.ddb.de› abrufbar.
INHALT
Cover
Titel
Der Autor
Impressum
Einleitung
I.
Oheim, was ist Euch?
Wilhelm Busch – nach hundert Jahren
Nietzschestechen
Der hydraulische Novellist
Sigmund Freud heute
II.
Bedenke auch den kleinen weissen Hund
Das lyrische Werk Gertrud Kolmars
Rainer Maria Rilke
oder der Fluch des Virtuosen
Baum des Hasses und Vogel des Tods
Über die Zeit in der Lyrik von Karl Kraus
Kopf aus ertrunkenen Mandeln
Ein Denkmal für Meret Oppenheim
Ich kenne nicht des Todes Bild und nicht des Sterbens Nöte
Die Galgenlieder Christian Morgensterns
III.
Trost im Fell des Nachbarn
Zu Kafkas Tierparabeln
Der Fluch des Allerliebsten
Eine Neulektüre der »Buddenbrooks« nach fünfundzwanzig Jahren
Der Humor des Nachtpfauenauges
Zum 125. Geburtstag von Hermann Hesse
»Kein Jude ist Löwe«
Irmgard Keuns Roman »Nach Mitternacht«
IV.
Zweimal Benn
Herrenwissen vom Seidelbast
Der letzte Band der Jünger-Werkausgabe
Günter Grass: »Die Blechtrommel« / Martin Walser: »Halbzeit«
Zwei Klassiker der jungen BRD im Kontrast ihres Ranges
Anstelle eines Textnachweises
Fußnoten
EINLEITUNG
Lufthunde: Das sind in Kafkas Erzählung »Forschungen eines Hundes« jene Wesen, die, obschon zweifellos dem großen Volk der Hunde zugehörig, welchem das warme Beisammensein über alles geht, es sich dennoch herausgenommen haben, allein und auf eigene Faust sich hoch in den Lüften umherzutreiben. Was sie dort oben anstellen, was sie an greifbaren Forschungsresultaten mitbringen, das erscheint alles sehr zweifelhaft. Es kann sogar aussehen, als wären sie bloß ein schönes Fell und ihre Frisuren größer als der ganze Hund. Und trotzdem erfüllen sie in ihrer grandiosen, manchmal traurigen Vereinzelung hoch droben, wo sie nur mit dem Wind zu kommunizieren scheinen, einen wichtigen, wenngleich unbestimmten Auftrag. Wer in der Hundeschaft emporblickt, kann ihre Kontur als kleine Wolken über sich erkennen.
Lufthunde: Wer so eine Sammlung von Essays über die Autoren der deutschen literarischen Moderne tauft, der vereinzelt sie gegeneinander und erteilt ihnen allen dasselbe leichte Gewicht. Aber er handelt nicht respektlos. Er betreibt keine biographischen Studien, aber er blendet auch nicht in werkimmanentem Furor die Tatsache aus, dass nur lebendige Wesen Werke zu schaffen vermögen. Portraits wollte ich geben. So, denke ich mir, wünscht sich jeder schöpferisch Tätige zur Kenntnis genommen zu werden: Dass man über dem Werk nicht den Menschen, und über dem Menschen nicht das Werk vergisst. Tradition genügt nicht; man sollte sich bereit finden, Nachwelt zu sein. Nur im Modus der Nachwelt wird dem Tod das entscheidende Schnippchen geschlagen. Sie ist eine höchtspersönliche Angelegenheit, auf beiden Seiten: jemand ist sie für jemanden. Mit einer Doppel-Ausnahme sind alle Menschen, die in diesem Buch auftauchen, tot, teils schon länger, als man es sich eingestehen möchte; fast ein Jahrhundert trennt uns inzwischen von Kafka. Dazu müssen diese Portraits sich verhalten. Sie müssen ihre Auswahl begründen und jeweils erkennbar machen, was an den Verstorbenen so lebendig und unverjährt ist, dass sie hier ihren Platz finden.
Es kann, so paradox es klingt, belebend auf jemanden wirken, wenn er tot ist. Solang er lebt, bietet sich sein Leben als unentrinnbar progressive Linie dar. Alles, was vor dem gegenwärtigen Augenblick liegt, den er mit sämtlichen anderen jetzt Lebendigen teilt und dessen Tyrannei er nicht zu entrinnen vermag, kann nur als vorbereitender Weg ins Jetzt gedeutet werden. Der Tod erst hebt diese unbedingt verpflichtende Linie auf und zerbricht das gewesene Leben in seine einzelnen Punkte, die plötzlich Selbständigkeit erlangen. So gewinnt das einstige Besondere, der geglückte Abend zum Beispiel, der sich nie wiederholen sollte, eine absolute Freiheit, die es nie zuvor genoss. Aus Stationen werden gültige Orte. Man muss dann den mittleren Nietzsche nicht mehr im Zeichen des sich anbahnenden Wahnsinns lesen, und in Gertrud Kolmars Lyrik nicht mehr nach den Vorahnungen von Auschwitz fahnden. Das Unwissen von dem, was noch kommen soll, ist der vitale Kern jedes Menschen (unserer auch). Es könnte keiner glücklich sein, der seine Zukunft kennt, nicht einmal wenn es eine glückliche Zukunft wäre.
Die Form des Portraits und seine entschiedene Tendenz zum Kontrahieren nimmt die Figur aus der Zeit heraus und erstattet sie an den Raum. Fünfzehn solcher Portraits also habe ich zusammengestellt, eine angemessen unrunde Zahl. Das Zufällige und das Unzufällige haben dabei, wie in einem Kartenspiel, ihre Rolle vereint gespielt. Manche Autoren gerieten en face ins Visier, manche wurden im Halbprofil angeschnitten, je nachdem was der Aufgabe zu entsprechen schien. Manche sind vergrößert, manche verkleinert aus dem Prozess hervorgegangen; Pietät wurde nicht geübt. Die hier versammelten Texte sind zu verschiedenen Gelegenheiten entstanden, gern zu runden Geburts- und Todestagen – sie gehen aus der Zeitlichkeit hervor, um ihr Trotz zu bieten. Der Begriff der Moderne scheint, nach beiden Seiten, von mir ein wenig überstrapaziert, indem sowohl schon Wilhelm Busch als auch noch Martin Walser und Günter Grass ihren Platz finden. Entscheidend war, dass sich mir die Autoren als eine frische Vorwelt darboten, deren wirkende Kraft sich in der Gegenwart spüren lässt (Walser und Grass mögen mir verzeihen, die Bücher, von denen ich spreche, sind fünfzig Jahre alt); und dass sie in meiner Sprache, dem Deutschen, schrieben.
In vier Gruppen habe ich die Texte sortiert. Sie kriegen keine eigenen Titel, das hieße den Lufthunden Gewalt antun. Aber in ihr schwebendes Muster darf man doch so etwas wie Sternbilder hineinsehen. Darum erscheint als I: Die Ursprünge im 19. Jahrhundert, Busch, Nietzsche, Freud; als II: die Lyriker, Kolmar, Rilke, Kraus, Oppenheim (deren künstlerische Eigenart sich jedenfalls als eine lyrische bezeichnen lässt), Morgenstern; als III: die Prosa-Autoren, Kafka, Thomas Mann, Hesse, Keun; und als IV die immer noch Umstrittenen, mögen sie teils auch tot sein, Benn, Jünger, Grass/Walser.
Besonders danke ich Anne Hamilton, die dieses Buch ermöglicht hat, indem sie es mir abverlangte. Sie verfügt über die bemerkenswerte Fähigkeit, schon ein Buch zu sehen, wo andere Leute vorerst nichts als einen Haufen Zettel erblicken.
I.
OHEIM, WAS IST EUCH?
Wilhelm Busch – nach hundert Jahren
Niemand im deutschen Sprachraum, der sich zu Wilhelm Busch äußern will, kann dies mit Unbefangenheit tun. Wie die Erkältung, die sich ein sonst gesunder Erwachsener zuzieht, in ihm die Gedächtnisschleusen zu den fiebrigen Erkrankungen seiner Kindheit öffnet, so scheint durch die Belustigung, mit der er heute Buschs Bildergeschichten durchblättert, der tiefe Eindruck einer frühen Zeit. Wer Buschs gedenkt, sollte den Anfang mit »Max und Moritz« machen, einem Buch, das nicht oder jedenfalls nicht ganz als Kinderbuch gedacht war, aber wie kein anderes das Buch der Kinder geworden ist.
Böse Buben
Lange haben deutsche Eltern es nicht gewagt, ihre Kinder Moritz oder Max zu nennen, mit einer Scheu, die erst in den letzten Jahren zu weichen beginnt. Höchstens, dass ein Dakkel Max oder ein Kater Moritz hießen, denn in ein Haustier durfte man diese Geister bedenkenlos fahren lassen. Kein Kind hätte Max oder Moritz, wie sie steckbriefhaft auf der ersten Seite prangen, für seinesgleichen angesehen; für Kollegen des Froschkönigs und des Rumpelstilzchens musste es sie halten, für, ohne dass es ein Wort dafür gehabt hätte, Dämonen. Die Frage, warum sie taten was sie taten, stellte sich gar nicht. Ganz überflüssig, dass mehrere Generationen von Erziehern sich Sorgen um die Folgen für das kindliche Gemüt machten, erst weil ihnen »Max und Moritz« als verdammenswertes Vorbild zu wirken schien (die Regierung der Steiermark verbot den Verkauf des Buchs noch 1929), später weil sie die verkrüppelnde Gewalt der »Schwarzen Pädagogik« fürchteten. Für ein Kind verstanden sich Max und Moritz so sehr von selbst und blieben zugleich so gänzlich außerhalb seiner eigenen Lebenssphäre, dass ihm daraus weder Angst noch das Bedürfnis zur Nachahmung erwuchsen, sondern ein Erlebnis ganz eigener Art. Noch viel inniger verbanden sich ihm Bild und Text in diesem Buch, als sein Autor es angestrebt hatte; unzerspaltbar, wie ein Name im Verhältnis zu seinem Träger, leuchteten sie durch die Kindheit.
Es sind zwei antinaturalistische Stilprinzipien, die sich in Buschs Zeichnungen befehden und durchdringen: Er setzt das Bild als Zeichen wie die Kunst des Mittelalters, mit den immer wieder gleichen Floskeln für Schreck und Verletzung, für Nachttopf und Stiefelknecht und Brezel (mit nur zwei statt den heute üblichen drei Ösen), besonders fassbar in der Gequetschtheit der Räume und den falschen Proportionen zwischen Mensch und Ding – wie groß geraten ihm die Maikäfer und wie klein die Häuser! Und er zielt, zweitens, auf die groteske Übertreibung, die Wert darauf legt, dass sie bei allem Eigensinn rein anatomisch »auch« möglich wäre; sie will als Virtuosität gewürdigt sein. Dem erwachsenen Blick wird sich beides ohne weiteres amalgamieren; nicht so dem Kind, von dessen Blick nur das Zeichenhafte erfasst wird (auch in der kindlichen Kunst beginnt das Zeichnen ja mit dem Zeichen). In diesem aber ruht es mit solchem Bildvertrauen, dass es auch dann nicht irre wird, wenn es die Bewegungsmuster, in welchen sich die Groteske konzentiert, nicht begreift. Aus den Moriskentänzen des Schneiders Böck, den die Leibschmerzen quälen, und des Onkels Fritz in seiner Panik-Attacke förderte es ganz andere Gestalten zutage, als es heute dem erwachsenen Auge selbstverständlich wäre, mit des Onkels Ferse und Wade als Kopf und Hals eines unvermittelten Rätselwesens – und fand doch nichts daran fraglich.
Onkel Fritz und die Maikäfer
Als eigentliches Gegenstück zu »Max und Moritz«, so weit es die volkstümliche Rezeption betrifft, kann der »Struwwelpeter« gelten. Der »Struwwelpeter« will von vornherein ein Kinderbuch sein, und ist kein schlechtes; aber seinen Vorsatz bezahlt er mit einer gewissen Plattheit, die höchstens von der Perspektive des fliegenden Roberts ein Stück weit überwunden wird. »Max und Moritz« aber steckt voll eines erwachsenen Augenzwinkerns, von dem ein Kind kaum versteht, dass es hier etwas nicht versteht. Der unverwertbare Überschuss bietet sich ihm als Geheimnis dar. Geheimnisse sind gut für Kinder. Schlimmstenfalls passieren sie das kindliche System als unverdauter Ballaststoff, im günstigen Falle aber verleihen sie der Fläche des Augenscheinlichen (und nichts ist flacher als eine Zeichnung!) eine Tiefendimension, die auszuschöpfen dann ein ganzes erwachsenes Leben kaum hinreicht; und dieser Vorgang ist besetzt mit der Lust der Phantasie.
Solche Tiefe erstreckt sich notwendig in die einzige Dimension, die offensteht, in die Vergangenheit. Sie ist die erste große Neuigkeit für die Kinder, wenn sie hören, wie das Märchen anhebt: Es war einmal … Die Verschiedenheit des Einst vom Jetzt entdecken sie mit einer Inbrunst wie erst später wieder, in der Pubertät, die Geschlechtlichkeit; ja vielleicht darf man sagen, dass für mehr als für diese beiden Überraschungen von Grund auf, Geschlecht und Geschichte, im Menschenleben gar kein Platz ist. Die Zweischichtigkeit der Welt zwischen Jetzt und Dazumal stellt dabei den ersten Befund dar; er zerlegt sich alsbald in einen rechten Blätterteig. Wie bedeutungsvoll insinuiert das Märchen hinter allem Altem stets das noch Ältere!
Busch steht in Verbindung mit vielen Überlieferungen – mit dem Münchner Künstlerbetrieb seiner Jugend, einschließlich Kneipzeitung und Fliegender Blätter; mit der biedermeierlichen Idylle und der sentimentalen Ironie Heinrich Heines; mit der Malerei des 17. Jahrhunderts in ihrer festlich flämischen sowie ihrer bummlig holländischen Variante; mit Breughel und mit dem Holzschnitt des 16. Jahrhunderts; mit der alterslosen Tierfabel, die sich seit dreitausend Jahren immer neu einkleidet. Doch dürfte das Märchen die einzige Tradition in Buschs Werk sein, die von einem breiten und jungen Publikum noch immer auf Anhieb erfasst wird.
Und wie das Märchen vermittelt auch Busch das Gefühl, dass er letztmalig ein sich schon Entziehendes erwischt, gewissermaßen beim hinten herauslugenden Sacktuch, das bei ihm so oft den Umriss der Voranstrebenden bereichert. Busch ist vermutlich der letzte Dichter deutscher Zunge, der, wenngleich ironisch gebrochen, noch weiß, dass die Maikäfer mit vollem Recht den Vögeln zugerechnet werden, insofern sie fliegen; und ebenso der letzte, der mit Verständnis des Systems das unregelmäßige Zahlwort »zwei« beugt: zwei maskulin, zwo feminin, zwee neutral. Für die Mühle und die Backstube hegt er einen uralten Schauder und einen uralten Groll: Hier geschieht grundhafte Umerschaffung, feurig und zermalmend, höllischer mehr als segensreicher Art. »Ricke-racke! Ricke-racke/Geht die Mühle mit Geknacke …« Und hier auch haben die ländlichen Reichen ihren Platz, die dank dem Mahlzwang und ähnlichen obrigkeitlich eingesetzten Privilegien dick und fett geworden sind. Ihnen steht das Bäuerlein gegenüber, immer eine Gestalt von äußerster Magerkeit. Ihm, dem verachteten »Parzellenbauer«, wollte Buschs Zeitgenosse Marx keinen Platz im Gang der Geschichte gönnen, diese Klasse kam für ihn gar nicht in Betracht, obwohl ihr damals noch bestimmt die Hälfte der Bevölkerung Europas angehörte. Busch jedoch hält ihm und seiner Armut die physiognomische Treue.
Diesem Werk lässt sich ein unvordenkliches Darben ablesen, mit den Wänsten der dörflichen Oberschicht als seinem lächerlichen, eigentlich aber empörenden Widerspiel. Die ewigen Ringkämpfe drehen sich um Äpfel, Schinkenbeine und Brezel; und die Katastrophen, wenn Betrunkene sich irrtümlich in die Teigmulde betten, dicke Gesäße auf dem Buttervorrat Platz nehmen, der Korb mit den Eiern fällt, für uns als reiner Slapstick belachbar, werden von den Beteiligten deswegen so schrill beklagt, weil es einen Raub an ihrer knappsten und gehegtesten Ressource bedeutet, den Barren aus Fett und Protein, ohne die aus ihrem Winter leicht ein Hungerwinter wird. Vier der sieben Streiche von Max und Moritz haben es mit Nahrungsmitteln zu tun. Wenn einer ins Fettnäpfchen tritt, wenn es um die Wurst geht, so sind das bei uns, die wir nur noch 15 Prozent des durchschnittlichen Familieneinkommens für Lebensmittel ausgeben und uns dennoch mehr als gut genährt fühlen dürfen, spaßige Redewendungen; bei Busch geraten sie zum höchst realen Handgemenge. »Teuer« ist das jedesmalige, unreine und doch triftige Reimwort auf »Eier«; ohne dieses können sie gar nicht gedacht werden. Man denke, was heute ein Ei kostet – und ermesse daran, wie weit wir in so kurzer Zeit der Urgeschichte, wie sie uns Wilhelm Busch erzählt, entronnen sind!
Freilich wird dies bei ihm alles nur sagbar im Modus der Lustigkeit. Lustig ist nicht identisch mit heiter. Lustig ist bei Wilhelm Busch überall und vor allem die Gewalt. Mehr als jeder andere Umstand bestimmt sie das zeichnerische Werk und dessen Handlungsgänge – wobei man der Gewalt billigerweise auch die Unfallketten zurechnet, von denen die Geschichten durchzogen und ihrem Höhepunkt entgegengetrieben werden. Kein Missgeschick, kein Erziehungsakt und keine Exekution (vielleicht mit Ausnahme des Schlusses von Fipps dem Affen), bei dem Busch auch nur einen Hauch von Mitgefühl für seine Opfer erkennen ließe. Stets wird dem Leser und Betrachter eingeflüstert, es seien doch nur Puppen eines Papiertheaters, er solle doch bitte seiner Schadenfreude keinen Zwang antun.
Es ist oft bemerkt worden, dass sich bei Busch die Nasenverletzungen in so monomanischer Weise häufen. Die Nase ist ein merkwürdiges Organ; anders als ihre direkten Nachbarn im Gesicht, Mund und Augen vor allem, daneben Wangen, Stirn und selbst Kinn, scheint sie gänzlich ohne Poesie und zum niedrigen Stil verdammt. Sie gibt den bevorzugten Henkel ab, bei dem der Karikaturist sein Opfer packt; schutzlos ragt sie, obwohl eins der am feinsten innervierten Organe, in die Welt hinein. Mehr als jedes andere Organ ist sie der Schadenfreude affin. Keiner kommt umhin, selbst zusammenzuzucken, wenn der fremden Nase ein Stich oder eine Schraubendrehung angetan wird; und um den sympathetischen Schmerz zu verringern, muss er den Affekt, unter Aufbietung erheblicher psychischer Energien, um- und abwenden. Jenem Schmerz, den Busch vorzugsweise einen »peinlichen« nennt, insofern er neben dem Leiden selbst auch das Mitempfinden des Beobachters meint, entgeht nur das Lachen; ein schönes Geräusch ist es nicht. »Die Nase dreht sich mehrere Male/Und bildet eine Qualspirale.« Wenn man es laut liest, widersteht man kaum der Versuchung, die Vokale in die Länge zu ziehen und die Qual, statt sie abzukürzen, gewissermaßen noch zu dehnen; man findet sich wieder als Komplize dieser exquisiten Folterung, an deren Ende eine Nasenhälfte von der Elastizität eines Zweigs abgetrennt und hochgeschnellt wird. Und zu allem Überfluss trägt die grausame Szene auch noch die Unschuldsmiene des pädagogischen Zwecks zur Schau: Das wird dich lehren, nach Affenfleisch zu trachten! Dies nämlich hatte der verstümmelte Mohr im Schilde geführt. Buschs Strafen gehorchen dem Gesetz der absurden Überbietung jenes Vergehens, für das sie verhängt werden. Er und sein willig-unwilliger Vertrauter, der Leser, genießen jede Missetat zweimal: einmal wenn sie getan und einmal wenn sie geahndet wird.
Nasenspäße
Muss das sein? haben Wohlmeinende mit Entsetzen gefragt, wenn sie die dramaturgische Notwendigkeit in Zweifel zogen, mit der der arme Kater Schnipps nach den Klauen auch noch den Schwanz einbüßt und der skelettierte Rest sich dem Betrachter als mit jedem Wirbelchen liebevoll ausgeführte Miniatur empfiehlt. Als Gegenfrage sei erlaubt: Was bliebe von Busch, wenn man die spezifische Häme seiner Peinlichkeiten abzöge? Er würde zurückgeworfen auf das, worauf er parodistisch reagiert, auf Ludwig Richter. Man tut Busch kein Unrecht, wenn man ihn als Parodisten in einem ähnlichen Sinn versteht wie Cervantes mit seinem Don Quijote. Das biedermeierliche Idyll braucht man so wenig zu kennen wie den spanischen Ritterroman, um Busch und Cervantes zu begreifen. Und doch bergen beide ihren verjährten Anreiz in sich wie die Perle das Sandkorn. Von Ludwig Richter, diesem deutschen Verhängnis mit seiner klaustrophobischen Innerlichkeit und dem schwunglos gleichförmigen Zeichenstrich wie zu Laubsägevorlagen, ist Busch nie so weit weg wie es scheint; er erbt von ihm die Geschlossenheit der Kontur und die Enge als Familienschicksal. So oft Busch seiner Sehnsucht nach Versöhnung die Zügel schießen lässt, etwa bei der Geschichte vom braven Lenchen (keinesfalls mit der frommen Helene zu verwechseln!), erliegt er der Gravitation des Kitschs wie einer Naturkonstante. Aber in der Masse wird sein Werk eben doch vom Aufbegehren gegen so viel Bravheit geprägt. In der rabiaten Art, mit der das geschieht, deutet sich an, dass da letztlich jemand keinen Weg weiß, wie das Verabscheute zu überschreiten wäre. Dass »Max und Moritz« dann ausgerechnet im Verlag von Richters Sohn erscheint, hat das Zweideutige an sich, das Akte der Vergeltung bei Busch stets aufweisen: Ist es die Rache Buschs an Richter? Oder die Rache Richters an Busch?
Man hat das Phänomen Busch auf die Kälte seiner Kindheit und die damals erlittenen, nie wieder gutzumachenden Beschädigungen zurückführen wollen; und sicher zu Recht. Selbst in der zurückhaltenden, herunterspielenden Art, wie Busch von einigen Schlüsselgeschehnissen berichtet, ahnt man, dass hier Dinge passiert sind, von denen sich ein Mensch das ganze Leben nicht mehr erholt: Wie sein Vater, nachdem der kleine Wilhelm Schießpulver für einen max- und moritzhaften Streich entwendet hatte, ihn prügelte, dann am Ohr packte und unter härtesten Ermahnungen immer im Kreis um das bestohlene Gefäß herumführte; wie er, offenbar ohne Vorwarnung, aus der Familie gerissen und einem Onkel zur Erziehung übergeben wurde; wie er, als er nach Jahren das erste Mal wieder heimkam, seiner Mutter im Feld begegnete und sie ihn nicht wiedererkannte. Wie setzt man sich zur Wehr gegen solche verkrüppelnde Erlebnisse?
Natürlich indem man tut, als wäre nichts gewesen; oder, wenn das nicht gelingt, als wäre es jedenfalls nicht der Rede wert und fiele ins Spektrum der Normalität. In dieser Weise funktionieren Familien ja bis zum heutigen Tag als Scham- und Beschönigungsgemeinschaften, mit dem Schweigen und der Anekdote als ihren wichtigsten Bastionen. Auf die Frage: Du armes Kind, was hat man dir getan? kann Busch, der niemals Freiheit erlangt, keine Antwort geben als eine kecke, nicht anders als seine verhärteten Lausbuben. Man mag sich kaum vorstellen, was dieses unausgesetzte Prügeln als der pädagogisch intensivste Umgang mit dem kindlichen Selbst damals wirklich bedeutet hat, für die Kinder und für die Erwachsenen, die aus ihnen hervorgingen. Eine ganze Epoche scheint sich darauf verständigt zu haben, dass dies »noch keinem geschadet hat«. Jedenfalls konnte Busch auf breite Zustimmung rechnen, wenn er den Umkreis des gesellschaftlich Üblichen und Akzeptablen hier so weit wie möglich dehnte, damit auch die von ihm erfahrene Gewalt noch darin Platz fand und seine Biographie sozusagen ein Dach über dem Kopf bekam. Die Welt muss wesenhaft bös sein, auch und gerade die Kinder (die von ihnen kaum geschiedenen Tiere sowieso): Sonst nämlich wäre ihm, dem einzelnen Kind, ein beispielloses, ihn gänzlich vereinsamendes Unrecht widerfahren; und das wäre schlimmer, als sich selbst für verworfen erklären müssen. »Es saust der Stock, es schwirrt die Rute./Du darfst nicht zeigen, was du bist./Wie schad, o Mensch, dass dir das Gute/Im Grunde so zuwider ist.« Die Rettung naht hier in der Anrufung der anthropologischen Konstante. »O Mensch«, da scheint er sich mit vorsätzlicher Komik im Ton zu vergreifen; aber es ist ein echtes De Profundis, das bei aller Schwärze seine tröstliche Wirkung entfaltet, indem der persönlich Verkümmerte sämtliche Sterblichen als seine Schicksalsgenossen erkennen darf.
Diese Hornhaut musste sich der Künstler Busch zulegen, damit sie die alten Striemen bedeckte und vor schmerzender neuer Berührung schützte; hier liegt die Wurzel seiner Lustigkeit, wie auch (denn da befindet er sich in breiter Gesellschaft) des elenden Humors des ganzen 19. Jahrhunderts. Wo Wilhelm Busch diese Dinge, die er unausgesetzt gestaltet, leibhaftig tut, da sind sie nicht lustig, sondern verbreiten um sich den peinlichen Schrecken: Als er 1881 seine Münchner Freunde besucht, zieht er der Schwester Franz Lenbachs den Stuhl weg, dass sie auf den Hintern fällt, und wirft über die Köpfe der Anwesenden plötzlich einen Käse an die Wand. Danach geht er und kehrt nie wieder. Er muss sich in Grund und Boden, er muss sich zu Tode geschämt haben. Solchen vernichtenden Gefühlen antworten die Todesarten, die er für seine Figuren findet. Nicht zufrieden damit, ihnen das Leben zu nehmen, tilgt er die erkennbare Gestalt vom Angesicht der Erde, sie wird mit einem wahren Ingrimm von Mühlsteinen zermalmt wie Max und Moritz, platt ausgewalzt wie die bösen Buben von Korinth, zu Asche verbrannt wie die fromme Helene, zu zackigen Eisgebilden transformiert und dann amorph zerschmolzen wie der Eispeter. Dies unterscheidet Busch grundsätzlich vom Comic, als dessen Ahnherr er verdientermaßen in Anspruch genommen wird. Wenn dem Koyoten Karl ein Amboss auf den Kopf fällt, ist er im nächsten Panel, trotz einiger Heftpflaster, wieder wohlauf. Bei Busch aber bleiben die Toten tot. Der Tod bei Busch stellt den Grenz- und Testfall des Lustigen dar, auf den er mit Entschiedenheit hinarbeitet.
Zum Furchtbarsten der kindlichen Kälteschäden gehört es, dass ihr Opfer nicht einmal mehr zu einer klaren Vorstellung des möglichen Anderen, des Glücks, imstande ist. Bei Busch zeigt sich das krass beim einzigen Gegenstand, wo man ihm wirklich zeichnerische Mängel nachsagen kann, beim Bild der schönen Frau. Erkennbar sucht er sie in ihrer Lieblichkeit aus dem karikaturistischen Umfeld inselhaft herauszuheben. Man betrachte die Portraitbüste der Christine Dralle in »Schnurrdiburr«: Wie hier Anmut als Kindchenschema vonstatten geht, wie der angestrebte Silberblick zum Ausdruck des bekümmerten Schwachsinns gerinnt! Alle anderen Figuren um sie herum sind sozusagen karikaturistische Skelette; sie allein hat vor lauter Holdseligkeit keinen einzigen Knochen im Leib und ähnelt in der Durchführung dem ungebackenen Brotteig, der in Buschs Geschichten eine so auffallende Rolle spielt.
Knochenlose Schönheit
(Auszunehmen wäre hier allein die Fromme Helene, die es wohl verdient, Buschs »erwachsenstes« Werk genannt zu werden. Auch sie freilich folgt dem Muster der sinkenden Biographie, das für so viele der längeren Bildergeschichten gilt; aber hier springt Busch einmal über seinen Schatten, er identifiziert sich feinfühlig mit dem andersartigen Wesen Frau; und so ist es, was bei Busch nicht oft vorkommt, ein Buch voll sozialen Takts geworden – ein Eindruck, den er durch die abschließende Höllenfahrt allerdings soweit wie möglich wieder verwischt. Soweit auf deutschem Boden eine Madame Bovary erblühen konnte: Das ist sie.)
Über Busch und die Frauen ist viel geschrieben worden; es hat für ihn zweifellos hier viel Angst, Enttäuschung und Demütigung gegeben, auch, wie es scheint, einiges an Ausflucht und Verrat von seiner Seite. Die Ehe stellt das große ungelöste Problem in seinem Leben und Werk dar. Wenn man den »Tobias Knopp« liest, speziell den ersten Teil der Trilogie, worin er suchend die Welt durchreist und auf mancherlei beweibte und unbeweibte Lebensmuster stößt, fühlt man sich an Buschs älteren Zeitgenossen Kierkegaard und dessen sehr ernst gemeintes Wort erinnert: Heirate, und du wirst es bereuen; heirate nicht, und du wirst es auch bereuen. Als Knopp, desillusioniert und wie aus einer verlorenen Schlacht, heimkehrt, macht er schließlich seiner Dienstmagd einen Antrag: »›Mädchen‹, spricht er, ›sag mir, ob … ‹/Und sie lächelt: ›Ja, Herr Knopp!‹« Ein kleinmütigeres Happy-End lässt sich nicht gut vorstellen. Auch wo Busch das ausdrückliche Liebesglück graphisch festzuhalten strebt, erscheint eine zwiespältige Hieroglyphe: das küssende Paar im Profil, deutlich geschieden, wobei die rüsselförmig vorgeschobenen Lippen zu einer Art gemeinschaftlich genutzter Pipette werden, die sprödestmögliche Verschmelzung der Geschlechter. Zu guter oder schlechter Letzt läuft es für den Menschen Busch auf das Junggesellentum hinaus, ein Leben ohne »tugendsamen Vorgesetzten«, wie er die Gestalt der Hausfrau mit Schalkheit und Argwohn fasst. Dazu singt er sich, wie ein Wiegenlied, einen Refrain, »Schön ist’s, Junggeselle sein!« Die letzte Strophe lautet, in einer Resignation, die erschreckend wüste Züge annimmt: »Heut stolziert er auf und ab,/Morgen scheißt der Hund aufs Grab,/Dies ist dann sein Leichenstein –/Schön ist’s, Junggeselle sein!«
Der Pipettenkuss
Hier ist guter Rat teuer. Schopenhauer hatte sich das Gleichnis der Stachelschweine in einer Winternacht ausgedacht; zwischen den beiden gleich unangenehmen Extremen des isolierten Frierens und des wechselseitigen Piekens finden sie schließlich einen Mittelabstand, in dem sie nur ein bisschen frieren und einander nur ein bisschen pieken müssen. So wählt Busch zwischen den Übeln des familiären Erstickungstods und der völligen Vereinsamung die Onkelschaft – sowohl in seinem Privatleben als auch für viele seiner Geschichten. Onkel sein ist das mittlere Übel und das mittlere Gut; es inhäriert schon dem bloßen Wort eine gewisse und von Busch weidlich genutzte Komik wie etwa auch der Nase. Seine Onkelpflichten nahm Busch so ernst, wie er den Vaterpflichten aus dem Wege ging. »Vater werden ist nicht schwer,/Vater sein dagegen sehr«, lautet eins seiner geflügelten Worte, die selbst in der zitatarmen heutigen Zeit noch kursieren; und doch gilt ebenso: »Onkel heißt er bestenfalles,/Aber dieses ist auch alles.«
In einem umfassenden Sinn ist Wilhelm Busch unser aller Onkel geblieben. Als ein glückliches Resultat wird man das nicht bezeichnen wollen, eher als eine typisch familiäre Notlösung (mehr Not als Lösung, möchte man sagen). Der Preis, den er für die Duldung im Schoß seiner Lieben zu zahlen hat, liegt in der Anmutung der Lustigkeit, die er seiner doch eigentlich traurigen Existenz zu geben hat; aufs Lustige kommt man bei Wilhelm Busch immer wieder zurück. Es eignet dieser pläsierlichen Haltung eine ansteckende Kraft, fast wie einem Gähnen, die bis heute zu spüren ist: Die Mechanismen, an denen Busch sich formte und von denen er verformt wurde, können nicht gänzlich verschollen sein. Man muss schon sehr kämpfen, um sich da nicht einfach kongenial gehen zu lassen. Noch Gerd Haffmans schreibt 2004 in seinem Nachwort: »Sollte der unmögliche Fall der Fall sein, dass jemals jemand alkoholische Getränke in ein wenig reichlicher Form zu sich genommen hat, so wird er bei Betrachtung dieser Bilder nur ebenso bitter wie beifällig in sich hineinmurmeln: ›Jaja, genau so isses.‹« Dabei liegt es auf der Hand, dass diese Bilder – gemeint sind vor allem die Rausch-Episoden der »Haarbeutel« – das Werk eines schwer alkoholkranken Mannes sind. Indem Haffmans Busch den Gefallen tut, diese Tatsache schmunzelnd zu verharmlosen, tut er ihm zuletzt keinen Gefallen; er verweigert ihm das erlösende Wort, das hier so dringend nötig wäre wie im »Parsifal«: Oheim, was ist Euch?
Und so hat man bei der Busch-Rezeption oft den Eindruck, auch nach hundert Jahren, dass hier weniger die Nachwelt als eine verschleppte Mitwelt zugange ist. Man hat bei Busch die vielen Momente seiner zeichnerischen Technik betont, die in die Moderne bis hin zu Film und Abstraktion vorausweisen, gewiss mit gutem Grund. Als machtvoller aber erweist sich sein Potential, uns zum Rückfall zu ermuntern. Wir halten uns für Bürger des 21. Jahrhunderts, von dem wir doch noch gar nichts wissen können. (Wer hätte vor hundert Jahren was vom 20. gewusst?) Was uns aber offenbar so unverlierbar anhaftet wie Knopp, wenn er seine eleganten Tanzfiguren aufs Parkett legt, der heimlich und außerhalb seines Gesichtskreises angenähte Schweineschwanz, das ist immer noch das vorvergangene Säculum; in ihm suchen wir Behagen, seine gereimten Ohrwürmer üben immer noch schmeichelnde Gewalt über unser Gehör und Gedächtnis, zu ihm greifen wir wie ein Kind, dem seine Eltern die Schokolade verboten haben, gierig, sobald niemand zuguckt. In keinem anderen Autor verkörpert sich für uns so machtvoll ein lasterhaft süßes Heimweh nach dem 19. Jahrhundert. Mit Verwunderung über die ungebrochene Lebenskraft eines so gebrochenen Phänomens und nicht ohne Respekt sei es gesagt: Den habt ihr noch nicht hinter euch!
Knopp und sein Schwänzchen
NIETZSCHESTECHEN
Es gab früher eine besondere Art von Losorakel, das seinen Ursprung wohl in den innigeren Traditionssträngen des Protestantismus hat, dem Quietismus, dem Pietismus und wie sie alle heißen: das Bibelstechen. Man stellte der Heiligen Schrift eine Frage, die das persönliche Schicksal betraf, griff dann zu einer Strick-, Spick- oder Stopfnadel, einem langen spitzen Gerät jedenfalls, das den Körper des Buchs in voller Länge zu durchdringen vermochte, stach hinein, entschied sich noch für rechts und links – und da stand der Spruch, der unfehlbaren Aufschluss gab, wenngleich man ihm diesen oft erst durch langes und manchmal gewundenes Nachdenken entlocken musste. Den Amtskirchen war diese Art von privater Hermeneutik wohl immer ein Dorn im Auge, weil er dem Hauptstrom der Verkündigung ein kleines Wässerlein entzog, das jemand auf seine eigene Mühle zu lenken trachtete. Und es steckt gewiss auch ein frivoles Moment darin. Dieses muss sich verstärken, wo der Glaube schwächer wird. Auch ich, ein Heide, habe dieses Orakel verschiedentlich bemüht und andere ermutigt, es mir gleichzutun; ein Gesellschaftsspiel haben wir daraus gemacht. Aber darum waren die Fragen, die wir an das Buch richteten, doch immer bedeutsame – und die Antworten nicht minder; ja zuweilen war es erheiternd bis gespenstisch, wie ohne Umschweife der entlegene Vers auf das, was wir ihn fragten, passte. Glaubte man ihm? Nichts weniger. Und tat es doch in jener Weise, wie der Aberglaube es zu tun pflegt, nämlich im Erlebnis der guten oder schlechten Laune, in die man sich versetzt fand, je nachdem. In dieser Gestimmtheit besuchen pietätlose Touristen ein Spukschloss. Den Spuk erklären sie für Unfug und wären doch enttäuscht, wenn sie herausfänden, dass die Überlieferung ihn in Wahrheit einem anderen Ort zuschreibt und sie sich bei der Wahl ihres Reiseziels geirrt hätten. Sie wären sogar imstande, ihr Geld zurückzuverlangen, weil sie sich betrogen fühlen. Das sind so die homöopathischen Spätzustände der Geschichte.
Ein entsprechendes Stechen in den Gesammelten Werken Friedrich Nietzsches kann nicht ganz auf dieselbe Art funktionieren. Wir taten es zu zweit, nachdem wir einen langen, erschöpfenden Abend mit der Behandlung eines anderen literarischen Werks verbracht hatten: abschließend, zur Erholung und damit so etwas wie ein Ausklang da wäre. Während es mit der Bibel, auch im Zeitalter ihrer Säkularisierung, ja immer so steht, dass nicht wir sie prüfen (obwohl wir das vorgeben), sondern sie uns, musste es bei Nietzsche umgekehrt sein. Es ist ein Werk, groß genug, dass es sich verlohnt, es in jedem seiner Sätze einzeln zu untersuchen; aber doch eben wieder allzu deutlich Menschenwerk, als dass der Reiz dieses Verfahrens nicht eben vor allem darin bestünde, es dem Urteil auszusetzen. Nicht »Was sagst du mir?« konnte die Frage lauten, sondern »Was soll ich von dir halten?« Das ist übermütig bis zur Anmaßung, aber angesichts eines unabsehbar gewordenen Ruhmes hilft es womöglich weiter. »Nietzsche als solcher«, das ist ein Trumm, vor dem jeder instinktiv zurückschreckt. (Tucholsky erzählt von einem wiederkehrenden Albtraum: Es ist Deutschabitur, alle warten gespannt auf die Stellung des Aufsatz-Themas, da kommt es: Goethe als solcher. Schweißgebadet erwacht er.) Aber wenn es gelänge, Nietzsche nach einem zuverlässig kaleidoskopischen Verfahren zu sondieren, da könnte was herausspringen – zumal Nietzsche, speziell der mittlere, ja selbst dazu neigt, das Werk in kleinen Portionen vorzusetzen, durchnumeriert, um das Zufällige zu betonen, das in jeder Reihe herrscht, so dass man die Gefahr, hier etwas aus dem Zusammenhang zu reißen, als gering taxieren darf. Er will, was er zu sagen hat, durchaus in Brocken geben? Testen wir also die Brocken!
Drei oder vier Stiche wagten wir an jenem späten Abend und waren angenehm enttäuscht: enttäuscht, wie wenig er Stich hielt, in des Wortes buchstäblicher oder mindestens absätzlicher Bedeutung; aber doch angenehm, in welchem Grad wir der Zwiesprache teilhaftig wurden. Ja, an den mittleren hielten wir uns, der redet und mit sich reden lässt, und führten die Stiche mit einer gewissen vagen Vorauswahl (wie es beim Bibelstechen der tut, der möglichst weit hinten stochert, in der Hoffnung, ein Kraftwort aus der Apokalypse zu ergattern). Denn wir wussten gut genug, dass der späte nicht minder als der frühe Nietzsche vor allem Stil ist, ein ihn selbst arg strapazierender Stil; dass er dort ganz in sich befangen bleiben muss und sich dem anderen nur um bewundert zu werden, also: gar nicht öffnet. Den »Zarathustra« muss man zuallererst mögen oder nicht mögen; da bleibt die Frage nach seiner Wahrheit auf der Strecke, jene Frage, die dem, der sie stellt, immer sofort eine überschwengliche Freiheit beschert.
Auf was wir damals stießen, tut jetzt nichts mehr zur Sache. Jetzt halte ich die Nadel (einen hölzernen Schaschlikspieß) neu in der Hand und warte nicht ohne Bangen, worauf die kecke Wünschelrute wohl diesmal zeigt. Die Reaktion erfolgt im Kommentar, assoziativ, beipflichtend, weiterführend, einwendend, je nachdem, es soll hier keine Regel geben. Nur eine regulierende Bedingung führe ich ein: Wo das erstochene Stück mehr als zwanzig Zeilen hat, also zu viel, um in seiner Gänze Präsenz zu erlangen, lasse ich es beiseite und versuche es noch einmal.
Erster Stich: Menschliches, Allzumenschliches,
Erster Band: Anzeichen höherer und niederer Kultur, Nr. 266
»Unterschätzte Wirkung des gymnasialen Unterrichts. – Man sucht den Wert des Gymnasiums selten in den Dingen, welche wirklich dort gelernt und von ihm unverlierbar heimgebracht werden, sondern in denen, welche man lehrt, welche der Schüler sich aber nur mit Widerwillen aneignet, um sie so schnell er darf von sich abzuschütteln. Das Lesen der Klassiker – das gibt jeder Gebildete zu – ist so, wie es überall getrieben wird, eine monströse Prozedur: vor jungen Menschen, welche in keiner Beziehung dazu reif sind, von Lehrern, welche durch jedes Wort, oft durch ihr Erscheinen schon einen Mehltau über einen guten Autor legen. Aber darin liegt der Wert, der gewöhnlich verkannt wird – dass diese Lehrer die abstrakte Sprache der höhern Kultur reden, schwerfällig und schwer zum Verstehen, wie sie ist, aber eine hohe Gymnastik des Kopfes; dass Begriffe, Kunstausdrücke, Methoden, Anspielungen in ihrer Sprache fortwährend vorkommen, welche die jungen Leute im Gespräche ihrer Angehörigen und auf der Gasse fast nie hören. Wenn die Schüler nur hören, so wird ihr Intellekt zu einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise unwillkürlich präformiert. Es ist nicht möglich, aus dieser Zucht völlig unberührt von der Abstraktion als reines Naturkind herauszukommen.«
Dieses Gymnasium hat mit dem heutigen nicht mehr viel Ähnlichkeit. Dieses Gymnasium, das ganz auf den Frontalunterricht in den alten Sprachen setzt, kannte ich (Bayern 1970 – 80) noch zum Teil. Es war, obwohl gern das Gegenteil behauptet wird, keine eigentlich gute Schule; vielleicht ist heute tatsächlich vieles besser, mindestens nicht mehr so dumpf. Wenn ich mich erinnere, erstaunt mich vor allem, was ich damals nicht erkennen konnte oder für selbstverständlich hielt, mit wie geringem Aufwand oder sagen wir lieber gleich: mit welcher Faulheit diese Lateinlehrer alle durchkamen. Auf etlichen von ihnen lag nicht nur jener Mehltau, von dem Nietzsche spricht, er faltete sich geradezu aus der Fläche in bizarren Wucherungen auf. Mit der alten Schule ist auch der völlig durch seine Marotten charakterisierte Lehrer dahin. Das ist ein Verlust im Malerischen, sonst wohl eher nicht. Nietzsche spricht offenbar in erster Linie von jenem Zögling, der er