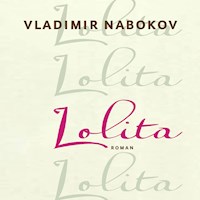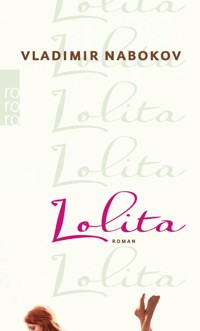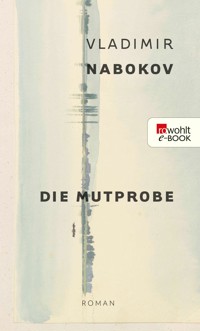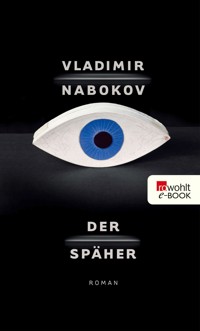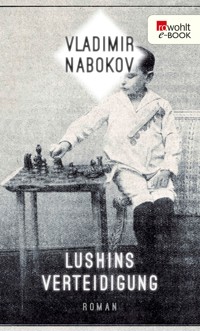
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein kleiner verschlossener Junge findet an nichts Vergnügen außer an Puzzlespielen und Zaubertricks. Mit vierzehn Jahren schon holt sich Lushin den ersten Schachturnier-Preis, mit zwanzig gehört er zu jenen gefeierten Matadoren, die von Turnierbrett zu Turnierbrett hetzen. Der große Erzähler Vladimir Nabokov hat diese traurig-komische Geschichte eines fast monströsen Außenseiters mit einer Fülle burlesker Details ausgestattet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Ähnliche
Vladimir Nabokov
Lushins Verteidigung
Roman
Deutsch von Dietmar Schulte und Dieter E. Zimmer
Über dieses Buch
Ein kleiner verschlossener Junge findet an nichts Vergnügen außer an Puzzlespielen und Zaubertricks. Mit vierzehn Jahren schon holt sich Lushin den ersten Schachturnier-Preis, mit zwanzig gehört er zu jenen gefeierten Matadoren, die von Turnierbrett zu Turnierbrett hetzen.
Der große Erzähler Vladimir Nabokov hat diese traurig-komische Geschichte eines fast monströsen Außenseiters mit einer Fülle burlesker Details ausgestattet.
Vita
Vladimir Nabokov ist einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Er entstammte einer großbürgerlichen russischen Familie, die nach der Oktoberrevolution von 1917 emigrierte. Nach Jahren in Cambridge, Berlin und Paris verließ Nabokov 1940 Europa und siedelte in die USA über, wo er an verschiedenen Universitäten arbeitete.
In den USA begann er, seine Romane auf Englisch zu verfassen, «Lolita» war Nabokovs Liebeserklärung an die englische Sprache, wie er im Nachwort selber schrieb. Nach einer anfänglich schwierigen Publikationsgeschichte wurde «Lolita» zum Welterfolg, der es Nabokov ermöglichte, sich nur noch dem Schreiben zu widmen.
Nabokov zog in die Schweiz, wo er schrieb, Schmetterlinge fing und seine russischen Romane ins Englische übersetzte.
Er lebte in einem Hotel in Montreux, wo er am 5. Juli 1977 starb.
Der Herausgeber, Dieter E. Zimmer, geboren 1934 in Berlin, 1959 bis 1999 Redakteur der Wochenzeitung «Die Zeit», seit 2000 freier Autor. Zahlreiche Veröffentlichungen über Themen der Psychologie, Biologie und Anthropologie, literarische Übersetzungen (u.a. Nabokov, Joyce, Borges).
Das Gesamtwerk von Vladimir Nabokov erscheint im Rowohlt Verlag.
Für Véra
Kapitel 1
Am tiefsten traf ihn, dass er ab Montag Lushin sein sollte. Sein Vater – der richtige Lushin, der ältere Lushin, der Bücher geschrieben hatte – verließ lächelnd das Kinderzimmer, rieb sich die Hände (schon für die Nacht mit einer wasserhellen, kühlenden Fettcreme eingerieben) und tappte mit seinem abendlichen, wildlederweichen Gang ins Schlafzimmer zurück. Seine Gattin lag im Bett. Sie richtete sich halb auf und fragte: «Nun, wie war’s?» Er legte seinen grauen Morgenrock ab und antwortete: «Wir haben es geschafft. Er hat es ruhig aufgenommen. Uff … Mir ist direkt ein Stein vom Herzen gefallen.» – «Wie gut …», sagte seine Frau und zog langsam ihre seidene Bettdecke hoch. «Gottseidank, gottseidank …»
Es war wirklich eine Erleichterung. Den ganzen Sommer über – einen flüchtigen Sommer auf dem Lande, der hauptsächlich von drei Gerüchen erfüllt gewesen war: blauem Flieder, frisch geschnittenem Heu und trockenem Laub –, diesen ganzen Sommer über hatten sie die Frage hin und her gewälzt, wann und wie man es ihm eröffnen solle, und sie hatten es verschoben, verschoben und schließlich bis Ende August hinausgezögert. Wieder und wieder waren sie um ihn herumgegangen, behutsam immer engere Kreise ziehend; sobald er aber auch nur den Kopf hob, begann der Vater mit vorgeschütztem Interesse an das Barometerglas zu klopfen, dessen Zeiger immer auf Sturm stand, indes die Mutter irgendwohin in die Tiefe des Hauses entfloh, hinter sich alle Türen offen ließ und den Strauß langstieliger blauer Glockenblumen in wirrer Unordnung auf dem Flügel vergaß. Die rundliche französische Gouvernante, die ihm laut den Grafen von Monte Christo vorlas (und sich ab und zu unterbrach, um gefühlvoll «Armer, armer Dantès!» zu rufen), machte seinen Eltern den Vorschlag, selber den Stier bei den Hörnern zu packen, auch wenn sie vor diesem Stier Todesangst empfand. Der arme, arme Dantès erweckte bei ihm keine Anteilnahme, und wenn er ihren pädagogischen Seufzer vernahm, kniff er bloß die Augen zusammen, bearbeitete wild sein Zeichenpapier mit einem Radierer und versuchte, die Wölbungen ihres Busens so abstoßend wie nur möglich zu porträtieren.
Lange Zeit danach, in einem Jahr unerwarteter Hellsichtigkeit und Verzauberung, erinnerte er sich ohnmächtig und entrückt dieser verflossenen Lesestunden auf der Veranda, schwimmend auf dem Rauschen des Gartens. Die Erinnerung daran verband sich mit Sonnenschein und dem süßen, tintigen Geschmack jener Lakritzestangen, von denen sie mit ihrem Federmesser kleine Stücke abhackte, die er dann unter die Zunge stecken musste. Auch die Reißzwecken, die er einst auf den Sitz des Korbsessels gelegt hatte, der unter Knarren und Knistern ihre gewichtige Hinterpartie aufnehmen sollte, entsprachen in seiner Erinnerung der Sonne, den Geräuschen des Gartens und der Mücke, die sich an seinem zerschundenen Knie vollsog und dabei beseligt ihr rubinrotes Hinterteil anhob. Gut und bis in alle Einzelheiten kennt ein Zehnjähriger seine Knie – den blutig gekratzten Huppel, die weißen Spuren der Fingernägel auf der braungebrannten Haut und alle die Schrammen, die die angefügten Signaturen von Sandkörnchen, Kieseln und scharfen Reisern sind. Die Mücke entkam gewöhnlich dem Schlag und flog davon; die Gouvernante bat ihn, doch nicht so hin und her zu rutschen; wütend vor Konzentration zeigte er seine unebenen, von einem Petersburger Dentisten mit Platindraht verklammerten Zähne, senkte den Kopf mit der Scheitellocke und kratzte und rieb alle fünf Finger auf der Stelle herum, wo ihn die Mücke gestochen hatte – und mit wachsendem Entsetzen beugte sich währenddessen die Gouvernante dem geöffneten Zeichenheft entgegen, der unglaublichen Karikatur.
«Nein, ich sage es ihm lieber selber», antwortete Lushin senior nicht ganz überzeugt auf ihr Angebot. «Ich sage es ihm später, soll er nur erst in Ruhe sein Diktat schreiben. Die Lerche nistete in einer alten Lärche», diktierte er in gemessenem Tempo und schritt dabei im Unterrichtszimmer auf und ab. «Die Lerche nistete in einer alten Lärche.» Und der Sohn schrieb, lag beim Schreiben fast auf dem Tisch, seine Zähne mit den Metallklammern traten hervor, und für die Wörter ‹Lerche› und ‹Lärche› ließ er einfach leere Stellen. Besser ging es mit Arithmetik: Eine geheimnisvolle Süße lag darin, dass eine unter langem Suchen mühsam gefundene Zahl sich nach manchen Abenteuern im entscheidenden Augenblick ohne Rest durch neunzehn teilen ließ.
Lushin senior fürchtete, dass sein Sohn, wenn er erst erführe, wozu diese Gründergestalten Russlands, diese Sineus und Truwor[1], denen jedes charakteristische Merkmal abging, wozu die Liste der russischen Wörter mit einem ‹Jatj› und die Hauptflüsse Russlands nötig seien, sich genauso anstellen würde wie vor zwei Jahren, als langsam und massig, vom Geräusch knarrender Treppenstufen, knackender Dielen sowie hin und her gerückter Koffer begleitet, die französische Gouvernante erschienen war und sich mit ihrer Person im ganzen Haus breitgemacht hatte. Doch nichts dergleichen trat ein; er hörte ruhig zu; und als der Vater in seinem Bemühen, die interessantesten und erfreulichsten Einzelheiten zusammenzusuchen, unter anderem erwähnte, dass er fortan wie ein Erwachsener mit seinem Familiennamen gerufen würde, errötete der Sohn, begann zu blinzeln, ließ sich mit dem Rücken auf ein Kissen fallen, sperrte den Mund auf und schüttelte den Kopf («Rutsch nicht so herum!», sagte der Vater ahnungsvoll, als er seine Aufregung bemerkte und Tränen erwartete), weinte jedoch nicht, vergrub vielmehr sein Gesicht ins Kissen, presste mit Plosivlauten die Lippen hinein, richtete sich dann plötzlich auf, um zerzaust, glühend und mit glänzenden Augen die Frage hervorzusprudeln, ob man ihn auch zuhause Lushin nennen würde.
Auch jetzt, an diesem trüben, angespannten Tag, unterwegs zum Bahnhof, zum Zug nach St. Petersburg, schaute Lushin senior, der neben seiner Frau in der Kutsche saß, auf den Sohn, bereit, ihn sofort anzulächeln, falls er ihm das hartnäckig abgewandte Gesicht zuwenden sollte, und konnte nicht begreifen, warum dieser plötzlich so «unnatürlich steif und abweisend» war, wie seine Frau sich ausdrückte. In schwarzbraune Loden gewickelt, saß der Sohn auf der Vorderbank, seine Matrosenmütze schief auf dem Kopf, die zurechtzurücken im Augenblick niemand in der Welt gewagt hätte, und schaute zur Seite auf die dicken, vorbeihuschenden Birkenstämme am Rande des Grabens, der mit ihren Blättern angefüllt war.
«Frierst du denn nicht?», fragte die Mutter, als der Weg zum Fluss bog und eine Windbö den grauen Vogelflügel auf ihrem Hut in Bewegung brachte. «Ja», sagte der Sohn und schaute auf den Fluss. Mit einem mauzenden Laut griff die Mutter nach seinem Umhang, doch als sie den Ausdruck in seinen Augen bemerkte, zog sie die Hand zurück und deutete nur hilflos mit den Fingern in der Luft umher: «Mach ihn zu, mach ihn fester zu.» Der Sohn rührte sich nicht. Sie wölbte die Lippen, um den Schleier vom Munde zu lösen – eine ständige Gebärde, fast ein Tic von ihr –, und in stillem Flehen um Beistand blickte sie ihren Gatten an. Auch er trug einen Lodenmantel, seine Hände steckten in Fäustlingen und lagen auf dem karierten Plaid, das schräg herabfiel, ein Tal bildete und kaum merklich wieder bis zur Taille des kleinen Lushin anstieg. «Lushin», sagte er mit gezwungener Fröhlichkeit, «na, Lushin?», und stieß seinen Sohn unter dem Plaid sanft mit dem Fuß. Lushin zog die Knie an. Da waren schon die Dächer der Bauernhäuser, dicht mit hellem Moos bewachsen, da war der vertraute alte Pfahl mit der halbverwaschenen Inschrift (der Name des Dorfes und die Anzahl seiner «Seelen»), da der Dorfbrunnen mit seinem Eimer, schwarzem Matsch und einer Bäuerin mit weißen Beinen. Außerhalb des Dorfes fuhren sie im Schritt bergan, und weiter unten tauchte hinter ihnen die zweite Kutsche auf, in der eng beieinander die Französin und die Wirtschafterin saßen, die sich nicht ausstehen konnten. Der Kutscher schnalzte, die Pferde setzten sich wieder in Trab. Über dem Stoppelfeld flog langsam am farblosen Himmel eine Krähe.
Die Bahnstation lag zwei Werst vom Gutshaus entfernt, dort, wo die eben noch sanft und hallend durch den Tannenwald führende Landstraße die St. Petersburger Chaussee kreuzte und sich dann über die Gleise hinweg, unter der Schranke hindurch ins Unbekannte verlor. «Wenn du willst, kannst du die Marionetten tanzen lassen», sagte Lushin senior schmeichlerisch, als sein Sohn aus der Kutsche gesprungen war und nun auf dem Boden stand und seinen Hals hin und her drehte, weil ihn die Wolle des Lodenmantels kratzte. Schweigend nahm der Sohn das dargebotene Zehnkopekenstück. Aus der zweiten Kutsche krochen schwerfällig die Gouvernante und die Wirtschafterin, die eine nach rechts, die andere nach links. Der Vater zog seine Handschuhe aus. Die Mutter schlug ihren Schleier zurück und achtete auf den kräftig gebauten Gepäckträger, der die Plaids einsammelte. Ein Windstoß ließ die Mähnen der Pferde flattern und blähte die karminroten Ärmel des Kutschers auf.
Ganz allein auf dem Bahnsteig, trat Lushin an den Glaskasten heran, in dem fünf kleine Puppen mit nackten, herabhängenden Beinen darauf warteten, dass ein Geldstück sie zum Leben erwecken und sich im Kreise drehen lassen werde; aber ihre Erwartung wurde heute enttäuscht, der Automat war kaputt, und das Zehnkopekenstück war verloren. Lushin wartete eine Weile, drehte sich dann um und trat an die Bahnsteigkante. Rechts saß auf einem gewaltigen Bündel ein kleines Mädchen, den Ellbogen in die flache Hand gestützt, und aß einen grünen Apfel. Links stand ein Mann in Stiefelgamaschen, eine Reitgerte in der Hand, und schaute in die Ferne zum Waldrand hinüber, hinter dem in wenigen Minuten ein Vorbote des Zuges auftauchen musste – ein weißes Wölkchen. Geradezu, auf der anderen Seite der Gleise, neben einem dunkelgelben Zweiter-Klasse-Wagen ohne Räder, der im Boden Wurzeln geschlagen hatte und in eine ständige menschliche Behausung verwandelt worden war, hackte ein Bauer Brennholz. Plötzlich wurde das alles von einem Tränenschleier verdeckt, seine Lider brannten; zu ertragen, was unmittelbar bevorstand, erschien unmöglich – der Vater, die Fahrkarten fächerförmig in der Hand, die Mutter, die Koffer mit den Augen nachzählend, der einfahrende Zug, der Gepäckträger, der einen Tritt an die Wagenplattform stellte, um das Einsteigen bequemer zu machen. Er sah sich um. Das kleine Mädchen aß ihren Apfel; der Mann in den Stiefelgamaschen blickte in die Ferne; alles war ruhig. Fast schlendernd erreichte er das Ende des Bahnsteigs und rannte plötzlich rasch davon, eilte ein paar Stufen hinab – ein ausgetretener Pfad, der kleine Garten des Stationsvorstehers, ein Zaun, eine Pforte, Tannen, geradeaus eine kleine Schneise und dann unvermittelt dichter Wald.
Anfangs lief er geradeaus durch den Wald, streifte raschelndes Farnkraut, glitschte auf den herbstroten Blättern der Maiglöckchen – die Mütze hing ihm, nur noch von ihrem Gummiband gehalten, im Nacken, seine Knie in den wollenen Stadtstrümpfen fühlten sich heiß an, er weinte im Laufen, jammerte, schimpfte wie ein kleines Kind, wenn ihm ein Zweig an die Stirn schlug – und hielt schließlich inne, hockte sich außer Atem hin, sodass sein Lodenmantel die Beine bedeckte.
Erst heute, am Tag der Abreise in die Stadt, einem ohnehin nicht erfreulichen Tag, an dem überall im Hause Durchzug herrscht, an dem man den Gärtner beneidet, weil er nirgendwohin zu reisen braucht, erst heute begriff er den ganzen Schrecken der Umstellung, von der sein Vater gesprochen hatte. Die gewohnte Rückkehr in die Stadt im Herbst früherer Jahre erschien auf einmal das reine Glück. Der tägliche Morgenspaziergang mit der Gouvernante – immer durch ein und dieselben Straßen, den Newskij-Prospekt entlang und dann im Bogen über die Uferpromenade nach Hause – würde sich nun nie mehr wiederholen. Glückliche Spaziergänge. Manchmal hatte sie ihm auch vorgeschlagen, mit der Uferpromenade zu beginnen, aber das hatte er stets abgelehnt – nicht so sehr, weil er von früher Kindheit an ein Freund der Gewohnheit war, sondern weil er unerträgliche Angst vor der Peter-Pauls-Kanone hatte, deren mächtiger Donnerschlag die Fensterscheiben der Häuser erzittern ließ, dass einem das Trommelfell wehtat. Immer wusste er es durch unscheinbare kleine Tricks so einzurichten, dass sie sich um zwölf Uhr mittags auf dem Newskij-Prospekt weit weg von der Kanone befanden, deren Knall sie sonst bei der vorgeschlagenen Änderung des Spazierweges unmittelbar am Winterpalast erreicht hätte. Vorbei war es auch mit dem süßen Sichgehenlassen nach dem Mittagessen auf der Couch unter der Tigerdecke und der genau um zwei gereichten Milch in der silbernen Tasse, die ihr einen so kostbaren Geschmack verlieh; vorbei mit der Spazierfahrt im offenen Landauer genau um drei. Stattdessen stand jetzt etwas widerwärtig Neues und Unbekanntes bevor, eine aussichtslose, unfassbare Welt, in der es, von neun bis drei, fünf Unterrichtsstunden nacheinander geben würde und eine Schar von Jungen, noch furchterregender als jene, die ihn kürzlich an einem Julitag auf der Brücke umzingelt, ihre Blechpistolen auf ihn gerichtet und ihn mit Holzstöckchen beschossen hatten, von denen heimtückischerweise die Gummisaugkappen abgezogen worden waren.
Im Wald war es still und feucht. Nachdem er sich ausgeweint hatte, spielte er ein wenig mit einem Käfer, dessen Fühler unruhig zuckten, und während er sich Mühe gab, das ursprüngliche, saftige Knackgeräusch zu wiederholen, zerquetschte er ihn lustvoll mit einem Stein. Schließlich bemerkte er, dass es zu nieseln begonnen hatte. Er stand auf, fand den vertrauten Pfad und rannte weiter, über Wurzeln stolpernd, bewegt von dem aufregenden, rachsüchtigen Gedanken, das Sommerhaus zu finden: Er würde sich dort den Winter über verstecken und von Käse und Eingemachtem aus der Speisekammer ernähren. Der Pfad schlängelte sich etwa zehn Minuten durch den Wald, führte dann zum Fluss hinunter, auf dem Regentropfen dicht bei dicht Ringe bildeten, und nach weiteren fünf Minuten kam die Sägemühle in Sicht, der Steg, wo man bis zu den Knöcheln in Sägemehl versank, und schließlich – durch kahle Fliederbüsche hindurch – das Haus. Er schlich die Mauer entlang, sah, dass das Wohnzimmerfenster offen stand, kletterte an der Regenrinne auf das grüne Sims, dessen Farbe abblätterte, und rollte über das Fensterbrett hinein. Im Wohnzimmer blieb er stehen und horchte. Eine Daguerreotypie seines Großvaters mütterlicherseits – schwarzer Backenbart, eine Geige in der Hand – starrte zu ihm herunter, verschwand aber völlig, löste sich hinter dem Glas auf, sobald er das Porträt von der Seite anschaute; ein sinnloser Spaß, den er nie versäumte, sooft er das Wohnzimmer betrat. Er überlegte einen Augenblick, schob die Oberlippe hin und her, wodurch die Platinklammer an den Vorderzähnen ungehindert auf und ab glitt, öffnete vorsichtig die Tür, fuhr zusammen vor dem widerhallenden Echo, das nach dem Auszug der Herrschaften allzu rasch vom Hause Besitz ergriffen hatte, huschte über den Korridor und von dort die Treppe hinauf zum Dachboden. Es war ein eigenartiger Boden mit einem kleinen Fenster, durch das man auf die Treppe hinunterschauen konnte, auf den bräunlichen Glanz ihres Geländers, das sich weiter unten anmutig krümmte und dann im Dämmerlicht verschwand. Das Haus war vollkommen still. Nach einer Weile klingelte unten im Arbeitszimmer des Vaters gedämpft das Telephon. Es läutete immer wieder, eine ganze Weile lang. Dann trat wieder Stille ein.
Er ließ sich auf einer Kiste nieder. Ganz in der Nähe stand eine ähnliche Kiste, die aber geöffnet war und in der sich Bücher befanden. Ein Damenfahrrad mit zerrissenem grünem Netz am Hinterrad stand in einem Winkel, die Räder nach oben, zwischen einem rohen, an die Wand gelehnten Brett und einem gewaltigen Reisekoffer. Schon nach kurzer Zeit begann sich Lushin zu langweilen wie an Tagen, wenn er, einen Flanellschal um den Hals, nicht hinausdurfte. Er griff nach den staubigen, schmutzig grauen Büchern in der offenen Kiste und ließ schwarze Fingerabdrücke auf ihnen zurück. Außer den Büchern lagen noch ein Federball mit einer einzigen Feder, eine große Photographie (eine Militärkapelle), ein gesprungenes Schachbrett und einige andere nicht besonders interessante Dinge herum.
So verging eine Stunde. Plötzlich hörte er Stimmengewirr und das Quietschen der Haustür. Als er vorsichtig durch das kleine Fenster spähte, erblickte er unten den Vater, der wie ein Knabe die Treppe heraufrannte, aber, noch ehe er den Absatz erreicht hatte, wieder behände und mit auswärts gebogenen Knien hinunterlief. Die Stimmen unten waren jetzt deutlich: der Hausdiener, der Kutscher und der Wachtmann. Kurze Zeit später belebte sich die Treppe von neuem. Diesmal war es die Mutter, die mit zusammengerafften Röcken eilig heraufstieg, aber auch sie kam nicht bis zum Absatz, sondern lehnte sich über das Geländer und lief dann rasch mit ausgebreiteten Armen wieder hinunter. Endlich, nachdem abermals etwas Zeit verstrichen war, bewegte sich die ganze Gesellschaft wie ein Aufgebot nach oben – die Glatze des Vaters glänzte, der Vogel auf dem Hut der Mutter schwankte hin und her wie eine Ente auf einem gekräuselten Teich, der graue, kurzgeschorene Schopf des Hausdieners wippte auf und ab; dahinter kamen der Kutscher, der sich immerzu über das Geländer beugte, der Wachtmann und aus unerfindlichen Gründen sogar Alkulina, das Milchmädchen, sowie am Schluss ein schwarzbärtiger Bauer von der Wassermühle, künftiger Mitwirkender künftiger Albträume. Er als der Stärkste war es dann, der Lushin vom Dachboden hinunter zur Kutsche trug.
Kapitel 2
Lushin senior, der Lushin, der Bücher geschrieben hatte, dachte oft darüber nach, was aus seinem Sohn einmal werden würde. In seinen Büchern – sie waren alle, mit Ausnahme des vergessenen Romans Dunst, für Knaben, Jünglinge und Schüler mittlerer Lehranstalten geschrieben und wurden in starken bunten Einbänden verkauft – erschien immer wieder die Gestalt eines blond gelockten Knaben, «trotzköpfig», «verträumt», der dann zum Geiger oder Maler heranreifte, ohne hierdurch seine moralische Schönheit einzubüßen. Die kaum wägbaren Eigentümlichkeiten, durch welche sich sein Sohn von allen jenen Kindern unterschied, die seiner Meinung nach dazu bestimmt waren, zu völlig unbemerkenswerten Menschen zu werden (vorausgesetzt, dass es solche gab), deutete er als unbewusste Regungen von Talent; er klammerte sich fest an den Umstand, dass sein verstorbener Schwiegervater Komponist gewesen war (übrigens ein ziemlich trockener Komponist, der sich in reiferen Jahren im zweifelhaften Glanz von Virtuosität gesonnt hatte). So manches Mal stieg er nachts im Traume mit einer Kerze ins Wohnzimmer hinunter, wo, einer Lithographie nicht unähnlich, das Wunderkind in weißem, bis zu den Fersen reichendem Hemd auf einem mächtigen schwarzen Flügel spielte.
Es kam ihm vor, als müssten alle das Ungewöhnliche an seinem Sohn bemerken; fremde Menschen, so schien es ihm, könnten sich darauf vielleicht eher einen Reim machen als er selber. Die Schule, die er für seinen Sohn ausgesucht hatte, war besonders dafür berühmt, auf das «Innenleben» ihrer Schüler einzugehen, für ihre Menschlichkeit, Rücksichtnahme und freundliche Einsicht. Es hieß, dass in der ersten Zeit ihres Bestehens die Lehrer in der großen Pause gemeinsam mit den Kindern herumgetobt hatten – der Physiklehrer schielte beim Schneeballbacken über die Schulter, der Mathematiklehrer bekam beim lapta (einer Art russischem Baseball) den großen Ball in die Seite, und sogar der Direktor feuerte mit fröhlichen Zurufen das Spiel an. Solche gemeinschaftlichen Spiele gab es jetzt nicht mehr, aber der idyllische Ruf war geblieben. Der Klassenlehrer seines Sohnes unterrichtete russische Literatur, war ein guter Bekannter des Schriftstellers Lushin und übrigens kein schlechter Lyriker, der einen Sammelband anakreontischer Gedichte herausgegeben hatte. «Kommen Sie vorbei», hatte er damals gesagt, als Lushin seinen Sohn zum ersten Mal in die Schule brachte. «Donnerstags um zwölf.» Lushin kam vorbei. Auf der Treppe war es leer und ruhig. Als er durch die Halle zum Lehrerzimmer ging, vernahm er aus der zweiten Klasse gedämpft ein vielstimmiges Lachen. In der folgenden Stille hallten seine Schritte ganz besonders deutlich auf dem gelben Parkett. Im Lehrerzimmer saß der Erzieher hinter einem großen, mit einem Wolltuch bedeckten Tisch – das Ganze ließ die Vorstellung von Examina aufkommen – und schrieb einen Brief.
Seitdem sein Sohn diese Schule besuchte, hatte er mit dem Lehrer nicht mehr gesprochen, und als er heute, einen Monat später, bei ihm erschien, war er von prickelnder Erwartung, Aufregung und Bangigkeit erfüllt – von denselben Gefühlen, die er einst durchlebte, als er in seiner Studentenuniform den Redakteur aufsuchte, dem er kurz vorher seine erste Erzählung geschickt hatte. Auch heute bekam er, genau wie damals, statt Worten freudigen Erstaunens, die er im Stillen erwartete (wie man beim Erwachen in einer fremden Stadt, noch ehe man die Lider geöffnet hat, einem ungewöhnlichen, strahlenden Morgen entgegensieht), statt aller jener Worte, die er am liebsten selber souffliert hätte, wäre nicht die Hoffnung gewesen, dass sie schließlich von selber fielen, bekam er kalte, nichtssagende Worte zu hören, die ihm zeigten, dass der Lehrer seinen Sohn noch weniger verstand als er selber. Von irgendwelchen verborgenen Talenten war keine Rede. Das bleiche, bärtige Gesicht mit den geröteten Grübchen auf den Nasenflügeln gesenkt, nahm der Lehrer vorsichtig den Kneifer von der Nase, rieb sich die Augen mit den Handflächen und begann als Erster zu sprechen. Er sagte, der Knabe könne besser lernen, es sehe so aus, als vertrage sich der Knabe nicht mit seinen Kameraden, der Knabe laufe in den Pausen nicht viel herum … «Der Knabe ist zweifellos befähigt», sagte der Lehrer, der inzwischen sein Augenreiben beendet hatte, «aber wir müssen eine gewisse Lustlosigkeit bei ihm feststellen.» In diesem Augenblick ertönte irgendwo unten ein Klingeln, sprang nach oben und pflanzte sich unerträglich gellend durch das ganze Gebäude fort. Darauf folgten zwei, drei Sekunden absoluter Stille – und plötzlich wurde es überall lebendig, ein Tosen setzte ein, Pultdeckel wurden zugeschlagen, und die Halle füllte sich mit Stimmengewirr und Fußgetrappel. «Große Pause», sagte der Lehrer, «wenn Sie wollen, gehen wir zusammen auf den Hof hinunter. Sie können zuschauen, wie die Kinder herumtoben.»
Die Jungen stürmten die Steintreppe hinunter und polierten, eine Hand auf dem Geländer, mit ihren Sandalen die abgeschliffenen Stufenkanten. Unten, in der dunklen Enge voller Kleiderständer, wechselten sie die Schuhe; einige setzten sich dazu auf die breiten Fensterbänke und banden eilig unter Schnaufen die Schnürsenkel fester. Plötzlich erblickte er seinen Sohn, der gebückt dastand und widerwillig seine Stiefel aus einem Tuchbeutel herausnahm. Ein drängelnder, flachsblonder Junge schubste ihn beiseite, er machte Platz und sah plötzlich seinen Vater. Dieser lächelte ihm zu, hielt seine hohe Persianer-schapka in der Hand und brachte ihr mit der Handkante oben die erforderliche Delle bei. Lushin kniff die Augen zusammen und wandte sich ab, als hätte er seinen Vater nicht gesehen. Er hockte auf dem Boden, kehrte seinem Vater den Rücken und machte sich an den Stiefeln zu schaffen; die Jungen, die schon fertig waren, stiegen über ihn hinweg. Nach jedem Schubs krümmte er sich noch mehr zusammen, als verstecke er sich in einer dunklen Ecke. Als er endlich hervorkam mit seinem langen grauen Mantel und der Persianermütze (die ihm ein und derselbe Rowdy immer wieder herunterriss), stand der Vater schon am Tor und schaute erwartungsvoll vom anderen Ende des Hofes hinüber. Neben ihm stand der Literaturlehrer, und als diesem während des Spiels der große Gummiball, mit dem die Jungen Fußball spielten, zufällig vor die Füße rollte, setzte er spontan die entzückende Überlieferung fort und tat so, als wolle er ihm einen Stoß geben, trat aber nur ungeschickt von einem Fuß auf den anderen, verlor fast eine seiner Galoschen und brach dann in gutmütiges Lachen aus. Der Vater stützte ihn am Ellbogen, und Lushin junior nutzte den Augenblick, um auf den Korridor zurückzulaufen, wo es jetzt ganz ruhig war und hinter Garderobenständern verborgen der Pedell wonnevoll gähnte. Durch die Türscheibe zwischen den gusseisernen Strahlen der Gittersterne hindurch sah er, wie der Vater plötzlich seinen Handschuh auszog, sich rasch von dem Erzieher verabschiedete und unter dem Torbogen verschwand. Dann erst kroch er wieder hervor, ging vorsichtig um die Spielenden herum und sonderte sich nach links ab, wo unter einem Schwibbogen Brennholz aufgestapelt lag. Dort ließ er sich mit hochgeschlagenem Mantelkragen auf den Scheiten nieder.
So saß er etwa zweihundertfünfzig große Pausen hindurch, bis zu dem Jahr, als man ihn ins Ausland brachte. Manchmal war unerwartet der Lehrer hinter einer Ecke aufgetaucht. «Lushin, warum sitzt du hier immer herum wie ein Häufchen Unglück? Du könntest doch ein bisschen mit den Kameraden herumtoben.» Lushin erhob sich von dem Holzstapel, versuchte einen Platz zu finden, der in gleich weiter Entfernung von seinen drei Klassenkameraden lag, die sich um diese Stunde besonders wild aufführten, nahm vor dem Ball Reißaus, den irgendwer mit voller Wucht geschossen hatte, und kaum hatte er sich vergewissert, dass der Lehrer weit weg war, kehrte er zu dem Holzstapel zurück. Diesen Platz hatte er sich schon am ersten Tag ausgesucht, an jenem schwarzen Tag, an dem er um sich herum solch eine Abneigung, eine so spöttische Neugier spürte, dass seine Augen sich ganz von allein mit einem brennenden Schleier überzogen. Alles, was er ansah – unter dem verwünschten Zwang, irgendetwas anzusehen –, unterlag einer raffinierten optischen Metamorphose. Die Heftseite mit den hellblauen Karos begann zu verschwimmen; die weißen Ziffern auf der schwarzen Tafel flossen bald zusammen, bald wieder auseinander; die Stimme des Arithmetiklehrers klang immer dumpfer und unverständlicher, als ob sie sich allmählich weiter und weiter entfernte, und der Nebenmann auf der Bank, ein tückischer Rohling mit Flaum auf den Wangen, sagte leise und tief befriedigt: «Gleich heult er.» Aber er weinte kein einziges Mal, sogar dann nicht, als sie mit vereinten Kräften versuchten, seinen Kopf in das niedrige Becken mit den gelben Blasen hinunterzudrücken. «Meine Herrschaften», sagte der Lehrer in einer seiner ersten Stunden, «euer neuer Kamerad ist der Sohn eines Schriftstellers. Solltet ihr noch nichts von ihm gelesen haben, so tut das gefälligst.» Mit großen Buchstaben schrieb er dann an die Tafel, wobei er so fest aufdrückte, dass die Kreide unter seinen Fingern knirschend abbröckelte: DIE ABENTEUER DES JUNGEN ANTOSCHA, VERLAG SILWESTROW & CO. Für die nächsten zwei, drei Monate nannten seine Klassenkameraden Lushin dann Antoscha. Der Rohling brachte mit geheimnisvoller Miene das Buch mit in die Klasse, zeigte es während des Unterrichts verstohlen den anderen, schielte vieldeutig auf Lushin – und als die Stunde zu Ende war, begann er aufs Geratewohl eine Stelle mittendrin laut vorzulesen und verdrehte dabei absichtlich die Worte. Petrischtschew, der ihm über die Schulter blickte, versuchte eine Seite festzuhalten, worauf sie riss. Krebs brabbelte: «Mein Papa sagt, das ist ein ganz zweitrangiger Schriftsteller.» Gromow schrie: «Antoscha soll es uns selber vorlesen!» – «Nein, geben wir lieber jedem ein Stück», sagte genießerisch der Spaßvogel der Klasse, der nach stürmischer Balgerei das rotgold prunkende Bändchen ergattert hatte. Buchseiten flatterten durch das ganze Klassenzimmer. Auf einer war ein Bild – ein helläugiger Gymnasiast, der an einer Straßenecke einen räudigen Hund mit seinem Frühstücksbrot füttert. Am nächsten Tag fand Lushin dieses Bild sorgfältig mit Reißzwecken an die Unterseite seines Pultdeckels geheftet.
Bald ließen sie ihn jedoch in Ruhe; nur der Spitzname tauchte ab und zu noch einmal auf, aber da er auf ihn beharrlich nicht reagierte, geriet auch er schließlich in Vergessenheit. Man hörte auf, Lushin überhaupt zu beachten, man sprach nicht mit ihm, und selbst der einzige Schüchterne in der Klasse (wie es ihn in jeder Klasse gibt, ebenso wie unweigerlich einen Dicken, einen Kraftmeier und einen Witzbold) hielt sich von ihm fern, aus Furcht, die verachtete Stellung mit ihm teilen zu müssen. Dieser Schüchterne erhielt übrigens sechs Jahre später, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, für ein äußerst gefährliches Spähtruppunternehmen das Georgskreuz und verlor dann im Bürgerkrieg einen Arm. Als er (in den zwanziger Jahren des Jahrhunderts) den Versuch machte, sich vorzustellen, wie Lushin in der Schule gewesen sei, konnte er sich dessen Bild nicht mehr anders in Erinnerung rufen als von hinten; er sah nur noch, wie Lushin entweder vor ihm mit abstehenden Ohren in der Klasse saß oder vom Lärm weg an das andere Ende der Halle flüchtete, wie er mit einer Schlittendroschke nach Hause fuhr, die Hände in den Taschen, den großen scheckigen Ranzen auf dem Rücken, wie es schneite … Er versuchte vorauszulaufen, ihm ins Gesicht zu schauen, aber dieser eigentümliche Schnee des Vergessens hatte schweigend die Erinnerung mit einem dichten, lückenlosen Nebeltuch zugedeckt. Und der einstmals Schüchterne, heute ein ruheloser Emigrant, sagte mit einem Blick auf das Bild in der Zeitung: «Stellen Sie sich vor, ich kann mich überhaupt nicht an sein Gesicht erinnern … Ich kann mich einfach nicht erinnern …»
Doch Lushin senior, der gegen vier immer wieder zum Fenster hinausschaute, sah den näher kommenden Schlitten und wie einen blassen Fleck das Gesicht des Sohnes. Gewöhnlich kam der Sohn sofort zu ihm ins Arbeitszimmer, küsste die Luft, während er mit seiner Wange ganz leicht die des Vaters berührte, und wandte sich sofort wieder zum Gehen. «Warte», sagte der Vater, «warte. Erzähl einmal, wie es heute war. Musstest du an die Tafel?»
Voller Erwartung blickte er seinen Sohn an, der das Gesicht abwandte; er hatte Lust, ihn bei den Schultern zu packen, ihn zu schütteln, ihn fest auf die blassen Wangen, auf die Augen, auf die zarte, konkave Schläfe zu küssen. In jenem ersten Schulwinter ging von dem kleinen, anämischen Lushin ein merklicher Knoblauchgeruch aus, eine Folge der arsenhaltigen Spritzen, die der Arzt verordnet hatte. Den Platindraht hatte man entfernt, aber aus Gewohnheit fuhr er fort, die Zähne zu zeigen und die Oberlippe aufzustülpen. Er trug eine graue Matrosenjacke mit einem Band auf dem Rücken und Knickerbocker mit Knöpfen unter den Knien. Er stand am Schreibtisch, balancierte auf einem Bein, und sein Vater wagte es nicht, etwas gegen seine abweisende Verdrießlichkeit zu unternehmen. Der kleine Lushin ging hinaus und schleifte den Schulranzen auf dem Teppich hinter sich her; Lushin senior stützte sich mit dem Ellbogen auf den Tisch, wo er in dunkelblaue Schulheftchen (eine Marotte, die ein künftiger Biograph vielleicht zu würdigen wüsste) eine seiner üblichen Erzählungen schrieb, und lauschte auf den Monolog im angrenzenden Speisezimmer, auf die Stimme seiner Frau, die die Stille zu überreden suchte, eine Tasse Kakao zu trinken. Entsetzlich, diese Stille, dachte Lushin senior. Er ist nicht gesund, er hat wohl so etwas wie Seelenschmerzen … Vielleicht hätte man ihn doch nicht in die Schule schicken sollen. Aber man muss ihn doch an die Gesellschaft der anderen Jungen gewöhnen … Eine rätselhafte Sache, ein Rätsel …
«Dann iss doch wenigstens einen Keks», fuhr die Stimme hinter der Wand bekümmert fort, und wieder herrschte Stille. Manchmal aber geschah etwas Entsetzliches: Plötzlich antwortete ohne erkennbaren Grund eine andere Stimme, kreischend, heiser, und wie bei einem Orkan krachte die Tür zu. Dann sprang Lushin senior auf und stürzte ins Speisezimmer, den Federhalter wie einen Wurfpfeil in der Hand. Seine Frau nahm gerade mit zitternden Händen die umgekippte Tasse und die Untertasse vom Tischtuch und schaute nach, ob sie einen Sprung abbekommen hatten. «Ich habe ihn nach der Schule gefragt», sagte sie, ohne ihren Mann anzublicken. «Er wollte nicht antworten – aber dann … wie ein Rasender …» Sie lauschten beide. Die französische Gouvernante war im Herbst nach Paris zurückgefahren, und jetzt wusste niemand mehr, was er in seinem Zimmer eigentlich trieb. Die Tapete dort war weiß, und weiter oben war ein hellblauer Streifen mit grauen Gänsen und fuchsroten Welpen. Die Gans ging auf einen Welpen los, und dann wiederholte sich das, achtunddreißigmal, um das ganze Zimmer herum. Auf einem Wandgestell standen ein Globus und ein ausgestopftes Eichhörnchen, das einmal am Palmsonntag auf dem Kätzchenmarkt gekauft worden war. Unter den Troddeln des Lehnsessels guckte eine grüne Aufziehlokomotive hervor. Es war ein hübsches, helles Zimmer. Lustige Tapeten, lustige Sachen.
Auch Bücher waren da. Vom Vater verfasste Bücher in gold-rot geprägten Einbänden mit handschriftlicher Widmung auf der ersten Seite: «Ich hoffe inniglich, dass sich mein Sohn zu Tieren und Menschen immer so verhält wie Antoscha», mit einem großen Ausrufungszeichen dahinter. Oder: «Dieses Buch habe ich geschrieben, mein Sohn, als ich an Deine Zukunft dachte.» Diese Widmungen riefen bei ihm das verwirrende Gefühl hervor, dass er sich für den Vater schämen müsse, während die Bücher selbst ebenso langweilig waren wie Korolenkos Der blinde Musikant oder Gontscharows Die Fregatte Pallas. Ein dicker Puschkin-Band mit dem Porträt des krausköpfigen Knaben mit den wulstigen Lippen wurde überhaupt niemals aufgeschlagen. Dafür aber gab es zwei Bücher – beide hatte ihm die Tante geschenkt –, die er fürs ganze Leben lieb gewann, die er deutlich wie unter einem Vergrößerungsglas im Gedächtnis behielt und so leidenschaftlich durchlebte, dass er in ihnen, als er sie nach zwanzig Jahren nochmals las, nur eine dröge Nacherzählung, eine gekürzte Ausgabe zu erblicken glaubte, ganz als hätte das unwiederholbare, unauslöschliche Bild, das in ihm zurückgeblieben war, sie weit hinter sich gelassen. Aber nicht die Sehnsucht nach Fernreisen ließ ihn Phileas Fogg folgen, nicht das kindliche Gefallen an geheimnisvollen Abenteuern zog ihn zu dem Haus in der Baker Street hin, wo sich der hagere Detektiv mit dem Falkenprofil eine Kokainspritze gegeben hatte und träumerisch Geige spielte. Erst viel später machte er sich klar, wodurch ihn diese beiden Bücher so bewegt hatten: durch ihre sich folgerichtig und schonungslos entwickelnde Handlung – Phileas, diese Modepuppe mit Zylinder, der seine verwickelte, kunstvoll ersonnene, jedes Opfer rechtfertigende Reise bald auf dem für eine Million gekauften Elefanten, bald auf einem Schiff zurücklegte, das er zur Hälfte verfeuern musste; und Sherlock, der der Logik den Zauber eines Tagtraums verlieh, Sherlock, der eine Monographie über die Asche aller bekannten Zigarrensorten verfasste und mithilfe dieser Asche wie mit einem Zaubermittel durch das kristallene Labyrinth aller möglichen Folgerungen hindurch zu dem einzig richtigen, glänzenden Schluss gelangte. Der Zauberkünstler, den seine Eltern zu Weihnachten eingeladen hatten, vereinigte irgendwie für kurze Zeit Fogg und Holmes, und ein eigenartiges Wonnegefühl, das Lushin an diesem Tage empfand, wog all das Unangenehme auf, das mit dessen Vorführung verbunden war. Da die Bitten – behutsame, nur selten geäußerte Bitten –, «deine Schulfreunde doch einmal einzuladen», zu nichts geführt hatten, hatte sich Lushin senior in der Überzeugung, dass derlei sowohl vergnüglich als auch lehrreich sein würde, an zwei Bekannte gewandt, deren Söhne dieselbe Schule besuchten, und hatte außerdem die Kinder eines entfernten Verwandten eingeladen, zwei stille, schwächliche Knaben und ein blasses Mädchen mit einem dicken, schwarzen Zopf. Die eingeladenen Knaben steckten in Matrosenanzügen und dufteten nach Pomade. In zweien erkannte Lushin junior zu seinem Entsetzen Bersenjew und Rosen aus der dritten Klasse, die in der Schule immer unordentlich gekleidet waren und sich wild aufführten. «Nun denn», sagte Lushin senior aufgeräumt und packte seinen Sohn an der Schulter (die Schulter glitt langsam unter seiner Hand weg). «Jetzt lasse ich euch allein. Freundet euch an, spielt eine Weile – und dann werdet ihr gerufen, und es gibt eine Überraschung.» Nach einer halben Stunde kam er, um sie zu holen. Im Zimmer herrschte Schweigen. Das Mädchen saß in einer Ecke und blätterte auf der Suche nach Bildern in einer Beilage der Zeitschrift Niwa (Das Kornfeld). Bersenjew und Rosen saßen auf dem Sofa, verlegen, mit hochroten Köpfen, spiegelblank vor Pomade. Die schwächlichen Neffen gingen im Zimmer hin und her, betrachteten gelangweilt die englischen Holzschnitte an den Wänden, den Globus, das Eichhörnchen und den schon seit langem zerbrochenen Schrittzähler, der auf dem Tisch lag. Lushin selbst, ebenfalls im Matrosenanzug mit weißem Band und Pfeife auf der Brust, saß auf einem Holzstuhl am Fenster, blickte mürrisch drein und knabberte an einem Daumennagel. Der Zauberkünstler jedoch machte dann alles wieder wett, und als Bersenjew und Rosen am nächsten Tage wie eh und je ausgelassen und abstoßend in der Halle auf ihn zukamen, sich tief verneigten, dann roh auflachten und Arm in Arm davonliefen und dabei hin und her schwankten – selbst dann vermochte dieser Spott den Zauber nicht zu zerstören. Auf seine mürrische Bitte – was auch immer er jetzt sagen mochte, stets waren seine Brauen qualvoll gefurcht – hatte ihm die Mutter aus dem Kaufhof einen großen, mahagonifarbenen Kasten mitgebracht und dazu ein Zauberlehrbuch, auf dessen Umschlag ein ordengeschmückter Herr im Frack abgebildet war, der ein Kaninchen an den Ohren hochhielt. In der Kiste waren Büchsen mit doppeltem Boden, ein mit besterntem Papier beklebter Zauberstab, ein unvollständiges Kartenspiel, dessen Bilder zur Hälfte aus Königen und Buben, zur Hälfte aus Schafen in Uniform bestanden, ein zusammenklappbarer Zylinder mit Unterteilungen, eine Schnur mit zwei hölzernen Dingern an den Enden, deren Bedeutung nicht ganz klar war. Und in den großtuerisch aufgemachten Kuverts befanden sich Pülverchen, mit denen man Wasser dunkelblau, rot und grün färben konnte. Als weit anziehender erwies sich aber das Buch, und Lushin erlernte mühelos einige Kartenkunststücke, die er sich selbst, stundenlang vor dem Spiegel stehend, vormachte. In der cleveren und exakten Art, wie ein Trick aufging, fand er eine rätselhafte Befriedigung, eine unbestimmte Verheißung anderer, noch nicht begriffener Genüsse, aber etwas fehlte noch immer, das Geheimnis vermochte er nicht zu erfassen, das der Zauberkünstler offenbar gemeistert hatte, wenn er einen Rubel aus der Luft griff oder eine vom Publikum stillschweigend gewählte Kreuzsieben aus dem Ohr des verwirrten Rosen hervorholte. Die komplizierten Vorrichtungen, die in dem Buch beschrieben waren, ärgerten ihn. Das Geheimnis, nach dem er strebte, war Einfachheit, harmonische Einfachheit, die größeres Erstaunen hervorruft als die komplizierteste Magie.
In dem vor Weihnachten zugestellten Zeugnis über seine Leistungen, einem sehr in Einzelheiten gehenden Zeugnis, wo unter der Rubrik «Allgemeine Bemerkungen» weitschweifig und voller Pleonasmen von seiner Schlaffheit, Apathie, Schläfrigkeit und Unbeholfenheit die Rede war und in dem anstelle von Noten Adverbien standen, fanden sich ein ‹nicht genügend› in Russisch und mehrere ‹kaum genügend›, unter anderem in Mathematik. Zur gleichen Zeit wurde er indessen von einer Aufgabensammlung, der Fröhlichen Mathematik, wie sie im Titel hieß, außerordentlich angezogen, von den wunderlichen Eigenschaften der Zahlen, die unberechenbare Streiche spielten – von alledem, wovon im Schulbuch nichts zu finden war. Mit Seligkeit und Grauen verfolgte er, wie eine schräge Linie, die wie eine Radspeiche rotierte, immer näher an eine andere, senkrechte heranrutschte – eine Illustration für das Mysterium der Parallelität. Die Senkrechte war unendlich lang wie jede Linie, und die ebenfalls unendliche Schräge, die immer höher heranglitt, je kleiner der Winkel wurde, war zu ewigem Nebenhergleiten verdammt, denn es war ihr unmöglich, sich davonzustehlen, und beider Schnittpunkt schob sich auf einem unendlichen Weg immer weiter hinaus. Aber mit dem Lineal zwang er sie, sich voneinander zu lösen: Er zog sie einfach neu, parallel zueinander, und hatte dabei das Gefühl, dass dort, in der Unendlichkeit, wo er die Schräge zwang, ihre Bahn zu verlassen, sich eine unvorstellbare Katastrophe ereignet hätte, ein unerklärliches Wunder, und lange Zeit war er wie betäubt von jenen unendlichen Weiten, in denen irdische Linien den Verstand verlieren.
Eine Zeitlang fand er bei Puzzlespielen eine illusorische Befriedigung. Zunächst handelte es sich um einfache, kindliche Bilder, die aus großen Stücken bestanden, welche an den Rändern wie Butterkekse wellenförmig eingekerbt waren und so hartnäckig aneinanderhafteten, dass man ganze Teile des zusammengesetzten Bildes hochheben konnte, ohne dass sie auseinanderfielen. In jenem Jahr aber kam aus England die Mode der Puzzles für Erwachsene herüber – «Puhsels», wie man sie im besten Petersburger Spielzeugladen nannte –, deren Einzelteile außerordentlich raffiniert ausgeschnitten waren: Stücke in jeder Gestalt vom einfachsten Kreis (Teil eines künftigen blauen Himmels) bis zu den kompliziertesten Formen mit vielen Ecken, Kaps, Meerengen und kniffligen Ausbuchtungen, denen sich nicht ansehen ließ, wo sie hingehörten – ob sie das scheckige Fell einer schon fast vollendeten Kuh ergänzen sollten oder ob dieser dunkle Rand auf grünem Grund den Schatten vom Stab des Hirten bildete, von dem man auf einem verständlicheren Stück deutlich das Ohr und einen Teil des Scheitels erkennen konnte. Und wenn sich links allmählich die Kruppe der Kuh und vor etwas Grün rechts die Hand mit der Rohrpfeife des Schäfers abzeichneten und der leere Raum darüber gleichmäßig mit himmlischem Blau ausgefüllt wurde und die blaue Scheibe genau in den Himmel passte, dann fühlte Lushin eine wunderbare Erregung über die präzisen Kombinationen dieser bunten Stücke, die zu guter Letzt ein plausibles Bild ergaben. Einige dieser harten Nüsse waren sehr teuer und bestanden aus mehreren tausend Teilen; seine junge Tante hatte sie gekauft, eine fröhliche, zärtliche, rothaarige Tante – und stundenlang saß er über den Spieltisch im Salon gebeugt, prüfte jede Auszackung mit den Augen, bevor er probierte, ob sie in diese oder jene Lücke passe, und bemühte sich, kaum wahrnehmbare Anzeichen zu finden, anhand derer sich die Essenz des Bildes im voraus bestimmen ließ. Aus dem Zimmer nebenan, wo die Gäste sich laut unterhielten, flehte die Tante: «Dass dir um Gottes willen kein Teil abhandenkommt!» Ab und zu kam der Vater herein, betrachtete die Stücke, deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger zum Tisch hin und sagte: «Das hier gehört bestimmt dorthin», worauf Lushin, ohne sich umzudrehen, murmelte: «Unsinn, Unsinn, stör mich nicht!» Der Vater berührte den Haarschopf seines Sohnes ganz zart mit den Lippen und ging wieder hinaus – ging vorbei an den vergoldeten Stühlen, an dem mächtigen Spiegel, an der Kopie der badenden Phryne, an dem Flügel, einem großen, schweigsamen Flügel, der dicke Glasschuhe trug und über den eine Brokatdecke gebreitet war.
Kapitel 3
Erst im April, in den Osterferien, kam für Lushin der unvermeidliche Tag, an dem die ganze Welt ringsum verlosch, als hätte jemand an einem Schalter gedreht, und inmitten der Finsternis blieb nur eines hell erleuchtet, das neugeborene Wunder, ein funkelndes Inselchen, auf das sich nun sein ganzes Leben konzentrieren sollte. Das Glück, an das er sich fortan klammerte, war beständig; dieser Apriltag erstarrte zur Ewigkeit, während weit weg das Kommen und Gehen der Jahreszeiten, der Frühling in der Stadt und der Sommer auf dem Land auf einer anderen Ebene ihren Fortgang nahmen – dämmrige Ströme, die ihn kaum berührten.
Es fing harmlos an. Am Todestag seines Schwiegervaters veranstaltete Lushin senior bei sich im Hause einen Musikabend. Selber verstand er nur wenig von Musik, hegte aber eine heimliche, verschämte Leidenschaft für La Traviata, und bei Konzerten pflegte er nur anfangs dem Flügel zu lauschen, beobachtete aber dann, ohne hinzuhören, nur noch die Hände des Pianisten, die sich in dem schwarzen Lack widerspiegelten. Diesen Musikabend mit der Aufführung von Werken des verstorbenen Schwiegervaters musste er nolens volens veranstalten: Wie die Dinge standen, hatten die Zeitungen zu lange geschwiegen – das Vergessen war vollkommen, bleiern, hoffnungslos –, und immer wieder beteuerte die Gattin mit bebenden Lippen, dass dies alles Intrigen seien, Intrigen, Intrigen, dass man auf die Begabung ihres Vaters schon zu seinen Lebzeiten neidisch gewesen sei und jetzt seinen postumen Ruhm totschweigen wolle. In einem ausgeschnittenen schwarzen Kleid mit einem wunderschönen Diamantcollier empfing sie die Gäste mit einem gleichbleibenden Ausdruck verschlafener Liebenswürdigkeit auf dem geschwollenen weißen Gesicht, leise, ohne laute Begrüßungen, flüsterte jedem rasch irgendetwas angenehm Klingendes zu, verging aber innerlich vor Befangenheit und suchte mit den Augen ständig ihren Gatten, dessen gestärkte Hemdbrust wie ein Panzer aus seiner Weste hervorschwoll und der hierhin und dorthin trippelte – ein leutseliger, dezenter Herr mit den ersten zaghaften Ansätzen literarischer Würde. «Wieder splitternackt», seufzte der Herausgeber einer Kunstzeitschrift und blickte beiläufig auf Phryne, die in der verstärkten Beleuchtung besonders lebhaft hervortrat. Da geriet ihm der kleine Lushin vor die Füße und wurde ein bisschen am Kopf gekrault. Lushin wich zurück. «Wie groß er geworden ist», sagte die Stimme einer Dame von hinten. Er versteckte sich hinter jemandes Frackschößen. «Nein, erlauben Sie», ertönte es donnernd über seinem Kopf, «das kann man von unserer Presse wirklich nicht verlangen.» Keineswegs groß, sondern im Gegenteil für seine Jahre recht klein, lief der Junge zwischen den Gästen auf der Suche nach einem stillen Platz hin und her. Ab und zu fasste ihn jemand an der Schulter und stellte ihm idiotische Fragen. Der Salon wirkte wegen der in Reihen aufgestellten, vergoldeten Stühle besonders voll. Vorsichtig brachte jemand ein Notenpult durch die Tür.
In unauffälligen Etappen gelangte Lushin ins Arbeitszimmer des Vaters, wo es dunkel war, und setzte sich auf den Diwan in der Ecke. Aus dem fernen Salon drang durch zwei Räume hindurch sanft das Wimmern einer Geige.