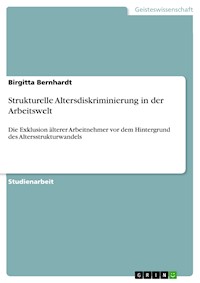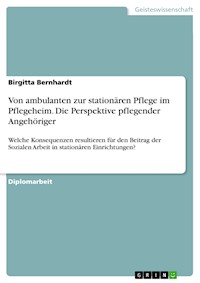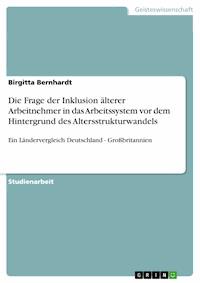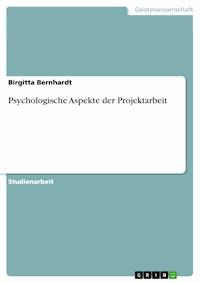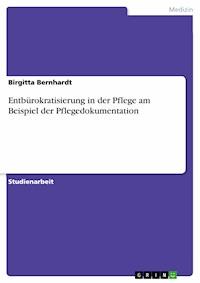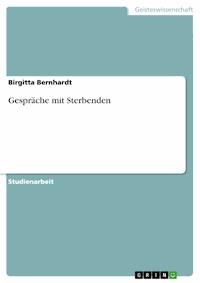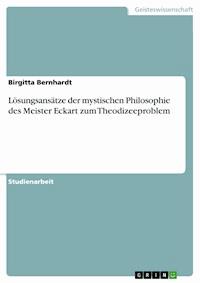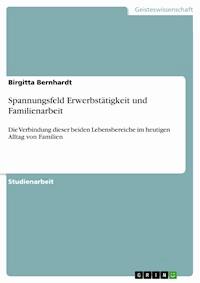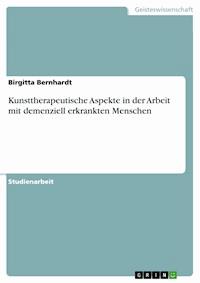29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Frühlingsgefühle mit Anfang sechzig? Leidenschaft, Begehren und Sex mit siebzig und eine neue Liebe mit achtzig? Für jüngere Generationen ist das unvorstellbar. Die Partnerschaft im Alter, in der Liebe und Sexualität gelebt werden, ist ein Thema, das von der Gesellschaft tabuisiert oder verniedlicht wird. Die Lebenserwartung der Menschen ist in den letzten Jahrzehnten rapide gestiegen. Warum also nicht den älteren Mitbürgern Intimität und Leidenschaft gönnen, statt sie zu belächeln? Inwieweit verändert sich Sexualität im Alter und weshalb sollte ein hohes Lebensalter gleichzeitig sexuelle Abstinenz bedeuten? Dieses Buch gibt Denkanstöße und Antworten aus der Sicht von Wissenschaftlern und Pflegern. Aus dem Inhalt: Gesellschaftliche Tabuisierung von Sexualität im Alter Sexualität im Altenheim Sexualität und Demenz Homosexualität im Alter Erotik im Alter Erektionsstörung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © 2013 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlags GmbH
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: © FotoDesignPP - Fotolia.com
Lust auf Sex
Sexualität im Alter
Birgitta Bernhardt: Liebe und Sexualität im Alter 2004
1. Einleitung
2. Partnerschaften im höheren Lebensalter – Beziehungen im Spannungsfeld zwischen Gewohnheit und Neuorientierung
3. Sexualität im höheren Lebensalter
4. Die Sexualität betagter Menschen im institutionalisierten Pflegekontext
5. Exkurs: Die spezifische Situation älterer homosexueller und lesbischer Menschen
6. Handlungsfelder Sozialer Arbeit in Bezug auf Liebe und Sexualität im Alter
7. Schlussgedanken
8. Literatur
Mandy Rüdiger: Liebe bis in den späten Herbst – Partnerschaft, Liebe und Sexualität in der zweiten Lebenshälfte 2008
1. Einleitung
2. Partnerschaft und Liebe im Alter
3. Sexualität im Alter
4. Die gesellschaftliche Tabuisierung von Partnerschaft und Sexualität in der zweiten Lebenshälfte
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Nadja Berger, Sandra Hennig, Elvira Knaute und Annika Mewitz: Wodurch wird das Sexualverhalten älterer und alter Menschen beeinflusst und welchen Einfluss hat dies auf die Pflege? 2007
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Forschungsstand
3. Allgemeiner Pflegerischer Umgang mit der ATL Sexualität
4. Kontinuität oder Veränderung der Sexualität im Alter
5. Sexualität und Alzheimer
6. Sexuelle Beziehungen bei Personen mit Demenz und ihrem Partner
7. Sexuell unangemessenes Verhalten bei Personen mit Demenz
8. Homosexualität im Alter
9. Anders alt werden – Die Lebenssituation von „alten Schwulen und Lesben“
10. Wohnprojekte für Homosexuelle
11. Literaturverzeichnis
Anja Hartmann: Mythos Asexualität im Alter – Der Umgang mit Alterssexualität, Einflüsse und Problemlagen. 2004
1. Einleitung
2. Mythos der Asexualität im Alter
3. Theorien über die Altersgeschlechtslosigkeit
4. Forschungsergebnisse über Alter und Sexualität
5. Andere Einflüsse auf die Sexualität im Alter
6. Privatsphäre-Situationen in Pflegeeinrichtungen
7. Elemente lebensweltorientierter, Privatsphäre fördernder Pflege
8. Abschluss
9. Literaturliste
Katharina Sieren: Leben mit Demenz. Eine empirische Studie über die sexuellen Bedürfnisse von Heimbewohnern aus Sicht der Fachkräfte 2010
Vorwort
1. Einleitung
2. Literaturstudie
3. Eigene Studie
4. Auswertungsverfahren
5. Ergebnisse
6. Resümee und Fazit
7. Literaturverzeichnis
Birgitta Bernhardt: Liebe und Sexualität im Alter
„Die Liebe gehört zur Magie des Lebens. Die sexuelle Anziehungskraft ist eine ihrer elementarsten Ausdrucksformen. Sexualenergie ist Lebensenergie und in der unbeschnittenen Sexualität stecken die Elementarkraft und die Tiefe, die Leidenschaft und die Ruhe, die Spannkraft und die Hingabe des Lebens an sich selbst.“
(Dieter Duhm: Schön ist die Bewegung eines angstfreien Körpers)
1. Einleitung
Der Bereich „Liebe und Sexualität“ ist seit Jahrtausenden untrennbar mit unserem Mensch-Sein verknüpft. Quer durch alle Gesellschaften sind Paarbeziehungen zentraler Inhalt von Geschichten, Liedern, Theaterstücken, Filmen und anderen Ausdrucksformen menschlicher Kultur. Auffällig dabei ist, dass die jeweiligen Akteure in der Regel jung, vital, gutaussehend und altersmäßig überwiegend der ersten Lebenshälfte zuzuordnen sind. Dies steht bezogen auf unseren Kulturkreis in einem objektiven Gegensatz zur demografischen Entwicklung der letzten Jahre, welche eine stetig wachsende Zahl an älteren Menschen aufweist.
Die Frage nach den Bedürfnissen dieser Personengruppe in Bezug auf emotionale Nähe und Sexualität ist Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. Nach der Darstellung einiger wichtiger soziologischer Aspekte werde ich zunächst auf Faktoren eingehen, welche für langjährige Beziehungen stabilisierend bzw. beeinträchtigend wirken. Anschließend werde ich einige klassische Ereignisse in langjährigen Beziehungen beschreiben, die besonders häufig zu Krisensituationen führen können. In einem weiteren Schritt werde ich den Fokus auf den Bereich sexuelle Interessen und gelebte Erotik im Alter richten. An diesem Punkt stellt sich auch die Frage nach physiologischen Veränderungen der menschlichen Sexualität im Zusammenhang mit dem natürlichen Alterungsprozess. Des Weiteren werde ich einige typische Probleme aus dem Bereich der Sexualität erläutern, die bei älteren Menschen gehäuft auftreten. Außerdem werde ich auf die Möglichkeiten eingehen, sexuelle Bedürfnisse betagter Menschen in den Pflegekontext zu integrieren. Anschließend möchte ich im Rahmen eines Exkurses die spezifische Situation homosexueller und lesbischer Menschen darstellen. Den Abschluss der Arbeit bilden Hinweise auf den möglichen Transfer des Themenbereichs in Handlungsfelder Sozialer Arbeit.
2. Partnerschaften im höheren Lebensalter – Beziehungen im Spannungsfeld zwischen Gewohnheit und Neuorientierung
2.1. Soziologische Aspekte
„Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Neugeborenen hat sich in den vergangenen hundert Jahren verdoppelt. 1871 betrug sie für Männer 35,6 und für Frauen 38,5 Jahre; 1997 betrug sie für Männer 73,5 und für Frauen 80 Jahre.“ (s. Waller, 48). Diese Grundaussage, dass die Menschen immer älter werden und die zumindest für die Industrienationen der sog. Ersten Welt zutrifft, bringt zahlreiche Konsequenzen für das gesellschaftliche Zusammenleben mit sich. Neben den massiven wirtschaftlichen Problemen, welche die demografische Umwandlung der Bevölkerungsstruktur von der bisher vorherrschenden Pyramidenstruktur in einen pilzförmigen Altersaufbau nach sich zieht, hat diese Umstrukturierung auch weitreichende Auswirkungen auf private soziale Lebensformen, wie Ehe und Familie: die Verdoppelung der durchschnittlichen Lebenserwartung in den vergangenen hundert Jahren hat auch eine Verdoppelung der durchschnittlichen Dauer einer Ehe, die nicht durch Scheidung beendet wird, mit sich gebracht. Gekoppelt mit der Tendenz zu geringen Geburtenzahlen, führt diese Entwicklung dazu, dass Ehen noch ca. 20 Jahre nach der Loslösung der Kinder vom Elternhaus andauern (vgl. Beck-Gernsheim, 159). Diese relativ neue Beziehungsform der „nachelterlichen Gefährtenschaft“ stellt Beziehungen vor Herausforderungen, die erst in den letzten Jahren Beachtung in der Öffentlichkeit finden. Bislang war die vorherrschende Meinung, dass Paare, die erst einmal die krisenanfälligen Jahre der Kinderaufzucht überstanden haben, meist für den Rest des Lebens zusammen bleiben. Dieser Auffassung widersprechen jedoch die aktuellen Scheidungsstatistiken deutlich: Zunächst sind es vorwiegend die kinderlosen Paare, die sich schon häufig nach relativ kurzer Ehedauer voneinander trennen: 1998 gingen ca. 40% der Ehen in die Brüche (s. Sidler, 74). Davon waren weit über die Hälfte kinderlose Paare betroffen. Nach 20 Ehejahren übertreffen jedoch die Scheidungszahlen der Eltern die Scheidungsrate kinderloser Paare (vgl. Geo, 48). Dies kann als Bestätigung von Studien gewertet werden, die neben gemeinsamen Wohneigentums v.a. auch kleine Kinder als ehestabilisierenden Faktor werten (s. Sidler, 75).
Stabile Beziehungen sind jedoch keinesfalls gleichzusetzen mit zufriedenen Beziehungen. Häufig wird über Jahre der Ehestatus aufrechterhalten, obwohl die Partner die Beziehung nicht als glücklich erleben. Fällt die gemeinsame Verantwortung für jüngere Kinder weg, sind Beziehungen auf sich selbst zurückgeworfen, unterschwellig schon länger bestehende Probleme können offen zutage treten und ernsthafte Krisen initiieren.
Im Hinblick auf die Zukunft ist es wichtig zu bedenken, dass sich die Tendenz zur Pluralisierung der Lebensformen im jüngeren Alter in einigen Jahren auch in der älteren Generation bemerkbar machen wird. Spätestens dann, wenn die Generation der „Patchwork-Familien“, „living-apart-together-Paaren“ und „Lebensabschnittsgefährten“ in die Jahre kommt, wird auch eine Neuorientierung im Hinblick auf private soziale Lebensformen älterer Menschen jenseits der traditionellen Institution Ehe erfolgen müssen.
2.2. Beziehungsbeeinträchtigende und -stabilisierende Faktoren
Psychologen waren lange der Ansicht, dass langjährige Beziehungen in ihrer Zufriedenheit einen u-förmigen Verlauf aufweisen: Die Zufriedenheit mit der Partnerschaft nimmt nach einem Höhepunkt zu Beginn mit den Jahren kontinuierlich ab, erreicht einen Tiefpunkt in der Phase, in der die pubertierenden Kinder noch zu Hause leben und steigt dann nach der Bewältigung der „empty-nest-Phase“ wieder deutlich an. Neuere Studien widerlegen jedoch diese Ansicht: Einer Studie von Fooken (1995) zufolge lassen sich grundsätzlich vier verschiedene Beziehungsverläufe „älterer“ Partnerschaften differenzieren:
a) Wandel von Konflikthaftigkeit zu emotionaler Distanzierung
b) Erreichen von Autonomie und gegenseitiger Bezogenheit bei Beibehaltung individueller Ansprüche und Bedürfnisse
c) Fortgesetzte Aufgabenorientierung, die mit einer zunehmenden gegenseitigen Anteilnahme einhergeht (eher im Sinne einer Kameradschaftsehe)
d) Aufrechterhaltung starker Bezogenheit und Verschmelzung (hohe Stabilität und Konstanz in Nähe, Harmonie und Zärtlichkeit bis ins hohe Alter)
Allgemein lässt sich feststellen, dass Sexualität im höheren Alter an Bedeutung verliert, während Faktoren wie soziale Unterstützung und unterstützende Kommunikation für die Zufriedenheit in der Beziehung wichtiger werden(vgl. Re 19-20) Welchen Einfluss die Übereinstimmung der Partner hinsichtlich Interessen und Einstellungen auf die Beziehungsqualität haben, wird in der Literatur unterschiedlich beschrieben: Einer Untersuchung von Hammerschmidt und Kaslow (1995) zufolge werden diese Bereiche als wichtige Voraussetzungen für Ehezufriedenheit genannt (vgl. Re 20). Eine andere Befragung des Münchner Psychologieprofessors Klaus Schneewind kommt jedoch hinsichtlich gemeinsamer Interessen und Ansichten als Faktoren für Zufriedenheit in langjährigen Beziehungen zu keinem einheitlichen Ergebnis, sondern es wurden völlig unterschiedliche Angaben gemacht (Geo 149). Eine weitere Untersuchung von Brandstädter und Felser von der Hochschule Harz ergab als Merkmale für glückliche, langdauernde Beziehungen überraschenderweise, dass äußere Umstände, wie materielle Stellung, Bildung, Wohnverhältnisse etc. ebenso wenig Einfluss auf die Beziehung haben wie der familiäre Hintergrund. Was die Untersuchung jedoch herausfand, war die Wichtigkeit des gegenseitigen Umgangs der Partner miteinander. Besonders Fairness, wozu auch die gerechte Aufteilung der Hausarbeit zählt, wurde von den Befragten als ehestabilisierend genannt. Auch eine optimistische Grundhaltung der Partner wurde übereinstimmend mit einer Studie der University of California, Berkeley als förderlich für langwährendes Eheglück erwähnt. Interessant ist auch das Ergebnis einer Befragung von 167 älteren Paaren, die mindestens 15 Jahre miteinander verheiratet waren im Rahmen einer Dissertation von Helga Hammerschmidt, Universität München. Sie fand heraus, dass verschiedene Liebesstile sich positiv oder negativ auf die Ehezufriedenheit auswirken. Zufriedener sind Paare, bei denen entweder ein durch Erotik und Romantik geprägter Liebesstil vorherrscht oder Paare, deren Beziehung sich über Selbstlosigkeit und Pflichterfüllung definiert. Sehr negativ für die Beziehung wirkt sich hingegen ein eher spielerischer, spaßbetonter, nicht bindungsbereiter Liebesstil aus, den besonders Männer pflegen (Geo 149).
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ein Großteil der verheirateten älteren Menschen in stabilen Beziehungen lebt. Ca. 80 Prozent bezeichnen sich als „glücklich verheiratet“, wobei die Zufriedenheit seitens der Männer größer als die der Frauen ist (Re 18).
2.3. Klassische Krisensituationen von Partnerschaften im höheren Lebensalter
2.3.1. Die Loslösung der Kinder vom Elternhaus
Die zunehmende Selbstständigkeit der heranwachsenden Kinder löst bei Eltern – insbesondere bei Müttern – unterschiedliche Emotionen aus. Manche Frauen erleben diese Phase als Befreiung von jahrelangen Pflichten und nutzen die gewonnenen Freiräume zur Entwicklung neuer Interessen und Aktivitäten (vgl. Beck-Gernsheim 161). Diese Neuorientierung von Frauen kann sich auf die Zweierbeziehung auf verschiedene Weise auswirken. Insbesondere in traditionell orientierten Partnerschaften ist es vorstellbar, dass diese neue, evtl. ungewohnte Autonomie der Frau den Partner zunächst verunsichert, da alte, eingefahrene Rollenmuster aufgegeben werden müssen und eine Neuverortung innerhalb der Partnerschaft erfolgen muss. Diese Umstellung kann jedoch auch als Chance für die Beziehung begriffen werden, da aus neuen Aktivitäten eines Partners auch neue Impulse für die Partnerschaft erwachsen. Dies kann vom anderen Partner durchaus auch als positiv und belebend empfunden werden. Frauen, die sich über lange Jahre ausschließlich der Familienarbeit gewidmet haben, geraten durch die Loslösung ihrer Kinder häufiger in einen Gefühlszustand der Leere und Sinnlosigkeit, was schließlich auch zu ernsthaften depressiven Verstimmungen und Depressionen führen kann. Einen solchen Zustand bezeichnet auch der Begriff des „empty-nest-syndroms“ (vgl. Beck-Gernsheim 161-162). Psychische Beeinträchtigungen oder gar Erkrankungen haben auch immer Auswirkungen auf die Beziehungsdynamik, da man jede Beziehung immer als System begreifen muss. Neigt nun einer der Partner infolge des Gefühls der Sinnlosigkeit zu depressivem Empfinden und Verhalten, hat er auch für die „Beziehungsarbeit“, die für das Funktionieren jeder gesunden Partnerschaft notwendig ist, wenig oder keine Kapazitäten mehr zur Verfügung. Die Folge kann sein, dass der Partner dies entweder durch überfürsorgliches Verhalten zu kompensieren sucht oder sich zunehmend aus der Beziehung zurückzieht.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Auswirkungen, welche die Ablösung der Kinder vom Elternhaus auf die Paarbeziehung der Eltern haben, sehr vom individuellen biografischen Hintergrund der jeweiligen Partner, abhängen.
2.3.2. Der Eintritt in den Ruhestand
Eine zweite Statuspassage, die sich häufig auf das Beziehungsgeschehen älterer Paare auswirkt, ist das Ausscheiden eines oder beider Partner aus dem Berufsleben. Kurzsichtig wäre es, die Problematik dieses Lebensereignisses darauf zu reduzieren, dass der Mann beim Eintritt in den Rentnerstatus seine zentrale Rolle als Ernährer und „Außenvertreter“ der Familie verliert. Diese Aspekte sind bei Krisensituationen sicherlich auch oft von Bedeutung,
werden jedoch nicht der gesamten Komplexität des Problems gerecht. Häufig verbinden sich mit dem Übergang in den Ruhestand durchaus auch positive Emotionen, wie Entlastung und Befreiung. Insgesamt herrscht meist eine gewisse Ambivalenz an Gefühlen vor (vgl. Re 17). Ein häufiges Problem für die Partnerschaft ergibt sich aus unrealistischen Vorstellungen, die bisweilen mit der Berentung verknüpft werden. Viele Männer hegen z.B. die Erwartung, künftig sehr viel Zeit mit ihrer Ehefrau zu verbringen. Dabei bedenken sie häufig nicht, dass dies für die Partnerin eine komplette Umstellung ihrer Tagesstruktur bedeuten würde, den sie, ebenso wie den Verlust an Autonomie, in dieser Form nicht wünscht (vgl. Re 18). Wie bei der Loslösung der Kinder vom Elternhaus müssen auch bei der Berentung alte Rollenmuster aufgegeben und evtl. neu festgelegt werden. Das Aushandeln von Aufgaben und Verantwortlichkeiten ist jedoch immer ein konfliktträchtiges Unternehmen, besonders wenn negative Gefühle wie z.B. Verlustgefühle infolge der Aufgabe des Arbeitsplatzes beteiligt sind. Folglich ist die frühzeitige gemeinsame Abstimmung und Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt äußerst wichtig für einen gelungenen Übergang in den Ruhestand. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass auch Frauen sich infolge der wachsenden Berufstätigkeit mit der Berentung auseinandersetzen müssen. Das bedeutet für die Beziehung, dass weitere Absprachen bzgl. des zukünftigen Zusammenlebens getroffen werden müssen. Frauen haben gegenüber Männern allerdings den Vorteil, dass ihnen infolge der Kindererziehungsphasen die Reduktion auf den häuslichen Bereich nicht gänzlich fremd ist. Außerdem waren sie, meist neben ihrer Berufstätigkeit, auch für den Haushalt zuständig, so dass dieser gewohnte Kompetenzbereich ihnen auch in Zukunft erhalten bleibt. Des weiteren verfügen sie meist über größere soziale Netzwerke, die evtl. Verlustgefühle auffangen und kompensieren können ( vgl. Re 17). Dieser Vorsprung, den Frauen gegenüber Männern in Bezug auf den Übergang in den Ruhestand haben, kann bei Männern unterschiedliche Gefühle auslösen. Zum einen können Neid und Eifersucht z.B. auf den größeren Freundes- und Bekanntenkreis entstehen, dessen Existenz dem Ehemann während seiner Berufstätigkeit vielleicht gar nicht so bewusst war. Zum anderen könnten Männer jedoch auch von diesen Vorteilen ihrer Frauen profitieren, wenn beide Partner dies zulassen können.
2.3.3. Die Pflegebedürftigkeit eines Partners
Das Ereignis, welches wohl am nachhaltigsten die Qualität von Beziehungen älterer Menschen beeinträchtigen kann, ist die ernsthafte Erkrankung bzw. die Pflegebedürftigkeit eines Partners. Auch wenn der Ehepartner nicht die Hauptpflegeperson des Pflegebedürftigen ist, verändert die Situation der Pflegebedürftigkeit immer die Beziehungsdynamik. In Pflegesituationen brechen durch die Belastung häufig alte Konflikte auf, auch zwischen den Generationen, welche die Beziehung sehr belasten können. Nach wie vor stellen Frauen den Hauptanteil unter den Pflegenden. Ursache dürfte neben dem traditionellen Rollenbild v.a. die demografische Situation sein: Frauen werden im Schnitt ca. 8 Jahre älter als ihre Ehemänner. Meist sind Frauen zudem einige Jahre jünger als ihre Ehepartner, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Männer von ihren Ehefrauen gepflegt werden. Neben den Belastungen, denen jeder pflegende Angehörige ausgesetzt ist, kommt bei pflegenden Ehepartnern noch die Trauer über den Verlust der Unterstützung durch den Partner, Sexualität , gemeinsame Interessen und vieles andere, was das gemeinsame Leben bisher bereichert hat, hinzu. Besonders ausgeprägt ist dieses Problem bei der Pflege von Demenzkranken. In diesem Fall hat der pflegende Partner bisweilen das Gefühl, einen fremden Menschen zu pflegen, da sich der Erkrankte in seiner Persönlichkeit völlig verändern kann (vgl. Re 25). Häufig sind pflegende Ehepartner infolge des eigenen Alters auch schon gesundheitlich beeinträchtigt und deshalb durch die Pflegesituation doppelt belastet. In einer Studie von Wright und Aquilino (1998) wurde der Einfluss emotionaler Unterstützung in der Ehe auf das Belastungserleben pflegender Ehefrauen untersucht. Demnach korrespondierte die Ehezufriedenheit eindeutig mit dem Maß, wie die Frauen sich durch ihre Ehemänner in der belastenden Situation emotional unterstützt fühlten. Bei Ehemännern, die demenziell erkrankt oder anderweitig sehr schwer pflegebedürftig waren und deshalb die Möglichkeit der emotionalen Unterstützung entfiel, stieg das Belastungserleben ihrer pflegenden Frauen drastisch an (vgl. Re 24).
Wie dargestellten klassischen Krisensituationen in Beziehungen älterer Menschen waren alle auf langandauernde Partnerschaften bezogen. Zunehmend finden sich jedoch inzwischen auch ältere Menschen, die in „jüngeren“ Partnerschaften leben. Wie diese Menschen, mit den beschriebenen Situationen umgehen, ob es Unterschiede zu lang andauernden Partnerschaften gibt, wird sich in der Zukunft zeigen.
3. Sexualität im höheren Lebensalter
3.1. Die Bedeutung von Erotik und Sexualität für den Menschen
„Liebe ist die beste Medizin.“ Dieser Satz, den der spätmittelalterliche Arzt Paracelsus vor ca. 500 Jahren geäußert hat, ist inzwischen zu einer alten Volksweisheit geworden. In der Kinderheilkunde hat er im vergangenen Jahrhundert eine revolutionäre Umstrukturierung der Kinderkliniken initiiert. Man hat erkannt, wie wichtig, die Nähe und Liebe der Eltern für den Gesundungsprozess ihrer Kinder ist und ermöglicht seither die Mitunterbringung der Eltern in den Krankenzimmern ihrer Kinder. Die Erkenntnis, dass emotionale Nähe, Körperkontakt und Fürsorge auch für den erwachsenen Menschen lebensnotwendig sind, belegen verschiedene Studien: „Diese Untersuchungen zeigen... dass verheiratete Menschen eine niedrigere Mortalitätsrate haben als geschiedene, verwitwete oder alleinlebende. Diese Beziehung gilt für viele körperliche und psychische Krankheiten.“ (s. Waller 61). Zu den elementarsten menschlichen Bedürfnissen gehört auch der Wunsch dazu, mit einem anderen Menschen eine intime, erotische Beziehung aufzunehmen. „So hat die intime Beziehung zwischen Mann und Frau eine partnerschaftliche, also soziale Funktion, natürlich auch die Funktion, Lust zu bereiten und damit eine Selbsterfahrung zu ermöglichen, die anders nicht gewonnen werden kann.“ (s. Cyran 5) Dabei ist Intimität nicht gleichzusetzen mit genitaler Sexualität. Die menschliche Erotik ist so schillernd und facettenreich, dass eine Reduktion auf den Geschlechtsakt ihr nicht gerecht werden würde. Der Wunsch, Erotik lustvoll zu genießen, bleibt meist lebenslang bestehen. Nur die Ausdrucksformen von Sexualität ändern sich meist im Verlauf des Lebens.
3.2. Sexuelle Interessen und gelebte Erotik im Alter – nach wie vor ein Tabu-Thema?
Sexuelle Handlungen zwischen alten Menschen sind für viele Jüngere kaum vorstellbar und oft mit sehr negativen Wertungen verbunden. In einer vom Jugendkult bestimmten Welt lässt sich die Vorstellung von alten und gebrechlichen Menschen, die ihre Sexualität lustvoll leben, schlecht integrieren. Insbesondere ältere Frauen werden in diesem Punkt häufig diffamiert, was sich z.B. auch in der unterschiedliche Akzeptanz von Beziehungen älterer Männer zu jüngeren Frauen und älterer Frauen zu jüngeren Männern zeigt.
In den letzten Jahren ist das Thema Erotik und Sexualität im Alter vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. (Ähnlich wie das Thema Sexualität und Behinderung). Verschiedene Institutionen, wie z.B. pro familia greifen das Thema auf und bieten spezifische Informationen und Beratung an. Dennoch halten sich noch hartnäckig zahlreiche Vorurteile in Bezug auf erfüllte Sexualität im höheren Lebensalter. Verlässliche empirische Ergebnisse zu diesem Thema sind bis heute recht dünn gesät. Dieses Defizit resultiert z.T. aus der Scheu und dem Ungeschick von Forschern, ältere Menschen zu diesem tabuisierten Themenfeld zu befragen, z.T. aber auch aus der Haltung älterer Menschen gegenüber Gesprächen über Sexualität: „Meine Generation hat nicht gelernt, darüber zu reden.“
Im Folgenden werde ich einen Überblick geben über spezifische Veränderungen der Sexualität im höheren Lebensalter, sowie über potenzielle Probleme, die in diesem Bereich auftreten können.
3.3. Physiologische Veränderungen der Sexualität in Bezug auf den Alterungsprozess
3.3.1. Veränderungen der Sexualorgane bei Frauen
Wie alle anderen Organe sind auch die Genitalien vom natürlichen Alterungsprozess des Menschen betroffen. Nach der Menopause endet die Fruchtbarkeitsphase im Leben von Frauen. Die Fähigkeit, Kinder zu gebären geht verloren und schafft Freiräume für andere Formen der Fruchtbarkeit und Kreativität.
Bei älteren Frauen können die Schamlippen infolge von Östrogenmangel schrumpfen, sowie bei sexueller Erregung langsamer und weniger anschwellen. Die Klitoris kann kleiner und schmerzempfindlicher werden. Die Vagina verliert an Elastizität, wird dünnwandiger und wird trockener. Beim Geschlechtsverkehr lässt die Lubrikation nach, d.h. die Vagina ist vermindert gleitfähig und verletzlicher. Die Brustwarzen werden bei sexueller Erregung weniger hart als bei jüngeren Frauen (vgl. Grond 44-45).
3.3.2. Veränderungen der Sexualorgane bei Männern
Männer können bis ins hohe Alter zeugungsfähig bleiben. Der Penis wird bei älteren Männern jedoch kleiner und bei einer Erektion wird er nicht mehr so fest und hart wie in jüngeren Jahren. Bei einer sexuellen Erregung ist der Hodenanstieg geringer und es dauert wesentlich länger, bis der Penis erigiert ist. Beim Orgasmus nimmt die Ejakulation ab und der Penis erschlafft schneller. Die Refraktärzeit dauert bei den meisten älteren Männern deutlich länger und die Intensität des Erlebens nimmt ab (vgl. Grond 47-48).
3.3.3. Sexuelles Interesse und Aktivität
Erotik und Sexualität gehören zu den Triebfedern unseres menschlichen Daseins und sind Quelle für Kreativität, Kunst und Kultur (vgl. Cyran 3). Diese Aussage über die Bedeutung der menschlichen Sexualität beschränkt sich nicht nur auf das jüngere Lebensalter, sondern ist über die gesamte Lebensspanne gültig. Allerdings verändern sich die Formen der menschlichen Sexualität im Zusammenhang mit dem natürlichen Alterungsprozess. Die Untersuchungsergebnisse, die sich in der Literatur zu diesem Thema finden, sind jedoch recht unterschiedlich. Gründe hierfür sind u.a. die verschiedenen Lebenssituationen, in denen die Menschen befragt wurden: So gelangt man z.B. zu völlig verschiedenen Ergebnissen wenn man verheiratete und unverheiratete Frauen nach der Häufigkeit ihrer sexuellen Aktivität befragt, da die Möglichkeiten, für unverheiratete Frauen, sich im Alter sexuell zu betätigen, aufgrund der demografischen Situation rapide abnimmt..
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das sexuelle Interesse und die sexuelle Aktivität tendenziell mit dem Alter abnehmen, jedoch bei wenigen Personen – selbst in hohem Alter – vollständig erlöschen (Bucher/Hornung u.a. 57).
Die Ausdrucksformen der sexuellen Aktivität wandeln sich von der genitalen Form des Geschlechtsverkehrs hin zu anderen Formen der Erotik, wie z. B. Zärtlichkeit, Petting etc. In einer Studie, die 2000 in der deutschsprachigen Schweiz durchgeführt wurde, gaben die befragten Männer der Altersgruppe über 75 Jahren folgende Antworten: 33.8% erlebten in den vergangenen 3 Monaten noch Geschlechtsverkehr; 54,3% erlebten Sexualität in Form von Petting und 80% gaben an, in ihrem Alltag regelmäßig Zärtlichkeit zu erfahren. Bei den Frauen sehen die Zahlen in der gleichen Altersgruppe deutlich anders aus: 8,1% erlebten Geschlechtsverkehr; 21.9% hatten Sexualität in Form von Petting und 39,4% erfuhren regelmäßig Zärtlichkeit im Alltag. Aus diesen Zahlen lässt sich neben der Bestätigung der These, dass die genitale Sexualität zugunsten anderer Formen der Erotik abnimmt, auch ableiten, dass Frauen im höheren Lebensalter wesentlich weniger sexuelle Aktivität leben als Männer. Allerdings liegt dies keineswegs an mangelndem Interesse, wie eine andere Frage der gleichen Studie belegt: befragt nach dem Wunsch nach Geschlechtsverkehr, bejahten dies 46,7% der über 75-jährigen Frauen. Den Wunsch nach Petting verspürten 34,5% und den Wunsch nach Zärtlichkeit im Alltag äußerten 75% der Frauen. Es kann also von einer deutlichen Diskrepanz zwischen sexuellem Interesse und sexueller Aktivität ausgegangen werden. Die Autoren der Studie bezeichnen dieses Phänomen als „interest-activity-gap“, das bei den Frauen infolge der demografisch bedingten mangelnden Möglichkeiten wesentlich ausgeprägter ist als bei der Vergleichsgruppe der Männer (vgl. Bucher, Hornung u.a. 39-51).
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Alterssexualität stellt die intraindividuelle Stabilität der Sexualität dar. Wer sich in jüngeren Jahren schon stark für Sexualität interessiert hat, behält dies auch eher im Alter bei und für wen Sexualität eine weniger zentrale Rolle im Leben gespielt hat, wird meist auch im höheren Lebensalter sexuell weniger aktiv als andere Altersgenossen sein (vgl. Cyran 35).
Ein Phänomen, das beide Geschlechter gleichermaßen betrifft, ist die verlangsamte sexuelle Reaktion mit zunehmendem Alter: “Die sexuellen Reaktionsphasen sind im Alter verlangsamt und weniger intensiv.“ (s. Grond 45)
3.3.4. Ressourcen und Chancen der Veränderungen von Sexualität im höheren Lebensalter
Diese Annäherung der sexuellen Reaktionszeiten beider Geschlechter kann ein deutlicher Gewinn für die Sexualität im Alter bedeuten. Viele jüngere Paare leiden unter dem Problem, dass der Orgasmus beim Mann häufig wesentlich früher erfolgt als bei seiner Partnerin. So kann es durchaus sein, dass eine Frau erst in höherem Alter zum ersten Mal einen Orgasmus erlebt.
Ein weiterer Vorteil im Sexualleben älterer Frauen ist das Wegfallen der Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Nach den Wechseljahren ist es mit dem Ende der Fruchtbarkeit möglich, Sexualität ohne die manchmal als lästig empfundene Empfängnisverhütung zu genießen. Selbstverständlich ist dies im Zeitalter von AIDS nur in einer zuverlässig monogamen Beziehung ratsam.
Manche Frauen erleben auch das Ausbleiben der Periode und den damit verbundenen unangenehmen Begleiterscheinungen wie Bauchschmerzen, Migräne, depressive Verstimmungen etc. als positive Veränderung für sich und ihre Sexualität.
Ein interessanter Aspekt ist das Ergebnis einer Studie, dass Frauen über 50 Jahren unter fünf von sechs untersuchten sexuellen Funktionsstörungen seltener litten als ihre jüngeren Geschlechtsgenossinnen (vgl. Sydow 88).
Schließlich ist im Zusammenhang mit Erotik im Alter das Phänomen der Gewöhnung noch zu erwähnen. Oft wird mit diesem Ausdruck Abstumpfung und Langeweile verbunden. Dies erfasst jedoch nicht den gesamten Sinngehalt des Begriffs. Gewöhnung bedeutet auch die Chance, der tiefen, manchmal auch nonverbalen Verständigung mit dem Partner. Der andere ist so vertraut, dass daraus eine tiefe Verbindung erwächst, welche auch für die erotische Seite der Partnerschaft eine Bereicherung sein kann.
3.4. Potentielle Schwierigkeiten älterer Menschen im Zusammenhang mit Sexualität
Viele Menschen können ihre Sexualität ohne Beeinträchtigungen bis ins hohe Alter leben. Dennoch gibt es einige Faktoren, die im höheren Lebensalter zu Schwierigkeiten in diesem Bereich führen können. Manche davon lassen sich mit relativ einfachen Mitteln beheben; andere müssen trauernd verarbeitet werden, da sie sich schwerlich ändern lassen.
3.4.1. Frauenspezifische Probleme
Das größte Problem von älteren Frauen im Zusammenhang mit Liebe und Sexualität im Alter ist der demografisch bedingte Männermangel in ihrer Altersgruppe. Hinzu kommt die nach wie vor verbreitete Tendenz, dass Männer sich eher eine jüngere Partnerin aussuchen und Frauen eher einen älteren Partner. Die Konsequenz aus dieser Tatsache ist, dass 75% der über 65-jährigen Männer verheiratet ist, während dies nur bei 28% der gleichaltrigen Frauen der Fall ist (vgl. Sydow 95). Daraus resultiert die enorm große Schwierigkeit für Frauen in dieser Altersgruppe einen passenden Partner zu finden.