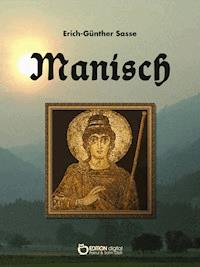
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann ein Künstler ein Volk führen? Manisch, ein Schriftsteller unserer Tage, recherchiert die Todesumstände seines verschollenen Vaters und entdeckt, dass er Erbfolgekönig des im Geheimen lebenden wendischen Volkes ist. Trotz erzwungener Anpassung an christliche Glaubens- und Machtverhältnisse und an die wechselvolle Geschichte der Deutschen konnten die Wenden ihre verborgene Identität bewahren, denn sie hatten das Schwert beiseite gelegt und wurden Bauern. Krone und Zepter wurden über Jahrhunderte weitervererbt. Nun käme die Reihe an Manisch. Doch reale Macht und Kunst sind nach den Vorstellungen von Manischs Großmutter, der schon zur Legende gewordenen, letzten herrschenden Wendenkönigin, unvereinbar. Mit dem scharfen Blick der Wissenden erkennt sie nicht nur Ehrgeiz und Größe, sondern auch Zweifel, Ratlosigkeit und Ruhmsucht im Wesen ihres Enkels. Lange zögert sie, ehe sie sich entschließt, die Geheimnisse der Macht und die Erbschaft des Thrones einem Unbekannten zu übergeben. Manisch bleibt verstrickt in der Banalität seines Alltags. Krieg, Macht und Kunst sind Schlüsselprobleme dieses Künstlerromans, der, überraschend und herausfordernd, traditionelle Vorstellungen vom Mythos des Künstlers zerstört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Erich-Günther Sasse
Manisch
ISBN 978-3-86394-554-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1990 bei Hinstorff Verlag GmbH Rostock.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
An jenem Tag stand die Sonne früher als sonst schon so hoch über den Bäumen, dass sie durch die Gardinen ins Zimmer fiel, auf die Alte, die hustend, keuchend und murmelnd für ihren Sohn und dessen Sohn, Manisch, betete und die Götter anflehte, ihnen nichts geschehen zu lassen.
Aber die Uralte trauerte auch. Wenn es überhaupt einen Sinn hatte, wieder und wieder auf die Erde zu kommen und auszuharren, war es der, zu erfahren, dass es ständig neue Kriege gegeben hatte und dass sie grausamer und grausamer geworden waren.
In ihrer Familie gab es Könige und Fürsten, Heerführer und Diplomaten, aber auch Hirten und Wächter. Bauer war ihr Vater gewesen, und sie, die Tochter von Königen, selber Königin, hatte ihr Leben hindurch Bauernarbeit verrichtet.
Ob es in der Familie jemals einen Schriftsteller gegeben hatte, sagten ihre Bücher nicht. Nicht, dass die Alte Manisch hasste, aber sie hatte ihn Jahre beobachtet und lange gehofft, er würde sich der Verantwortung bewusst werden, sich endlich des Erbes würdig zeigen. Weil er es bis jetzt nicht getan hatte, fasste sie den Entschluss, ihre Geheimnisse mit ins Grab zu nehmen...
Sie griff an ihr Herz und seufzte, ehe sie die feuchte Stirn trocknete und auf den Schrank starrte, hinter dem sich in der Wand die geheime Nische befand, wo die Bücher lagen, in denen von Anbeginn der Zeit aufgeschrieben stand, was das Volk und seine Könige erlebt und durchlitten hatten.
Dreimal verneigte sich die Alte dorthin. So etwas wie Freude fühlte sie darüber, dass sie nun entschlossen war, der Entscheidung nicht mehr auszuweichen. Erleichtert sagte sie mit klarer Stimme: Ihr Götter, ich danke Euch!
Sie lehnte sich zurück und schloss die Augen. Nun war sie stark genug, die wenigen Wochen, die ihr noch blieben, ruhig, gelassen und ohne Bitterkeit zu überstehen. Das Ende kannte sie voraus, den Tag und sogar die Stunde hätte sie nennen können.
Ihre Pflicht war es gewesen, die Würde und das Wissen weiterzugeben. Aber sie hatte alles verloren, was ein Mensch nur verlieren kann. Sie hatte verloren. Wenigstens den Schwur wollte sie halten: Niemand, der unwürdig wäre, sie zu bewahren, würde die Geheimnisse erfahren. Die Unsterbliche wünschte, endlich sterben zu können. Die Alte sehnte sich nach Ruhe.
2. Kapitel
Wann Manisch begriffen hatte, dass der Krieg seiner Mutter und seiner Großmutter die Hoffnung genommen hatte, wusste er nicht mehr. Schon wieder war überall in der Welt Krieg. Das hätte ihn zwar nicht betreffen brauchen, denn diese Kriege spielten sich weit weg von ihm ab, aber obwohl er anscheinend außerhalb stand, war er doch mittendrin.
Bestürzt hatte er irgendwann gemerkt, dass ihn Bilder im Fernsehen, Bücher und Zeitungen nicht mehr aufregten. Das Eingeständnis, abzustumpfen, und der Wille, sich dagegen zu wehren, waren vor allem entscheidend für den Wunsch, ein Buch über den Krieg zu schreiben. Obwohl seine Notizen schon mehrere Hefter füllten, gelang es ihm nicht, daraus etwas zu schaffen, das ihn selber bis ins Innerste bewegte. Immerhin war das Ergebnis des Fleißes, mit dem er viele Bücher durchforscht hatte, eine wichtige Erkenntnis: Die Erinnerungen von Politikern und Heerführern an den größten und schrecklichsten aller Kriege dienten vor allem dazu, sie selber ins rechte Licht zu setzen und ihre eigene Leistung genügend herauszustreichen. Oft widersprachen sie in ihren Aussagen einander vollkommen. Aus diesen Büchern erfuhr Manisch kaum Neues. Nachdem schon einige Jahre vergangen waren, fragte er sich, ob seine Methode wohl die richtige sei. In den wichtigen Archiven hätte er arbeiten mögen, dort wäre sicher manches zu entdecken, das noch nirgendwo gedruckt stand. Aber die Archive waren geschlossen und würden sich für ihn nicht öffnen. Wer war er denn, dass er ein Buch über den Krieg schreiben zu wollen sich erdreisten konnte?
Manisch war gerade vierzig und hatte niemals Krieg erlebt. Vieles ging ihm verquer. Meistens reagierte er nicht so, wie andere es erwarteten, häufig sogar anders, als er selber es lange von sich gewöhnt war. Die Einsicht, seine Versuche würden noch nicht zu dem Gewünschten führen, traf ihn, denn es war beileibe nicht das erste Mal, dass er den Dingen schreibend auf den Grund kommen wollte. Schreiben half ihm, besser mit dem Leben fertig zu werden. Obwohl allzu viele Jahre vergangen waren, ohne dass er seinen Zielen näher gekommen wäre, hatte Manisch das Gefühl, Entscheidendes läge vor ihm. Vor Jahren schon hatte er sich für das Schreiben entschieden. Nun wurde es Zeit, auf ernsthafte Weise damit zu beginnen.
3. Kapitel
Ganz gegen seine Gewohnheit lag Manisch um halb neun im Bett. Er fühlte sich müde, zog die Decke bis ans Kinn, und schon fielen ihm die Augen zu. Weil er noch nicht schlafen wollte, öffnete er sie wieder, nahm ein Buch vom Nachttisch und begann in den Erinnerungen des Königs zu lesen:
»Es war im Mai, als ich nach Paris kam. Der Krieg stand unmittelbar bevor. Ich wusste es, und der Präsident, der mich vom Bahnhof abholte, wusste es auch. Wir alle spürten die Spannung dieser Tage. Der Empfang war herzlich. Viel Volk stand an den Straßenrändern. Mir fiel auf, wie festlich die Leute gekleidet waren. Mag sein, sie hofften, der Krieg werde vorübergehen. Vielleicht sehnten sie sich auch nur nach Abwechslung und suchten Erholung und Freude nach einem langen und harten Winter. Sie ahnten nichts von dem, was ihnen bevorstand.
Das Volk winkte, und wir winkten zurück. Ich hörte den Präsidenten reden, spürte, er sprach von ernsten politischen Dingen, und wusste, die Gefahr, sie würden bald in ernste militärische Dinge umschlagen, konnte nicht größer sein. Ich hörte und nickte, aber ich verstand nicht, wovon der Präsident redete, denn ich betrachtete die beiden Reiter neben unserem Wagen. Der eine war kräftig und untersetzt. Er hatte ein braungebranntes, etwas stumpfes Gesicht, dem anzumerken war, wie wichtig er sich vorkam. Ich ahnte, dieser Mann würde ein guter Familienvater sein und der Erzeuger vieler kräftiger, untersetzter Kinder, die nach ihm starke Kinder zeugen würden und wie ihre Vorväter den Boden bearbeiten, wie die Pflicht es verlangt, und die ihre Steuern bezahlen würden, pünktlich und genau. So erfüllt war der Kavallerist vom Gefühl seiner Wichtigkeit, dass er nicht zu merken schien, wie lange ich ihn musterte.
Der andere war ein sehr junger Mann, blond und zart, er schien sich in der Uniform nicht besonders wohl zu fühlen. Jedenfalls sah er gleichgültig, fast gelangweilt mit seinen großen, hellblauen Augen über die Menge hin. Von uns nahm er keine Kenntnis. Auch er merkte nicht, dass ich ihn lange anblickte.
Ich wusste, die beiden Männer müssten bald töten oder würden getötet. Ich wünschte wahrhaftig den Krieg nicht, aber ich zweifelte nicht daran, dass er kommen würde. Ich saß hoch im Wagen, der leicht schaukelte, und konnte alles übersehen, die sauber gefegten Straßen und das geputzte Volk, die hohen Kastanienbäume, die gerade zu blühen anfingen, dieses Bild des Friedens, der Ruhe und des Glückes.
Immer wieder fiel mein Blick auf die beiden Männer. Ich war mir der Verantwortung für sie bewusst, aber ich trug auch Verantwortung für die vielen. Wenn diese beiden nicht stürben, würden sehr viele sterben müssen. Das wusste ich. Und auch, warum dieses Opfer zu hoch war.
Dann stand der Wagen. Wir stiegen aus. Ich hielt eine Rede. Ich weiß, sagte ich, dass nun die Zeit gekommen ist, alle Demütigungen zurückzugeben. Von Rache, wie man später behauptete, sprach ich nicht. Denn niemals spürte ich den Wunsch, mich zu rächen. Wie ernst mir das ist, weiß nur Gott.
Während ich sprach, zu dieser Zeit war ich noch in der Lage, lange frei zu reden, fiel mein Blick wieder auf die beiden Männer, die jetzt mit gezücktem Säbel neben uns standen. Ich sah sie stehen, den kräftigen und den zarten. Nun war ich sicher, dass sie bald sterben würden. Still und ergeben der eine. Mit Gestöhn und Geschrei, Gott verfluchend, der andere, der schmale blasse junge Mann mit den klugen Zügen, der vielleicht der Welt keine Kinder gegeben hätte, die den Boden bearbeiteten und hackten und gruben, aber ein Buch vielleicht oder ein Gedicht, ein Bild...
Ich war voller Mitleid für sie, als ich Gott zum Zeugen anrief, dass ich den Krieg nicht, niemals gewünscht hatte. Unter dem Beifall, der aufbrauste und zum Orkan wurde, rief ich: So wahr mir Gott helfe!
Dann trat ich zur Seite, um dem Präsidenten das Wort zu überlassen.«
Manisch warf das Buch auf den Nachttisch zurück. Plötzlich überkam ihn ein starkes Gefühl von Feindschaft. Er legte sich auf den Rücken und schloss die Augen.
Als seine Frau dann auch kam, fragte sie: Was machst du denn?
Gerade darauf wollte Manisch nicht antworten, er fürchtete endlose Diskussionen und Streit. Obwohl sie einander genau kannten, stritten sie sich oft. Dabei hasste Manisch nichts mehr als Streit. Er sah der Frau ins Gesicht, das von Creme glänzte.
Sie kannte diesen Blick und drehte sich um. Als sie ins Bett stieg, fragte sie: Willst du noch lange lesen?
Manisch hörte den Ton in ihrer Stimme, mit dem sie früher nie geredet hatte und von dem sie genau wusste, wie sehr er ihn verletzte. Sie benahm sich, als wäre es ein Verbrechen, Bücher zu lesen, und gar, welche zu schreiben. Das ärgerte ihn. Tatsächlich hatte sie keines seiner Bücher je gelesen. Manchmal wünschte Manisch, sie sollte alles von ihm erfahren. Aber immer häufiger verspürte er den Drang, sich irgendwo zu verkriechen, um allen Demütigungen, die das Schreiben für ihn schon mit sich gebracht hatte, zu entgehen.
Er war nicht wütend auf die Frau. An ihre Art hatte er sich gewöhnt. Daran, wie sie den Kopf hielt, wenn sie sprach, an ihre Stimme, die leise sein konnte und weich, aber auch hart und schrill.
In diesem Augenblick hatte er den Wunsch, seine Frau sollte ihn bewundern. Aber wie konnte sie das denn? Er schrieb schon so lange. dass er immer wieder von ihr und den Kindern Opfer forderte, musste sie als rücksichtslos empfinden.
Krieg, sagte sie, nachdem sie einen Blick auf das Buch geworfen hatte, weißt du darüber denn noch nicht genug? Die vielen Bücher, die du gekauft und gelesen hast, und es ist nichts dabei herausgekommen. So geht es jedenfalls nicht mehr weiter! Eindringlich sah sie ihm ins Gesicht.
Das konnte Manisch nicht ertragen. Was er getan hatte und noch zu tun beabsichtigte, durfte nicht ohne Sinn geschehen sein. Wenn er sich dem Gefühl überließe, alles wäre sinnlos, könnte er keine Zeile mehr schreiben. Aber Schreiben war sein Leben.
Hör doch auf, dachte er und sagte müde: Von einem bestimmten Alter an muss jeder das Recht haben, an sich zu denken!
Und ich? Die Frau schluckte, während sie nach Worten suchte, um dem Mann endlich deutlich zu machen, für wie egoistisch sie ihn hielt und dass es so nicht weitergehen könne. Er nahm sie ganz in Anspruch. Wenn er sein Leben dem Schreiben opferte, war es seine Sache, aber sie musste sich dagegen wehren, geopfert zu werden. Gegen ihn musste sie sich zur Wehr setzen.
Weil sie spürte, dass sie jetzt nicht die richtigen Worte fand, sagte sie nur: Hör auf damit!
Manisch nahm das Buch wieder in die Hände und gab sich den Anschein, lesen zu wollen. An ihrem Schweigen merkte er, wie er die Frau provozierte. Schon seine Existenz schien eine Provokation zu sein. In den letzten Jahren war es ihm häufig passiert, dass Menschen ihn von sich gestoßen hatten, weil sie sich von ihm provoziert fühlten.
Wieder wünschte er, irgendwohin gehen zu können, wo er allein wäre und lesen und schreiben dürfte, was und soviel er wollte, wann immer er Lust dazu hätte. Aber er war hier und musste hier bleiben!
Er zog die Bettdecke zu sich heran. Lass mich in Ruhe, dachte er. Die Frau sollte sich ja um ihn kümmern, sein Gesicht sollte sie streicheln, den Hals. Sie sollte mit ihm reden. Streiten sollte sie, dass er wüsste, sie wenigstens nähme Anteil an seinem Leben. Tödlich war nur dieses Schweigen!
Als die Frau sagte: Du hast dein Zimmer und einen Schreibtisch, dort kannst du machen, was du willst, sprach Manisch schnell irgend etwas... Weil er nahe daran war, die Frau anzubrüllen, legte er, schneller als gewollt, die in Leinen gebundenen Erinnerungen des Königs auf den Nachttisch, zu anderen Büchern. Er knipste das Licht aus und warf sich herum, so dass er der Frau den Rücken zudrehte. Die Kälte in ihm ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Er kroch unter die Decke und versuchte sich von seiner Niedergeschlagenheit abzulenken. Manisch dachte an Ber.
4. Kapitel
Angefangen hatte es vor ein paar Jahren. Manisch las in der Zeitung, Ber würde in der größten Buchhandlung der Stadt Gedichte vortragen. Einige dieser Texte kannte er. Manches hatte er über den Mann reden hören. Erst vor kurzem war ihm ein Buch von Ber in die Hände gefallen. Er hatte darin geblättert, sich dann aber doch entschieden, es nicht zu kaufen. Es gab genügend Bücher, über die viel mehr geredet und geschrieben wurde und die ihm deswegen entschieden interessanter und wichtiger erschienen.
Als er seiner Frau, die sonst kaum Gedichte las, vorschlug, mit in die Buchhandlung zu kommen, willigte sie gleich ein. Er war zwar erstaunt, machte sich aber keine Gedanken darüber, denn er war neugierig darauf, zu sehen, wie jemand, der als Dichter bezeichnet wurde, sich in der Öffentlichkeit zeigte.
5. Kapitel
Mit breitem Lächeln auf seinem langen, unscheinbaren und farblosen Gesicht erschien Ber. Die Buchhändlerinnen, die er sämtlich mit Handschlag begrüßte, guckten ihn verzückt an.
Als ein Blick Bers ihn traf, wandte Manisch sich ab. Bestürzt nahm er wahr, wie viele Leute sich eingefunden hatten. Seine Lesungen waren noch nie von so vielen besucht worden. Es schien eher so zu sein, als interessierte man sich für sein Schreiben nicht sonderlich. Weshalb das so war, wollte Manisch in der Buchhandlung herausbekommen. Doch dieses Vorhaben vergaß er bald. Noch nie hatte er einen Menschen in solcher Aufmachung gesehen: Ber trug gelbe Lackschuhe und graue, gestreifte Hosen, darüber eine Jacke, die ihren Namen von einem ehemaligen Außenminister hatte. Der Melone auf seinem Kopf war im Laufe der Zeiten viel von ihrer Schwärze verloren gegangen. Ber legte sie mit grandioser Geste auf den Tisch, neben Bücher und Manuskripte. Bevor er sich setzte, zupfte er die grellbunte Krawatte zurecht.
Die Zuschauer kicherten. Unter ihnen saßen einige Damen mit Hütchen. Gerade deren Lachen schien Ber zu beleben.
Manisch wäre am liebsten gegangen. In ihm waren Abwehr und Neugierde, aber auch eine seltsame Anspannung, die sich langsam löste, als Ber las. Dessen Stimme berührte Manisch auf sonderbare Weise, dass er schließlich dachte:
Ein Clown, ein Narr, hat er das nötig, sich so aufzuführen? Er spürte, wie sich Verachtung in ihm breitzumachen begann, die alles andere zu ersticken drohte.
Töricht genug war Manisch, die Fassade für das Eigentliche Bers anzusehen. Immerhin begriff er, ohne dass er hätte sagen können, warum: der Clown meinte es ernst, und die Zuhörer schienen ihn tatsächlich ernst zu nehmen. Da hatte er schon den Wunsch, mehr über Ber zu erfahren.
Später stellten die Buchhändlerinnen Manisch und Ber einander vor. Ber gab sich sehr liebenswürdig und schien ebenfalls Interesse an Manisch zu haben. Der war so verblüfft, dass er, als Ber ihn und die Frau aufforderte, noch mit ihm Kaffee zu trinken, sofort zusagte.
Fast eine Stunde liefen sie schweigend durch die Stadt. Als sie endlich in einer verräucherten Kneipe Platz fanden, schwiegen sie immer noch. Manisch und die Frau bemühten sich, ein Gespräch über Bücher und Literatur in Gang zu bringen. Weil ihnen peinlich war, keinen von Bers Gedichtbänden je gelesen zu haben, entschuldigten sie sich mehrmals. Dazu schwieg Ber. Aber als Manisch Lobendes über die Lesung sprach, hörte er, sehr zu seinem Erstaunen, Ber erwidern: Das interessiert mich nicht!
Überrascht lachte Manisch auf, fast ungläubig blickte er ihn an und entdeckte Bers abstoßende Hässlichkeit, die fahle Haut, die dunklen Säcke unter den Augen, die rauen, geplatzten Lippen. Verlegen senkte er den Kopf und trank Kaffee. Sie schwiegen wieder.
Als Manisch schon überhaupt nicht mehr an ein Gespräch dachte, begann Ber über Literatur und über sein Leben, über das, was er als seine Aufgabe in dieser Zeit bezeichnete, zu reden.
Manisch versuchte sich zu konzentrieren, doch es gelang ihm nicht, Bers Gedanken zu folgen. Er ahnte, dass der Mann klug war und Charakter besaß und dass er alles tat, um deutlich zu machen, wie sehr er sich von anderen unterschied. Ohne dass er es aussprach, wies er auf die Kluft hin, die zwischen ihm und anderen lag.
Indem er Ber als Angeber bezeichnete, versuchte Manisch sich vor ihm zu schützen. Damals ahnte er noch nicht, dass Ber ein wirklicher Künstler war, einer, der mit seiner ganzen Person einstand für das, was er tat, einer, dem seine Kunst und das Leben, das die Grundlage dafür bildete, so ernst und wichtig erschienen, dass er für die Ergebnisse seines Tuns sogar den Kopf hinzuhalten bereit war.
Als hätten sie schon öfter zusammen geredet, sprach Ber schließlich von seinen Schwierigkeiten. Man fordere von ihm Dinge, die er nicht tun wolle und könne, sagte er, und deshalb werfe man ihm vor, er stelle sich außerhalb. Er beteuerte, nur nach der Wahrheit zu suchen, und behauptete, die Anschuldigungen, über die er sich jedoch nicht weiter ausließ, seien ganz und gar aus der Luft gegriffen.
Nie wäre Manisch in den Sinn gekommen, jemand könnte Schwierigkeiten haben, weil er tat, was er tun musste. Er gestand sich ein, nicht tiefer als gerade bis unter die Oberfläche von Dingen und Erscheinungen gedrungen zu sein, und versuchte sich zu rechtfertigen, indem er sich einredete, gerade erst am Anfang zu stehen und vor wirklichen Bewährungsproben überhaupt noch nicht gestanden zu haben.
Ihn überraschte, dass Ber, als sie auseinander gingen, fragte, ob sie sich nicht wieder sehen wollten. Obwohl er nicht sicher war, es wirklich zu wünschen, sagte er zu. Ein paar Tage später trafen sie sich erneut. Diesen ersten Begegnungen sollten viele folgen. In immer kürzeren Abständen würden sie zusammenkommen. Aber das konnte noch niemand voraussehen.
6. Kapitel
Als Ber gegangen war, blieb Manischs Frau stehen: Ein erwachsener Mann und dann solche Faxen, dass er sich nicht schämt. Manche Leute halten sich einfach für zu wichtig! Sie nahm Manischs Arm. Der will um jeden Preis Eindruck machen, alles hat sich nur um ihn zu drehen. So deutlich wie heute habe ich noch nie empfunden, wie weit Menschen aneinander vorbeireden können. Was der wirklich will, hat doch niemand verstanden!
Damit hatte Manisch nicht gerechnet. Er versicherte der Frau zwar, ähnlich wie sie zu empfinden, aber sie schien ihm nicht zu glauben und wickelte sich in ihren Mantel. Auch Manisch fror. Er überlegte, warum Ber ihn beeindruckt und sogar getroffen hatte. Manisch war betroffen.
Während sie langsam durch die leeren Straßen gingen, spürte er die Spannung zwischen ihnen. Er hörte ihre Stimme und wusste, die Frau musste als Bedrohung empfinden, was sie nicht begreifen konnte. Um sich davor zu schützen, verachtete sie das Bedrohende.
Sie habe nicht das Recht, so über Ber, einen Menschen, von dem sie beide fast nichts wüssten, zu urteilen, sagte er und warf ihr schließlich vor, anmaßend und ungerecht zu sein.
Sie schwiegen wieder und jeder war mit sich und seinen Gedanken beschäftigt.
Ohne dass Manisch es ahnte, brachte dieser Tag der ersten Begegnung mit Ber in sein Leben einen Bruch, der auch einen Bruch in den Beziehungen zu seiner Frau darstellte. Wahrscheinlich hatte es den Bruch schon viel früher gegeben, er war ihnen entweder nicht bewusst geworden, oder sie hatten ihn stets schnell und notdürftig wieder gekittet. Der Zustand, in den sie nun, ohne es zu wollen, hineingekommen waren, machte sie beide unzufrieden.
7. Kapitel
Ber und Manisch gingen regelmäßig ins Theater, häufig tranken sie hinterher noch etwas. Unmerklich fast begann Ber, in Manischs Leben einen immer wichtigeren Platz einzunehmen. Jedes Mal stärker empfand Manisch in Bers Nähe, klein und mittelmäßig und zu großen Gedanken überhaupt nicht fähig zu sein. Obwohl ihn dieses Gefühl bedrückte, wurde vieles, das ihm Unbehagen bereitete, leichter, und manches, das ihm für lange Zeit unlösbar vorgekommen war, schien ihm nun einfach zu lösen. Beschämt gestand er sich ein, dass ihm die meisten Dinge in den Schoß gefallen waren. Ber sprach es nie aus, doch Manisch verstand seinen Vorwurf, unmoralisch zu sein. Wie er sich mit den Dingen auseinandersetzte, ohne jemals wirklich in die Tiefe zu gelangen, und wie er schließlich darüber schrieb, konnte Ber nur als unmoralisch empfinden.
Oft fragte Manisch sich, warum er das ertrug und sogar darunter litt. Doch ebenso wenig wie auf manches andere fand er damals darauf schon eine Antwort.
Seiner Frau blieb nicht verborgen, wie Manisch sich von Tag zu Tag mehr veränderte. Sie wusste, dass Bers Einfluss diese Veränderung bewirkte. Instinktiv begriff sie die Gefahr, die davon für sie und die Familie ausging. Indem sie nie aufhörte, ihren Mann vor diesem überheblichen Ber mit seinen verrückten Künstlermanieren, die doch nur dazu dienen sollten, Aufsehen zu erregen, um im Mittelpunkt zu stehen, zu warnen, setzte sie sich dagegen zur Wehr.
Sie hatte recht. Aber Manisch hatte schließlich auch recht. Es gab Augenblicke, in denen er die Frau hasste, weil sie ihn zwang, sich der Konflikte, in die ihn die Freundschaft mit Ber gestürzt hatte, bewusst zu werden.
Zu begreifen, dass er und die Frau einander fremd geblieben waren, war schwer, und sich einzugestehen, sie hätten womöglich die ganzen Jahre aneinander vorbei gelebt, war für Manisch wahrscheinlich das schwerste überhaupt...
8. Kapitel
Mit weit offenen Augen lag Manisch da. Sein rechtes Bein war eingeschlafen. Bevor er sich wieder auf den Rücken legte, die Augäpfel nach oben drehte, dass sie schmerzten, und zu zählen begann, warf er sich zweimal herum. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf: Vielleicht habe ich nur noch ein paar Jahre zu leben!
Immer häufiger überfiel ihn in der letzten Zeit die Angst, nie ein wichtiges Buch schreiben zu können. Immer öfter fragte er sich, ob er wirklich etwas zu sagen hätte. Längst war ihm klar, dass er alle Kräfte auf das Buch über den Krieg konzentrieren müsste, und ob er jemals damit zurecht käme, konnte ihm kein Mensch sagen. Nicht einmal Ber hatte ihm Mut gemacht. Ber, der sich gegen alles zu wehren verstand, das ihn vom Schreiben ablenkte, einengte oder auf eine Linie zu zwingen versuchte, Ber war mutig und hatte Kraft. Deswegen war er unentbehrlich. Manisch empfand sich im Vergleich zu Ber als einen winzigen Schriftsteller. Von zu vielen Dingen ließ er sich einfangen und verwirren. Sich gegen das, was ihn bedrückte, einengte und manchmal fast zu ersticken drohte, aufzulehnen, brachte er einfach nicht fertig.
Er musste husten und bewegte sich vorsichtig, um die Frau nicht zu wecken. Sie machte ihm nie etwas vor. Nie trug sie eine Maske. Er umgab sich dagegen mit verschiedenen Hüllen, die ihn schützen sollten und es manchmal scheinbar wirklich taten. Dabei wünschte er sich oft, die Masken und Häute herunterreißen zu können, dass er nackt wäre und ohne Schutz, und zu schreien: So bin ich, Manisch, so sehe ich wirklich aus, ich bin ein verletzlicher Mensch und manchmal zu Tode verletzt!
Er zog das Taschentuch aus dem Schlafanzug und wischte sich den Mund ab. Als er es wieder verstaute, berührte er zufällig seinen Bauch. Er hielt den Atem an. So lag er einen Moment. Ihn ärgerte, dass er nicht wagte, die Frau zu wecken oder einfach unter ihre Bettdecke zu kriechen. Er wurde immer wacher. Leise stand er auf und schlich in die Küche. Aus dem Schrank nahm er zwei Beruhigungstabletten, schluckte sie und trank ein Glas lauwarmes Wasser hinterher.
Als er am nächsten Morgen aufwachte, hatte er das Gefühl, zuviel getrunken zu haben. In seinem Kopf schmerzte es. Im Mund hatte er einen schalen Geschmack. Der blieb noch, als Manisch frühstückte, und verging erst, als er an seinem Schreibtisch saß und zu arbeiten begann.
9. Kapitel
Ber stand von seinem Schreibtisch auf, schob Papiere, Manuskripte, Bücher zusammen. Er putzte Fenster und wischte den Fußboden. Als alles fertig war, erschien es ihm immer noch nicht gut genug. Er ging in die Kaufhalle, kaufte Brot und Butter, frischen Aufschnitt und mehrere Flaschen Rotwein. Wie in einem Rausch handelte er, denn was er sich lange gewünscht hatte, sollte nun geschehen: er würde Besuch bekommen!
Vor einiger Zeit war er auf einer Lesung einem jungen Mann begegnet. Dessen Fragen waren Ber aufgefallen. Die Diskussion hatte sich schließlich zu einem Gespräch zwischen ihnen entwickelt, das sie später in einer Gaststätte fortgesetzt hatten.
Als sie sich trennten, hatte Ber den jungen Mann, von dem er inzwischen wusste, dass er Medizin studierte, ermuntert, ihm doch einfach mal zu schreiben, wenn er sich wohl fühle oder Probleme habe. Für ihn sei das alles interessant, hatte er hinzugefügt und dann erschrocken geschwiegen. Umso überraschter war er gewesen, als der junge Mann es ihm versprochen hatte.
Von Tag zu Tag hatte Ber enttäuschter auf die Post gewartet. Als der Brief endlich doch angekommen war, hatte er ihn wieder und wieder gelesen und dabei das Gefühl gehabt, der Schreiber verstände ihn, wie selten ein Mensch ihn verstanden hatte. Weil er Angst hatte zu antworten und vor allem fürchtete, sich lächerlich zu machen, hatte er dem jungen Mann vorgeschlagen, ihn zu besuchen.
Nun wartete Ber. Er badete lange, wusch seine Haare und kämmte sie glatt, zog eine Hose an, die ihm viel zu weit war, einen verfilzten roten Wollpullover, den er sehr lange nicht mehr getragen hatte.
Als er vor dem Spiegel stand, fiel ihm auf, wie abgerissen er war und wie schäbig seine Sachen aussahen. Obwohl er sein ganzes Leben lang nicht gewusst hatte, was man gerade trug, fand er die Kleider so heruntergekommen, dass er beschloss, sich neu einzukleiden. Lautlos lachte er, als er dachte, in meinem Alter muss man sich wenigstens schick kleiden, schick und elegant! Du Narr, sagte er und lachte lauter.
Ber wunderte sich über seinen Hunger danach, Menschen kennen zu lernen, zu entdecken, und das Gefühl, in dieser Hinsicht viel versäumt zu haben. Er nahm sich vor, wieder öfter auszugehen, und wusste schon, dass es dabei bleiben würde.
Du Narr, sagte er, du weißt doch genau, dass du nicht nachholen kannst, was du versäumt hast! Er deckte den Tisch, legte ein weißes Tuch darauf und steckte sogar eine Kerze an. Schließlich fand er die Kerze albern und pustete sie aus. Als sie nicht mehr brannte, stellte er fest, dass etwas fehlte, da steckte er sie wieder an.
Wie ich mich aufführe, ist ja lächerlich, dachte er. Gott sei Dank weiß der junge Mann nichts davon, er würde mich auslachen und niemals wiederkommen!
Ber lebte schon lange allein. Vor mehreren Jahren war seine Mutter an einer quälenden Krankheit gestorben. Mit seinen wenigen Kräften hatte Ber versucht, ihr Leben zu verlängern.
Kurz nach dem Tod der Mutter verließ ihn seine Frau mit einem sehr viel älteren Mann. Diesen Schritt hatte sie längst vorgehabt und tatsächlich nur auf eine günstige Gelegenheit gewartet. Seit langem warf sie Ber vor, der fixen Idee wegen, ein Schriftsteller oder gar Künstler zu sein und unregelmäßig, überdies meistens noch nachts, arbeiten zu müssen, alles andere und besonders sie, seine Frau, vernachlässigt zu haben.
Sie beklagte sich, für die Dinge, die in anderen, normalen Ehen gemeinsam besprochen und ausgeführt würden, stets allein verantwortlich gewesen zu sein. Habe sie mal einen Wunsch oder ein Anliegen gehabt, sei es ihm schon zuviel gewesen, darauf auch nur einzugehen. Mit seinen Freunden oder jedenfalls Leuten, die er dafür halte, habe er bis in die Nacht hinein zusammenhocken und unwichtiges Zeug reden können. Sie, behauptete Bers Frau, sei lange genug so töricht gewesen, Essen und Trinken heranzuschleppen. Zum Dank dafür habe er sie nicht einmal zur Kenntnis genommen. Dir war es doch gleich, ob ich allein gehockt und mich gequält habe, warf sie ihm vor.
Das war es wirklich, dachte Ber und konnte es kaum ertragen, hören zu müssen, dass die Frau ihn einen Arbeitsscheuen und Asozialen nannte.
Was ist denn los, fragte er sich und wünschte, die Sache sollte so schnell wie möglich zu Ende sein. Ohne ein Wort der Verteidigung und schweigend ertrug er die Vorwürfe der Richterin, einer Frau ohne jede Fantasie, die ihre Sympathie für seine Frau offen zeigte und Ber beschuldigte, ein Mensch ohne Anstand zu sein, und die es sogar wagte, ihm vorzuwerfen, er habe auf Kosten seiner Frau gelebt. Obwohl sie vermied, dieses Wort zu gebrauchen, verstand Ber doch, dass sie ihn für einen Schmarotzer hielt. Er war damit beschäftigt, sich zu schützen.
Warum muss einer, der anders als sie ist, so viel ertragen, dachte er und ließ die Richterin reden.
Als endlich die Scheidung hinter ihm lag, fühlte er sich nur von einer Last befreit. Was ihm tatsächlich bevorstand, konnte er nicht ahnen. Zu seinen Freunden sprach er nicht davon, wie überflüssig er sich oft vorkam. Weil sie selber genügend Probleme hatten, wollte er sie nicht auch noch belasten. Immer öfter schob er Arbeit vor. Wenn jemand nach ihm fragte, entschuldigte er sich damit, er habe keine Zeit und stecke in der Arbeit an einem neuen Buch. Das akzeptierten sie. Einer, der schrieb und in Ruhe gelassen werden wollte, wurde in Ruhe gelassen.
Doch in Wahrheit vertat Ber seine Zeit mit Dingen, von denen er hoffte, sie würden ihn vom Grübeln ablenken und ihm helfen, mit dem gefährlichen Alleinsein fertig zu werden. Er trank entschieden zuviel und gestand sich, wenn er betrunken war, ein, es sei gleich, ob er lebte und schrieb oder nicht. Im Schreiben sah er keinen Sinn mehr.
Bei einem Trödler erwarb er die Außenministerjacke und Lackschuhe. Tagelang übte er vor dem Spiegel die Bewegungen, mit denen er die Melone abnahm oder aufsetzte. Schnell merkte er, wie die Leute ihn zu sehen wünschten und dass sie über den, der sich vor ihnen präsentierte, spreizte und zu verkaufen willens war, lachen wollten. Da war er schon bereit, sie zum Lachen zu bringen. Wahrscheinlich war er sogar derjenige, der am meisten über sich selber lachte. Immer seltener gestand er sich ein, was es ihn kostete, die Leute hinters Licht zu führen.
Auch äußerlich hatte er sich verändert. Er war mager geworden, seine Augen lagen in tiefen dunklen Höhlen. Grau und strähnig hingen seine Haare bis in den Nacken.
Nur wenige Menschen wussten, dass Ber anders war, als er sich zeigte. Manisch gehörte dazu.
10. Kapitel
Während Ber Teller und Gläser hin und her schob, sprach er halblaut, was er mit dem jungen Mann reden wollte. Von Anfang an würde er das Gespräch auf die Dinge lenken, die ihm wichtig waren. Er wurde immer aufgeregter, lief zur Tür, öffnete und schloss sie sofort wieder, lehnte den Kopf dagegen und murmelte: Gott, lass ihn kommen! Ich spinne ja, ich... Er hat doch fest zugesagt. Warum bin ich denn bloß so durcheinander, er geht mich doch gar nichts an.
Als es klingelte, fuhr Ber zusammen. Das ist er, natürlich, wer sonst sollte es sein, es kommt doch sonst niemand mehr zu mir! Ber schluckte und zog an seinem lappigen Pullover herum. Er war ganz beherrscht und sogar liebenswürdig, als er die Tür öffnete, den jungen Mann hereinließ und ihn aufforderte, sich zu setzen.
Der ließ sich nicht nötigen. Er rückte seine Nickelbrille zurecht, griff sich ein Brot und fing schon zu essen an. Mit vollen Backen beteuerte er: Ich habe nämlich Hunger!
Essen Sie ruhig! Ber ließ ihn nicht aus den Augen. Jede Geste prägte er sich ein, jede Bewegung des Gesichtes, als der junge Mann ununterbrochen redete, von einer großen Liebe, die gerade zu Ende gegangen sei, schwatzte und behauptete, deswegen sehr traurig zu sein. Die Muskeln um seinen Mund bewegten sich langsam, als er erklärte: Vielleicht müssen Menschen, die nicht so glücklich sein können wie ich, auch nicht so traurig sein, weil sie das große Glück nicht kennen. Bei ihnen ist alles alltäglich. Sie sind zufrieden, aber dafür müssen sie auf das Glück verzichten! Mit der rechten Hand klopfte er leicht auf den Tisch.
Ber hörte zu, er nickte zwar höflich, aber er begann schon, sich zu fragen, weshalb ihm, was der junge Mann damals gesagt hatte, wichtig und sogar bedeutend vorgekommen war. Warum er ihn klug gefunden hatte, schien ihm nun rätselhaft. Jetzt fand er ihn einfach banal, fast ein bisschen dumm.
Wenn man so jung ist und dazu so gut aussieht, darf man getrost oberflächlich und anmaßend sein, dachte er und sagte: Da haben Sie recht!
Warum denn? Der junge Mann hörte auf zu kauen. Er hob den Kopf und blickte Ber kühl an, ehe er sagte: Daran glaube ich! Dann aß er weiter. Mit immer größer erscheinendem Appetit schlang er, trank er und merkte überhaupt nicht, dass er eine Flasche Wein schon fast allein ausgetrunken hatte.
Tun Sie sich keinen Zwang an, spöttelte Ber.
Das machte der junge Mann sowieso nicht. Unentwegt redete er: ...ich suche einen Menschen, der mich liebt, um in meinem Leben einen Sinn sehen zu können. Um meine Sehnsucht aufrechtzuerhalten, musste ich das Mädchen idealisieren. Diesem Bild war ich nicht gewachsen, auch der Beziehung nicht. Ich beschäftigte mich fast nur noch mit mir selber. Dabei habe ich doch erlebt, dass es echte Zuneigung sogar zu mir geben kann. Das müssen Sie wissen!
Ber biss die Zähne zusammen. Sein Mund verzog sich zu einem angewiderten Lächeln, als der junge Mann seufzend nach dem mit Kochschinken belegten Brot langte, davon abbiss und mit ausladenden Bewegungen kaute.
Wie der schlingt, dachte Ber, das ist doch nicht normal. Was der schon weggefressen hat, hätte für mich die ganze Woche gereicht. Was will der überhaupt hier! Fressen und saufen soll er bei seinen echten Zuneigungen... Um seine Enttäuschung zu verbergen, senkte er den Kopf. Das wäre aber nicht nötig gewesen, der junge Mann nahm ihn überhaupt nicht wahr. Der redete: Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der mich nicht nur ertragen hätte, sondern vor allem liebt, mit allen meinen Widersprüchen. Die Minderwertigkeitskomplexe können also weiter wirken...
Was für ein schlechtes Deutsch der spricht, dachte Ber. Er fühlte sich angeekelt.
Ja, das stimmt! Der junge Mann guckte auf die nächste Weinflasche.
Aber die bleibt zu, dachte Ber. Ohne ihn zu fragen, öffnete der junge Mann sie schon, goss sein Glas voll und trank mit einem Schluck die Hälfte des Inhaltes aus.
Ach, entschuldigen Sie! Er stellte das Glas auf den Tisch, nahm die Flasche wieder in die Hand, lächelte schalkhaft und fragte: Möchten Sie vielleicht auch?
Ber wurde rot bis unter die Haarwurzeln, aber er blieb stumm.
Als der junge Mann das Glas wieder voll goss und sagte: Sie trinken ja gar nicht, schüttelte Ber sprachlos den Kopf. Sehr freundlich, dass du es wenigstens merkst, dachte er und fragte sich, ob der andere wohl wisse, wie er, Ber, heiße, wer er sei und was er tue. Er bekam Lust, sich danach zu erkundigen. Aber der junge Mann äugte schon wieder nach der Flasche. Vor Behagen ächzend, sagte er mit vollem Mund: In den letzten Tagen habe ich ja versucht, alles nicht so wichtig zu nehmen...
Wichtig, dachte Ber, nimmst du nur dich selber. Solche wie dich kenne ich! Hast du denn schon gemerkt, dass ich deinetwegen die Wohnung auf den Kopf gestellt und mich extra fein angezogen habe! Mit einem Ruck warf er den Kopf zurück und lachte schallend. Jedes Gefühl in ihm war gestorben, als er dem jungen Mann an den Arm fasste und sagte: Wenn Sie hier bleiben...
Ja aber, der junge Mann zog seinen Arm weg.
Ber ahnte, was der andere dachte. Nein nein, sagte er, schlug die Augen nieder und strich mit der Hand über die Stirn.
Ich habe sowieso noch was vor, ein andermal vielleicht! Der junge Mann sah zur Uhr und sprang dann auf.
Wird sich schon eine finden, dachte Ber wütend und verletzt, bei der du alles abladen kannst. Für dein Seelenschmalz bin ich ja gut genug. Aber dazu bin ich mir zu schade. Was gehst du mich überhaupt an. Mit dir könnte ich keinen Tag zusammen sein, du gingst mir mit deinem Gequatsche auf die Nerven. Raus hier!
Voll Hohn verbeugte er sich und schob den jungen Mann zur Tür, dabei wünschte er, der sollte bleiben, seinetwegen konnte er plappern, was und soviel er wollte, Hauptsache, er wäre da. An der Tür überlegte er, ob er den jungen Mann auffordern sollte, wenigstens zurückzukommen. Er gab ihm die Wohnungsschlüssel und sagte mit brennendem Gesicht: Wenn Ihnen mal so ist, kommen Sie ruhig vorbei, die Tür wird für Sie jederzeit offen sein! Als es heraus war, hätte er sich am liebsten die Zunge abgebissen.
Das freut mich ja unwahrscheinlich! Unsicher und zögernd nahm der junge Mann den Schlüssel. Das mache ich bestimmt, versprach er.
Ber fühlte nur Abwehr, als er dachte: Lügner, was geht der mich an, ich kenne ihn doch überhaupt nicht...
Noch während der junge Mann die Treppe hinuntersprang, schloss Ber die Tür. Er lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand. Dabei sah er in den Spiegel. Sein Gesicht verzerrte sich zu einem bösen Grinsen. Mit den Fingerspitzen strich er darüber hin und zerrte schließlich an der Haut, bis es schmerzte. Das konnte er nicht lange ertragen. Er lief hin und her, räumte den Tisch ab, wusch das Geschirr sauber, stellte es in den Schrank, und als er damit fertig war, zog er sich aus. Während er duschte, dachte er bitter: Der kennt nicht eine Zeile von mir. Gerade diese jungen Leute, auf die ich so sehr gehofft habe, wissen überhaupt nichts von meiner Existenz. Sie wollen nichts von mir wissen. Bei einer Auflage von zweitausend Exemplaren pro Buch kann es ja gar nicht anders sein. Ich will nicht mehr hören, dass dieses Land ein Leseland ist. Was tatsächlich gelesen wird, sind seichte Abenteuerbücher und verlogene Liebesgeschichten!
Vor Verzweiflung begann er zu frieren. Hastig zog er den Schlafanzug an und warf sich auf das Bett. Da lag er und starrte die Decke an. Er wusste, dass er am Ende seiner Möglichkeiten und Kräfte angelangt war. Es nützte nichts, sich etwas vorzumachen, er war allein.
Zögernd stand er schließlich wieder auf, ging in die Küche, öffnete den Medizinschrank, nahm die Schlaftabletten heraus, ließ Wasser in ein Glas laufen und warf eine Tablette hinein. Seltsam fasziniert, beobachtete er, wie sie sich langsam auflöste und zerfiel.
Noch eine, dann schlafe ich besser, noch eine, noch eine... Er konnte es kaum erwarten, zu erfahren, was passieren würde, wenn er alle Tabletten schluckte, und schüttete den Inhalt des Röhrchens ins Glas. Mit dem Zeigefinger rührte er um und trank hastig die weißliche Flüssigkeit. Bevor er sich auf sein Bett legte, hörte er sich sprechen: Ich will schlafen, das ist jetzt das beste, schlafen, nichts mehr hören und sehen, nichts mehr spüren müssen, nur noch schlafen... Ihm wurde ganz leicht zumute. Von seinem Schnarchen schreckte er noch einmal auf, dann wusste er nichts mehr.
Doch er hatte sich geirrt. Der junge Mann war im Kino gewesen. Auf einer Disko hatte er später versucht, mit einem Mädchen anzubändeln. Es ließ sich zwar küssen, aber als er von Liebe schwatzte und mehr versuchte, wies es ihn ab. Das war dem jungen Mann selten passiert. Er machte ein paar spöttische Bemerkungen, dann lief er wütend und enttäuscht weg.
Die Straßenbahnen fuhren nicht mehr. Eine Taxe zu mieten, hatte der junge Mann nicht genug Geld. Er kauerte sich schließlich auf eine Bank und begann bald erbärmlich zu frieren.
Als zwei Polizisten ihn aufforderten, sich schnellstens zu erheben, fiel dem jungen Mann Ber ein. In dessen Wohnung war es wenigstens warm, es gab dort gutes Essen und Trinken. Alles andere würde er in Kauf nehmen.
Stumpf vor Kälte und Müdigkeit, machte er sich auf den Weg. Vorsichtig schloss er die Wohnungstür auf, öffnete sie leise und trat in den Flur. Obwohl er auf Zehen ging, hatte er das Gefühl, bei jedem seiner Schritte krachten die Dielen. Um so mehr wunderte ihn, warum Ber von dem Lärm nicht aufwachte.
Der junge Mann tastete nach dem Lichtschalter und knipste. Weil das Licht ihn blendete, kniff er die Augen zusammen. Als er wieder gucken konnte, fiel ihm etwas auf. Er ging näher an Ber heran und entdeckte, was geschehen war. Es dauerte eine Weile, bis er sich so weit gefasst hatte, dass er wieder klar denken konnte. Einen Augenblick überlegte er, ob er einfach verschwinden sollte, weglaufen, kein Mensch könnte ihm beweisen, dass er noch einmal hier gewesen war. Aber dann rannte er auf die Straße, bis zur nächsten Telefonzelle, in der das Telefon tatsächlich funktionierte, und rief die Schnelle Medizinische Hilfe an.
Schon eine halbe Stunde nachdem der junge Mann ihn gefunden hatte, lag Ber im Krankenhaus. Eine Stunde danach hatte man ihm den Magen ausgepumpt.
Der junge Mann bekam die Nachricht, Ber sei über den Berg und es gehe ihm den Umständen entsprechend. Als er wissen wollte, welches die Umstände seien, antwortete man: Tut uns leid, weitere Auskünfte dürfen wir nicht geben! Der junge Mann wusste auch so Bescheid. Er begann zu begreifen, dass Ber in einer miserablen Lage gewesen war, und warf sich vor, ihn zusätzlich mit Problemen belastet zu haben. Erst als er in der MITROPA mehrere Kannen Kaffee getrunken hatte, wurde ihm etwas besser.
11. Kapitel
Ungefähr zu der Zeit, als der junge Mann einen weißen Kittel überzog und anfing, einen menschlichen Arm in seine Einzelteile zu zerlegen, erwachte Ber. Mühsam öffnete er die Augen und blinzelte. Ich bin doch gestorben, dachte er, hörte jemanden reden und leise lachen, sah eine Gestalt auf sich zukommen, öffnete die Augen weiter und erkannte eine Frau. Sie schlug leicht sein Gesicht und sagte mit tiefer Stimme: Na, da haben wir ja was Schönes angestellt, das wird Folgen haben!
Was denn angestellt, überlegte Ber, und wieso Folgen? Er wollte fragen, aber je mehr er sich anstrengte, desto weniger war er imstande, auch nur einen Ton herauszubringen. Erschöpft schloss er wieder die Augen. Er spürte, dass die Schwester sich an seiner Hand zu schaffen machte. Zwischen den Lidern hindurch erspähte er neben dem Bett das Gestell, an dem zwei Flaschen hingen. Schläuche liefen bis zu seiner linken Hand, auf der eine Nadel mit Pflaster festgeklebt war.
Mühsam drehte Ber den Kopf. In anderen Betten lagen Leute, deren Gesichter waren ihm zugewandt. Neugierig und schamlos starrten die fremden Augen. Lauernd beobachteten sie, wie er langsam und unter Mühen ins Leben zurückgebracht wurde.
In Strömen lief ihm der Schweiß über das Gesicht. Die Schwester wischte ihn mit Zellstoff ab. So, nun werden wir wieder schlafen, sagte sie bestimmt und in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete, wenn wir aufwachen, sieht alles ganz anders aus!
Ich bin doch gestorben, dachte Ber. Dunkel erinnerte er sich, Tabletten genommen zu haben und dann eingeschlafen zu sein. Das Sterben war viel einfacher gewesen, als er sich jemals hatte vorstellen können.
Ich will überhaupt nicht wieder aufwachen, sagte er entschlossen, ich will nicht, brüllte er. Es kam aber nur ein Flüstern heraus, und niemand konnte verstehen, was er meinte. Er versuchte sich aufzurichten und das Pflaster, das die Nadel festhielt und die Schläuche daran, die zu den Flaschen liefen, abzureißen. Mit aller Kraft warf er sich im Bett herum.
Schwester Anita, schnell, kommen Sie, der Neue macht Theater, rief aufgeregt die Schwester. Als die Schwestern ihn mit kräftigen Armen packten und in die Kissen zurückdrückten, versuchte Ber sich zu wehren. Ich will sterben, keuchte er.
Ob Sie sterben oder nicht, entscheiden nicht Sie, erwiderte die Schwester.
Ber spürte den Stich der Nadel im Arm. Wer entscheidet denn, fragte er und wollte es schon gar nicht mehr wissen. Er war nur müde. Er nahm nicht mehr wahr, dass die Schwestern ihre Kleider und Hauben zurechtrückten und die Bettdecke, die heruntergerutscht war, bis an sein Kinn zogen. Er hörte nicht mehr, wie die eine Schwester zu den anderen Männern sagte: Der wacht jedenfalls heute nicht wieder auf, der schläft durch bis morgen früh!
12. Kapitel
Am übernächsten Tag telefonierte Manisch mit einem Kollegen. Der erzählte ihm beiläufig, was geschehen war. Vor Schreck konnte Manisch kein Wort mehr sprechen. Sofort beendete er das Gespräch.
Zufällig rief kurze Zeit später seine Mutter an. Sie würde gern am nächsten Sonntag vorbeikommen, sagte sie und fragte, ob es ihnen passe. Weil Manisch schien, sie habe etwas auf dem Herzen, bat er sie nicht, den Besuch um eine Woche zu verschieben. Es passt, sagte er und beeilte sich, zu versichern: Wir freuen uns, dass du kommst! Das war nicht gelogen.
13. Kapitel
Als er die Tür öffnete, um die Mutter hereinzulassen, sagte er: Schön, dass du da bist! Während sie sich vor dem Spiegel kämmte, sah er ihr zu. Sie bewegte sich langsam. Ihr Gesicht war blass und faltenlos. Dass sie ihre Lippen gefärbt hatte, überraschte ihn. Als sie sprach, antwortete er zwar, doch er war damit beschäftigt, sich über die Veränderung, die mit ihr vorgegangen war, zu wundern.
Was meinst du, fragte die Mutter.
Da hast du recht! Manisch nickte.
Was denn? Die Mutter schüttelte den Kopf.
Hanne, Mutti ist da, komm doch, rief Manisch in die Küche. Komme gleich, antwortete seine Frau. Sie redete ein paar Worte mit der Mutter, bevor sie wieder in der Küche verschwand.
Manisch beobachtete die Mutter. Für wen hast du dich bloß so zurechtgemacht, dachte er, die roten Lippen und das Seidentuch um den Hals, das die Runzeln doch nicht verdecken kann... Du hast ein schweres Leben, aber das ist doch noch lange kein Grund, dich so lächerlich herzurichten. Er öffnete die Stubentür und forderte die Mutter auf, einzutreten. Mit kurzen, trippelnden Schritten folgte sie ihm. Als sie sich setzte, seufzte sie kaum hörbar.
Auch Manisch setzte sich. Zwar wusste er, nicht er war daran schuld, dass seine Mutter ein schweres Leben hatte, doch ganz frei von Gewissensbissen fühlte er sich nicht.
Wie geht es dir denn? Er griff nach ihren Händen und ließ sie gleich wieder los, um aufzuspringen und den Stecker des Heizofens in die Steckdose zu stecken.
Du weißt doch, dass es mir immer gut geht, erwiderte die Mutter, Probleme hat jeder, und warum soll ich andere damit belästigen! Sie putzte sich die Nase.
Du tust es aber, indem du schweigst, dachte Manisch und öffnete den Hemdkragen. Er wollte der Mutter nicht mehr ins Gesicht blicken und guckte auf seine rotlackierten Kunstlederlatschen, deren Spitzen abgestoßen waren. Ist dir auch nicht zu warm, fragte er. Ohne die Antwort der Mutter abzuwarten, zog er den Stecker wieder heraus und schob den Heizofen mit dem Fuß an die Seite. Als er sich setzte, fiel ihm auf, dass die Mutter den Kopf gesenkt hielt und die Tasche in ihrem Schoß, die prall gefüllt war und über der sie die Hände gefaltet hatte, anstarrte.
Er ahnte, dass sie die Fremdheit zwischen ihnen empfand und darunter litt. Noch immer nicht konnte sie sich damit abfinden, dass er längst erwachsen war. Plötzlich hatte er den Wunsch, zu seiner Mutter zu gehen, ihr den Kopf in den Schoß zu legen und zu sagen: Ber hat Tabletten genommen, es geht ihm schlecht. Vielleicht liegt er sogar im Sterben. Ich habe Angst, es könnte mir eines Tages ergehen wie ihm, hilf mir...
14. Kapitel
Gott sei Dank brachte seine Frau das Tablett mit Tellern und Tassen. Während die Frauen Geschirr auf den Tisch stellten, musterte Manisch die Mutter. Etwas beschäftigte und bewegte sie, das merkte er ihr an. Vielleicht ist es das Beste, sie nach dem Kaffee direkt zu fragen, dachte er.
Endlich kamen die Söhne. Langhaarig und mit schlaksigen Bewegungen der Ältere, mit pickligem Gesicht und verlogenem Grinsen sein Bruder. Nachdem sie die Großmutter begrüßt hatten, fragte Manisch: Wo wart ihr so lange? Ihr wisst doch genau, drohte er, als sie keine Antwort gaben.
Lass sie doch, unterbrach ihn seine Mutter, schließlich sind es Jungs!
Man wird sich wohl noch im Bad die Hände waschen dürfen, sagte der Ältere und hatte um den Mund einen trotzigen Zug.
Wer weiß, wozu das nötig war, dachte Manisch und ärgerte sich, dass er ausgerechnet jetzt daran dachte.
Schließlich setzte man sich an den Kaffeetisch, auf dem die guten Sammeltassen standen, Topfkuchen mit Rosinen und Torte mit Schokoladencreme. Die Frau konnte backen und kochen und hatte Manisch oft versichert, es gern zu tun.
Schmeckt gut, lobte die Mutter. Ja, die Frau tat ein bisschen ungläubig, ehe sie über das Wetter redeten, die Hitze zuerst, die Kälte dann, die Hitze und nun wieder die Kälte.
Den Wind nicht vergessen, spottete Manisch. Immerzu dachte er an Ber. Anstatt zu ihm gehen zu können, musste er sich das Gequatsche der Frauen anhören. Während Ber vielleicht nach ihm rief und womöglich seine Hilfe brauchte, hockte er hier untätig herum und aß Kuchen.
Als sein ältester Sohn mit dem Stuhl kippelte, bestimmte Manisch: Setz dich ja anständig hin! Sitz anständig! Der Sohn hörte nicht auf zu kippeln.
Ach, lass ihn doch, sagte die Mutter.
Du halt dich da raus, erwiderte Manisch aufgebracht und in einem Ton, der die Mutter verwunderte. Ganz deutlich sah Manisch den Ausdruck von Enttäuschung über ihr Gesicht huschen, als sie kaum hörbar sagte: Dann kann ich ja gehen, ich komme überhaupt nicht wieder her! Sie schien es tatsächlich ernst zu meinen und stand schon auf.
Seine Frau warf Manisch einen Blick zu. Sie klatschte in die Hände und sagte zur Mutter: Bleib doch, ich habe mir so viel Mühe gemacht!
Das weiß ich! Zögernd setzte sich die Mutter wieder. Ohne Manisch anzusehen, erzählte sie seiner Frau, ein Bekannter habe ihr prophezeit, nach dem Hundertjährigen Kalender gebe es einen langen und sehr harten Winter.
Woher der das wissen will, dachte Manisch. Er konnte sich schon denken, um was für einen Bekannten es sich handelte.
Die Mutter rieb ihre rechte Hand, um deutlich zu machen, wie viel stärker als sonst sie unter Rheumatismus zu leiden habe.
Wirst eben alt, sagte der älteste Sohn. Halt die Klappe, fuhr Manisch ihn an.
Man wird doch hier noch was sagen dürfen!
Aber nicht so etwas, sagte Manisch, und es war, als spräche nicht er, sondern ein ganz anderer, und als erreichte es die anderen nicht, wie er es meinte. Flüchtig sah er die Mutter an und hatte ein schlechtes Gewissen, weil er sich nicht genügend um sie kümmerte. Dass sie sich so selten sahen und es kaum eine Gelegenheit gab, ihr zu zeigen, wie sehr er sie liebte, bedrückte ihn. Manisch liebte seine Mutter. Der Gedanke, dass sie womöglich schon bald sterben könnte, war für ihn kaum zu ertragen.
Möchtest du noch etwas? Er zeigte auf den Topfkuchen, die Schokoladentorte. Langsam ließ er die Hand wieder sinken und dachte: Unsinn, wenn sie was will, wird sie es schon nehmen!
Nein danke, sagte die Mutter spitz und lächelte abweisend.
Es schien Manisch, als hätte sie Mühe, zu erfassen, wo sie sich befand. Du bist eine alte Frau, dachte er, und du hast ein hartes Leben, es ist nicht deine Schuld, dass dein Leben so gewesen ist, und dafür, dass du nun nicht weißt, wohin du gehörst, kannst du nichts!
Der Schweiß lief ihm von den Achselhöhlen bis hinunter zum Hosenbund. Manisch hatte das Gefühl, gleich am Stuhl festzukleben.
Schling nicht so, tadelte seine Frau ihren jüngeren Sohn. Ach Gott, ach Gott, sagte der und verdrehte die Augen.
Sofort setzt du dich gerade hin! Als der Sohn nicht tat, was sie verlangte, nannte die Frau ihn ungezogen und frech.
Durch Manischs Mutter lief eine Bewegung. Ihre linke Hand, die neben dem Kuchenteller lag, öffnete und schloss sich.
Manisch zog an seinem Hemd. Es war furchtbar still. Nur der jüngere Sohn kratzte den Teller mit dem Silberlöffel.
Ich müsste ja mal wieder zum Doktor gehen, sagte die Mutter kaum hörbar.
Musst du, da würde ich nicht warten! Die Frau nickte.
Sie ist doch wohl nicht etwa krank, fragte Manisch sich und blickte flüchtig der Mutter ins Gesicht, aber das verriet von einer Krankheit nichts.
Wenn ich es nur schon hinter mir hätte! Die Mutter wandte sich dem älteren Enkel zu und fragte: Was willst du denn nun endgültig werden?
Weißt du doch, ich gehe zehn Jahre zur Armee!
Erschrocken sah die Mutter von einem zum anderen, ehe sie verstört sagte: Damit du endest wie dein Großvater, den sie totgeschossen haben!
Manisch wusste: Seine Mutter hatte den Wunsch, kein Manisch sollte jemals wieder ein solches Ende finden, weder er noch seine Söhne, noch deren Söhne. Ihn überraschte, dass sie ausgerechnet jetzt von seinem Vater anfing.
Heute wird keiner mehr totgeschossen, behauptete jugendlich ungeniert der Sohn, heute ist kein Krieg mehr!
Gerade heute kann schnell wieder Krieg werden, ereiferte sich die Mutter.
Das glaube ich sowieso nicht, erwiderte der Sohn.
Manisch schwieg und tat nichts, als die Mutter und den Sohn zu beobachten. Wahrscheinlich hätte er kein einziges Wort herausgebracht. Nach einer Weile hob er die Hand, als wollte er Sohn und Mutter davon abhalten, weiter zu sprechen. Mühsam sagte er schließlich: Euren Kindern soll es nicht ergehen, wie es mir ergangen ist. Ich will nicht, dass sie ohne Vater aufwachsen und so allein, wie ich es immer gewesen bin. In einem jähen Aufwallen von Unbehagen, Furcht und Hilflosigkeit stieß er hervor: Dabei hätte ich manchmal nötig meinen Vater gebraucht!
15. Kapitel
Obwohl es unter Manischs Vorfahren Könige, Heerführer und viele andere tapfere Männer gegeben hatte, über die noch immer mit Ehrfurcht gesprochen wurde, war Manisch nicht danach ehrgeizig, auf Soldatenart Ruhm zu erwerben. Er meinte, der Inhalt seines Lebens solle ein anderer sein, als Tag für Tag Befehle auszuführen, die andere erdacht hätten.
Kurze Zeit bevor er studieren wollte, waren Offiziere, um für die Armee zu werben, in die Schule gekommen. Einige Mitschüler hatten sich für lange Zeit verpflichtet, andere verhielten sich von vornherein ablehnend. Bewusst hatten sie in Kauf genommen, Schwierigkeiten in Bezug auf ihre berufliche Entwicklung zu bekommen.
Tatsächlich merkten die Offiziere schnell, wie sie mit Manisch umzugehen hatten. Sie wollen doch studieren, drängten sie, und als Manisch sich davon nicht besonders beeindrucken ließ, drohten sie: Entweder, Sie sind für den Staat, dann beweisen Sie es, indem Sie sich für mindestens drei Jahre verpflichten. Oder..., Sie müssen die Konsequenzen tragen!
Da endlich hatte Manisch begriffen. Er unterschrieb die Verpflichtung und erhielt zugesichert, nach der Armeezeit sofort den Studienplatz, den er sich wünschte, zu bekommen.
Dass Krieg und alles, was damit in Zusammenhang stand, unvermeidbar wäre, redete er sich ein und versuchte so, die Folgen seines Tuns zu vergessen, was ihm erstaunlich leicht fiel. Bald galt die Verpflichtung sowieso nichts mehr: Die allgemeine Wehrpflicht wurde eingeführt.
Kurz danach lernte Manisch ein Mädchen kennen. Bald heirateten sie.
16. Kapitel
Bei allem, was er tat, wurde Manisch behütet und hatte keine andere Aussicht, als bis ans Ende seiner Tage behütet zu werden.
Er konnte nicht wissen, dass die Alte, seine Großmutter, ihn genau beobachtete und mit größter Sorge sah, wie er sich entwickelte. Sie erkannte sehr schnell, dass er dem, was auf ihn zukam, nicht gewachsen war. Deshalb zögerte sie, ihn zu ihrem Erben zu ernennen, wie es ihm zugekommen wäre, und Stück für Stück mit den Geheimnissen des Volkes und der Familie, der er entstammte, vertraut zu machen. Niemals zeigte sie ihm die mit Diamanten besetzte Krone und das Zepter, die beiden goldenen Diademe, die sich schon über tausend Jahre im Besitz der Familie befanden und von denen in dieser Zeit nicht ein einziger Stein abhanden gekommen war. Nie bekam Manisch den Mantel mit Hermelinbesatz, der längst vergilbt war, zu Gesicht. Nie durfte er auch nur einen Blick in die Bücher werfen, in denen von Anbeginn aufgeschrieben war, woher das Volk im sechsten Jahrhundert gekommen war und welche Könige es seitdem regiert hatten. Niemals durfte Manisch dabei sein, wenn die Alte mit ihrem Staatsrat, den Oberhäuptern gewisser Familien, die das ganze Volk betreffenden Angelegenheiten beriet. Noch nie hatte sie ihm erlaubt, anwesend zu sein, wenn die Männer ihr einmal jedes Jahr an ihrem Geburtstag königliche Ehren erweisen und sie in ihrer Majestät sehen durften. An diesem Tag, wenn die Alte sich zeigte, wie sie sich sonst nicht zeigen durfte, blieben ihrem Erben und Enkel die Türen ihres Hauses fest verschlossen.
17. Kapitel
Manisch arbeitete in der Bezirksstadt. Er trug Verantwortung und fühlte sich überhaupt noch nicht fähig, sie zu tragen. So gut es ging, versuchte er zwar, ihr gerecht zu werden, aber eines Tages fiel er plötzlich um. Der Arzt stellte einen viel zu hohen Blutdruck fest. Wenn Sie so weitermachen, kriegen Sie bald einen Gehirnschlag, drohte er und brachte Manisch, der gerade fünfundzwanzig Jahre alt war und Vater eines Sohnes, mit seiner Direktheit zur Verzweiflung.
Im Krankenhaus lernte Manisch, wie er Dinge, die ihn belasteten, so von sich fernhalten konnte, dass sie keine Folgen mehr für ihn hatten. Es dauerte ein paar Jahre, bis er tatsächlich gelassener wurde, freier, und es ihm gelang, stärker seinen Willen einzusetzen und zu handhaben. Er war überzeugt, in eine Situation wie die, mit der er gerade fertig wurde, niemals mehr zu kommen.
Aber dann kam es anders. Er sollte Soldat werden. Am Morgen des Tages, an dem er vor der Musterungskommission erscheinen musste, überwand er seinen Widerwillen und trank hintereinander zwanzig Tassen starken, bitteren Kaffee. Ihm wurde übel. Sein Herz raste. Vor den Augen tanzten rote und blaue Kreise.
Wie kann man mit einem solchen Blutdruck überhaupt leben und arbeiten, stellten die Ärzte fest. Das ging Manisch nichts an. Stumm ließ er die Untersuchungen über sich ergehen. Als er wusste, dass er Sieger sein würde, triumphierte er nicht. Nur verwundert war er und zugleich ein bisschen erschrocken darüber, wie schnell es ihm gelungen war, die unbestechlichen Ärzte zu überrumpeln und hinters Licht zu führen.
Ehe ihm der Leiter des Wehrkreiskommandos, ein für seine Jahre schon zu stämmiger und fetter Oberstleutnant, einen Schein überreichte, sagte er: Sie haben das seltene Glück oder Pech, wie Sie wollen, ausgemustert zu werden.
Manisch dachte an seine Frau, die froh sein würde, an seine Mutter, von deren Angst um ihn er wusste, an seine Großmutter vor allem. Für immer, fragte er fast ungläubig.
Für immer und ewig! Der Oberstleutnant wischte die Hände an der Uniform ab, als hätte er etwas Schmutziges berührt. Er rieb einen Moment, bevor er sagte: Selbst wenn dieses Land in Verteidigungsbereitschaft versetzt werden sollte, was niemand wünschen kann, wird man Sie nicht einziehen!
Mit vor Aufregung zitternden Händen legte Manisch den Ausmusterungsschein, dieses kostbare Dokument, zu anderen Papieren und Ausweisen in die Brieftasche. Als er die in seine Jacke steckte, begann er sich schon zu fragen, wie die Alte wohl reagieren würde, wenn sie erführe, was geschehen war.
18. Kapitel
An diesem Tag wurde er sich seines Zwiespaltes zum ersten Mal deutlich bewusst. Aus einem Instinkt heraus begriff er: Er war der Erbe der Alten und würde ihr folgen. Sosehr sie sich noch dagegen sträubte, ihm die Geheimnisse zu übergeben, die Bücher, in denen geschrieben stand, was ihm Macht verleihen würde, die Krone, das Zepter, die Diademe und den Hermelinmantel, es nützte ihr nichts, am Ende musste das alles doch ihm gehören.
Verwirrt und aufgewühlt lief er in die Gaststätte, wo seine Frau auf ihn wartete. Nur ein Wort, das ihm in diesem Augenblick das wichtigste war, sprach er noch aus, dann fiel er ihr um den Hals, und sie pressten sich aneinander, bis sie keine Luft mehr kriegten.
Von nun an hatten sie ein Geheimnis. Geheimnisse zu hüten konnte schwierig sein und oft genug belastend, aber das wusste noch keiner von ihnen. Es folgte eine gute Zeit, die beste in ihrer Ehe. Bald wurde ihr zweiter Sohn geboren.
Manisch vermied, die Alte aufzusuchen. So erfuhr er nicht, dass sie beschloss, einen seiner Söhne zu ihrem Erben zu ernennen, und sich vornahm, am Leben zu bleiben, bis dieser Sohn erwachsen genug und bereit wäre, wirklich ihr Erbe zu sein.
Keiner in ihrer Familie hatte je seine Verantwortung gegenüber Volk und Königtum missbraucht. Alle Rechte und Pflichten waren Gesetz. Jeder hatte sich daran gehalten und die Notwendigkeit anerkannt. Hätten sie es nicht getan, wären die Geheimnisse längst gestorben und für immer tot. Aber sie lebten ebenso wie der König, und wenn der König am Leben war, konnte das Volk nie sterben!
Die Alte war lange genug auf der Welt, um zu erkennen, wie sehr Manisch ihr ähnelte. Nur ihre Härte, Strenge und Tiefe fehlten ihm und damit fast alle Voraussetzungen, zu werden wie sie. Wenn sie an die Zukunft dachte und verzweifelt überlegte, was sie tun sollte, war sie nicht mehr sicher, ob es richtig war, weiter zu überleben.
19. Kapitel
Manisch wusste, dass seine Mutter ihn vergötterte. Obwohl ihre Liebe manchmal etwas Erdrückendes hatte, wagte er nicht, sich ihr zu entziehen. Er tat, was er konnte, um die Mutter nicht zu verletzen. Fast an jedem Sonntag kam sie zu Besuch. Sie aß bei ihnen Mittag und blieb meistens bis zum Abend. Zwischen ihr und der Frau gab es keine besonderen Probleme.
Alles war einfach, durchschnittlich und überschaubar. Manisch fuhr jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit. Er war Buchhalter mit der Aussicht, später Hauptbuchhalter zu werden. Manchmal jedoch, wenn er über sich und sein Leben nachdachte, schien ihm, als wäre in ihm verborgen noch ein ganz anderer. Häufig spürte er die ungewisse Leere. Zweifel und Ängste füllten ihn immer mehr aus, und das Erstaunen darüber wurde zur Furcht, in seinem Leben noch nichts erreicht zu haben.
Tatsächlich fühlte Manisch sich längst ohnmächtig gegenüber diesem anderen, das er noch nicht benennen konnte. Er las viel und fing zaghaft an, erste Geschichten zu schreiben. Durch das Schreiben erkannte er sich mehr, als es im Zusammensein mit anderen Menschen der Fall war. Obwohl Manisch nie Krieg erlebt hatte, waren es gerade die Bücher über Kriege, die ihn am meisten anzogen, beschäftigten und beeindruckten.
20. Kapitel
Das ist deine Sache, hörte Manisch seinen älteren Sohn sagen. Er wusste, die Söhne meinten: Was geht uns an, wie du aufgewachsen bist, wen interessiert denn, ob du einen Vater gehabt hast. Wir müssen mit dir auskommen, und das ist schwer genug. Du weißt zuviel von uns, und je mehr du über dich selber erfährst, desto schwieriger wird es, mit dir umzugehen!
Manisch sah von unten hoch und versuchte, kühl und ruhig zu sein. Doch dann konnte er sich nicht mehr beherrschen. Mit der flachen Hand schlug er auf den Tisch und fuhr den Sohn an: Das ist eben nicht nur meine Sache!





























