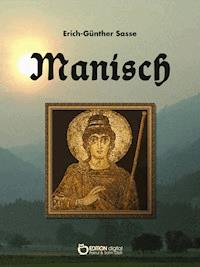8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman beginnt verdammt düster, damals im Herbst des Jahres Neunzehnhundertsechsundvierzig, am zehnten November, einem Freitag. An diesem Herbsttag, der hell und kalt war, lag die Welt still und verlassen. Die Männer hatten so viel erlebt, dass sie nichts mehr aus der Fassung bringen konnte. Der Krieg war schon anderthalb Jahre vorbei. Gefühle, die verschüttet waren und für immer verschwunden schienen, brachen hervor. Die Männer schwiegen. Das Pferd kaute trockene Grashalme und kratzte manchmal mit seinem Huf die Erde. Der jüngere Mann blickte dorthin, wo Himmel und Erde zusammenstießen. Er sah nur einen schwarzen Punkt, der seine Aufmerksamkeit fesselte, als er größer wurde. Auf einmal waren es zwei Punkte. Der jüngere Mann entdeckte, dass eine Frau und ein Kind etwas hinter sich herschleppten, das wie ein Handwagen aussah. Bevor er etwas sagen konnte, sagte der ältere: Ach du lieber Gott, noch welche, die unterwegs sind, wird Zeit, dass sie unterkommen! Ihnen war eine junge Frau entgegengekommen, mit einem Kind neben sich. Beide sahen furchtbar aus, waren schmutzig und in Lumpen und voller Angst. Sie müssen viel durchgemacht haben. Die beiden Ankömmlinge sind die 23-jährige Gräfin Eva von Kutschberg-Hohenau und ihre vierjährige Tochter Astrid. Um ihretwegen lebt sie überhaupt noch. Sie finden Unterkunft auf dem Hof der alten Frau Reimann in einem Dorf bei Magdeburg. Die Gräfin ähnelt auf seltsame Weise ihrer eigenen Tochter, die todkrank ist. Von jetzt an nennt sich die Gräfin Eva Krüger. Sie hatte ihren alten Namen weggegeben – nun eine Frau ohne Herkunft und Abstammung. Ein ganz neues, ganz anderes Leben hatte begonnen. Ja, Eva Krüger war mit ihrem Leben zufrieden. Auf eine ganz bestimmte Art war sie vielleicht sogar glücklich. Nachdem zunächst die Tochter von Frau Reimann stirbt und etwas später auch Frau Reimann selbst, heiratet Eva Krüger im Sommer des Jahres 49 den verwitweten Mann von Frau Reimanns Tochter, wird zu Frau Meyer und damit zugleich zur Hofbesitzerin. Meyer und Eva Krüger heirateten schon im Juli. Der Weizen war noch grün, aber die Frühkartoffeln starben schon ab. Es war ein heißer Tag. Als sie mit der Kutsche zum Standesamt nach W. fuhren, stand die Sonne hoch an einem blauen wolkenlosen Himmel. Doch die Zeiten ändern sich. Neue Zeiten brechen an, die Eva nicht mehr ganz begreifen kann. Nachdem sie noch einen Coup in West-Berlin gelandet hat, zieht sie sich in die Bibliothek des Hofes und in ihre ganze eigene Welt zurück
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Erich-Günther Sasse
Abgefunden oder Das Siegel
Roman
ISBN 978-3-86394-754-5 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1986 im VEB Hinstorff Verlag Rostock.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Auf dass Du daran gedenkest, und Dich schämest, und vor Schande nicht mehr Deinen Mund aufthun dürfest; wenn ich Dir alles vergeben werde, was Du gethan hast ...
Hesekiel 16,63
Es war noch nicht Mittag an diesem Tag im Spätherbst, als die Männer auf dem abgeernteten Rübenfeld standen und über die schlimmen Zeiten redeten, aber auch darüber, dass es nun wohl doch weitergehen werde.
Hoffentlich, sagte der ältere, ein bisschen schwerfällige, und biss von seiner Klappstulle ab, während der jüngere mit der Stiefelspitze Löcher in die Erde bohrte und dem braunen Pferd die Blesse auf der Stirn streichelte.
An diesem Herbsttag, der hell und kalt war, lag die Welt still und verlassen. Die Männer hatten so viel erlebt, dass sie nichts mehr aus der Fassung bringen konnte. Der Krieg war schon anderthalb Jahre vorbei. Gefühle, die verschüttet waren und für immer verschwunden schienen, brachen hervor.
Die Männer schwiegen. Das Pferd kaute trockene Grashalme und kratzte manchmal mit seinem Huf die Erde.
Der jüngere Mann blickte dorthin, wo Himmel und Erde zusammenstießen. Er sah nur einen schwarzen Punkt, der seine Aufmerksamkeit fesselte, als er größer wurde. Auf einmal waren es zwei Punkte. Der jüngere Mann entdeckte, dass eine Frau und ein Kind etwas hinter sich herschleppten, das wie ein Handwagen aussah. Bevor er etwas sagen konnte, sagte der ältere: Ach du lieber Gott, noch welche, die unterwegs sind, wird Zeit, dass sie unterkommen!
Er faltete das Brotpapier zusammen und steckte es in die Joppentasche. Dann zog er dem Pferd das Geschirr zurecht und legte ihm die Leine über den Hals. Er blieb stehen und sah auf die Frau, die sich langsam näher schleppte. Sie schien uralt zu sein, ihre Bewegungen waren müde und kraftlos, das Gesicht wirkte unnatürlich blass und starr. Sie hielt den Kopf gesenkt. Als sie die Männer entdeckte, zuckte sie zusammen und wollte weglaufen. Die Frau trug ein Lumpenkleid, das aus Säcken zusammengenäht war. Sie hatte nackte Beine, die Füße steckten in halbhohen Lederschuhen. Die Männer hörten ihre Stimme, die ängstlich war, zugleich aber voller Härte, leise fragen: Kann ich vielleicht hier irgendwo unterkommen? Mit einem Ruck drehte die Frau sich um, als fürchte sie, verfolgt zu werden. Dann blickte sie die Männer an, ihre Augen waren groß und kalt.
Der jüngere Mann musterte die Frau, wie sie dastand, die Lumpen, die groben schmutzigen Schuhe, er sah, dass die Frau sehr jung war, und etwas erschütterte ihn, dass er dachte: Großer Gott, wie viel muss die durchgemacht haben, um so runterzukommen. Etwas zwang ihn, seine Hand auszustrecken und dem Kind, das ihn mit neugierigen, furchtlosen Augen anstarrte, über den Kopf zu streichen. Als die Frau das merkte, knurrte sie böse und zog die Oberlippe hoch. Es schien, als fletschte sie die Zähne. Plötzlich riss sie das Kind an sich und presste es gegen ihren Leib. In ihren Augen war ein Ausdruck, dass der jüngere Mann zurückwich: Aber ich wollte doch nur ...
Der ältere Mann wartete.
Die Frau beugte sich über das Kind, in ihren Augen war dieses Flackern, Furcht und Drohung zugleich.
Dem jüngeren schien es, als ähnelte dieses armselige, heruntergekommene Wesen einer anderen, die in ihrem verdunkelten Zimmer lag und nicht mehr wusste, wer sie war, dass sie ein Kind gehabt hatte und schon überhaupt nicht, dass sie bald sterben würde.
Nein, sagte der ältere abweisend, wir haben auch kein Unterkommen. Was denken Sie, wie viele schon hier waren! Er bückte sich und befestigte das Pferd mit Ketten am Pflug.
Bitte, sagte die Frau leise und senkte den Kopf. Sie wusste nicht, was es war, das sie ausgerechnet jetzt bitten ließ. So oft auf ihrem langen Weg hatte sie fremde Menschen angefleht, dass sie es nur noch mit größter Anstrengung tun konnte.
Weil hier etwas anders zu sein schien, wiederholte sie: Bitte, wir wissen nicht, wo wir bleiben sollen!
Der jüngere Mann spürte den Gestank, der von ihr ausging. Er trat ein paar Schritte zurück, sah wieder die Lumpen und die groben Schuhe an den schmutzigen Beinen, er sah aber auch das Kind, das ihn aufmerksam und überhaupt nicht ängstlich anblickte. Da fühlte er eine Scham, deren Ursprung ihm rätselhaft war. Ihm war, als wäre er verantwortlich für das, was aus der Frau und dem Kind würde. Er erschrak.
Der ältere Mann legte sich die Leine über den Rücken und klatschte sie dem Pferd auf die Kruppe. Er schnalzte mit der Zunge. Das Pferd zog an, und der Mann drückte mit seinem ganzen Gewicht auf den Pflug. Hü! rief er. Die Rufe wurden schnell leiser und waren bald überhaupt nicht mehr zu hören.
Nein, sagte der jüngere Mann und starrte auf die braune Erde, wo Rübenblätter herumlagen, ein Unterkommen haben wir wohl nicht, aber vielleicht könnten Sie mit uns essen!
Essen, die Frau warf mit einem Ruck den Kopf nach hinten, essen, stieß sie hervor, und dann?
Der Mann spürte ihre Furcht und Verachtung. Er wusste, was die Frau meinte, und fühlte sich ertappt. Wieder war da das Gefühl der Scham. Die Frau stieß ihn ab, aber in ihm war auch dieses andere, das immer stärker wurde.
Als die Frau ihr Kind losließ und sich vor den Handwagen spannte, um mit müden, kraftlosen Bewegungen weiterzuziehen, dachte der Mann: Was geht ihr mich an!
Er nahm sein Fahrrad, das am Feldrand lag, warf noch einen Blick auf den älteren Mann, der das andere Ende des Feldes pflügte, und setzte sich auf das Rad. Er fuhr hinter der Frau her, die schon ein Stückchen weg war, und erinnerte sich an seine Frau, daran, wie sie ausgesehen hatte früher, und ihm fiel ein, dass ihr Kind schon fast ein Jahr alt wäre. Er rief: Warten Sie doch, vielleicht lässt sich irgendwas für Sie finden! Warten Sie doch, rief er noch mal. Er ärgerte sich, dass seine Stimme so bittend klang.
Worauf? Die Frau zerrte den Handwagen und das Kind weiter.
Der Mann fuhr voraus und bestimmte: Los, kommen Sie mit! Dann stieg er vom Fahrrad.
In ihren Augen, die ihn verwundert ansahen, entdeckte der Mann ein Flackern, das Furcht war, zugleich Hass und Verachtung. So trostlos hatte ihre Stimme geklungen, dass er sich an seinem Fahrrad festhielt und zu frieren begann. Auf einmal wusste er, dass er schon längst Verantwortung übernommen hatte.
Das Kind sah ihn neugierig und überhaupt nicht ängstlich an, und dem Mann war klar, dass er die Verantwortung tragen wollte. Er ging neben dem Handwagen her, der tief einsackte, und manchmal, wenn die Frau sich besonders anstrengen musste, fasste er mit zu. Er schob den Wagen den Hügel hoch und auf die Straße bis zu den ersten Häusern.
So kamen die Frau und ihr Kind in das Dorf.
2. Kapitel
Das Dorf sah aus wie die anderen Dörfer in dieser fruchtbaren Gegend: Große Höfe drängten sich um Kirche und Friedhof, alles war alt und grau, auch die Ziegeldächer und geputzten Fassaden, und so ineinander verschachtelt, dass es für Fremde lange schwer war, sich zurechtzufinden. Die Leute lebten nicht schlecht. Seit Jahrhunderten hatten sie den Boden bearbeitet, Häuser gebaut und Ställe für ihr Vieh. Eine Generation war der nächsten gefolgt, und alle strebten danach, das Ererbte zu vermehren. In seinen Ansprüchen war man bescheiden, aber was man brauchte, hatte man.
Geradeaus, bestimmte der junge Mann. Hin und wieder streifte sein Blick die seltsame Frau, die er da anschleppte. Sie war das Gewöhnlichste und Schmutzigste, was er jemals gesehen hatte. Noch nie war ihm ein Mensch begegnet, der so widerlich stank.
Er sah auf ihre blonden Haare, die struppig und ungekämmt vom Kopf abstanden, und dachte: Ob sie Läuse hat? Bestimmt. Er schüttelte sich: Hoffentlich sieht mich keiner mit ihr!
Gerade in diesem Moment entdeckte er auf der anderen Straßenseite die Schwiegermutter des Lehrers. Sie wusste alles und kümmerte sich um das Neueste. Mit dem Handfeger kehrte sie Pferdeäpfel zusammen. Der junge Mann merkte, dass die alte Frau ihn beobachtete, er blickte schnell auf eine Hauswand. Er fühlte sich nicht wohl in seiner Haut und hatte Furcht. Seine eigene Furcht widerte ihn an. Schnell ließ er den Handwagen los, senkte den Kopf und sah nicht mehr auf. Dann dauerte es ihm zu lange. Er fasste wieder zu und schob den Wagen kräftig. Er hörte die Frau keuchen und bestimmte: Rechtsrum!
Sie fuhren durch das geöffnete Tor auf den Hof, der ein geräumiges Viereck war. Ackerwagen standen dort, und auf dem Misthaufen scharrten Hühner. Ein Hund kam gelaufen.
Der Mann streichelte ihn. Dann stieß er ihn von sich, sprang die Treppe hoch und lief ins Haus.
Die Frau holte tief Luft, stellte sich gerade hin und rieb ihren schmerzenden Rücken. Sie sah die Ställe und Scheunen und erinnerte sich an etwas, das so ähnlich ausgesehen hatte, nur viel größer, vielleicht war ihr das auch nur so vorgekommen, denn sie war lange ein kleines Mädchen gewesen.
Sie stand ganz still, und Sehnsucht überfiel sie. Sie sehnte sich nach einem Zuhause. Von ihrem wusste sie nicht einmal mehr, wo es gelegen hatte.
Vor anderthalb Jahren hatte ihre Flucht in die fremde Welt begonnen. Sie hatte damals nicht geahnt, was an Schrecklichem ihr auf diesem Weg begegnen würde. Sie rief das kleine Mädchen, das mit dem Hund spielen wollte, und presste es an sich. Aber es riss sich los und lief dem Hund hinterher.
Die Frau sah dem Kind nach. Sie ärgerte sich und wurde wütend. Ein paar Leute umstanden sie im Halbkreis und kamen näher, die Frau spürte deren mitleidige, schamlose Blicke und schrie: Was guckt ihr so, habt wohl noch keinen Menschen gesehen!
Die Leute lachten und redeten. Die Frau lehnte die Arme gegen die Hauswand und legte den Kopf darauf. So stand sie und hätte sich am liebsten irgendwo verkrochen.
Endlich rief eine Männerstimme: Frau, kommen Sie doch mal her!
Es dauerte eine Weile, bis sie begriff, dass sie gemeint war. Sie sah hoch und erkannte auf der Treppe den jungen Mann. Neben ihm eine ältere Frau, die ein schwarzes Seidenkleid anhatte und Ringe an den Fingern trug.
Die ältere Frau rief den anderen etwas zu, und die junge Frau sah, dass die Leute sich auf dem Hof verstreuten.
Sie machte ein paar Schritte zu ihrem Handwagen hin, stolperte und wäre fast gefallen. Dann griff sie die Hand ihrer Tochter und drückte sie. Sie wollte gehen, hörte, wie der junge Mann der älteren Frau etwas zuflüsterte und bemerkte, dass beide sehr erregt waren. Sie spürte, dass es um sie ging, und wunderte sich, dass man sie hier nicht vor die Tür warf, nicht mit Füßen nach ihr trat. Sie fing an zu weinen, presste die rechte Hand an die Augen und holte tief Luft. Es war gleich vorbei.
Auf einmal hatte sie Hoffnung, zugleich fürchtete sie sich davor, enttäuscht zu werden. Sie dachte: Bevor ich gehen muss, gehe ich lieber selber!
Sie nahm die Deichsel des Handwagens, doch der Blick der älteren Frau, der nicht schamlos war wie die Blicke der anderen vorhin, dieser Blick zwang sie, stehen zu bleiben. Sie sah die ältere Frau dem jungen Mann zunicken und hörte ihn wieder rufen: Frau, kommen Sie doch mal her!
Als sie sich nicht rührte, kam ein junges Mädchen die Treppe herunter und sagte: Sie möchten mir bitte folgen.
Wohin folgen, dachte sie, sie hatte das Bitte gehört, und auf einmal wusste sie, dass es so schlimm, wie es gewesen war, nicht werden würde. Sie fasste fest die Hand ihrer Tochter. Langsam stiegen sie die Treppe hoch. Als sie an der alten Frau vorbeigehen wollten, fragte die mit leiser, zittriger Stimme: Wie heißen Sie?
Die junge Frau blieb stehen. Eva, sagte sie.
Eva, wiederholte die ältere Frau. Wie weiter, fragte sie und kreuzte die Arme vor der Brust.
Die junge Frau antwortete nicht. Sie hob die Schultern und ließ sie wieder fallen. Die ältere Frau fragte nichts mehr, musterte die Frau vor sich und blickte sie traurig an.
Eva wartete. Sie sah auf den jungen Mann. Er hatte blaue Augen und knochige entschlossene Züge, über seinen Lippen trug er ein kleines Bärtchen.
Eine Uhr schlug laut und lange. Eva dachte nichts dabei. Sie war müde. Am liebsten hätte sie sich hier irgendwo hingelegt, um nie mehr aufzustehen. Doch sie musste auf ihre Tochter achten. Astrids wegen hatte sie das alles ertragen. Ihretwegen lebte sie noch.
Sie presste Astrids Hand. Das kleine Mädchen sagte aua! und versuchte, sich mit heftigen Bewegungen zu befreien.
Bevor sie ins Haus gingen, fragte Eva das junge Mädchen: Was ist heute für ein Tag?
Ehe das junge Mädchen antworten konnte, sagte die ältere Frau: Wie bitte? Sie sollten uns nicht zum Narren halten!
Auf ihrer Stirn entdeckte Eva viele senkrechte Falten. Ich halte Sie nicht zum Narren, sagte sie leise.
Eva konnte kaum noch stehen, ihre Füße schmerzten. Sie senkte den Kopf und sah an sich hinunter. Jetzt erst fiel ihr auf, dass sie Lumpen trug. Hier auf dieser Treppe vor dem grau geputzten Haus wurde ihr klar, dass sie von einem Tag zum anderen gelebt hatte, ohne ein Gefühl für die Zeit, nur getrieben von dem Willen zu überleben.
Nun spürte sie den Gestank. Widerlich, dachte sie, wie ich stinke, ist ja widerlich! Sie trat ein paar Schritte von der Frau zurück. Aus Angst, man könnte sie doch wieder wegschicken, sagte sie: Ich weiß es wirklich nicht!
Die alte Frau warf ihr einen misstrauischen Blick zu. Weil sie nicht wusste, was sie sonst sagen sollte, antwortete sie: Heute ist der zehnte November neunzehnhundertsechsundvierzig, ein Freitag! Sie schüttelte den Kopf. Dann verschwand sie schnell hinter einer der Türen.
Der junge Mann lief auf den Hof, wo er etwas zu den Leuten sagte. Als sie hinter dem jungen Mädchen die Treppe hochstiegen, dachte Eva: Anderthalb Jahre!
Sie spürte die Wärme im Flur, wollte, dass auch ihre Tochter dies merkte und sagte: So schön warm hier! Astrid nickte.
Dann traten sie in die Dachkammer, deren Tür das junge Mädchen geöffnet hatte.
Eva hielt Astrids Hand fest. So standen sie einen Moment. Das junge Mädchen schloss die Tür.
Eva ließ die Hand ihrer Tochter los und fiel auf das Bett. Als sie sich unter den dicken schweren Federbetten verkroch, war sie voller Hoffnung, dass nun nichts Schlimmes mehr geschehen würde, dass alle diese Dinge für immer hinter ihr lägen.
Sie gähnte und kuschelte sich an Astrid.
So kamen sie in das Haus.
3. Kapitel
Eva schlief nicht. Vielmehr befand sie sich in jenem seltsamen Zustand zwischen Schlaf und Wachsein, der einer Bewusstlosigkeit gleicht. Alles in ihr war gespannt und voller Furcht, man könnte sie doch noch verjagen. Oder ein Mann käme, um ihr etwas anzutun. Sie sah die Gegenstände in der Dachkammer genau, aber es gelang ihr nicht, richtig wach zu werden. Sie wartete, doch es passierte nichts.
Endlich klopfte jemand gegen die Tür. Evas Bewusstsein kehrte zurück, die Furcht, wieder könnte Schlimmes geschehen. Es war ein heller Morgen.
Jemand öffnete die Tür, eine Frauenstimme sagte: Na, ausgeschlafen!
Eva schreckte zusammen. Sie hockte im Bett und presste den Rücken gegen das harte Holz. Langsam kam sie zu sich und merkte, dass Astrid neben ihr ruhig schlief. Dass schon anderthalb Jahre nicht mehr geschossen wurde, hatte man ihr gesagt, aber sie konnte es nicht glauben.
Nun dachte sie: Wenigstens hatten wir diese Nacht ein Dach über dem Kopf und brauchten nicht frieren!
Sie erinnerte sich, wie sie in das Haus gekommen waren, und erkannte die Frau in der Tür als diejenige, die sie in die Dachkammer gebracht hatte.
Gestern hatte sie ein junges Mädchen gesehen, nun bemerkte sie, dass die Frau mindestens fünfzig war.
Eva setzte sich zurecht. Sie legte die Arme um die Knie und richtete sich auf. Sie fühlte sich zerschlagen, und ihr wurde bewusst, dass ihr Geist sie genarrt hatte. Erstaunt sah sie die Frau an und dachte: Bin ich denn verrückt?
Nein, ich darf nicht verrückt sein!
Frau Reimann möchte, dass Sie in einer halben Stunde in die Bibliothek kommen! Die Frau ging und schloss die Tür hinter sich.
Eva sah ihr nach und erinnerte sich an die alte Frau, die gestern mit ihr auf der Treppe gesprochen hatte. Reimann also hieß diese Frau. Ihr fiel ein, dass sie in einem großen Haus war, auf einem Bauernhof mit Scheunen ringsherum und Ställen, in denen Vieh gehalten wurde. Alles war viel kleiner als dort, woher sie kam, aber eine Bibliothek hatte es dort auch gegeben.
Ich komme! Eva wusste, dass die Frau es nicht mehr hören konnte. Sie hob ihre Beine aus dem Bett und kauerte sich auf den Rand. Dann beugte sie sich zu Astrid hinunter, streichelte deren Gesicht und küsste sie leicht, das tat ihr gut.
Sie zog die Bettdecke über Astrid und begann sich zu waschen. Auf dem Boden sah sie Lumpen, starrte darauf und begriff, dass es die Sachen waren, die sie so lange getragen hatte.
Auf dem Tisch entdeckte sie saubere Wäsche, daneben eine blau geblümte Kittelschürze, ein Kopftuch und dicke Wollstrümpfe. Als sie die über ihre Beine zog, fühlte sie sich so, dass sie ein Lied summte. Sie sah in den Spiegel, und das Summen verging ihr, als sie die fremde Frau vor sich erblickte: ein bis auf die Knochen abgemagertes Geschöpf.
Dieses Geschöpf war ein rundliches Mädchen gewesen, das freundlich in die Welt sah, die ihm nichts Böses getan hatte. Aber die Frau im Spiegel, mit den blassen starren Zügen, den tief liegenden flackernden Augen, war auch sie.
Eva strich mit den Fingerspitzen über ihr Gesicht und dachte: Vor drei Wochen war ich dreiundzwanzig!
Sie versuchte den Kamm durch die verfilzten Haare zu zerren. Als es schmerzte, hörte sie auf und band das Kopftuch um. Dann öffnete sie vorsichtig die Tür und schloss sie leise hinter sich. Sie lief durch einen hohen Flur, in dem es warm und halb dunkel war, stieg die Holztreppe hinunter in einen anderen Flur, dessen Wände und Decken über einem grünen Sockel mit Pflanzen und Tieren bemalt waren; ein Schwan tauchte seinen Hals in blaues Wasser.
Die Frau, die sie vorhin geweckt hatte, kam aus der Küche: Guten Morgen!
Als Eva nicht antwortete, musterte die Frau sie kurz, öffnete eine Tür: Bitte, treten Sie ein!
Wie? Eva blieb stehen.
Bitte, wiederholte die Frau und musterte sie länger.
Bitte, dachte Eva, wenn sie es doch noch einmal sagen würde. Sie überlegte, weshalb man sie wohl in das Haus genommen und ihr Wäsche gegeben hatte. Eva merkte, dass ihr Kopf zu schmerzen anfing und trat in das Zimmer.
Dort blieb sie einen Moment stehen. Als ihre Augen sich an das dämmrige Halbdunkel gewöhnt hatten, sah Eva, dass der Raum sehr groß war. An seinem anderen Ende, genau gegenüber der Tür, brannte ein kleine Stehlampe, in deren Licht eine Frau saß. Es war die, mit der sie auf der Treppe gesprochen hatte. Ihr fiel ein, dass sie Reimann hieß. Wenn ich mich nun irre, dachte sie erschrocken und nahm sich vor, die Frau nicht anzusprechen.
Eva ging ein paar Schritte auf sie zu. Sie ahnte nichts davon, dass die Frau überlegte, ob es richtig war, die Fremde in ihr Haus genommen zu haben, oder ob es besser gewesen wäre, sie weiterlaufen zu lassen! Frau Reimann fühlte längst, dass da ein Mensch in Not war, und sie wollte helfen. Sie sah Eva vor sich stehen, dünn und schüchtern, unsicher lächelnd, und sie dachte: Nein, so ist es schon richtig! Sie hatte die Ähnlichkeit mit ihrer Tochter bemerkt und war erschrocken gewesen. Zugleich war ihr ein Gedanke gekommen ...
Bitte, sagte sie, und es ärgerte sie, so schnell dem Drängen des Schwiegersohnes und dem eigenen Gefühl nachgegeben zu haben. Sie nahm die Hand von dem Buch, das in ihrem Schoß lag.
Eva verstand, dass sie nähertreten sollte. Sie zitterte, ihre Knie schmerzten. Als sie auf die Frau zutrat, dachte sie: Wieso ist denn hier alles dunkel? An der Wand entdeckte sie einen hellen Lichtschein, dort schien ein Fenster zu sein. Wenigstens hatten wir die Nacht ein Dach über dem Kopf, dachte sie wieder und ging einen Schritt vor. Selbst wenn es so niedrig gewesen wäre, dass ich meinen Kopf daran gestoßen hätte, wir hatten es warm und waren sicher.
Eva hatte ihren Kopf nicht gestoßen, die Schmerzen kamen von den Ängsten und den Ängsten vor den Ängsten, die ja viel schlimmer waren, weil sie jeden Gedanken erstickten, jedes Gefühl abtöteten, jeden Schritt lähmten. Eva verschränkte die Arme vor der Brust.
Bitte, wiederholte die Frau, ihre Stimme klang ungeduldig, fast abweisend: Vielleicht setzen Sie sich endlich!
Eva konnte sich nicht rühren.
Wie ist Ihr Name? Die Frau klopfte mit den Fingern auf das Buch.
Eva, sagte die junge Frau leise. Sie würde verschwiegen sein, niemand sollte etwas von ihr erfahren, ihren Nöten und Ängsten. Wenn es sein müsste, würde sie schon einen Namen erfinden.
Den ganzen Namen! Die Finger der Frau trommelten auf das Buch.
Eva merkte, dass die Frau ihren Blick nicht lockerte. Sie schwieg und dachte: Niemals, ich kann nicht sagen, wer ich bin. Sie presste die Lippen zusammen, ich will doch bloß meine Tochter großziehen!
Sie starrte auf die weißen Finger der Frau, die immer heftiger auf das Buch trommelten, und erinnerte sich an die langen Monate, die sie durch das Land geirrt waren, niemals hatte jemand sie nach ihrem Namen gefragt, niemand hatte ihr je ein Dach über dem Kopf gegeben. Sie war Freiwild gewesen für Soldaten auf dem Heimweg, für Gestrandete, eine leichte Beute für Männer, die Brot hatten. Niemals hatte einer der vielen Männer ihren Namen wissen wollen.
Nicht einmal dies, dachte sie, hörte die Frau ungeduldig und schon ein bisschen wütend sagen: Ich habe nicht ewig Zeit! Ich möchte endlich Ihren Namen wissen!
Reicht es nicht, wenn ich Ihnen meinen Vornamen sage, fragte Eva leise.
Nein, Frau Reimann lachte ärgerlich auf, ich will doch wissen, wen ich in mein Haus genommen habe!
In mein Haus genommen, dachte Eva, nicht weggeschickt! Sie wusste, dass die Angst, ihren Namen zu nennen, stärker war als das Vertrauen, das sie der Frau entgegenbringen wollte. Ich heiße Eva und nichts weiter! Sie ärgerte sich, dass sie rot wurde und war froh über die Dunkelheit in diesem Zimmer.
Sie kann es ja nicht sehen, dachte sie, wenigstens kann sie das nicht sehen!
Sie wollen mir Ihren Namen wirklich nicht sagen? Die Frau legte das Buch auf das Tischchen neben dem Sessel. Rasch stand sie auf und strich ihr Kleid glatt. Dann machte sie ein paar Schritte auf Eva zu und hob die Hand.
Eva zuckte zusammen und duckte sich. Blitzschnell riss sie die Arme hoch und versteckte ihren Kopf. Nicht schlagen, wimmerte sie, bitte nicht schlagen!
Als sie merkte, dass die Frau sie nicht schlagen wollte, ließ sie langsam die Arme sinken.
Niemand wird Sie hier schlagen! Frau Reimann konnte vor Schreck kaum sprechen. Sie nickte und zog Eva auf einen Stuhl. Solange Sie unter diesem Dach sind, wird niemand Sie zu schlagen wagen, hier sind Sie in Sicherheit! Sie legte die Hand auf Evas Schulter.
Eva setzte sich gerade hin und hatte das Gefühl von etwas Wunderbarem. Sie spürte den Geruch der alten Frau und sah die Hand mit den Ringen unbeweglich liegen. Sie hörte die Frau wieder: Mein Name ist Reimann!
Die Frau ging ein paar Schritte und ließ sich in den Sessel fallen. Sie starrte Eva an.
Eva versuchte, an den Augen der Frau vorbeizusehen, doch es gelang ihr nicht. In ihrem Kopf ging alles durcheinander, sie wusste nur, dass sie ihren Namen nicht nennen durfte, auch nicht dieser Frau. Als Frau Reimann ihre Hand nahm, zuckte sie zusammen, sie musste schlucken. Sie wollte die Hand wegziehen, aber Frau Reimann hielt sie fest und forderte: Ihren Namen, jetzt, sofort!
Nein, dachte Eva, niemals, hier bin ich in Sicherheit. Wenn sie meinen Namen kennt, wird sie uns davonjagen, dafür sorgen, dass wir erschlagen werden, aber wenigstens Astrid soll leben! Ich habe keinen Namen, sagte sie schnell und presste die Lippen zusammen, dass kein Ton mehr herauskam.
Aber junge Frau, sagte Frau Reimann unwirsch, jeder Mensch hat einen Namen! Oder, sie zögerte, ist mit Ihrem so Schlimmes verbunden, dass Sie etwas zu befürchten haben?
Eva schüttelte den Kopf.
Frau Reimann sagte: Haben Sie vielleicht jemand bestohlen oder sogar umgebracht? Sie können mir doch nicht erzählen, Frau Reimanns Gesicht war verschlossen, Sie hätten nur Ihres Namens wegen etwas zu befürchten, das gibt es nicht!
Wenn Sie wüssten, was es alles gibt! Eva saß und schwieg. Sie blickte auf die Lampe mit dem Seidenschirm, dessen Farben verblasst waren, und wusste, dass die Frau sie zwingen konnte, alles von sich preiszugeben. Auf einmal hasste sie diese Frau Reimann, die in ihrem Zimmer saß, weitab von der Welt, ein Seidenkleid trug, satt zu essen und es warm hatte. Sie wünschte, endlich reden zu können, und wusste auch, dass die Frau sie nicht wegschicken würde, aber die Kehle war ihr wie zugeschnürt.
Sie klammerte sich an Frau Reimanns Hände, die warm und trocken waren, hielt den Blick auf die Ringe gerichtet und sagte gequält: Ich bin die Gräfin Eva von Kutschberg-Hohenau!
Als es heraus war, fiel sie fast vom Stuhl.
Die alte Frau zog ihre Hände weg. Eva war ohne Schutz. Sie fürchtete sich und fasste nach der Stuhllehne.
Frau Reimann griff hastig ein Buch und blätterte darin. Sie sprach nichts und glaubte diesem Wrack eines Menschen kein Wort, diesem hergelaufenen Weib, das frech behauptete, eine Gräfin zu sein. Sie lachte kurz und sagte: Dann bin ich vielleicht der Papst höchstpersönlich!
Ich bin die Gräfin Eva von Kutschberg-Hohenau. Die junge Frau brachte nur noch dies heraus.
Die alte Frau hielt das Buch fest. Sie überlegte, hatte aber schon beschlossen, auf der Hut zu sein. Und das soll stimmen, fragte sie.
Es stimmt! Die junge Frau wusste, dass es Zeit war zu gehen, doch ihr schien, die alte Frau wünschte, dass sie bliebe. Eva wollte bleiben können und war bereit, alles zu tun, was man von ihr verlangte.
Und Ihre Pläne, fragte die alte Frau, ich meine, spottete sie, jemand wie Sie müsste doch Pläne haben! Sie wollte grob sein zu der anderen und lachte höhnisch.
Pläne, dachte die junge Frau, Pläne ...
Sie war lange umhergeirrt, eine Beute für jeden, der auf diese Art Beute aus war. Nie in ihrem Leben hatte sie Pläne gehabt. Auf einmal war sie so voll Hoffnung, dass sie sagte: Pläne habe ich nicht! Sie lächelte und war froh, dass die alte Frau es nicht sehen konnte. Frau Reimann wollte sich nicht rühren lassen. Nach einiger Zeit fragte sie: Stimmt, was Sie eben gesagt haben, wirklich?
Was ich gesagt habe, ist die Wahrheit! Eva war schon sicher, dass die Frau sie nicht wegschicken würde, und sagte: Nun schicken Sie uns doch weg!
Darauf sagte die alte Frau nichts. Sie forderte: Weisen Sie sich aus!
Nein, sagte Eva. Aus Angst, man könnte erfahren, wer sie war, hatte sie alle Ausweise und Dokumente weggeworfen.
So kann ja jeder kommen! Für deine Gruselgeschichten, dachte Frau Reimann, mit denen du bloß Mitleid erregen willst, musst du dir schon andere, Dümmere, suchen, solche, die bereit sind, dein Zeug zu glauben, ich bin es jedenfalls nicht. Du bist nichts weiter als eine hergelaufene Schlampe, die nicht ganz richtig im Kopf ist. Du verdienst kein Mitleid! So dachte Frau Reimann und merkte erschrocken, dass sie der Fremden zu glauben begann.
Aber wieder war etwas in ihr, das sie zwang, immer noch vorsichtig zu sein. Sie stand auf und schaltete die Deckenlampe ein. Das Licht war hell und blendete Eva. Sie musste blinzeln. Als sie wieder gucken konnte, sah sie, dass Frau Reimann zwischen den Büchern herumkramte, von denen es unzählige in diesem Zimmer gab: Die Wände waren damit zugestellt, selbst auf Stühlen und Tischen lagen Bücher.
Frau Reimann kramte lange. Dann bedeutete sie mit einem Rucken des Kopfes, dass Eva sich setzen solle und setzte sich ebenfalls.
Dies, sie hielt das Buch so, dass Eva die schwarze Schrift auf dem hellen Pappeinband lesen konnte, ist ein Kalender der Gräflichen Häuser von neunzehnhunderteinundvierzig, die letzte Ausgabe. Wenn Sie die Wahrheit gesagt haben ... Sie blätterte. Endlich hatte sie gefunden, was sie suchte, sie war ganz ruhig.
Vielleicht, sie musterte Eva abschätzend, sagen Sie mir, wann und wo Sie geboren wurden!
Frau Reimann wollte der Frau zeigen, dass sie ihr haushoch überlegen war. Sie sah in das Buch und las. Sie erschrak und verbarg nicht, wie betroffen sie war, als sie erfuhr, dass Eva, die mindestens vierzig Jahre alt schien, in Wahrheit genauso jung war wie ihre, Frau Reimanns, Tochter.
Evas Gehirn begann zu arbeiten. Sie brauchte nicht lange nachdenken. Ohne zu stocken, sagte sie: 25. Oktober 1923, zwei Uhr nachmittags.
Um Gottes willen! Frau Reimann presste die Hand vor den Mund. Sie schluckte. Immer noch war sie misstrauisch. Für alle Fälle fragte sie Eva nach den Namen der Schwiegereltern, den Geburtstagen, dem Namen des Mannes. Eva beantwortete die Fragen genau. Sie wunderte sich darüber, wie es ihr gelang, in das Durcheinander Ordnung zu bringen.
Frau Reimann ließ das Buch sinken und fragte nach Evas Mann.
Er ist tot! Eva versuchte, an ihn zu denken. Sie erinnerte sich daran, dass er neunzig Anzüge besessen hatte und über zweihundert Krawatten, aber auch daran, dass er fast nur in Reithosen und Stiefeln herumgelaufen war und die meiste Zeit in Gesellschaft der Reitknechte verbracht hatte. Auch daran dachte sie, dass man ihr ein Gerücht zugetragen hatte. Der Mann war ihr viel zu gleichgültig gewesen, als dass sie sich deswegen besonders aufgeregt hätte. Dazu war sie zu stolz. Seit frühester Kindheit hatte man sie in dem Bewusstsein erzogen, dass ihre Familie zu den ersten Familien des Königreiches zähle. Es war natürlich, dass der Mann, den sie heiratete, ihrem Stand entsprach. Eva konnte sich nicht einmal mehr daran erinnern, wie er ausgesehen hatte.
Frau Reimann fragte sie weiter nach dem Namen des Vaters, sie blätterte Seiten um, fragte weiter nach dessen Titeln, dem Namen der Mutter, deren Lebensdaten, und die Gräfin Kutschberg-Hohenau, geborene Reichsgräfin Pleß-Carolath, war froh, endlich reden zu können und noch genug zu wissen, jede Frage zu beantworten. Endlich schlug Frau Reimann das Buch zu. Sie sah Eva nicht an und war etwas verlegen, als sie sagte: Sie werden verstehen, dass ich vorsichtig bin. Man erlebt heutzutage allerhand!
Was können Sie schon erlebt haben, dachte Eva. Sie ärgerte sich darüber und war froh, dass Frau Reimann gleich wieder sprach: Unter Ihrem Namen können Sie hier unmöglich leben. Ich schlage vor, dass Sie von jetzt an Eva Krüger heißen!
Von jetzt an, dachte Eva, von jetzt an! Dürfen wir bleiben, fragte sie leise.
Wenn Sie wollen, sagte Frau Reimann. Als sie das Buch zu den anderen Büchern stellte, hatte sie sich entschieden. Die fremde Frau ähnelte ihrer Tochter. Das war kein Zufall. Gott hatte ihr dieses Geschöpf geschickt, und sie würde es zu ihrer Tochter formen. Aber davon sollte Eva Krüger noch lange nichts erfahren.
Als Eva Frau Reimanns Hände fassen wollte, drehte die alte Frau sich weg und forderte: Kommen Sie!
Sie öffnete eine Tür und trat in ein völlig dunkles Zimmer.
Eva Krüger folgte ihr dorthin.
4. Kapitel
Angewidert nahm sie den Geruch wahr: ein Gemisch aus stickiger Luft, Urin und irgendwelchen Tropfen. Sie hörte Geräusche, von denen sie nicht genau wusste, woher sie kamen, wer sie verursachte und was sie zu bedeuten hatten. Es war ein Keuchen und Brabbeln, jemand knirschte mit den Zähnen.
Die alte Frau ging auf die Mitte des Zimmers zu. Groß und dunkel stand dort ein Sessel, in dem jemand saß. Ich möchte dir Frau Krüger vorstellen, sagte sie, sie wird sich um dich kümmern!
Die Geräusche hörten nicht auf.
Die Stimme der alten Frau klang nach unterdrücktem Weinen. Sie flüsterte: Geben Sie ihr die Hand!
Eva gab sich einen Ruck und trat auf den Sessel zu. Frau Reimann nahm Evas Hand und legte sie auf eine andere, die schlaff war und eiskalt. So erschrocken war Eva, dass sie die Hand wegriss und zurückwich.
Für einen Moment verstummten die Geräusche, es war still. Langsam gewöhnten sich Evas Augen an die Dunkelheit. Obwohl sie nur die Umrisse des Gesichts vor sich erkennen konnte, sah Eva, dass die Frau im Sessel sehr krank war. Sie überwand den Widerwillen und ging auf die Kranke zu.
Frau Reimann hatte es bemerkt. Sie bleiben doch, fragte sie lauernd, aber auch ein bisschen ängstlich.
Nicht einen Moment dachte Eva daran, dass sie tief gesunken sei, wenn sie bliebe. Wir haben wenigstens ein Dach über dem Kopf, dachte sie, niemand kann uns mehr was anhaben, und wo sollten wir denn auch hin!
Ja, ich bleibe, sagte sie leise und wusste, dass es wie ein Versprechen klang.
Eine angenehme Arbeit ist es nicht, sagte Frau Reimann.
Angenehm! Eva lächelte. War es vielleicht angenehm, durch eine fremde Welt zu laufen, Tausende von Kilometern, und zu betteln!
Eva, die gewöhnt gewesen war, dass man sie um etwas bat, dachte nun: Angenehm, so ein Wort! War ihr jemals etwas angenehm gewesen? Sie ärgerte sich, dass die alte Frau, die nicht zu wissen schien, was in der Welt vor sich ging, das Wort angenehm verwendete. Ja, ich bleibe.
Eva hörte Frau Reimann atmen und merkte Erleichterung in deren Stimme, als die sagte: Wir können reden, sie versteht uns nicht. Es war eine Fruchtwasservergiftung, das Kind ist tot!
Als die Kranke lauter brabbelte, beugte Frau Reimann sich zu ihr hinunter: Kind, du musst doch schlafen!
Sie forderte Eva Krüger auf, ihr zu folgen.
Sie gingen zurück in die Bibliothek. Eva atmete ein paarmal tief und hörte Frau Reimann sagen: Es ist nicht gerade angenehm!
Eva spürte, dass Frau Reimann sie spöttisch und traurig musterte, und der Blick der alten Frau machte auch sie traurig. Es ärgerte sie, weil sie sich wie ein Eindringling vorkam, wie die Mitwisserin eines Geheimnisses. Sie schwieg verlegen.
Die alte Frau setzte sich, nahm das Buch vom Tischchen, strich mit den Fingerspitzen über den Einband und sagte leise: Es war ein schwerer Schlag für mich. Ich weiß schon lange, dass sie bald sterben muss. Sie zog aus dem Ärmel des Kleides ein Taschentuch und strich über ihr Gesicht.
Eva wunderte sich über die Ruhe der Frau, die, bevor Eva sie noch etwas fragen konnte, sagte: Sie sollten nicht erstaunt sein, dass ich so spreche. Sie machte eine Pause. Ich kann so sprechen, weil ich genau weiß, dass meine Tochter sehr glücklich war!
Frau Reimann nahm ein Bild und reichte es Eva: Eine junge Frau, die lächelte und den Mann neben sich anstrahlte. Eva sah, dass es derselbe war, der sie ins Haus gebracht hatte. Sie konnte nichts Besonderes an der Frau finden und wusste nicht, woraus sie schließen sollte, dass diese Frau glücklich gewesen war, wie Frau Reimann beteuerte.
Mein Schwiegersohn, Frau Reimann stellte das Bild wieder auf das Tischchen. Ich bin ihm dankbar dafür, dass er alle Schicksalsschläge mit so großem Anstand trägt. Er ist jung, ich weiß, wie schwer es ihm fällt!
Frau Reimann räusperte sich: Ihm wird hier einmal alles gehören, Haus und Hof, selbst die Bücher. Er hat meine Tochter glücklich gemacht, dafür wird er belohnt!
Anstand, Eva Krüger grübelte, was versteht sie unter Glück? Eva konnte sich nicht erinnern, jemals glücklich gewesen zu sein. Sie war neidisch auf die Kranke, darauf, dass man diese Frau umsorgte und pflegte.
Sie sah, dass Frau Reimanns Finger, die immer wieder über den Rahmen des Bildes strichen, zitterten. Sie merkte, wie Frau Reimann sich beherrschte.
Weil es ihr peinlich war, zu sehen, dass die alte Frau weinte, wandte sie sich ab.
Es dauerte einen Moment, bis Frau Reimann wieder reden konnte. Dann sprach sie zu Eva über deren Aufgaben, auch über die Bezahlung.
Bezahlung? Eva glaubte sich verhört zu haben.
Bezahlung! wiederholte Frau Reimann, ich hoffe, es passt Ihnen so.
Bezahlung, fragte Eva Krüger nun doch.
Bezahlung, bekräftigte Frau Reimann, natürlich, Sie arbeiten doch bei uns, dafür müssen Sie bezahlt werden, wie sich das gehört! Sie schwieg. Kerzengerade saß sie auf ihrem Stuhl und warf einen misstrauischen musternden Blick auf Eva Krüger. Dann lachte sie trocken.
In einem Ton, der keinen Widerspruch duldete, bestimmte sie: Sie sollten sich die Haare waschen!
Was gehen sie meine Haare an, dachte Eva wütend und schwieg. Sie schwieg noch, als Frau Reimann aufstand und aus dem Schubfach eine Brennschere nahm, auch, als sie sagte: Ich wünsche, dass Sie sich anständig und sauber halten, wie es sich für eine Frau Ihres Alters gehört!
Eva Krüger nahm die Brennschere. Sie wollte etwas erklären. Aber als Frau Reimann ein Buch aufschlug, zu lesen begann und sich darin vertiefte, ging sie. Sie lief die Treppe hoch in die Dachkammer, wo sie die Brennschere auf den Tisch warf. Frau Reimanns Worte hatten sie verletzt. Sie weckte Astrid und half ihr beim Anziehen.
Am Abend schleppte sie Wasser nach oben und heizte den gusseisernen Ofen. Sie wollte sich hier einrichten. Es störte sie nicht, dass sie eine Arbeit machen musste, die sie noch vor zwei Jahren als die widerwärtigste empfunden hätte. Nun war sie Frau Reimann dankbar dafür, diese Arbeit tun zu können, und sogar froh, dass die Kranke ihre Hilfe brauchte.
Eva legte Kohlen in den Ofen. Dann goss sie Wasser in einen großen schwarzen Topf, von dessen Rändern die Emaille abgeplatzt war. Sie stellte ihn auf die Ofenplatte. Sie betrachtete die Lumpen auf den Dielen, nahm sie mit spitzen Fingern, steckte sie in den Ofen und sah zu, wie sie langsam verbrannten. Als es anfing zu qualmen, würgte und spuckte Astrid. Eva musste husten. Sie riss das Fenster auf, lief nach unten und holte aus der Küche noch zwei Eimer Wasser. Dann wusch sie Astrid, die sich in die Schüssel auf dem Boden stellen musste. Später zog auch sie sich nackt aus, seifte sich gründlich ein und spülte den Schaum mit klarem lauwarmem Wasser ab. Sie wusch sich so lange, bis sie zu frieren anfing. Vor dem halb blinden Spiegel trocknete sie sich die Haare. Dabei überkam sie ein Gefühl, das sie erschreckte. Sie wusste, was es war, und versuchte, es zu unterdrücken. Schnell redete sie irgendwas mit Astrid, die auf dem Bettrand saß und nicht verstand, weshalb die Mutter das Gesicht hinter dem Handtuch versteckte. Eva redete und redete. Nach einer Weile war es vorbei. Als sie das Handtuch an ein Gestell neben dem Ofen hängte, waren ihre Haare fast trocken.
Eva sah in den Spiegel und fand ihr Gesicht weniger starr, es erschreckte sie kaum noch, wie sie aussah. So kann ich mich wieder unter die Leute wagen, dachte sie und wusste, dass sie davor Angst hatte. Sie kämmte ihr Haar, das schon viel weniger stumpf war, und befestigte es an den Seiten mit Klemmen. Dann brannte sie sich mit der Schere ein paar Wellen. Zum Schluss machte sie Astrid Locken.
Nackt liefen sie in der Dachkammer herum und balgten sich, bis sie auf das Bett fielen. Als es krachte, lachten sie.
Später, als sie die Kammer aufgeräumt und das Wasser von den Dielen gewischt hatte, krochen sie unter die Decke. Astrid kuschelte sich an die Mutter, und sie waren so vertraut miteinander wie niemals vorher.
5. Kapitel
Eva versuchte sich zu erinnern. Sie war achtzehn Jahre alt, als sie ihre Tochter zur Welt gebracht hatte. Sie wusste nicht, wie sie schwanger geworden war. Ihr Bauch wurde dick und immer dicker, und plötzlich war das Kind da. Ehe Eva richtig begriffen hatte und aufnehmen konnte, wie es aussah, wurde es ihr schon wieder aus den Händen genommen. Zwei Kinderschwestern und drei Pflegerinnen kümmerten sich um die Tochter. Schon bevor Eva wieder auf den Beinen stand, war ihr, als hätte sie nie ein Kind gehabt. Erst auf der Flucht begann sie sich für das Kind verantwortlich zu fühlen, dafür, dass es satt zu essen hatte und nicht frieren musste. Sie war wie ein Tier, das sein Junges schützt, das, wenn sich jemand diesem Jungen nähern wollte, die Zähne bleckte.
Eva Krüger lag lange wach, sie sah auf das Stückchen schwarzen Himmel über dem Scheunendach. Sie fühlte sich allein und weckte die Tochter, der sie einschärfte, dass ihr Vater Walter Krüger geheißen habe, Landarbeiter gewesen und im Krieg gefallen sei.
Astrid gähnte und fragte, ob sie nun nicht bald wieder nach Hause käme, in ihr Schloss.
Nein, sagte Eva schroff.
Dann bin ich wohl keine Gräfin mehr, fragte Astrid.
Nein, sagte Eva.
Was bin ich dann, fragte Astrid.
Eva antwortete nicht. Sie wusste selbst nicht, warum sie nicht mehr die sein konnten, die sie so lange gewesen waren.
Astrid fing an zu weinen. Es dauerte eine Weile, bis sie sich beruhigt hatte. Sie rieb sich mit den Fäusten die Augen und fragte: Warum denn nicht?
Weil du leben sollst, sagte Eva. Sprich nie ein Wort darüber, zu keinem, nie ein Wort, verstehst du!
Astrid nickte. Ist es denn so schlimm, eine Gräfin zu sein, fragte sie.
Darauf konnte Eva nichts antworten. Sie wusste nur, dass sie schreckliche Angst hatte, und tat alles, zu verbergen, wie sie hieß. Sie war froh, nun einen Namen zu besitzen, der keine Gefahr bedeuten würde.
Astrid Krüger, sie wunderte sich, wie leicht ihr dieser Name schon von den Lippen ging. Walter Krüger, Landarbeiter und gefallen ...
Wiederhol das, forderte sie und fasste die Tochter bei den Armen. Und nun will ich nichts mehr davon hören! Eva sprang aus dem Bett und zog die Kittelschürze über. Dann goss sie das schmutzige Waschwasser in die Eimer und schleppte sie nach unten. In der Küche schüttete sie es in den Ausguss. Mein Mann hieß Walter Krüger, er war Landarbeiter und ist gefallen. Ich bin Witwe, dachte sie, und das war sie wirklich.
Sie lief wieder nach oben, setzte sich auf den Bettrand und zog Astrid die Decke zurecht.
Es war dunkel und still. Eva starrte auf den schwarzen Himmel. Sie sehnte sich nach etwas, aber sie wusste nicht genau, wonach.
6. Kapitel
Eva war die vierte Tochter des Königlich-Preußischen Obergewandkämmerers, der den Titel trug: Grand-maitre de la garderobe. Heinrich, Graf von Pleß-Carolath, zählte zu den obersten Chargen des Königlichen Hofes. Er war Träger des Roten Adlerordens, des Anhaltischen Ordens Albrechts des Bären, des Braunschweigischen Ordens Heinrichs des Löwen, des Sankt-Andreas-Ordens Zweiter Klasse von Großbritannien, des Philippordens von Hessen, des Königlich-Italienischen Höchsten Ordens der Verkündigung Zweiter Klasse, des Mecklenburgischen Hausordens der Wendischen Krone, des Ordens des Niederländischen Löwen, des Sterns von Rumänien, des Schwarzburgischen Ehrenkreuzes, des Ordens unser Lieben Frau von Montesa, den Alfons der Dreizehnte von Spanien ihm anlässlich eines Besuchs des Kaisers in Madrid verliehen, des Verdienstordens Nischani-Imtiaz, den ihm der ottomanische Großsultan Abdul Hamid der Zweite mit gichtigen Fingern an die Brust geheftet hatte.
Ihre Mutter war die Gräfin Agnes geborene Blücher von Wahlstatt, die in direkter Linie abstammte vom Königlich-Preußischen Feldmarschall Gebhardt Lebrecht Fürsten Blücher von Wahlstatt, demselben, der einem Franzosen aus Korsika sein Waterloo bereitet hatte.
Eva wurde in der Nähe von Tilsit geboren. Das Schloss Groß-Kossow lag in beträchtlicher Entfernung von dem Dorf, in dem die Diener und Gutsarbeiter wohnten; weitab von anderen menschlichen Behausungen stand es in einem geräumigen Park, der in einen riesigen dunklen Wald überging. Dieser Wald war das einzige, wovor das kleine Mädchen sich fürchtete.
Ihr Papa, der plötzlich ohne Aufgabe war und nun versuchte, sich um seine Güter zu kümmern und um Geschäfte, von denen er nicht die geringste Ahnung hatte, sah sehr gut aus in seinen Anzügen und Uniformen, die er zu den Gedenktagen der Familie und denen des preußischen Königshauses trug. An diesen Tagen legte er auch seine Orden an, sie nahmen sich prächtig aus auf seiner Brust, vor allem der Rote Adlerorden, den ihm Seine Majestät, Kaiser Wilhelm der Zweite, persönlich überreicht hatte. Das kleine Mädchen war lange nach seinen Schwestern geboren worden. Die Eltern waren in den Jahren, wo sie ihre Ruhe haben wollten. Die Mama zog sich im Sommer häufig in den Garten zurück, schlief, las oder dachte nach. Dann durfte niemand in ihre Nähe kommen. Wenn sie sich ihrem Kopfweh überließ, blieb sie tagelang in ihren Zimmern und wünschte keinen zu sehen.
Ihre Zofe, die als einzige zu ihr durfte, wurde von ihr in solchen Momenten blöde Kuh genannt. Als Kind hatte Eva mit angesehen, wie die Frau dann knickste und mit gesenktem Kopf sagte: Sehr wohl, Euer Gnaden! Das Kind wusste kaum, was eine Kuh war, geschweige denn eine blöde Kuh.
Sie befand sich ständig in der Gesellschaft der Gouvernante, einem mageren Fräulein aus Hamburg. In Evas Nähe waren immer mehrere Frauen, die ihr jeden Wunsch zu erfüllen und sie mit Gnädigstes Fräulein und Euer Erlaucht anzusprechen hatten.
Jede Regung des kleinen Mädchens und seines kaum ausgebildeten Gemüts wurde gewertet. War das Kind laut und ausgelassen, mahnte die Gouvernante, dass sich solches Betragen für eine Person seines Standes nicht zieme. Zeigte es sich niedergeschlagen oder weinte gar, verbot sie ihm, Gefühlsregungen in der Öffentlichkeit zu zeigen.
So wuchs das Kind Eva heran, das nach heraldischem Recht schon in der Wiege eine Krone mit neun Zacken hätte tragen dürfen. Zwischen russischen Windhunden, Reitpferden, Dienern und Gouvernanten wurde es erzogen in dem Bewusstsein, auserwählt zu sein. Manchmal kamen die Schwestern zu Besuch, aber sie blieben nie so lange, dass Eva zu einer von ihnen hätte Vertrauen fassen können.
In dem großen Schloss war es immer still. Ruhig lagen die langen Korridore mit den kostbaren Teppichen und den Porzellanvasen, die man nicht umwerfen durfte. Verschlossen waren die Säle, in denen keine Feste mehr gefeiert wurden.
Die Eltern hatten sich von allem, was sie als die Gesellschaft bezeichneten, zurückgezogen. Die Mutter überließ sich ihrem Kopfweh, der Vater hing seinen Erinnerungen nach, die glanzvoll genug waren.
Niemand in dem großen Haus sprach über Ereignisse, die in Berlin geschahen: Regierungswechsel, Streiks und ein Putsch. Dies alles bedeutete nichts für den Grafen, er ignorierte es. Mit wem hätte er reden sollen. Er besaß keine Freunde. Seine ehemals ausgezeichnete Stellung schuf eine Kluft zwischen ihm und dem Adel der Umgebung, Männern, die über Weizenpreise sprechen konnten und Löhne der Gutsarbeiter, auch über Pferde vielleicht noch; aber keiner dieser Leute besaß den Roten Adlerorden, niemand von denen konnte auch nur daran denken, ein Neujahrstelegramm aus Holland zu bekommen, wie Evas Vater es regelmäßig erhielt, mit den besten Wünschen für die Familie und den huldvollsten Grüßen von Ihren Majestäten.
Niemand von jenen Leuten konnte auch nur im Traum daran denken, die Kaiserin als Gast bei sich begrüßen zu dürfen, diese Hermine, zu der das Kind Tante sagen durfte, weil es auf irgendeine Weise mit ihr verwandt war.
Während eines solchen Besuches hatte Eva zum ersten Mal gehört, die Sozis hätten den schlimmen Fehler gemacht, den Kaiser nach Holland zu schicken, Kaiser Wilhelm den Zweiten, von dem ein Ölbild im Speisezimmer hing und der von allen Menschen der höchste und beste wäre, was Tante Hermine bestätigte, und dass aus dem schändlichen Tun der Sozis immer schlimmere Folgen für das Reich entstünden.
Die sind doch auf den Kaiser angewiesen, nur er ist imstande, das Reich zu seiner alten Blüte zu führen, sagte die gute freundliche Tante, die immerzu gnädig lächelte und von jedermann mit Euer Majestät angeredet wurde.
Das kleine Mädchen, als es erfuhr, dass der Kaiser in Holland ohne Krone herumlaufen musste, erschrak, denn man hatte ihm oft genug gesagt, dass es selber eine neunzackige Krone habe. Ängstlich fragte es: Können sie uns denn auch die Krone wegnehmen!
Da hatte die Tante gelacht und das Kind beruhigt: Nein, das werden sie nicht wagen, es gibt genug Kräfte! Alles, was sie uns genommen haben, müssen sie bald zurückgeben. Und wenn sie es nicht freiwillig tun, wird man sie zwingen!
Da hatte das Kind nichts mehr gefragt.
Es sah dem Vater nach, der die Tante zu ihrem Automobil geleitete, wo ein Chauffeur die Tür öffnete und schloss. Das Kind blickte dem Automobil hinterher, das die Tante Hermine nach Holland brachte, wo ihr hoher Gemahl sie erwartete.
Die Welt, in der Eva aufwuchs, war märchenhaft. Anderes drang nicht in das Bewusstsein des kleinen Mädchens. Nur einmal war etwas geschehen, das Eva lange Zeit beschäftigte. Neumann, ein alter Diener des Vaters, hatte sich im langen Korridor, dicht neben den kostbaren japanischen Vasen, betrunken herumgewälzt, und als man ihn gewaltsam aus dem Schloss entfernte, hatte er den Grafen mit bösen Worten beschimpft, mit Worten, die das kleine Mädchen noch nie gehört hatte und deren Bedeutung es nicht verstand.
Aber dass der alte Neumann, der immer ruhig gewesen und eifriger als die anderen Diener war, dass dieser Mann sich auf einmal so anders benahm, hatte das Kind geängstigt.
Lange versuchte Eva, von ihrer Gouvernante etwas über die Bedeutung der Worte zu erfahren, doch das Fräulein schwieg beharrlich. Nur einmal sagte es verächtlich: Plebs bleibt Plebs! Da fragte das Kind nichts mehr, die Angst jedoch blieb. Nicht die vor Neumann, den sah Eva nie wieder. Sie hatte Angst vor den anderen Livrierten, die so geschäftig und eifrig taten, so unterwürfig dienerten.
Wenig später war Eva nach Breslau in ein Pensionat gekommen, das von der verwitweten Frau Generalin von Kalkstein geleitet wurde, einer würdevollen Exzellenz, die es als ihre Pflicht ansah, die Töchter der höchsten Aristokratie auf ihre Berufung vorzubereiten. Ihre Berufung sollte sein, Gattin eines Aristokraten zu werden, eines hohen Militärs oder Diplomaten, vielleicht sogar die eines Ministers.
Nur wenige konnten Hofdame der Königin von Preußen sein, aber sie alle wurden gründlich darauf vorbereitet. Was die Generalin vor allem auszeichnete, war ihre Weigerung, sich mit den neuen Gegebenheiten abzufinden. Immer wieder sprach sie davon, dass der Kaiser im Moment zur Erholung in Holland sei, dass er aber zurückkehren werde, denn es gebe nichts, das über dem monarchischen Prinzip stehe.
Eva lernte, sich gut zu benehmen. Das hatte ihr auch schon die Gouvernante beigebracht, aber die Generalin fand immer noch etwas auszusetzen. Eva lernte es, sich zu kleiden, unaufdringlich elegant, und angenehm zu plaudern, was Frau von Kalkstein Konversation machen nannte.
In dem Pensionat für adlige Fräulein in Breslau erfuhr Eva davon, dass es eine hohe Kunst sei, in jedem Menschen, mit dem man gerade sprach, das Gefühl zu erwecken, nur an ihm interessiert zu sein. Das Kind war eine gelehrige Schülerin. Es wusste bald, wie man mit vielen Worten wenig oder nichts sagt.
Einmal, als Eva fünfzehn Jahre alt war, geschah etwas Sonderbares. Sie stand abends, kurz bevor sie ins Bett ging, am Fenster, um die frische Mailuft zu genießen. Es war dunkel und warm, und sie hatte nur ihr Nachthemd an. Sie beugte sich hinaus, als sie plötzlich aus dem Park, der das Haus umgab, Geräusche hörte, die sie neugierig machten, abstießen, vor allem aber anzogen. Eva beugte sich weiter aus dem Fenster und entdeckte den Schatten eines Paares, das schwankte und endlich ins Gras fiel. Sie hörte sie keuchen und sah etwas, das sich auf und ab bewegte und immer schneller wurde. Sie starrte dorthin und klammerte sich am Fensterkreuz fest. Sie zitterte und bewegte sich, doch sie wusste nicht, was sie tat.
Eva hatte das Gefühl, sterben zu müssen. Sie stieß einen leisen Schrei aus, schloss das Fenster und zog eilig die Vorhänge zu. Ihr schien, als sei etwas Schlimmes geschehen, das aber irgendwie Bedeutung für sie haben würde. Langsam fasste sie sich wieder. Als sie ins Bett fiel, schlief sie sofort ein.
Am nächsten Morgen suchte Eva in den Gesichtern ihrer Mitschülerinnen Spuren, forschte, doch sie fand nichts, was auf das Geschehen im Park hingewiesen hätte. Sie wusste nicht, ob es eine der Mitschülerinnen, eine Lehrerin oder vielleicht die Generalin selbst gewesen war. Keiner sprach über das Vorgefallene ein Wort. Niemand schien etwas bemerkt zu haben, nach einiger Zeit glaubte Eva, alles nur geträumt zu haben. Aber sie vergaß es nie.
Als sie das Zeugnis der mittleren Reife erhalten hatte und nach Meinung der Generalin reif genug für ihre Berufung war, fuhr Eva nach Hause zurück. Sie wusste, dass ihr Aufenthalt im Schloss Groß-Kossow nur ein vorübergehender war. Wie die Schwestern würde man auch sie, die gerade siebzehn Jahre alt war, verheiraten.
Die Eltern, alt und nicht mehr gesund, wollten schnell die Verantwortung für die jüngste Tochter loswerden. Sie konnten es kaum erwarten, einen Mann für sie zu finden.
Die Reichsgräfin Eva von Pleß-Carolath auf Schloss und Gut Groß-Kossow lernte ihren späteren Gatten, den Grafen von Kutschberg-Hohenau, Oberst im Ersten Garderegiment zu Fuß, Ende Vierzig und ein schneidiger Herr, am Tage ihrer Verlobung kennen. Sie wusste nichts weiter von ihm, als dass er Güter besaß, die im Umfang denen ihres Vaters nicht nachstanden, und dass sein Adel nur wenig jünger als ihr eigener war. Der Mann, auf irgendeine Weise mit den Hohenzollern verwandt, konnte seiner Frau das ihr zustehende standesgemäße Leben bereiten.
Auf ihrer Hochzeitsreise, die sie durch Italien führte, erlebte Eva die Landschaft und besuchte Museen, doch das, wonach sie sich sehnte, geschah nicht. Alles war anders als damals im Park. Nach kurzer Zeit schon wurde ihr klar, dass das, worauf sie wartete, nicht von diesem Mann kommen würde, dessen Namen sie nun trug und der ihr immer etwas lächerlich vorkam. Sie musste sich beherrschen, dabei nicht loszulachen. Einmal lachte sie wirklich. Der Graf sah sie erstaunt an, aber er sagte nichts. Gekränkt zog er sich zurück. Das war das Ende dieser Dinge. Der Graf behandelte sie höflich und immer zuvorkommend. Er las ihr die Wünsche von den Augen. Eva mochte ihn, wie sie ihren Vater mochte, den sie nur als einen alten Mann gekannt hatte. Zu dieser Zeit war sie schon schwanger. Der Zustand war ihr lästig. Sie wünschte, er möge schnell vorübergehen.
Eva war die Gräfin und Herrin im Schloss Graudenz, einem uralten Gemäuer mit Burggraben und efeuumrankten Türmen. Das Schloss lag südlich von Tilsit, zwei Tagereisen von Groß-Kossow entfernt. Zu weit, um ihre Eltern öfter als einmal im Jahr besuchen zu können. Sie sehnte sich auch nicht nach ihnen.
Eva war gerade achtzehn, als die Tochter Astrid zur Welt kam, dieses Kind, das, wie sie selber, nach heraldischem Recht schon in der Wiege eine neunzackige Krone hätte tragen dürfen und mit Erlaucht angeredet werden würde, sobald es laufen konnte.
Eva stand einem großen Hauswesen vor. Der Graf tat längst, was er immer getan hatte: Er gab sich seinen Leidenschaften hin, vor allem der Jagd und den Reitpferden. Die Gesellschaft seiner Stallknechte hatte er lieber als die seiner jungen Frau. Als Eva begann, sich auf Graudenz einzuleben, wurde ihr das Gerücht hinterbracht. Sie tat es mit einer Handbewegung ab und verbot, darüber zu sprechen. Da war schon Krieg. Die Gräfin sah schwere Panzer auf der Chaussee in Richtung Osten fahren. Einmal entdeckte sie, dass die Bahnstation von Zügen blockiert war, in denen Soldaten transportiert wurden.
Der Graf trug nun fast immer Uniform, und häufiger als sonst waren Gäste im Haus. Es kam der jungen Gräfin, die all diese Gesellschaften über sich ergehen ließ, zugute, dass sie gelernt hatte, angenehm zu plaudern. Es fiel ihr leicht, die charmante Gastgeberin zu sein. Sie hatte es gern, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen und zu tanzen. Aber sie verbarg, dass sie Lust hatte, die Männer zu umarmen. An deren Blicken und Berührungen merkte sie, dass sie in ihnen Wünsche weckte, doch zu mehr kam es nie.
7. Kapitel
Die Front befand sich auf dem Rückzug. Aus dem Osten kamen bedrohliche Meldungen. Es ging hektisch zu im Schloss. Die Gräfin ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie lebte unbeteiligt, und wenn sie Kopfschmerzen hatte, zog sie sich, wie sie es bei der Mutter gesehen hatte, in ihre Zimmer zurück.
Anfang Februar fand man den Grafen von Kutschberg-Hohenau im Wald. Er war tot. Erschossen. Ungeklärt blieb, ob er sich selber das Leben genommen hatte oder erschossen worden war.
Es war gerade noch genügend Zeit, ihn standesgemäß in der Gruft unter der Schlosskapelle beizusetzen. Dann stob alles auseinander und flüchtete.
Die junge Gräfin, eine Witwe von gerade einundzwanzig Jahren, befahl, Wertsachen, Möbel, Teppiche, Geschirr und Wäsche zusammenzupacken und auf Wagen zu laden.
Mit sechzehn Wagen und vierzig Pferden begann im Februar des Jahres 1945 die Flucht. Eine Flucht, die immer mehr zu einem panischen Fliehen wurde und am Ende nur noch beherrscht war von dem Willen zu überleben.
Noch bevor sie die Weichsel erreicht hatten, waren die ersten Wagen verschwunden. Die Gräfin war so betäubt von ihrer Angst, dass sie bestimmte, weiterzufahren. Als sie über die Oder setzten, hockten Eva und ihre Tochter auf dem letzten Wagen, der ihnen geblieben war. Eva musste selber kutschieren. Die Pferde gehorchten ihr nicht. Es gab Unruhe auf der Fähre. Ein Kind wurde verletzt. Die Gräfin musste es sich gefallen lassen, dass man sie beschimpfte. Schweigend drückte sie Astrid an sich und verbarg das Gesicht hinter einem dunklen Tuch. Als sie die andere Seite des Flusses erreicht hatten und sich auf einer Straße in Richtung Westen befanden, hielt Eva im Schutz eines Wäldchens den Wagen an. Dort verbrachten sie die Nacht. Am nächsten Morgen waren die Pferde verschwunden. Ob man sie gestohlen hatte oder ob sie einfach nur davongelaufen waren, war nicht herauszukriegen.
Eva nahm vom Wagen ein paar Sachen, die ihr wertvoll erschienen, und nahm ihre Tochter an die Hand. Zu Fuß gingen sie weiter.
Eva wurde zu einem Tier, das ohne Ziel lief, nur irgendwohin, wo sie ihres Lebens sicher wären und satt würden. Sie wusste nie, wo sie sich befanden, was für ein Tag es war. Die Gräfin machte Erfahrungen und erlebte Demütigungen, die ihr in Groß-Kossow, weitab von anderen menschlichen Behausungen, niemand vorauszusagen gewagt hätte. Sie stumpfte ab und verlor jedes Bewusstsein dafür, wer sie war. Es zählte nichts mehr. Manchmal war Eva so verzweifelt, dass sie nicht mehr leben wollte. Aber Astrid hinderte sie daran, ins Wasser zu gehen oder sich am nächsten Baum aufzuhängen.
Die Tochter war nun vier Jahre, ein kräftiges Mädchen, das tapfer alle Strapazen ertrug. Wenn Eva liegen bleiben wollte, zerrte Astrid sie weiter.
Nachdem man Eva die letzten Kleider gestohlen hatte, bekam sie schließlich von irgendjemand Lumpen, die aus alten Säcken zusammengenäht und schwer und muffig waren.
Irgendwo am Wegrand stand verlassen ein Handwagen. Aus einem Instinkt heraus zog Eva ihn weiter.
Das war, kurz bevor sie in das Dorf und in dieses Haus gekommen waren.
8. Kapitel
Eva fuhr zusammen. Sie setzte sich und öffnete die Augen, vor denen es sich drehte. Sie fasste an ihre heiße Stirn und dachte: Ich habe doch wohl nicht etwa Fieber? Bloß nicht krank werden! Sie war durstig und leckte die Lippen. Durch das kleine Fenster drang fahles Dämmerlicht. Es war hell genug, zu erkennen, wo sie sich befand. Die Dachkammer war klein und auf einer Seite schräg. Über dem Fenster, wo es feucht zu sein schien, war die Tapete eingerissen. Auf dem Waschtisch standen Schüssel und Kanne aus Steingut. An der Wand gegenüber standen eine Kommode, ein Kleiderschrank und davor ein Tisch, umgeben von drei Sesseln mit hoher Lehne, deren Stoff abgewetzt und zerschlissen war. Unter dem Fenster ein grob gezimmertes hölzernes Gestell, an der Decke hing eine Lampe mit langen Fransen. Die Kammer, in der sie wohnen sollten, war eine Abstellkammer.
Eva legte sich zurück und starrte die kahlen Wände an. Sie lag nackt im Bett, unter einer Federdecke, die hoch und schwer war. Sie fühlte sich krank. Es machte ihr Mühe, sich zu bewegen.
Sie dachte an etwas, das lange zurücklag. Ihr schien, sie werde bald sterben. Wenn es so weit ist, dachte sie und presste die rechte Hand gegen den Mund, was wird dann aus ihr? Sie beugte sich zu Astrid, legte ihr Gesicht auf den Arm der Tochter und dachte: Ich muss mich zusammenreißen! Niemand jagte sie hier davon, kein Mann, der sie bald satthatte. Sie erinnerte sich, der alten Frau etwas von sich erzählt zu haben, und schämte sich.
Eva lag und zitterte. Sie spürte den Atem Astrids, der warm und sanft über ihre Haut strich. Im Haus war alles ruhig.
Eva hörte auf dem Hof Schritte und Türen klappen, jemand rief etwas.
Eimer schepperten, Kühe brüllten, ein Hund bellte.
Eva hatte diese Geräusche oft genug auf ihrem Weg gehört, doch noch nie so empfunden. Sie sprang aus dem Bett, wusch sich schnell, kämmte ihre Haare und steckte sie wieder mit Klemmen fest. Sie zog die Kittelschürze an und band sie vor dem Bauch zu. Dann ging sie nach unten in die Küche. Es war eine große Küche, mehr lang als breit, und bis zu halber Höhe gekachelt. Die Uhr an der Wand über dem Tisch war fast sechs. Gleich fing Evas Arbeit an.
Die Frau, Eva hatte sie schon ein paar Mal gesehen, räumte den Küchentisch ab, an dem der Bauer, dessen Namen sie immer noch nicht kannte, und ein Knecht gefrühstückt hatten.
Eva lehnte sich an den Küchenschrank. Sie wusste nicht, was sie tun sollte.
Morgen, sagte die Frau. Sie sprach eigenartig weich und verschluckte das R, so ähnlich sprachen auch Frau Reimann und der Bauer.
Morgen, sagte Eva Krüger leise.
Die Frau stellte Teller und Tassen in die Abwäsche. Brot und Wurst ließ sie auf dem Tisch stehen. Sie wies mit der Hand auf den Herd neben dem Schornstein, wo ein Wassertopf stand, und sagte: Kaffeewasser habe ich angesetzt, richtigen Kaffee gibt es ja nicht, aber Blümchenkaffee. Sie lachte: Oder was möchtest du sonst zum Frühstück trinken?
Eva Krüger zuckte mit den Schultern. Wann hatte sie das letzte Mal Wurst gegessen und Kaffee getrunken! Leise sagte sie: Ist schon gut so!
Stell für uns Teller und Tassen auf den Tisch!
Als Eva Krüger unschlüssig herumstand, zeigte die Frau auf den weiß gestrichenen Küchenschrank und sagte: Da ist der Schrank, und da steht das Geschirr drin!
Die Stimme klang spöttisch.
Bin ich so dumm, dachte Eva und schämte sich, so dumm, dass du mir das sagen musst?
Man hatte ihr beigebracht anzuordnen, auch, wie und wo der Kaffeetisch zu decken ist, sie gelehrt, angenehm zu plaudern und in jedem Menschen das Gefühl zu erwecken, dass gerade er der wichtigste Mensch der Welt sei. Sie öffnete die Schranktür und nahm Geschirr heraus, ein Teller rutschte ihr aus der Hand. Er fiel auf den Tisch, aber er blieb heil.
Die Frau schnalzte mit der Zunge und warf Eva einen Blick zu, der dies und jenes bedeuten konnte: Du hast wohl zwei linke Hände?
Eva versteckte die Hände schnell auf dem Rücken.
Die Frau hatte genug gesehen. Linke nicht, aber zarte Hände, sehr zarte, sagte sie und sah Eva prüfend ins Gesicht: Hast du dich schon ein bisschen eingelebt?