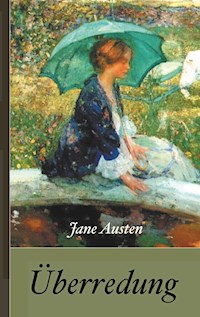Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mansfield Park ist eine bewegende Geschichte über Liebe, Pflicht und Selbstbestimmung. Der Roman erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich zwischen ihren eigenen Wünschen und den Erwartungen der Gesellschaft entscheiden muss. Fanny ist eine starke und unabhängige Frau, die sich für das, was sie glaubt, einsetzt. Dieser Roman ist ein Muss für alle Fans von Jane Austen und Gesellschaftsromanen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
5,0 (1 Bewertung)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Mansfield Park
Jane Austen
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
1. Kapitel
Vor etwa dreißig Jahren hatte Miss Maria Ward aus Huntingdon, mit nicht mehr als siebentausend Pfund Mitgift, das Glück, Sir Thomas Bertram, den Besitzer von Mansfield Park in der Grafschaft Northampton, zu fesseln und so in den Rang einer adeligen Dame mit großem Einkommen, einem stattlichen Haus und allen anderen Vorteilen einer solchen Stellung erhoben zu werden. Ganz Huntingdon ereiferte sich über die glänzende Partie, und sogar ihr Onkel, der Rechtsanwalt, gab zu, daß ihr mindestens dreitausend Pfund fehlten, um darauf billigerweise Anspruch machen zu dürfen. Sie hatte zwei Schwestern, denen ihre Standeserhöhung zugute kommen konnte, und diejenigen ihrer Bekannten, die Miss Ward und Miss Frances ebenso hübsch fanden wie Miss Maria, zögerten nicht zu prophezeien, daß sie sicherlich fast gleich gut heiraten würden. Doch offenbar gibt es auf dieser Welt weniger reiche Männer als hübsche Mädchen, die sie verdienen würden. Als ein halbes Dutzend Jahre verflossen waren, mußte Miss Ward sich damit begnügen, Pastor Norris, einem wenig begüterten Freund ihres Schwagers, die Hand zum Ehebund zu reichen, und Miss Frances traf es noch schlechter. Miss Ward machte nämlich, bei Licht betrachtet, gar keine so üble Partie; Sir Thomas war glücklicherweise in der Lage, seinem Freund die Pfarre von Mansfield zu verschaffen, und Mr. und Mrs. Norris traten ihr Eheglück mit einem Jahreseinkommen von nicht viel weniger als tausend Pfund an. Miss Frances aber heiratete, wie man so sagt, um es ihrer Familie zu geben, und besorgte dies aufs gründlichste, indem sie sich in einen Marineleutnant, einen jungen Mann ohne Kinderstube, ohne Geld und ohne Konnexionen, verliebte. Sie hätte kaum eine unglücklichere Wahl treffen können. Sir Thomas besaß gute Beziehungen, die er gern zum Nutzen von Lady Bertrams Schwester eingesetzt hätte, denn wie es ganz allgemein seinen Grundsätzen entsprach, recht zu tun, so verlangte im besonderen Fall sein Stolz, alle, die ihm nahestanden, in geachteter Position zu sehen. Doch in der Berufssphäre des jungen Mannes versagte Sir Thomas’ Einfluß, und ehe er noch dazu kam, nach anderen Wegen zu suchen, hatte ein vollkommener Bruch zwischen den Schwestern stattgefunden. Er war die natürliche Folge des Verhaltens sämtlicher Beteiligten, wie es bei einer so unvernünftigen Heirat kaum anders kommen konnte. Um nutzlosen Vorhaltungen und Predigten zu entgehen, hatte Mrs. Price ihrer Familie nichts von der ganzen Sache geschrieben, bevor sie unwiderruflich verheiratet war. Lady Bertram, eine Frau von sehr ruhiger Gemütsart und äußerst phlegmatischem Temperament, hätte es dabei bewenden lassen, ihre Schwester aufzugeben und nicht weiter an die Geschichte zu denken; doch Mrs. Norris war von einem aktiven Kampfgeist beseelt, der nur dadurch befriedigt werden konnte, daß sie Fanny einen langen, zornigen Brief schrieb, in dem sie die Torheit ihres Vorgehens darlegte und sämtliche nur möglichen schlimmen Folgen an die Wand malte. Mrs. Price fühlte sich nun ihrerseits gekränkt und beleidigt; und ihre Antwort, die beide Schwestern ihre Erbitterung entgelten ließ und so schrecklich despektierliche Bemerkungen über Sir Thomas’ Hochmut enthielt, daß Mrs. Norris sie unmöglich für sich behalten konnte, setzte jedem verwandtschaftlichen Verkehr für lange Zeit ein Ende.
Sie lebten so weit voneinander entfernt und bewegten sich in so verschiedenen Kreisen, daß im Lauf der nächsten elf Jahre die Möglichkeit, gegenseitig etwas von ihrem Dasein zu hören, beinahe ausgeschlossen schien; zumindest mußte es Sir Thomas geradezu wunderbar vorkommen, daß Mrs. Norris von Zeit zu Zeit in der Lage war, in zornigem Ton zu berichten, Fanny hätte schon wieder ein Kind bekommen. Nach Ablauf von elf Jahren jedoch konnte Mrs. Price es sich nicht mehr leisten, Stolz oder Groll zu hegen und auf eine verwandtschaftliche Beziehung zu verzichten, von der sie möglicherweise Hilfe erhoffen durfte. Eine große und immer noch größer werdende Familie, ein dienstunfähig gewordener Mann, der aber darum nichts von seiner Vorliebe für lustige Gesellschaft und einen guten Trunk eingebüßt hatte, ein äußerst schmales Einkommen, das kaum für die notwendigsten täglichen Bedürfnisse ausreichte – all das veranlaßte sie, sich wieder um die Verwandten zu bemühen, die sie so leichtfertig aufgegeben hatte. Sie schrieb Lady Bertram einen Brief, der von so großer Zerknirschung und Verzagtheit, einem solchen Überfluß an Kindern und einem so betrüblichen Mangel an allen anderen Dingen zeugte, daß er jedermann versöhnlich stimmen mußte. Die arme Frau sah ihrem neunten Wochenbett entgegen; und nachdem sie diesen Umstand beklagt und die Gönner- und Patenschaft ihrer Verwandten für das erwartete Kind erbeten hatte, vermochte sie ihre Hoffnung nicht zu verhehlen, daß sie vielleicht auch etwas für die Zukunft der acht bereits vorhandenen Kinder tun würden. Ihr Ältester wäre zehn Jahre alt, ein prächtiger, aufgeweckter Bursche, den es in die Welt hinaus trieb – aber was konnte sie dazu tun? Bestünde vielleicht die Möglichkeit, daß er sich später einmal Sir Thomas bei der Verwaltung seiner westindischen Besitzungen nützlich erweisen könnte? Keine Stellung würde ihm zu gering erscheinen. Oder was hielte Sir Thomas von Woolwich? Oder wie sollte man es anfangen, einen Jungen in den Fernen Osten zu schicken?
Der Brief blieb nicht ohne Frucht. Er stellte wieder Frieden und Freundschaft her. Sir Thomas sandte freundliche Ratschläge und Versprechungen, Lady Bertram Geld und Kinderwäsche, und Mrs. Norris schrieb die dazugehörigen Briefe.
Das waren die unmittelbaren Folgen des Briefes, und innerhalb Jahresfrist sollte er sich für Mrs. Price noch bedeutsamer auswirken. Mrs. Norris bemerkte häufig, sie könne ihre arme Schwester mit all den vielen Kindern nicht aus dem Kopf bringen; soviel sie auch alle schon für sie getan hätten, empfände sie das Bedürfnis, noch mehr zu tun. Und schließlich gestand sie ihren Wunsch, ihrer armen Schwester wenigstens die Sorgen und Kosten für ein Kind aus ihrer großen Schar gänzlich abzunehmen. Wie wäre es, wenn sie gemeinsam die Fürsorge für das älteste Töchterchen übernehmen würden? Das Kind sei jetzt neun Jahre alt, also in einem Alter, das mehr Aufmerksamkeit erfordere, als die geplagte Mutter ihm beim besten Willen widmen könnte. Verglichen mit der Größe dieser Wohltat seien die Mühen und Auslagen, die sie mit sich brächte, gering einzuschätzen … Lady Bertram stimmte augenblicklich zu. «Ich glaube, wir könnten nichts Besseres tun», sagte sie, «lassen wir das Kind gleich kommen.»
Sir Thomas konnte nicht so rasch und vorbehaltlos seine Einwilligung geben. Er zögerte und überlegte. Es sei eine ernste Verantwortung; ein Mädchen, das in seinem Haus aufwüchse, müßte späterhin auch standesgemäß versorgt werden, sonst wäre es keine Wohltat, sondern eine Grausamkeit, es von seiner Familie zu trennen. Er dachte an seine eigenen vier Kinder – an seine zwei Söhne – an die Möglichkeit einer Jugendliebe zwischen Cousin und Cousine – und so weiter. Doch kaum hatte er begonnen, seine Bedenken bedächtig darzulegen, als Mrs. Norris ihm mit ihrer Antwort ins Wort fiel, die sämtlichen aufgezählten und nicht aufgezählten Einwendungen Rechnung trug:
«Mein lieber Sir Thomas, ich verstehe Sie vollkommen und achte und schätze die Großmut und Feinfühligkeit Ihrer Bedenken, die so sehr im Einklang mit Ihrer ganzen Lebensführung stehen! Und in der Hauptsache bin ich völlig Ihrer Meinung, daß man ein Kind, das man sozusagen in die Hand genommen hat, auch weiterhin versorgen muß, soweit man dazu imstande ist. Ich persönlich bin wohl die Letzte, die für einen solchen Zweck ihr Scherflein verweigern würde! Da ich selbst keine Kinder habe, wüßte ich nicht, wem ich das wenige, das ich besitze, einmal zukommen lassen soll, wenn nicht den Kindern meiner leiblichen Schwestern – und mein guter Norris denkt sicher genau so, aber Sie wissen, große Worte und Versprechungen sind nicht meine Sache. Lassen wir uns nicht durch Bagatellen von einer guten Tat abschrecken! Wenn man ein Mädchen ordentlich erzieht und geziemend in die Welt einführt, kann man zehn zu eins wetten, daß sie die Möglichkeit finden wird, sich gut zu versorgen, ohne daß es irgend jemand weitere Kosten verursacht. Ich darf wohl sagen, eine Nichte von uns, Sir Thomas, eine Nichte von Ihnen, kann nur Vorteile davon haben, wenn sie hier aufwächst. Ich behaupte nicht, daß sie je ihren Cousinen gleichkommen wird, das gewiß nicht! Aber sie würde unter so günstigen Voraussetzungen in die hiesige Gesellschaft eingeführt, daß sie aller menschlichen Voraussicht nach eine sehr anständige Partie machen wird. Sie denken an Ihre Söhne – aber wissen Sie nicht, daß gerade dies am allerwenigsten zu befürchten wäre? Wenn sie doch wie Geschwister zusammen aufwachsen! Es ist einfach moralisch unmöglich, ich habe noch nie von so einem Fall gehört. Es wäre im Gegenteil das einzige sichere Mittel, einer solchen Verbindung vorzubeugen. Nehmen Sie an, sie ist ein hübsches Mädchen, und Tom oder Edmund bekämen sie von heute in sieben Jahren zum erstenmal zu Gesicht – ja, das könnte Unheil geben. Allein die Vorstellung, daß wir sie fern von uns in Armut und Elend haben großwerden lassen, könnte genügen, damit einer der lieben, gutherzigen Jungen sich in sie verliebt. Aber wenn die Kinder zusammen aufwachsen, wird keiner der Jungen sie je als etwas anderes als eine Schwester ansehen, und wäre sie schön wie ein Engel!»
«Es ist viel Wahres an dem, was Sie sagen», versetzte Sir Thomas, «und fern sei es mir, einem Plan, der der Situation aller Beteiligten so gut entsprechen würde, eingebildete Hindernisse in den Weg zu legen. Ich wollte nur bemerken, daß wir uns nicht leichtfertig darauf einlassen dürfen. Wenn er Mrs. Price wirklichen Nutzen und uns selber Ehre eintragen soll, müssen wir uns verpflichten oder uns innerlich für verpflichtet halten, das Mädchen später einmal standesgemäß zu versorgen, auch wenn sich keine so günstige Möglichkeit bietet, wie Ihr Optimismus Sie erwarten läßt.»
«Oh, ich verstehe Sie!» rief Mrs. Norris. «Sie sind die Großmut und Weisheit in Person, und wir werden in diesem Punkt sicher stets der gleichen Meinung sein! Sie wissen ja, was ich tun kann, tue ich von Herzen gern für meine Lieben. Und wenn ich für dieses kleine Mädchen auch nicht ein Hundertstel der Zuneigung empfinden kann, die ich Ihren lieben Kindern entgegenbringe, wenn sie mir auch in keiner Hinsicht jemals so nahestehen wird, so könnte ich es mir doch nie verzeihen, falls ich je imstande wäre, sie zu vernachlässigen. Ist sie nicht meiner Schwester Kind? Wie könnte ich da zusehen, daß sie Mangel leidet, solange ich auch nur einen Bissen Brot habe, den ich mit ihr teilen kann? Mein lieber Sir Thomas, bei all meinen Fehlern habe ich ein warmes Herz. Arm wie ich bin, würde ich mir lieber das Notwendigste versagen, als auf eine großmütige Tat zu verzichten. Wenn Sie also nichts dagegen haben, werde ich gleich morgen meiner armen Schwester schreiben und ihr unseren Vorschlag unterbreiten. Und sobald alles abgemacht ist, werde ich dafür sorgen, daß das Kind nach Mansfield gebracht wird; Sie sollen damit keine Mühe haben. Meine eigene Mühe, das wissen Sie ja, achte ich gering. Ich werde meine Nanny eigens nach London schicken – sie kann dort bei ihrem Vetter, dem Sattlermeister, übernachten und das Kind in Empfang nehmen. Von Portsmouth aus kann man es leicht mit der Postkutsche nach London expedieren, unter dem Schutz irgendeiner anständigen Person, die zufällig die gleiche Reise macht. Ich nehme an, daß sich immer die eine oder andere achtbare Handwerkersfrau finden läßt, die gerade nach London fährt.»
Abgesehen von dem Anschlag auf Nannys Vetter erhob Sir Thomas nun keine Bedenken mehr. Nachdem man seinem Wunsch gemäß einen zwar weniger sparsamen, aber respektableren Treffpunkt festgesetzt hatte, konnte alles als erledigt gelten, und man genoß bereits die Freude an dem guten Werk. Strenggenommen, hätten nicht alle Anwesenden das gleiche Anrecht auf dieses angenehme Gefühl gehabt, denn während Sir Thomas fest entschlossen war, dem auserkorenen Kind ein treuer Beschützer und Versorger zu sein, hatte Mrs. Norris nicht die mindeste Absicht, sich die Sache etwas kosten zu lassen. Solange es ums Reden und Plänemachen ging, war ihre Mildtätigkeit unbegrenzt, und niemand verstand es besser, die anderen zur Freigebigkeit anzuspornen; sie liebte es, alles zu dirigieren, doch nicht minder liebte sie ihr Geld und wußte mit dem ihren ebenso sparsam umzugehen, wie das ihrer Verwandten großzügig auszugeben. Da sie auf ein geringeres Einkommen hin geheiratet hatte, als es ihren jahrelangen Erwartungen entsprach, hatte sie von Anfang an strengste Sparsamkeit für notwendig gehalten; und was ursprünglich bloße Vorsicht gewesen, wurde ihr bald zum Bedürfnis, zum Gegenstand ihrer unermüdlichen Besorgnis, die sich ja auf kein Kind richten konnte. Hätte Mrs. Norris für eine größere Familie zu sorgen gehabt, wäre an Ersparnisse wohl nicht zu denken gewesen; da sie dieser Sorgen enthoben war, hinderte sie nichts, ihrem Hang zur Sparsamkeit zu frönen, und sie mußte sich nicht die Freude versagen, ihrem Einkommen, das sie und ihr Mann ohnehin niemals verbrauchten, jährlich noch ein Sümmchen hinzuzufügen. Im Banne dieser fixen Idee, der keinerlei wahre Zuneigung zu ihrer Schwester entgegenwirkte, konnte sie für sich nichts anderes erstreben als den Ruhm, eine so kostspielige gute Tat geplant und organisiert zu haben. Möglicherweise kannte sie sich auch so wenig, daß sie nach diesem Gespräch in der glücklichen Überzeugung ins Pfarrhaus heimkehrte, die großmütigste Schwester und Tante der Welt zu sein.
Als die Angelegenheit demnächst wieder zur Sprache kam, erklärte sie ihre Ansichten deutlicher. Aus ihrer Antwort auf Lady Bertrams gleichmütige Frage: «Zu wem soll das Kind zuerst kommen, Schwester, zu dir oder zu uns?» erfuhr Sir Thomas mit einigem Erstaunen, daß Mrs. Norris absolut nicht in der Lage sei, sich persönlich mit dem Kind zu belasten. Er hatte in dem kleinen Mädchen vor allem eine erwünschte Vermehrung der Pfarrersfamilie, eine hochwillkommene Gefährtin für die kinderlose Tante gesehen und merkte erst jetzt, wie gründlich er sich geirrt hatte. Mrs. Norris erklärte nachdrücklich, zu ihrem großen Bedauern käme ein Aufenthalt der Kleinen bei ihr überhaupt nicht in Frage, zumindest unter den jetzigen Umständen. Bei der schlechten Gesundheit ihres armen Norris sei das gänzlich ausgeschlossen: er sei ebensowenig imstande, Kinderlärm zu ertragen wie zu fliegen. Natürlich, wenn seine Gicht sich jemals bessern sollte, wäre das etwas anderes; dann würde sie gern und ohne der Unbequemlichkeit zu achten, ihr Teil tun. Doch gerade jetzt nähme der arme Norris jede Minute ihrer Zeit in Anspruch, und schon die bloße Erwähnung eines solchen Plans würde ihn zweifellos aufs höchste beunruhigen.
«Dann soll sie lieber zu uns kommen», bemerkte Lady Bertram mit größter Seelenruhe, und nach einer kurzen Pause fügte Sir Thomas würdevoll hinzu: «Ja, dieses Haus soll ihr Heim sein. Wir wollen uns bemühen, unsere Pflicht an ihr zu tun. Hier wird sie auch den Vorteil gleichaltriger Gefährten und eines regelmäßigen Unterrichts genießen.»
«Sehr richtig!» rief Mrs. Norris. «Das sind zwei sehr wichtige Erwägungen, und für Miss Lee kommt es ganz aufs gleiche heraus, ob sie drei oder nur zwei Mädchen zu unterrichten hat – das kann keinen Unterschied machen. Ich wünschte nur, ich könnte mich nützlicher erweisen, aber was in meinen Kräften steht, das tue ich. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die mit ihrer eigenen Mühe sparen. Meine Nanny soll sie abholen, wie unbequem es auch für mich sein mag, meine Haushälterin drei Tage lang zu entbehren. Ich denke, Schwester, du wirst das Kind in die kleine, weiße Dachstube neben den alten Kinderzimmern einquartieren. Das wird am besten sein, ganz in der Nähe von Miss Lee und nicht weit von den Kindern. Und nebenan wohnen die Stubenmädchen – eine von ihnen könnte ihr beim Anziehen helfen und ihre Kleider versorgen, denn ich nehme an, du wirst von Ellis nicht verlangen wollen, daß sie dieses Kind so wie die anderen bedient. Ich sehe wirklich nicht, wo du sie sonst unterbringen könntest.»
Lady Bertram hatte keine Einwendungen zu machen. «Ich hoffe nur, sie wird sich als gutgeartetes Kind erweisen», fuhr Mrs. Norris fort, «und das außerordentliche Glück zu würdigen wissen, daß sie solche Verwandte besitzt.»
«Sollte sie wirklich schlecht geartet sein», sagte Sir Thomas, «so dürfen wir sie um unserer eigenen Kinder willen nicht in der Familie behalten, aber es besteht kein Grund, etwas so Schlimmes zu erwarten. Wahrscheinlich werden wir vieles an ihr bemerken, was wir zu ändern wünschen. Wir müssen uns auf grobe Unwissenheit, eine gewisse Niedrigkeit der Anschauungen und betrüblich vulgäre Manieren gefaßt machen, aber diese Fehler sind nicht unheilbar und können auch, wie ich hoffe, ihren Gefährten nicht gefährlich werden. Wären meine Töchter jünger als sie, hätte ich es sehr ernsthaft überlegt, ihnen eine solche Hausgenossin zu geben. Doch wie die Dinge liegen, ist für unsere Kinder von einer solchen Gemeinschaft nichts zu befürchten und für das kleine Mädchen viel Gutes zu erhoffen.»
«Genau meine Meinung!» rief Mrs. Norris.
«Ich habe es noch heute morgen zu meinem Mann gesagt. Es wird eine Erziehung für das Kind sein, habe ich gesagt, wenn sie nur mit ihren Cousinen zusammensein darf. Sogar wenn Miss Lee ihr nichts beibrächte, würde sie von ihnen allein Bravheit und Gescheitheit lernen.»
«Hoffentlich wird sie meinen armen Mops nicht quälen», meinte Lady Bertram. «Ich habe gerade erst Julia dazu gebracht, ihn in Ruhe zu lassen.»
«Eine gewisse Schwierigkeit sehe ich voraus, meine liebe Mrs. Norris», bemerkte Sir Thomas, «nämlich den Mädchen, wenn sie heranwachsen, den Unterschied, der zwischen ihnen besteht, auf die richtige Art klarzumachen: meinen Töchtern einzuprägen, wer sie sind, ohne daß sie deswegen auf ihre Cousine herabschauen, und diese wiederum, ohne sie allzusehr zu entmutigen, nicht vergessen zu lassen, daß sie keine Miss Bertram ist. Ich wünsche, daß sie sehr gute Freundinnen werden, und möchte um keinen Preis bei meinen Töchtern die geringste Überheblichkeit gegenüber ihrer Cousine fördern, aber darum werden sie doch niemals Gleichgestellte sein. Ihr Rang, ihr Vermögen, ihre rechtmäßigen Ansprüche und Erwartungen müssen und werden immer verschieden sein. Das ist ein sehr heikler Punkt, und Sie müssen uns in unseren Bemühungen beistehen, genau die richtige Linie zu treffen.»
Mrs. Norris erklärte sich ganz zu seinen Diensten; und wenn sie ihm auch darin beistimmte, daß es eine äußerst schwierige Sache sei, ermutigte sie ihn doch zu der Hoffnung, daß sie es mit vereinten Kräften leicht schaffen würden.
Man wird ohne weiteres glauben, daß Mrs. Norris ihrer Schwester nicht vergeblich schrieb. Mrs. Price schien zwar etwas erstaunt, daß man sich für ein Mädchen entschieden hatte, wo sie doch so viele prächtige Söhne besaß, nahm jedoch das Anerbieten dankbarst an und versicherte, daß ihre Tochter ein wohlgeratenes, gutartiges Kind sei, das ihnen sicher niemals Anlaß geben würde, sie wieder von sich zu stoßen. Sie schilderte sie des weiteren als etwas zart und schwächlich, drückte aber ihre zuversichtliche Hoffnung aus, daß die Luftveränderung eine wesentliche Besserung bewirken würde. Arme Frau! Sicherlich dachte sie dabei, daß allen ihren Kindern eine Luftveränderung guttun würde.
2. Kapitel
Das kleine Mädchen legte die lange Reise glücklich zurück und wurde in Northampton von Mrs. Norris in Empfang genommen, die sich auf diese Weise den Ruhm errang, sie als Allererste willkommen zu heißen, um sie dann, im Bewußtsein der eigenen Wichtigkeit schwelgend, den anderen zuzuführen und ihrem Wohlwollen zu empfehlen.
Fanny Price war damals gerade zehn Jahre alt, und obwohl sie auf den ersten Blick nichts besonders Gewinnendes an sich hatte, lag doch in ihrem Persönchen nichts, was ihre Verwandten abstoßen konnte. Sie war klein für ihr Alter und weder durch strahlende Farben noch durch sonst eine auffallende Schönheit ausgezeichnet. Überaus schüchtern und ängstlich, schien sie sich geradezu in sich selbst zu verkriechen, doch ihr Benehmen war, wenn auch linkisch, so doch nicht vulgär, sie hatte ein süßes Stimmchen, und wenn sie sprach, wirkte sie beinahe hübsch. Sir Thomas und Lady Bertram nahmen sie sehr gütig auf. Sir Thomas, der bemerkte, wie dringend sie der Ermutigung bedurfte, tat sein möglichstes, um sie aufzumuntern, doch sein strenges, gewichtiges Wesen war ihm dabei sehr hinderlich. Lady Bertram, die sich nicht halb soviel Mühe gab und auf zehn seiner Worte höchstens eines äußerte, schien dem kleinen Mädchen dank ihrem gutmütigen Lächeln von vornherein die weniger schreckeinflößende Gestalt zu sein.
Die jungen Leute waren alle zu Hause und beteiligten sich sehr nett, mit viel Gutherzigkeit und Unbefangenheit an der Begrüßung, zumindest die beiden Söhne, die mit ihren sechzehn und siebzehn Jahren in den Augen der kleinen Cousine die ganze Erhabenheit erwachsener Männer besaßen. Verlegener wirkten die beiden Mädchen; als die Jüngeren empfanden sie mehr Scheu vor dem Vater, der sie bei diesem Anlaß recht ungeschickterweise durch längere Ansprachen auszeichnete, doch sie waren viel zu sehr an Gesellschaft und Bewunderung gewöhnt, um so etwas wie natürliche Schüchternheit zu besitzen. Der völlige Mangel an Selbstvertrauen ihrer kleinen Cousine erhöhte ihre eigene Zuversicht, so daß sie bald imstande waren, ihr Gesicht und ihr Kleid mit überlegener Gleichgültigkeit zu mustern.
Sie waren eine schöne Familie: die Söhne groß und gutaussehend, die Töchter ausgesprochen hübsch, alle prächtig gewachsen und für ihr Alter sehr gut entwickelt, so daß die jungen Verwandten sich in ihrem Äußeren nicht weniger auffällig unterschieden als in der gesellschaftlichen Gewandtheit, die sie ihrer Erziehung verdankten. Niemand hätte geglaubt, daß zwischen den Mädchen ein so geringer Altersunterschied bestand. Zwischen der Jüngeren und Fanny lagen nicht mehr als zwei Jahre. Julia Bertram war erst zwölf Jahre alt, Maria ein Jahr älter. Und über all dem fühlte sich der kleine Gast so unglücklich wie nur möglich. Angstvoll und in quälender Verlegenheit, voller Sehnsucht nach dem Elternhaus, das sie gerade erst verlassen hatte, wagte sie nicht, den Blick aufzuheben, und vermochte kaum ein hörbares Wort herauszubringen, ohne daß ihr die Tränen kamen. Mrs. Norris hatte auf der ganzen Fahrt von Northampton auf sie eingeredet, welch ein erstaunliches Glück ihr widerfahren sei und daß sie an Dankbarkeit und Artigkeit niemals genug tun könne, um sich dieser märchenhaften Fügung würdig zu zeigen. Ihr Kummer wurde noch durch das Bewußtsein gesteigert, daß es schlecht und verwerflich von ihr sei, sich nicht glücklich zu fühlen. Auch die Müdigkeit nach der langen, langen Reise war kein geringes Übel. Vergeblich war Sir Thomas’ gutgemeinte Herablassung, vergeblich die aufdringlichen Versicherungen von Mrs. Norris, daß sie doch bestimmt ein artiges Mädchen sein würde; umsonst lächelte Lady Bertram ihr zu und ließ sie sogar neben sich und Mops auf dem Sofa sitzen; ja selbst der Anblick einer Stachelbeertorte vermochte ihr keinen Trost zu bringen. Sie konnte kaum zwei Bissen hinunterwürgen, ehe die Tränen sie wieder überwältigten, und so wurde sie schließlich zu Bett geschickt, um im Schlaf ihren Kummer zu vergessen.
«Nun, das ist kein vielversprechender Anfang», bemerkte Mrs. Norris, sobald Fanny das Zimmer verlassen hatte. «Nach allem, was ich ihr unterwegs gesagt habe, hätte ich ein besseres Benehmen erwartet. Ich habe ihr erklärt, wieviel für sie davon abhängt, daß sie sich von Anfang an gut aufführt. Wir wollen nur hoffen, daß sie nicht bockig ist – ihre arme Mutter hatte einen sehr bockigen Charakter, aber mit einem Kind muß man nachsichtig sein – und ich weiß nicht, ob es tatsächlich gegen sie spricht, daß sie ungern ihr Elternhaus verläßt; mit all seinen Fehlern war es doch ihr Heim, und sie versteht noch nicht, was für einen guten Tausch sie gemacht hat. Immerhin darf man nichts übertreiben.»
Es dauerte jedoch länger, als Mrs. Norris zu gestatten geneigt war, bis Fanny sich mit der Neuheit von Mansfield Park und der Trennung von allen, an denen sie hing, abfand. Ihr Schmerz war tief, und da niemand ihn verstand, geschah auch nichts, um ihn zu lindern. Niemand meinte es böse mit ihr, doch es rührte auch niemand einen Finger, um es ihr behaglicher zu machen.
Der schulfreie Tag, der den Fräulein Bertrams eigens bewilligt wurde, damit sie sich in Muße mit ihrer Cousine bekannt machten, förderte die Freundschaft nur wenig. Nach der Entdeckung, daß Fanny nur zwei Schärpen besaß und niemals Französisch gelernt hatte, konnten sie nicht umhin, sie zu verachten; und als sie merkten, daß sie von dem Duett, das sie ihr liebenswürdigerweise vorspielten, sehr wenig beeindruckt war, blieb ihnen nichts übrig, als ihr großmütig ein paar unbeliebte Spielsachen zu schenken und sie sich selber zu überlassen, während sie ihrerseits sich der gerade im Schwange stehenden Lieblingsbeschäftigung zuwandten: künstliche Blumen verfertigen oder Goldpapier verwüsten.
Ob in der Nähe ihrer Cousinen oder fern von ihnen, ob im Schulzimmer, im Salon, im Garten – Fanny fühlte sich überall verlassen und verloren. Jeder Ort und jede Person flößten ihr Angst ein. Sie war entmutigt durch Lady Bertrams Schweigsamkeit, verängstigt durch Sir Thomas’ strenge Miene und ganz überwältigt von Mrs. Norris’ ständigen Ermahnungen. Die Cousinen demütigten sie durch Bemerkungen über ihre Kleinheit und verspotteten ihre Schüchternheit. Miss Lee staunte über ihre Unwissenheit, und die Stubenmädchen kicherten beim Anblick ihrer Kleider. Und wenn sich zu diesen Kränkungen die Erinnerung an ihre Geschwister gesellte, unter denen sie als Spielgefährtin, Lehrerin und Wärterin immer eine so wichtige Rolle gespielt hatte, wollte ihr das Herz verzagen.
Die Großartigkeit des Hauses beeindruckte sie, brachte ihr aber keinen Trost. Die Räume waren so groß und so hoch, daß sie sich nicht unbefangen darin bewegen konnte. Was sie berührte, fürchtete sie zu beschädigen. So schlich sie in ständiger Angst umher und verkroch sich oft in ihr eigenes Kämmerchen, um nach Herzenslust zu weinen. Das kleine Mädchen, über dessen unerhörtes Glück man sich abends, wenn es gute Nacht gesagt hatte, im Salon unterhielt, beschloß jeden kummervollen Tag damit, daß es sich in den Schlaf schluchzte. Auf diese Weise verging eine Woche, und ihr stilles, passives Wesen ließ nichts von ihrem Jammer ahnen, bis eines Morgens ihr Vetter Edmund, der jüngere der beiden Söhne, sie weinend auf der Treppe zum Dachboden kauern sah.
«Mein liebes, kleines Cousinchen», sagte er mit der ganzen Freundlichkeit eines vortrefflichen Charakters, «was ist denn passiert?» Er setzte sich zu ihr und gab sich alle Mühe, ihre Beschämung, in dieser Lage überrascht zu werden, zu überwinden und sie zum Sprechen zu bringen. War sie krank? Hatte jemand sie gescholten? Oder hatte es mit Maria und Julia Streit gegeben? Vielleicht verstand sie ihre Aufgabe nicht, und er könnte es ihr erklären? Gab es nichts, was er ihr bringen oder für sie tun könnte? Lange Zeit brachte er nichts anderes aus ihr heraus als abgerissene Worte: «Nein, nein – wirklich nicht –, danke, nein …» Doch er ließ nicht locker, und kaum hatte er begonnen, von ihrem Elternhaus zu sprechen, als ihr heftiger werdendes Schluchzen ihm den Grund ihres Kummers verriet. Er versuchte, sie zu trösten.
«Du bist traurig, weil du deine Mama verlassen mußtest, meine liebe, kleine Fanny», sagte er. «Das zeigt, daß du ein sehr liebes, gutes Mädchen bist. Aber denke daran, du bist hier bei deinen nächsten Verwandten, die dich liebhaben und glücklich machen möchten. Komm, gehen wir ein bißchen im Park spazieren. Du mußt mir von deinen Geschwistern erzählen.» Als er die Sache weiterverfolgte, entdeckte er, daß unter allen Geschwistern, an denen ihr kleines Herz hing, einer war, bei dem ihre Gedanken öfter als bei den übrigen weilten. Es war William, von dem sie immer wieder sprach und nach dem sie sich am meisten sehnte, William, der Älteste, ein Jahr älter als sie, ihr ständiger Gefährte und bester Freund, in jeder Not ihr Fürsprecher bei der Mutter (deren Liebling er war). William hätte nicht leiden wollen, daß sie wegginge – er hatte gesagt, es würde ihm bange nach ihr sein …
«Aber William wird dir doch sicher schreiben?» – Ja, das hätte er versprochen, aber gesagt, sie müsse zuerst schreiben. – «Und wann schreibst du ihm?» Sie ließ den Kopf hängen und antwortete zögernd, sie wisse nicht – sie habe kein Papier …
«Wenn das die ganze Schwierigkeit ist, werde ich dir Papier geben und alles, was du sonst brauchst, und du kannst schreiben, wann du Lust hast. Würde es dir Freude machen, ihm einen Brief zu schicken?»
«O ja – sehr!»
«Dann tun wir es gleich. Komm, gehen wir ins Frühstückszimmer, dort finden wir alles Nötige und bleiben ganz ungestört.»
«Aber – wird der Brief auch zur Post kommen?» «Verlaß dich auf mich. Er wird mit allen anderen Briefen zusammen abgeschickt werden, und William braucht nichts dafür zu bezahlen, weil dein Onkel ihn frankieren wird.»
«Der Onkel!» wiederholte Fanny erschrocken. «Ja, wenn du den Brief geschrieben hast, werde ich ihn meinem Vater bringen, damit er ihn frankiert.» Fanny hielt das für ein kühnes Unterfangen, leistete aber
keinen weiteren Widerstand, und gemeinsam gingen sie ins Frühstückszimmer, wo Edmund ihr einen Bogen zurechtmachte und linierte – mit nicht geringerer Hilfsbereitschaft, als ihr eigener Bruder hätte zeigen können, und sehr wahrscheinlich mit größerer Präzision. Während sie schrieb, saß er die ganze Zeit neben ihr und kam ihr, je nach Bedarf, bald mit seinem Federmesser, bald mit seiner Orthographie zu Hilfe. Doch außer diesen Aufmerksamkeiten, die sie tief empfand, erwies er ihrem Bruder eine Freundlichkeit, die sie mehr als alles andere hinriß: er fügte mit eigener Hand Grüße an seinen Vetter William hinzu und sandte ihm beigeschlossen eine halbe Guinee. Fanny war von ihren Gefühlen so überwältigt, daß sie es für ausgeschlossen hielt, ihnen Ausdruck zu verleihen; doch ihre glückstrahlende Miene und ein paar naive Worte genügten, um ihre ganze Dankbarkeit und Freude zu offenbaren, und ihr Vetter begann sie interessant zu finden. Er plauderte weiter mit ihr, und alles, was sie sagte, überzeugte ihn von ihrem zärtlichen Gemüt und ihrem ernsthaften Streben, recht zu tun; ihre große Schüchternheit und ein sehr feines Empfinden für ihre Stellung empfahlen sie noch mehr seiner Aufmerksamkeit. Er hatte sie niemals wissentlich gekränkt, doch jetzt sah er, daß man ihr mit zu wenig tätiger Freundlichkeit entgegengekommen war. Er bemühte sich vor allem, ihre Angst vor sämtlichen Hausbewohnern zu zerstreuen, und gab ihr eine Menge gute Ratschläge, wie sie mit Maria und Julia spielen und fröhlich sein sollte.
Von diesem Tag an begann Fanny sich wohler zu fühlen. Sie wußte jetzt, daß sie einen Freund besaß, und die Freundlichkeit ihres großen Vetters verlieh ihr den anderen gegenüber mehr Mut. Das Haus schien ihr nicht mehr so fremd und seine Bewohner weniger furchterregend; wenn es unter ihnen auch welche gab, die ihr immer Angst einflößen würden, begann sie doch wenigstens, sich an ihre Art zu gewöhnen und sich damit abzufinden. Die kleinen Ungeschicklichkeiten und Tölpeleien, die anfangs auf alle Hausbewohner und nicht zuletzt auf sie selber so peinlich gewirkt hatten, verschwanden von selbst. Sie zitterte nicht mehr vor Angst, wenn sie vor ihrem Onkel erscheinen mußte, und Tante Norris’ Stimme ließ sie nicht mehr ganz so heftig aufschrecken. Ihren Cousinen wurde sie mit der Zeit eine ganz annehmbare Spielgefährtin. Wenn sie auch an Alter und Kräften nicht an sie heranreichte und daher unwürdig war, bei allem mitzutun, gab es doch Spiele, bei denen man gut eine Dritte brauchen konnte, besonders wenn diese Dritte von nachgiebigem, gefälligem Wesen war, so daß die Mädchen, wenn Tante Norris sich nach Fannys Sünden erkundigte oder Bruder Edmund für Fannys Rechte eintrat, großmütig erklären konnten, daß Fanny «ein ganz gutes Ding» sei.
Edmund selbst war unveränderlich lieb und gut zu ihr, und von Tom hatte sie nichts Schlimmeres zu erdulden als die Scherze, die jeder junge Mann von siebzehn Jahren einem zehnjährigen Mädelchen gegenüber für angebracht hält. Er trat gerade in die Welt ein und befand sich in der zuversichtlichen Hochstimmung und der großmütigen Laune eines ältesten Sohnes, der einzig zum Zweck des Amüsierens und Geldausgebens geboren zu sein meint. Die Aufmerksamkeiten, mit denen er seine kleine Cousine beehrte, entsprachen ganz seiner privilegierten Stellung: er machte ihr hübsche Geschenke und lachte sie aus.
Je mehr sich Fannys Aussehen und Benehmen besserten, mit desto größerer Befriedigung betrachteten Sir Thomas und Mrs. Norris ihr gutes Werk. Sie waren sich einig, daß sie zwar nichts weniger als gescheit, aber ein lenksames, kleines Geschöpf wäre, das ihnen keinen wesentlichen Ärger verursachen würde. Diese geringe Meinung von Fannys Fähigkeiten wurde auch von anderen geteilt. Fanny konnte lesen, schreiben und handarbeiten, aber mehr hatte man ihr nicht beigebracht. Ihre Cousinen hielten sie für unerhört dumm, weil sie von vielen Dingen, die ihnen längst vertraut waren, keine Ahnung hatte, und in den nächsten Wochen brachten sie ständig neue Berichte über Fannys Unwissenheit in den Salon. «Mama, denken Sie nur, sie kann die Landkarte von Europa nicht zusammenstellen – sie kennt nicht einmal die wichtigsten Flüsse Rußlands – sie hat nie etwas von Kleinasien gehört – sie weiß den Unterschied zwischen Aquarell und Pastell nicht! – Wie komisch! – Haben Sie je so etwas gehört?»
«Liebe Kinder», sprach dann wohl die feinfühlige Tante, «das ist wirklich arg, aber ihr könnt auch nicht erwarten, daß jeder so begabt ist und soviel gelernt hat wie ihr selber.»
«Aber, Tante, sie weiß rein gar nichts! Denken Sie nur, gestern abend haben wir sie gefragt, wie sie von hier nach Irland fahren würde, und sie hat gesagt, über die Insel Wight! Sie kennt nichts als die Insel Wight und nennt sie einfach ‹die Insel›, als ob es sonst auf der Welt keine Insel gäbe. Ich hätte mich geschämt, so dumm zu sein, als ich noch viel jünger war als sie. Ich kann mich überhaupt an keine Zeit erinnern, wo ich nicht schon eine Menge Dinge wußte, von denen sie keine Ahnung hat. Denken Sie nur, wie lang es her ist, daß wir die Könige von England in der richtigen Reihenfolge aufsagen gelernt haben, mit dem Datum der Thronbesteigung und den wichtigsten Ereignissen ihrer Regierung!»
«Ja», fiel die andere ein, «und die römischen Kaiser bis zu Severus hinunter und dazu noch die ganze heidnische Mythologie und alle Metalle, Halbmetalle, Planeten und berühmten Philosophen!»
«Das stimmt, mein Herzchen, aber ihr seid mit einem wunderbaren Gedächtnis begnadet, und eure arme Cousine hat wahrscheinlich überhaupt keines. Wie in allen anderen Dingen gibt es auch bei dem Gedächtnis der einzelnen Menschen große Unterschiede, und darum müßt ihr Mitleid mit euerer Cousine haben und sie nachsichtig behandeln. Vergeßt nicht, gerade weil ihr so gescheit und begabt seid, müßt ihr Bescheidenheit üben, denn soviel ihr auch schon wißt, habt ihr doch noch viel zu lernen.»
«Ja, ich weiß, bis wir siebzehn Jahre alt sind. Aber ich muß Ihnen noch etwas von Fanny erzählen, es ist zu komisch. Denken Sie nur, sie sagt, sie möchte weder Musik noch Zeichnen lernen!»
«Das ist wirklich sehr dumm von ihr und beweist einen großen Mangel an Ehrgeiz und Talent, mein Herzchen. Aber ich weiß nicht, ob es nicht im Grunde besser so ist, denn ihr wißt ja (ich selbst habe es euch gesagt), wenn eure guten Eltern auch so edel sind, sie mit euch zusammen zu erziehen, so ist es doch durchaus nicht nötig, daß sie so gebildet wird wie ihr. Im Gegenteil, es ist viel wünschenswerter, daß ein Unterschied bestehenbleibt.»
Das waren die Ratschläge, die Mrs. Norris zur Erziehung ihrer Nichten beisteuerte, und es ist nicht verwunderlich, daß es ihnen bei all ihren vielversprechenden Talenten und Kenntnissen doch völlig an einigen weniger verbreiteten Fertigkeiten mangelte, wie etwa Selbsterkenntnis, Großmut und Bescheidenheit. Alles an ihnen wurde vortrefflich ausgebildet – bis auf das Gemüt. Sir Thomas wußte nichts von diesem Mangel, denn obwohl er ein wahrhaft treubesorgter Vater war, verstand er es nicht, seine Zärtlichkeit zu zeigen, und seine zurückhaltende Art dämpfte jeden Gefühlserguß.
Lady Bertram kümmerte sich überhaupt nicht um die Erziehung ihrer Töchter. Dazu hatte sie keine Zeit. Sie verbrachte den Tag hübsch angezogen auf ihrem Sofa über einer endlosen Handarbeit, die weder nützlich noch schön war, und interessierte sich mehr für Mops als für ihre Kinder, zeigte sich aber diesen gegenüber sehr duldsam, solange sie nicht ihre Bequemlichkeit störten. In allen wichtigen Angelegenheiten ließ sie sich von Sir Thomas, in den minder bedeutenden Fragen des Alltags von ihrer Schwester leiten. Auch wenn sie mehr Zeit gefunden hätte, sich ihren Töchtern zu widmen, wäre ihr dies überflüssig erschienen. Sie waren der Obhut einer Gouvernante und den richtigen Lehrern anvertraut, und mehr brauchten sie ja nicht. Was Fannys vermeintliche Dummheit beim Unterricht betraf, konnte Lady Bertram nur sagen, das sei schade, aber manche Menschen wären eben dumm, und Fanny müsse sich mehr Mühe geben; sie wüßte nicht, was man sonst tun könnte; und abgesehen von ihrer Dummheit könne sie dem armen, kleinen Ding nichts vorwerfen – im Gegenteil, sie fände sie sogar sehr flink und anstellig, wenn sie ihr etwas auszurichten oder zu holen auftrüge.
So lebte sich Fanny mit allen ihren Fehlern, als da sind Unwissenheit und Schüchternheit, in Mansfield Park ein, lernte ein gut Teil ihrer Anhänglichkeit an das Elternhaus auf ihr neues Heim zu übertragen und wuchs nicht gerade unglücklich neben ihren Cousinen auf. Maria und Julia waren nicht bösartig, und wenn sie Fanny auch oft überheblich behandelten, so dachte diese doch zu gering von sich, um sich beleidigt zu fühlen.
Etwa um die Zeit, als Fanny in die Familie eintrat, fühlte sich Lady Bertram durch leichte Kränklichkeit und große Trägheit bewogen, das Haus in London aufzugeben, wo sie bisher jedes Jahr einige Frühlingsmonate verbracht hatten. Sie blieb nun ständig auf dem Land und überließ es Sir Thomas, seine Pflichten im Parlament zu erfüllen, ohne sich viel den Kopf zu zerbrechen, ob ihre Abwesenheit zu seinem Behagen beitrug oder es schmälerte. Auf dem Lande fuhren die jungen Damen also fort, ihr Gedächtnis und ihre Duette zu üben und dabei unversehens zu großen, stattlichen Mädchen heranzuwachsen. Ihr Vater sah mit Befriedigung, daß ihr Aussehen, ihr Benehmen und ihre Bildung durchaus seine Erwartungen erfüllten. Sein ältester Sohn war leichtsinnig und verschwenderisch und hatte ihm schon viele Sorgen gemacht, doch von seinen anderen Kindern durfte er sich das Allerbeste versprechen. Solange seine Töchter den Namen Bertram trugen, würden sie ihm neuen Glanz verleihen, und wenn sie ihn einmal ablegten, durfte er hoffen, daß sie standesgemäße Verbindungen eingingen. Edmunds Charakter, sein ausgezeichneter Verstand und sein aufrechter Sinn sprachen dafür, daß er ein nützliches, geachtetes und glückliches Dasein führen würde. Er war zum Geistlichen bestimmt.
Über allen Sorgen und Freuden, die ihm seine eigenen Sprößlinge bereiteten, vergaß Sir Thomas die Kinder seiner armen Schwägerin nicht. Er unterstützte sie großzügig bei der Erziehung und Versorgung ihrer Söhne, sobald diese alt genug waren, einen Beruf zu wählen. Obwohl Fanny von ihrer eigenen Familie fast völlig abgeschnitten war, empfand sie jedesmal tiefste Befriedigung, wenn sie von der Güte ihres Onkels gegenüber ihren Brüdern oder von einer günstigen Wendung in deren Leben hörte. Ein Mal, ein einziges Mal in all den Jahren, ward ihr das Glück zuteil, mit William zusammenzukommen. Die übrigen bekam sie nie zu Gesicht; niemandem schien es in den Sinn zu kommen, daß sie einmal die Ihrigen besuchen könnte, und daheim schien niemand nach ihr zu verlangen. Doch William, der sich bald nach ihrer Übersiedlung entschlossen hatte, zur See zu gehen, wurde eingeladen, eine Woche bei seiner Schwester zu verbringen, ehe er seinen Dienst antrat. Man kann sich die Zärtlichkeit des Wiedersehens, die Seligkeit des Beisammenseins, die Stunden übermütiger Fröhlichkeit und die Augenblicke ernsthafter Beratung, die es mit sich brachte, lebhaft ausmalen – die zuversichtliche Zukunftsfreude und strahlende Laune des Bruders bis zum letzten Augenblick und den Schmerz der Schwester, als er endgültig gegangen war. Zum Glück fiel der Besuch in die Weihnachtsferien, so daß sie sich wenigstens bei ihrem Vetter Edmund Trost holen konnte; und er erzählte ihr so bezaubernd von Williams künftigen Taten und Ehren, daß sie nach und nach einzusehen begann, daß die Trennung auch ihre guten Seiten haben könnte. Edmunds Freundschaft versagte nie. Auch als er Eton verließ, um nach Oxford zu gehen, änderte sich nichts an seiner Zuneigung, und er fand eher noch häufiger Gelegenheit, sie zu beweisen. Ohne je zu betonen, daß er mehr für sie tat als die übrigen Familienmitglieder, oder zu befürchten, daß er zuviel tun könnte, trat er stets treulich und mit großer Feinfühligkeit für Fanny ein. Er bemühte sich, die anderen von ihren wertvollen Eigenschaften zu überzeugen und gleichzeitig Fannys Schüchternheit zu überwinden, die das Zutagetreten dieser guten Eigenschaften erschwerte. Ihm verdankte sie Rat, Trost und Ermutigung.
Da sie von allen anderen zurückgesetzt wurde, reichte seine Unterstützung allein nicht aus, sie in die erste Reihe zu stellen, doch ansonsten waren seine Bemühungen von unschätzbarem Wert für die Ausbildung ihres Geistes. Er wußte, daß sie klug war und eine rasche Auffassung sowie Vernunft und Feingefühl besaß. Allein ihre Leseleidenschaft mußte, unter der richtigen Leitung, zu wahrer Bildung führen. Miss Lee lehrte sie Französisch und hörte ihr die tägliche Geschichtslektion ab, doch Edmund wies sie auf die Bücher hin, die ihre Mußestunden verzauberten; er bestärkte sie in ihrem Geschmack und gab ihr ein sicheres Urteil. Erst durch ihn wurde das Lesen zur nützlichen Beschäftigung, weil er mit ihr über das Gelesene sprach und die Schönheiten eines Buches ins rechte Licht setzte. Zum Dank dafür liebte sie ihn mehr als jeden anderen Menschen auf Erden, William ausgenommen. Ihr Herz war zwischen beiden geteilt.
3. Kapitel
Das erste wichtigere Familienereignis, das eintrat, als Fanny etwa fünfzehn Jahre zählte, war der Tod von Pastor Norris. Es brachte natürlich gewisse Veränderungen und Umstellungen mit sich. Mrs. Norris verließ das Pfarrhaus und übersiedelte zuerst ins Herrenhaus und später in ein kleines Haus im Dorf, das zu Sir Thomas’ Besitz gehörte. Über den Verlust ihres Gatten tröstete sie sich mit der Überlegung, daß sie eigentlich sehr gut ohne ihn auskam, und über die Verminderung ihres Einkommens mit der Einführung noch drastischerer Sparmaßnahmen.
Die Pfarre war von jeher für Edmund bestimmt; wäre sein Onkel einige Jahre früher gestorben, hätte man sie ordnungsmäßig durch irgendeinen befreundeten Geistlichen betreuen lassen, bis Edmund alt genug wäre, sein Amt anzutreten. Doch Tom hatte inzwischen bereits soviel Geld verschwendet, daß es sich als notwendig erwies, anderweitig über die Pfründe zu verfügen, und der jüngere Bruder mußte für den Leichtsinn des älteren büßen. Zum Familienbesitz gehörte noch eine zweite Pfarre, die auf Edmund wartete, und dieser Umstand erleichterte Sir Thomas’ Gewissen ein wenig. Doch er empfand diese Regelung als arge Ungerechtigkeit gegenüber seinem jüngeren Sohn und bemühte sich ernsthaft, dieses Gefühl auch dem älteren einzuprägen; davon erhoffte er sich einen nachhaltigeren Eindruck als von allem, was er sonst sagen oder tun könnte.
«Ich erröte für dich, Tom», sprach er mit seiner würdevollsten Miene. «Ich erröte, daß ich gezwungen bin, zu diesem Mittel zu greifen, und ich darf wohl annehmen, daß auch du tiefe Beschämung empfindest. Du hast deinen Bruder für zehn, zwanzig, dreißig Jahre, vielleicht für sein ganzes Leben, um mehr als die Hälfte der ihm zustehenden Einkünfte gebracht. In Zukunft mag es mir oder dir (wie ich hoffe) möglich sein, ihm das einträglichere Amt zurückzuerstatten, aber du darfst nie vergessen, daß damit nicht mehr als sein selbstverständlicher Rechtsanspruch erfüllt würde und daß ihn in Wirklichkeit nichts für das sichere Einkommen entschädigen kann, das er jetzt durch die Dringlichkeit deiner Schulden verliert.»
Tom hörte seinem Vater zwar mit einiger Zerknirschung zu, entschlüpfte ihm aber so rasch wie möglich und war in seinem erfreulichen Egoismus bald imstande, einige tröstliche Überlegungen anzustellen: erstens, daß er nicht halb soviel Schulden gemacht hätte wie einige seiner Freunde, zweitens, daß sein Vater sich doch gar zu langweilig über die Sache ausgelassen hätte, und drittens, daß der nächste Inhaber der Pfarre, wer immer er sein mochte, ja doch aller Wahrscheinlichkeit nach bald sterben würde.
Der Nachfolger von Pastor Norris wurde ein gewisser Dr. Grant, der sich in Mansfield niederließ und als kräftiger Mann von fünfundvierzig Jahren nicht gerade geneigt schien, die freundlichen Erwartungen des jungen Mr. Bertram zu
erfüllen. Aber nein, meinte der, so ein kurzhalsiger, schlagflüssiger Kerl, der sich mit allen guten Dingen vollstopfte, würde schon rechtzeitig abkratzen.
Dr. Grant besaß eine um etwa fünfzehn Jahre jüngere Frau, aber keine Kinder, und dem Eintreffen des Paares gingen die üblichen wohlwollenden Gerüchte voraus, daß sie höchst achtbare und angenehme Leute seien.
Nun war der von Sir Thomas erwartete Zeitpunkt gekommen, zu dem, wie er stets geglaubt hatte, seine Schwägerin ihren Anspruch auf ihre Nichte geltend machen würde. Mrs. Norris’ veränderte Umstände und Fannys reiferes Alter schienen nicht nur angetan, alle früheren Bedenken gegen ein Zusammenleben der beiden zu zerstreuen, sondern ließen es im Gegenteil als die vorzüglichste Lösung erscheinen; da Sir Thomas’ Vermögenslage nicht nur durch die Verschwendungssucht seines ältesten Sohnes, sondern auch durch kürzlich erlittene Verluste aus seinen westindischen Besitzungen einigermaßen gelitten hatte, wäre es ihm nicht unerwünscht gewesen, von den Kosten für Fannys Unterhalt und der Verpflichtung ihrer künftigen Versorgung entlastet zu werden. Er war so fest davon überzeugt, es werde bald zu dieser Veränderung kommen, daß er seine Frau auf diese Wahrscheinlichkeit vorbereitete; und da Fanny zufällig anwesend war, als die Sache Lady Bertram zum erstenmal wieder in den Sinn kam, bemerkte diese in aller Ruhe: «Jetzt wirst du uns also verlassen, Fanny, und bei meiner Schwester leben. Wie wird es dir dort gefallen?»
Fanny war derart überrascht, daß sie nur die Worte ihrer Tante zu wiederholen vermochte:
«Sie verlassen, Tante?»
«Ja, mein Kind, warum verwundert dich das? Du bist jetzt fünf Jahre bei uns gewesen, und meine Schwester hatte stets die Absicht, dich zu sich zu nehmen, wenn ihr Mann nicht mehr da wäre. Aber du mußt trotzdem immer herüberkommen und mir meine Stickmuster einrichten.»
Die Nachricht war für Fanny ebenso schrecklich wie unerwartet. Sie hatte niemals etwas Gutes von ihrer Tante Norris erfahren und war nicht imstande, sie zu lieben.
«Es wird mir sehr schwerfallen, von hier fortzugehen», stammelte sie.
«Ja, Kind, das glaube ich dir. Das ist ganz natürlich. Es kann wohl keinem Menschen besser gehen, als es dir bei uns ergangen ist.»
«Ich hoffe, ich bin nicht undankbar, Tante», sagte Fanny bescheiden.
«Nein, liebes Kind, sicher nicht. Du warst immer ein sehr braves, gutes Mädchen.»
«Und ich soll niemals wieder hier leben?»
«Niemals, mein Kind. Aber du wirst ja auch dort ein behagliches Heim haben. Es kann für dich keinen Unterschied machen, in welchem Haus du wohnst, dort oder hier.»
Fanny verließ das Zimmer mit bleischwerem Herzen. Ihr erschien der Unterschied gewaltig, sie konnte nicht mit Gleichmut an ein Zusammenleben mit ihrer Tante denken. Sobald sie Edmund begegnete, gestand sie ihm ihren Kummer.
«Edmund», sagte sie, «mir steht etwas ganz Schlimmes bevor. Du hast es oft zuwege gebracht, mich mit Dingen auszusöhnen, die mir zuerst schrecklich vorgekommen sind, aber diesmal wird es dir nicht gelingen. Ich soll für immer zu Tante Norris übersiedeln.»
«Nein, wirklich!»
«Ja, Tante Bertram hat es mir gerade gesagt. Es ist schon fest abgemacht. Ich muß von hier fort und im Weißen Haus wohnen – wahrscheinlich, sobald sie dort eingerichtet ist.»
«Weißt du, Fanny, wenn der Plan dir nicht zuwider wäre, würde ich ihn ausgezeichnet finden.»
«O Edmund!»
«Bis auf deine Abneigung spricht alles dafür.
Es ist sehr vernünftig von Tante Norris, daß sie dich zu sich nehmen will. Sie könnte nirgends eine bessere Freundin und Gesellschafterin finden, und es freut mich, daß sie sich diesmal nicht von ihrem Geiz beeinflussen läßt. Du wirst ihr eine Tochter sein. Macht es dir wirklich so großen Kummer, Fanny?»
«Ja, ich bin sehr unglücklich. Hier habe ich alles so lieb – das Haus und alles. Dort ist nichts, was ich liebhaben kann. Du weißt ja, wie Tante Norris zu mir ist.»
«Als Kind hat sie dich wirklich nicht nett behandelt – in diesem Punkt kann ich sie nicht in Schutz nehmen. Aber zu uns war sie nicht viel anders – sie hat es nie verstanden, mit Kindern umzugehen. Jetzt, wo du bald erwachsen bist, wird das anders werden. Es kommt mir vor, daß sie dich schon jetzt freundlicher behandelt. Und wenn du erst ihre ständige Gefährtin bist, wirst du ihr sehr viel bedeuten – es kann gar nicht anders kommen.»
«Ich werde niemals einem Menschen etwas bedeuten.» «Warum nicht? Was sollte dich daran hindern?» «Alles … meine Stellung … meine Dummheit und Ungeschicklichkeit …»
«Was deine Dummheit und Ungeschicklichkeit betrifft, meine liebe, kleine Fanny, darfst du mir glauben, daß du keine Spur davon besitzt, außer wenn du so unpassendes Zeug redest. Jeder, der dich richtig kennt, wird dich schätzen und lieben. Du hast einen guten Verstand, ein liebes, sanftes Wesen und ein dankbares Gemüt, das keine Freundlichkeit unerwidert lassen kann. Ich wüßte nicht, wer sich besser zur Freundin und Gesellschafterin eignen könnte.»
«Du bist zu gut», sagte Fanny, über solches Lob errötend. «Wie kann ich dir jemals genug für deine gute Meinung danken? Ach, Edmund, wenn ich von hier weg muß, werde ich bis zu meiner letzten Stunde niemals vergessen, wie gut du zu mir gewesen bist.»
«Ich will hoffen, daß du mich von hier bis zum Weißen Haus nicht vergessen wirst», sagte Edmund lachend. «Fanny, du tust, als müßtest du zweihundert Meilen weit reisen, anstatt einfach den Park zu durchqueren. Du wirst genau so zu uns gehören wie bisher, wir werden an jedem Tag, den Gott gibt, zusammenkommen. Der einzige Unterschied wird darin bestehen, daß du, wenn du mit der Tante allein lebst, dich besser entfalten wirst. Hier gibt es zu viele, hinter denen du dich verstecken kannst. Bei ihr wirst du gezwungen sein, den Mund aufzutun und deine Meinung zu äußern.»
«Ach, sag das nicht!»
«Doch, ich muß es sagen, und ich sage es gern. Gerade jetzt scheint mir Tante Norris viel geeigneter, sich um dich zu kümmern, als meine Mutter. Es liegt in ihrer Natur, daß sie sich höchst energisch für jeden Menschen einsetzt, an dem sie wirklich Interesse hat. Sie wird dich dazu bringen, daß du dich selber richtig einschätzest.»
Fanny seufzte. «Ich kann es nicht so ansehen wie du», sagte sie. «Ich möchte gern glauben, daß du recht hast, und ich bin dir schrecklich dankbar, daß du mir helfen willst, mich mit dem Unabwendbaren abzufinden. Wenn ich nur denken dürfte, daß der Tante wirklich etwas an mir liegt! Es wäre so schön, zu wissen, daß ich einem Menschen etwas sein kann! – Hier, das weiß ich, bin ich niemandem wichtig, und doch hänge ich so sehr an dem Ort.»
«Den Ort, Fanny, wirst du nicht verlassen, auch wenn du das Haus verläßt. Du wirst ganz wie immer über Park und Garten verfügen. Sogar dein anhängliches kleines Herz braucht über eine Veränderung, die nur dem Namen nach eine ist, nicht zu erschrecken. Du wirst die gleichen Spaziergänge machen, deine Bücher aus der gleichen Bibliothek wählen, die gleichen Gesichter um dich sehen, auf dem gleichen Pferd reiten – genau wie bisher.»
«Ja, das ist wahr. Mein liebes, altes graues Pony! Ach, Edmund, wenn ich daran denke, wie ich mich vor dem Reiten gefürchtet, mit welcher Angst ich zugehört habe, wenn die Rede darauf kam, daß es mir guttun würde! (Wie habe ich immer gezittert, daß Onkel den Mund auftun würde, wenn das Gespräch auf Pferde kam!) Und wenn ich mich erinnere, wie lieb du dich bemüht hast, mir Vernunft zuzusprechen und mir meine Angst auszureden und zu versichern, daß es mir nach einer Weile Freude machen würde – und wenn ich denke, wie recht du behalten hast, könnte ich beinahe hoffen, daß du auch diesmal richtig prophezeist.»
«Siehst du! Und ich bin ganz überzeugt, daß das Zusammenleben mit Tante Norris deinem Geist und Gemüt ebenso guttun wird wie das Reiten deiner Gesundheit, und daß es dir Glück bringen wird.»
Damit endete das Gespräch. Was seinen praktischen Nutzen für Fanny betraf, hätte es ebensogut nicht stattfinden können, denn Mrs. Norris hatte nicht die leiseste Absicht, sie zu sich zu nehmen. Auch jetzt war ihr diese Möglichkeit nur als eine Gefahr in den Sinn gekommen, die sie sorgfältig zu vermeiden gedachte. Um allen diesbezüglichen Erwartungen vorzubeugen, hatte sie unter den Häusern der Pfarrgemeinde das allerkleinste gewählt, das noch als halbwegs herrschaftlich gelten konnte; das sogenannte «Weiße Haus» bot gerade Raum für sie, ihre Dienstboten und ein Gastzimmer, dessen Unentbehrlichkeit Mrs. Norris unablässig betonte. Das Gastzimmer im Pfarrhaus war niemals benützt worden, jetzt aber vergaß sie bei keiner Gelegenheit zu bemerken, daß sie für allfällige Besuche unbedingt ein Gastzimmer benötige. Jedoch alle ihre Vorsichtsmaßnahmen schützten sie nicht davor, daß man ihr bessere Absichten zutraute; vielleicht hatte auch gerade ihr ständiges Herumreiten auf der Notwendigkeit eines Gastzimmers Sir Thomas zu der Annahme verführt, es sei in Wirklichkeit für Fanny bestimmt. Eine beiläufige Bemerkung Lady Bertrams brachte Klarheit in die Sache.
«Ich denke, Schwester, wenn Fanny jetzt bei dir wohnen wird, brauchen wir Miss Lee nicht länger zu behalten.»
Mrs. Norris fuhr beinahe in die Luft. «Bei mir wohnen? Meine Liebe, was soll das heißen?»
«Ja, wird sie denn nicht bei dir wohnen? Ich dachte, du hättest es mit Sir Thomas abgemacht?»
«Ich? Niemals! Ich habe darüber mit keiner Silbe zu Sir Thomas gesprochen und er nicht zu mir. Fanny bei mir wohnen! Das Allerletzte, was jeder, der uns beide kennt, für wünschenswert halten könnte! Du meine Güte! Was sollte ich mit Fanny anfangen? Ich, eine arme, hilflose, verlassene Witwe, die zu nichts mehr taugt, die keine Kraft mehr hat – was sollte ich mit einem Kind in diesem Alter, einem fünfzehnjährigen Mädchen anfangen? Das ist genau das Alter, in dem sie ständige Beaufsichtigung brauchen und auch das geduldigste Gemüt auf eine harte Probe stellen. Sir Thomas kann es nicht so gemeint haben, dazu ist er mir ein zu guter Freund. Niemand, der es gut mit mir meint, könnte so etwas vorschlagen. Wie ist Sir Thomas darauf gekommen, dir davon zu sprechen?»
«Ich weiß wirklich nicht. Er hält es vielleicht für richtig.» «Aber was hat er gesagt? Er kann unmöglich gesagt haben, es sei sein Wunsch, daß ich Fanny zu mir nehme. Nein, das kann nicht sein aufrichtiger Wunsch sein!»
«Er hat nur gesagt, er hielte es für sehr wahrscheinlich – und ich habe das auch gedacht. Wir dachten beide, es würde dir ein Trost sein. Aber wenn du sie nicht willst, ist nichts weiter darüber zu sagen. Hier stört sie nicht.»
«Liebste Schwester, wie könnte sie mir ein Trost sein? Bedenke doch meinen unglücklichen Zustand! Hier sitze ich, eine arme, trostlose Witwe, die den besten aller Gatten verloren hat. Meine Gesundheit ist bei der schweren Pflege draufgegangen, von meiner seelischen Stimmung will ich gar nicht reden, meine Ruhe auf dieser Welt ist dahin, nichts ist mir geblieben! Ich habe kaum genug , um mich standesgemäß zu erhalten, um wenigstens so zu leben, daß ich dem Andenken des teuren Verschiedenen keine Schande mache – wie kann es mir da ein Trost sein, eine solche Last auf mich zu nehmen!
Sogar wenn ich es um meiner selbst willen wünschte, wäre es dem armen Mädchen gegenüber ein Unrecht. Hier ist sie in guten Händen und hat ein gesichertes Dasein. Ich muß mich allein durch meine Sorgen und Schwierigkeiten hindurchkämpfen, so gut ich es eben vermag.»
«Es macht dir also nichts, ganz allein zu leben?» «Liebste Schwester, tauge ich für etwas anderes als für Einsamkeit? Von Zeit zu Zeit hoffe ich einen lieben Gast in meinem bescheidenen Heim zu sehen (für meine Freunde wird stets ein Bett bereit sein), aber ansonsten werde ich den Rest meiner Tage in tiefster Abgeschlossenheit verbringen. Wenn ich nur recht und schlecht durchkomme – mehr verlange ich nicht.»
«Aber, Schwester, gar so schlecht geht es dir doch nicht. Sir Thomas sagt, du wirst über sechshundert Pfund im Jahr verfügen.»
«Ich klage nicht, Lady Bertram, ich klage nicht. Ich weiß, daß ich nicht mehr so leben kann wie früher. Da heißt es eben, sich einschränken, wo man kann, und besser haushalten lernen. Früher habe ich aus dem vollen gewirtschaftet, aber jetzt werde ich mich nicht schämen, Sparsamkeit zu üben. Meine Stellung hat sich ja ebensosehr verändert wie mein Einkommen. Vieles, was mein armer Norris seinem Amt als Pfarrherr der Gemeinde schuldig war, kann von mir nicht gefordert werden. Niemand weiß, wie viele Bedürftige in unserer Küche mitgegessen haben. Im Weißen Haus wird strengere Aufsicht geführt werden. Ich muß mich eben nach meinem Einkommen richten, sonst gerate ich ins Elend. Und ich gestehe, es wäre mir eine große Befriedigung, wenn es mir gelänge, darüber hinaus noch jedes Jahr eine Kleinigkeit zurückzulegen.»
«Oh, das wird dir sicher gelingen. Das hast du doch immer getan, nicht wahr?»
«Mein Ziel, liebe Schwester, ist es, denen, die nach mir kommen, von Nutzen zu sein. Wenn ich reicher zu sein wünsche, ist es um deiner Kinder willen. Ich habe für niemand sonst zu sorgen. Ich wäre froh, wenn ich ihnen eine Kleinigkeit hinterlassen könnte, die ihrer nicht unwürdig ist.»
«Das ist sehr lieb von dir, aber mach dir um sie keine Gedanken. Sie werden sicher gut versorgt sein, das wird Sir Thomas schon veranlassen.»
«Du weißt ja, daß seine Einkünfte sich empfindlich verringern werden, wenn die Besitzung in Antigua weiterhin so schlecht trägt.»
«Ach, das wird bald in Ordnung kommen. Ich weiß, daß Sir Thomas deswegen schon einen Brief geschrieben hat.»
«Also, liebe Schwester», schloß Mrs. Norris, indem sie sich zum Gehen wandte, «ich kann nur wiederholen, daß es mein einziger Wunsch ist, deiner Familie von Nutzen zu sein – und falls Sir Thomas je wieder darauf zu sprechen kommt, daß ich Fanny zu mir nehmen sollte, wirst du ihm mitteilen können, daß meine angegriffene Gesundheit und meine seelische Stimmung das jetzt leider nicht zulassen. Abgesehen von allem anderen hätte ich gar kein Bett für sie, denn mein Gastzimmer muß ich meinen Freunden zur Verfügung halten.»
Lady Bertram erzählte ihrem Mann genug von diesem Gespräch, um ihn erkennen zu lassen, daß er sich in den Absichten seiner Schwägerin gründlich getäuscht hatte, und diese hatte von diesem Augenblick an auch nicht die leiseste Anspielung von ihm zu befürchten. Es erstaunte ihn nur, daß sie es ablehnte, etwas für die Nichte zu tun, für deren Adoption sie sich so eifrig eingesetzt hatte. Doch da sie es auch ihm gegenüber nicht an Andeutungen fehlen ließ, daß alles, was sie besaß, dereinst seinen Kindern gehören sollte, fand er sich bald mit dieser Bevorzugung ab, die für ihn vorteilhaft und schmeichelhaft war und ihn überdies befähigen würde, selber ein übriges für Fanny zu tun.
Fanny erfuhr bald, wie überflüssig ihre Angst vor einer Trennung gewesen war, und ihre kindliche Freude darüber tröstete Edmund ein wenig über seine Enttäuschung, denn er glaubte noch immer, daß der Plan zu ihrem Besten gewesen wäre. Mrs. Norris nahm das Weiße Haus in Besitz, die Grants trafen im Pfarrhaus ein, und nach diesen Ereignissen ging alles in Mansfield weiter seinen gewohnten Gang.
Die Grants erwiesen sich als liebenswürdige, gesellige Leute und erwarben sich rasch die Sympathie ihrer neuen Bekannten. Allerdings hatten sie auch ihre Fehler, wie Mrs. Norris bald herausbekam. Dr. Grant legte großen Wert auf gutes Essen und mußte jeden Tag ein üppiges Dinner haben; Mrs. Grant hingegen – anstatt alle Kunst aufzubieten, um ihn mit bescheidenen Mitteln zufriedenzustellen – hielt sich eine Köchin, die einen ebenso hohen Lohn bezog wie die Köchin in Mansfield Park selbst! Und die Hausfrau persönlich ließ sich kaum jemals in den Wirtschaftsräumen blicken! Von solchen Übelständen mit Gleichmut zu sprechen, lag einfach nicht in Mrs. Norris’ Natur. Und die Unmengen von Butter und Eiern, die jetzt regelmäßig im Pfarrhaus verbraucht wurden! Niemand habe mehr für großzügige Gastlichkeit übrig als sie selber, sagte Mrs. Norris – niemandem sei Kleinlichkeit verhaßter – sie dürfe wohl behaupten, daß es zu ihrer Zeit im Pfarrhaus an nichts gefehlt und daß es in keinem schlechten Ruf gestanden habe – aber eine solche Großtuerei sei ihr einfach unverständlich! In einer Landpfarre die große Dame spielen – das passe eben nicht, und sie möchte meinen, ihre eigene Vorratskammer sollte für Mrs. Grant gerade noch gut genug sein. Dabei habe Mrs. Grant nicht mehr als fünftausend Pfund Mitgift bekommen – soviel sie auch herumfrage, höre sie nichts anderes.
Lady Bertram lauschte diesen Ausbrüchen ohne großes Interesse. In die Entrüstung einer in ihrer Sparsamkeit gekränkten Hausfrau konnte sie sich nicht hineindenken, fühlte sich aber als anerkannte Schönheit durch den Umstand beleidigt, daß Mrs. Grant, die nicht einmal hübsch zu nennen war, sich so glänzend versorgt hatte. Sie drückte ihr Erstaunen über diesen Punkt fast ebensooft, wenn auch weniger weitläufig aus, wie Mrs. Norris ihrer Empörung über Mrs. Grants Verschwendungssucht Luft machte.
Diese Dinge hatten etwa ein Jahr lang einen willkommenen Gesprächsstoff abgegeben, als sich ein neues Ereignis ankündigte; und diesmal war es von solcher Bedeutung für die Familie, daß es wohl einigen Raum in den Gedanken und Unterhaltungen der beiden Damen beanspruchen durfte. Sir Thomas fand es notwendig, persönlich nach Antigua zu reisen, um seine dortigen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Er nahm seinen ältesten Sohn mit, den er auf diese Weise von einigen höchst unerwünschten Freunden loszumachen hoffte. Sie verließen England mit der Aussicht, fast ein Jahr lang fernzubleiben.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)