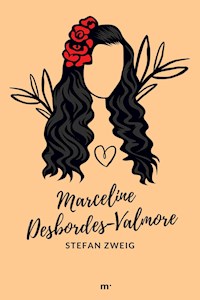
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Marceline Desbordes-Valmore war eine französische Schriftstellerin, Sängerin und Schauspielerin. Stefan Zweig verfasste die Biographie einer der bekanntesten Dichterinnen. #wenigeristmehrbuch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Zweig
Marceline Desbordes-Valmore
Das Lebensbild einer Dichterin
Die verlorene Kindheit
»D'un cœur de femme il faut avoir pitié, Quelque chose d'enfant s'y mèle à tous les âges.«
In der ersten Morgenröte des Jahrhunderts, im Kriegsjahre 1801 steuert eine kleine französische Karavelle Westindien zu, vierzig Tage und vierzig Nächte durch den unendlichen Ozean. Nur ganz Verwegene wagen ihr Leben damals an solche Fahrt, denn die englischen Fregatten durchkreuzen raubgierig das Meer und jagen jeder Napoleonsflagge als erwünschter Prise nach. Auf dem Verdeck zwischen Offizieren, Abenteurern, Kommissären und Kaufleuten, zwischen all den Heimatlosen des Wunsches und des Schicksals zwei weibliche Gestalten, eng aneinandergelehnt in ihrer Angst, wenn die Wellen wie gierige Tiere über Bord springen, zwei kranke und schwanke Gestalten, ein vierzehnjähriges Kind, blond und zart, eine kleine Madonna, mit ihrer sorgenvollen Mutter zur Seite. Stürme schüttern das schwanke Fahrzeug, tropische Sonne brennt auf die gerafften Segel, wenn in der Windstille das winzige Fahrzeug sich ohnmächtig in der endlos flimmernden Schwüle des Ozeans wiegt. Nachts blicken fremde Sterne herab auf das niedere Deck, wo sie auf und ab gehen, sorgenvoll und ohne Freund. Manchmal singt das kleine Mädchen mit ihrer gebrechlichen Silberstimme altmodische Romanzen, um die Mutter zu trösten und eine Heiterkeit vorzutäuschen, von der das eigene Herz nichts weiß.
Dieses vierzehnjährige blonde Mädchen unter fremden Sternen ist Marceline Desbordes, mit ihrem späteren Doppelnamen Marceline Desbordes-Valmore als Frankreichs größte Dichterin bekannt. Zu Douai in Nordfrankreich ist sie am 20. Juli 1786 geboren, in jenem flandrischen Grenzkreis, der von je der französischen Sprache die höchsten Meister des Liedes geschenkt hat: Verlaine, Samain, Rodenbach, Verhaeren, Lerberghe. Den Desbordes, einer alten Familie, steckt der Künstler im Blut. Der Oheim ist Maler, und auch der Vater, im Handwerk der Kunst verwandt, dankt behaglichen Wohlstand dem durchaus höfischen Beruf des Heraldikers und Schildermalers. Jahrzehntelang hat er die Karossen des Adels mit Emblemen geschmückt und mancherlei Prunkgerät mit Wappen und Spruch verziert. Aber die Revolution hat die Schlösser zertrümmert, die Karossen sind selten geworden und die Wappen zersplittert: aus gemächlicher Wohlhabenheit stürzt die Familie nieder in eine plötzliche Armut, und die grauen Schwestern Dürftigkeit und Sorge umschleichen das Haus. Der Erwerb ist verloren, nirgends in der Nähe Hilfe und Ersatz. Da beschließt die Mutter in phantastischer Kühnheit, Rettung von einem entfernten Verwandten in Guadeloupe zu erbitten, einem Plantagenbesitzer, von dessen Reichtum Legenden über das Meer gedrungen sind. Ohne sich von Vernunft und Gefahr abmahnen zu lassen, rüstet sie die Reise und nimmt als Begleiterin gerade das Schwächste, das Jüngste, das Liebste mit, die zwölfjährige Marceline, ein Kind, goldblond und zart, mit blaßrosig durchleuchtendem Antlitz wie das der Madonnen des van Eyck. Der Hafen wäre nahe, aber es fehlt den beiden das Geld zur Überfahrt. Nahezu zwei Jahre ziehen sie durch ganz Frankreich, ehe sie die Barschaft zusammengespart und gebettelt haben. Die Mutter ist untüchtig und schwächlich, so muß es Marceline, die Zwölfjährige, sein, die das Brot erwirbt, Tag für Tag. Im Alter der Sorglosigkeit, da andere Kinder noch mit ihren Puppen spielen, muß sie schon, wie Mignon, die Heimatlose, in Komödiantentruppen Dienst tun, muß täglich mit ihrer kindischen, fragilen Stimme Lieder singen und tanzen, um nur das Kärglichste der Notdurft zu verdienen. Und mit wie viel Tränen ist dies schmale Brot genetzt! Die Truppe, die sie aufnimmt, macht Bankrott, ein anderes Mal jagt sie eine unfreundliche Prinzipalin mit Schlägen davon, und vor dem Hungertod bewahrt sie nur das Mitleid gütiger Kameraden. Aber sie dulden alles, um nur hinüber zu gelangen ins Goldland, denn dort drüben harrt ihrer ja Reichtum, die Rettung. Sie hungern, sie betteln, sie frieren, sie darben sich durch von einem Ende Frankreichs bis zum andern, diese beiden Frauen; zwanzig Monate kämpfen sie, bis endlich in Bayonne jemand ihnen genügend Geld leiht oder schenkt, um die gefährliche Reise anzutreten. Vierzehn Jahre ist die kleine Marceline jetzt alt, aber ihre Kindheit ist unwiederbringlich untergegangen in Not und Sorge.
Und nun reisen sie über den Ozean vierzig glühende Tage, vierzig sterndunkle Nächte dem Vetter entgegen, der ihnen helfen soll. Aber ehe das Schiff landet, tauscht der Kapitän seltsame Signale mit denen am Ufer, und seine Mienen verdüstern sich. Entsetzliche Nachricht erwartet sie: Guadeloupe steht nicht mehr unter französischer Herrschaft, ein Aufstand der geknechteten Neger hat die Insel verwüstet. Und ihr Vetter, der reiche Plantagenbesitzer, auf den sie alle Hoffnungen gesetzt hatten, ist als einer der Ersten von der Meute ermordet worden. Ratlos stehen die beiden Frauen am Ufer, allein in einer ungeheuren Wildnis von Menschen und Dingen. Die Mutter trägt es nicht lange, das gelbe Fieber rafft schon in den ersten Tagen die Enttäuschte hinweg, und nun steht die vierzehnjährige Marceline ganz allein, meilenweit von der Heimat, unter fremden Menschen und Sternen, angewiesen auf das Mitleid oder Übelwollen von Unbekannten. Nichts an Grauen bleibt ihr erspart. Ein Erdbeben schüttert die Stadt, sie sieht Feuersäulen aus den harten Bergen brechen und die Häuser zusammenstürzen. Auf den Knieen bestürmt sie den Gouverneur, er solle ihr die Heimreise ermöglichen. Aber nach Wochen erst – nach namenlosen Wochen, von deren Elend niemand weiß – wird ihr Wunsch erfüllt, und siebenfach heimatlos, eine Waise, kehrt sie wieder zurück auf einem elenden Kauffahrteischiff, wieder vierzig Tage und vierzig Nächte. Das Kind ist das einzige weibliche Wesen auf dem Fahrzeug, und der Kapitän, ein trunkener und brutaler Geselle, sucht aus ihrer Verlassenheit Vorteil zu ziehen. Er stellt ihr nach, und die Erschreckte muß zu den Matrosen um Hilfe flüchten, die sie in einer Art humaner Revolte vor seinen Zudringlichkeiten schützen. Aus Rache fordert er nun Bezahlung für die Überfahrt und behält der Waise bei der Ausschiffung in Havre den kleinen Koffer zurück, der all ihre Habseligkeiten enthält. In schwarzen Trauerkleidern, ohne Geld und ohne Freunde steht die Fünfzehnjährige nun in der fremden Stadt, aber ihr Mut zur Entbehrung ist gestählt von all den bitteren Erfahrungen. Niemand weiß, wie sie sich weiter bis nach Lille geschleppt hat, wo sie einige Menschen kennt. Dort taucht sie im Jahre 1803 plötzlich auf, und freundliche Bekannte, von ihrem Schicksal gerührt, organisieren eine Theatervorstellung zu ihren Gunsten. Die Ankündigung, ein Kind, das aus dem Massaker von Guadeloupe gerettet sei, werde auftreten, bringt dem Theater einigen Zulauf und ihr genug Ertrag, daß sie endlich nach fast dreijähriger Wanderung wieder nach Douai in das Heimathaus zurückkehren kann. In traurige Stuben tritt sie dort mit ihrer bösen Botschaft ein. Der Vater bringt sich nur kümmerlich weiter, ihr Bruder, unfähig zu ernster Arbeit, ist aus Not Soldat geworden und kämpft in Spanien für Napoleon. Dunkel auch hier wie überall. Ein paar Tage bloß ruht sie aus bei den Ihren, dann wandert sie eilig weiter, um nicht länger zur Last zu fallen. Früh ruft sie das Leben: schon vom zwölften Jahre an wirft sich die ganze Notdurft der Existenz schwer auf die zwei schmalen Schultern und erdrückt ihr die Kindheit.
Die Schauspielerin
»Toujours du talent, mais trop de sensibilité.« Der offizielle Theater-Rapport von 1814
Die guten Bürger von Lille und Rouen sehen nun in diesen Jahren, wenn die Stafetten frohe Nachricht aus Napoleons Hauptquartier melden und sie, über die Weltlage beruhigt, ihrer Schaubühne Besuch abstatten, inmitten des heimischen Klüngels mäßiger Komödianten und abgetakelter Heroinen eine rührende Gestalt: ein halbreifes Mädchen von zartem Wuchs und verschüchtertem Gebaren, ernst und doch milde, keusch und doch nicht kühl. Aus Mignon ist Ophelia geworden, die Sanfte, die Schwärmerische; aber die frühe Strenge des in Sorgen verdüsterten Antlitzes wird schön beschwichtigt durch eine anziehende Kindlichkeit, die jedes Wort und selbst die flüchtigste Geste dieses Mädchens beseelt. Ihre Erscheinung ist gewinnend. Eine lichte Aureole von Blond umschmiegt Marcelines Gesicht, von dem nicht zu sagen ist, ob es jemals wahrhaft schön gewesen sei. Sie selbst, die Bescheidene, fand sich »laide aux larmes«, und die wenigen Bilder von ihr sind ungewiß und nicht recht authentisch. Aber die Kritiken aus jenen verblichenen Provinzgazetten wissen ihren Eindruck von damals deutlich zu beleben und bezeugen trotz ihrer ledernen Pathetik im letzten doch die gleichen Vorzüge ihres Wesens, die später die Dichterin inspirierten. Hier und dort, in jeder Kunstäußerung war ihr Zauber die tiefe Aufrichtigkeit einer Seele, die jedes und auch das unwertigste Gefühl mit einer wundervollen Kraft der Expansion ins Grenzenlose ausspannte, und dann jener innerste, vom Genie ihr eingesenkte Sinn für Musik. Dazu kam damals noch der Schimmer von Anmut, der ihre kindliche Gestalt umschwebte. Etwas Unirdisches und hold Sentimentales muß ihr damals zu eigen gewesen sein, etwas von der geheimnisvollen Magie der sanften Tiere, der rührenden Anmut der Rehe, der flüchtenden Leichtigkeit der Schwalbe, Schönheit von der Schönheit der wehrlosen Wesen, denen die Natur jede Waffe versagt hat, um ihnen dafür jenen Zauber der Seele zu schenken, der Rührung und Mitleiden schafft. Und wirklich: die Wehrlosen, die Leidenden, die unschuldig Gekränkten, das sind die Rollen, die Marceline damals zugewiesen sind. Niemals spielt sie die Heroinen, die Amoureusen; denn Leidenschaft, die begehrende und große, Pathos und Emphase, das glitzernde Funkenspiel der Koketterie sind ihr fremd. Sie vermag – hier ist Grenze und Größe der Dichterin und Schauspielerin – nur darzustellen, was ihrem eigenen Schicksal nahe ist. Damals wurde ihr noch die Rolle der Verfolgten zugeteilt, die gekränkte Waise, die verachtete Schäferin, das Aschenbrödel bei den bösen Schwestern, die verfolgte Unschuld, die liebende Tochter – alle diese himmelblau sentimentalen Mädchenfiguren, die wir noch besser als von jener verstaubten Literatur aus den affektierten Bildern Greuzes und den Kupfern der Almanache kennen. Aber diese Verlogenheit durchdringt sie mit Seele, weil ihre schon in kindlichen Jahren rege Güte selbst dies künstliche Schicksal mit Ergriffenheit überfühlt. Nur die seelische Sensibilität, die auf die geringste Vibration der Menschlichkeit mit stärkstem Ausbruch des Empfindens reagiert, macht sie als Schauspielerin bedeutsam. Und dann: sie hat die Träne, die leichte und doch die echte, nicht die erpreßte der Komödianten, sondern schon damals die der Dichterin, die Träne, die aus den Quellen eines heißen Herzens stammt und, aufsteigend in die Kehle, erst die Stimme warm durchschüttert, ehe sie feucht an den Wimpern blinkt.
Abend für Abend tritt sie vor die Rampe, und viele hundert bunte Schicksale hat sie in diesen zwei Jahren zur Freude der wackeren Bürger von Lille und Rouen dargestellt. Aber ihre wahre Existenz, die hinter den Kulissen, ist monoton und matt, ein freudloses proletarisches Dasein zwischen Arbeit und Entbehrung. Wenn oben die Kerzen verlöschen, der Vorhang sinkt, eilt sie müde nach Hause, wo die beiden Kostgängerinnen, ihre Schwestern, auf sie warten, die, ärmer noch als sie selbst, an ihrem armen Leben zehren. Bei der flackernden Lampe muß sie dann noch Kostüme schneidern, Kleider waschen, Rollen abschreiben, um sich mageren Zuschuß zu verdienen, und durch ein unerhörtes Mirakel der Aufopferung gelingt es ihr sogar, ab und zu von diesen achtzig Franken Gehalt etwas nach Hause zu senden. Aber unter welchen Entbehrungen sind diese Groschen gespart! Es ist oft das nackte Brot, das sie den Ihren opfert. »Man warf mir Blumen zu,« schreibt sie später »und ich kehrte hungernd nach Hause zurück, ohne es irgend jemandem zu verraten.« Und Marcelines ganzes Grauen vor ihrem Schicksal ermißt man an dem Schrei, mit dem sie zwanzig Jahre später, selbst in tiefster Notlage, davor zurückschreckt, ihre Tochter dem Theater zu geben: »Lieber sterben, als sie das erleben lassen, was ich selbst erlebte.«
Ein gnädiger Zufall erlöst sie von der Provinz. Die Künstler von der Opéra Comique, auf einem Gastspiel in Rouen, hören ein kleines Lied, von Marceline in einem der Stücke gesungen, und die Lieblichkeit ihrer Erscheinung sowie eine seltene Beseelung des Vortrags erwecken ihre Aufmerksamkeit. Sie verhelfen ihr zu einem Engagement nach Paris, an die Opéra Comique, und mit einem Male ist sie auf anderer Bahn, ist ohne Schulung und Übung Sängerin an einer Weltbühne. Grétry, der große Meister, wendet ihr seine väterliche Zuneigung zu, nennt sie »sa chère fille« und öffnet ihr sein Haus, gute Rollen werden ihr zugewiesen, obzwar ihre Stimme, die zarte, eigentlich nicht recht ausreicht und im weiten Saale zu verhauchen droht. Aber die Musiker, auch sie wie alle andern Kollegen von ihrem kindlichen Liebreiz und der schüchternen Güte ihres Wesens gewonnen, dämpfen mit Absicht, wenn sie singt, heimlich ihre Instrumente, damit ihr Gesang nicht gedeckt werde und besser zur Geltung komme. Fünf, sechs Jahre verbringt Marceline an dieser Bühne, eine drängende, geheimnisvolle Zwischenzeit. Das Kind in ihr ist längst versunken im Anstrom der Sorgen, der Flut der täglichen Geschäfte, aber auch die Frau in ihr ist noch nicht ganz wach. Denn noch haben die beiden Stimmen in ihr nicht geklungen, die sie in ihre wahre Welt erwecken und ihr harrendes Gefühl ins Grenzenlose heben: die Liebe und mit ihr die Dichtung.
Die Liebende
»Mon cœur fui créé pour n'aimer qu'une fois.«
Sie ist nun einundzwanzig Jahre alt. Ihr Gefühl, das übermächtige, hat sich bislang nur an kindliche Demut und schwesterliche Aufopferung verschwendet, jetzt aber tastet es weiter in die Welt, dies drängende »besoin d'aimer pour aimer«. Die Frucht ihres Gefühls ist reif. Unkund seiner Bestimmung gibt sie sich in dieser Zeit leidenschaftlich der Freundschaft hin, und am meisten wendet sich Marcelines Neigung einer jungen Griechin Delia zu, einer begabten Schauspielerin des gleichen Theaters. Zeitgenössische Beschreibungen schildern sie als eine übermütige, leichtfertige, sinnliche Frau. Wie immer wirkt hier Gegensätzlichkeit des Charakters als Anziehung. In ihrem Hause begegnet Marceline dem Verführer. Hier beginnt der tragische Roman ihres Lebens. Kapitel auf Kapitel können wir ihn aus ihren Gedichten lesen, Zug um Zug den Feldzugsplan ihres Verführers, das Ermatten ihres Widerstandes, die Peripetieen ihres Gefühls verfolgen, denn dies ist das Wunderbarste dieser Dichterin, daß sie, zaghaft im Wort und keusch im Wesen, sich bis auf das Letzte verriet in ihren Versen. Ihre Seele war immer nackt im Gedicht.
Delia spielt auch hier wie auf der Bühne die Rolle der Verführerin und Marceline die der Unschuld. Der Hauptakteur ist ein junger Dichter, Delias Geliebter, der »Olivier« der Elegieen. Die allererste Szene muß man sich ersinnen. Eines Tages (vielleicht hat Marceline eben die beiden verlassen) stellt der junge Dichter ganz absichtslos in heiterer Neugier die Frage an Delia nach ihrer Freundin Herzensangelegenheiten und staunt bei der verräterischen Mitteilung, die Zwanzigjährige noch völlig unschuldig zu wissen. Delia rät ihm lächelnd, sein Glück zu versuchen. Die Zumutung reizt und versucht ihn, sie verbinden sich beide übermütig zum Komplott, dies kühle Herz zu entflammen. Das nächste Mal schon setzt er sich an Marcelinens Seite und spricht Worte zu ihr, die sie beglücken und verwirren, er spricht mit seiner sanften Stimme, deren Schmelz sie in zahllosen Gedichten gerühmt und deren Zauber sie immer wieder unterlegen ist. Delia bleibt abseits, lächelnd und der verstatteten Abirrung ihres Geliebten neugierig froh. Unmerklich ebnet sie ihm die Wege und fördert durch Rat die leichte Mühe. Später, viel später erst begreift Marceline diese frivolen Zettelungen, später, zu spät, wie sie aufschreit:
»Ce perfide amant, dont j'évitais l'empire, Que vous aviez instruit dans l'art de me séduire, Qui trompa ma raison par des accents si doux, Je le hais encore plus que vous!«
Aber anfangs ist sie nur selig und verwirrt. Sie fühlt zwar gleichzeitig Gefahr; unbewußt, mit dem Instinkte schauert sie vor der Versuchung, sie sucht zu flüchten. Eine düstere Ahnung wetterleuchtet in den Himmel voll Glück: »Je l'ai prévu, j'ai voulu fuir.« Aber ihr klarer Wille will schon nicht mehr zurück. Zwar rettet sie sich zu ihren Schwestern und vertraut ihre Angst dem Gesang und der Dichtung, die zum erstenmal an dieser erhöhten Wärme des Gefühls in ihr aufkeimt, aber das Verhängnis ist schon im Zuge, sie ist ihm verfallen.
»J'étais à toi peut-être avant de t'avoir vu, Ma vie, en se formant fut promise à la tienne, Ton nom m'en avertit par un trouble imprévu, Ton âme s'y cachait pour éveiller la mienne. – Je l'entendis un jour et je perdis la voix, Je l'écoutais longtemps, j'oubliais de répondre, Mon être avec le tien venait de se confondre, Je crus, qu'on m'appelait pour la première fois.«
Er merkt ihre Verwirrung und seine Macht. Immer dringlicher werden seine Bewerbungen. Er spricht zu ihr in Délias Gegenwart, sie wagt ihm nicht zu antworten. Sie flüchtet aus dem Haus (Zug um Zug kann man die Szene aus ihrem Gedicht verfolgen), um ihm, nein, um sich selbst, ihrem eigenen Verlangen zu entgehen.
»Je fuyais tes regards, je cherchais ma raison, Je voulais, mais en vain, par un effort suprême, En me sauvant de toi me sauver de moi-même.«
Aber er folgt ihr auf die Straße. Sie sind zum erstenmal allein, sie erschreckt, schüchtern, mit klopfendem Herzen, er klug und berechnend. Mit unnachahmlichem Geschick weiß er an die einzige Saite ihres Herzens zu rühren, die bisher geklungen, an das Unglück. Er weiß, daß ihre Güte stärker ist als ihre Lust, und vertraut lieber dem Mitleid als Mittlerin, als stürmisch leidenschaftlicher Werbung. Er stellt sich traurig, melancholisch, heuchelt Weltschmerz und Überdruß, und sie, die Leiderfahrene, vergißt ihn zu fürchten, weil sie ihn leiden sieht und selbst das Leiden kennt. Die Tröstung scheint ihr eine Pflicht. Nun weigert sie ihm nicht mehr das Beisammensein, und rascher folgen nun die Kapitel im Roman ihrer Liebe. Ein Rendezvous wird vereinbart. Ihr ganzes Wesen fiebert ihm entgegen, vergebens sucht sie mit einem Buche ihre Ungeduld zu täuschen, aber ihr Herz spricht lauter und überschlägt alle Worte:
»Ah, je ne sais plus lire! Tous les mots confondus disent ensemble: il vient!«
Sie kann nicht mehr lesen, sie kann nicht mehr leben, sie kann nicht mehr atmen, sie kann nicht mehr schlafen. Aber alle diese Qualen liebt sie um seinetwillen, sie liebt diese Schlaflosigkeit, weil sie von Denken durchwirkt ist, von Denken an ihn:
»Je ne veux pas dormir; oh! ma chère insomnie, Quel sommeil aurait ta douceur?«
Und wenn er nun naht, so weiß sie nicht mehr zu fliehen, magnetisch hält seine Nähe sie fest:
»Hélas! Je ne sais plus m'enfuir comme autrefois!«
Schon ahnt sie, daß sie ganz an ihn verloren ist und jener große Sturm über ihre Sinne gekommen, den sie manchmal auf der Bühne durch fremdes Schicksal brausen sah. Ihre Angst ist längst nicht mehr Widerstreben, sie ist bloß Furcht vor dem Neuen, Furcht vor dem Glück. Sie erkennt sich erschreckt seinem Willen leibeigen und daß gar nicht mehr sie es ist, die dem Letzten noch widerstrebt. Er kann sie nehmen, wann er will, sie fühlt es, sie weiß es. Und der Aufschrei:
»Ma sœur, je n'avais plus d'appui que sa vertu«
sagt ihr ganzes Schicksal.
Er zögert nicht länger. Der Augenblick – auch einem minder Wissenden unverkennbar – ist gekommen. Er naht drängend und glühend. Ihre Tränen scheuchen ihn zurück, eine letzte kurze Sekunde lang, aber seine sanfte Stimme, diese Stimme, deren Bezauberung sie immer und immer wieder erlag, löst ihre Arme, und sie fühlt ihre Seele entfliehen in einem ersten Kuß:
»J'ai senti fuir mon âme effrayée et tremblante: Ma sœur, elle est encore sur sa bouche brûlante!«
Alle Bedenken des Gefühls und der Vernunft sind geschwunden, Vergangenheit und Zukunft gehen unter im Überschwang, die Sinne glühen auf:
»Et tout s'anéantit dans notre double flamme!«
Nun brechen Ekstasen aus ihren Versen, Feuergarben der Lust. Wie ein Sklave in die Freiheit stürzt sie in den Kerker dieser Leidenschaft. Nur wer das Glück nie gekannt hat, nur eine Frau, der wie Marceline die ganze Kindheit in tragischer Trauer sich verdüstert hatte, kann dermaßen aufglühen im Rausch. Sie, die nie wie die andern die Liebe vorgekostet in Spielen und Träumen, wird trunken von dem brennenden Trank seiner Lippen, sie jauchzt in der Seligkeit ihres Schwachseins, sie fiebert in der Lust, unter seiner Stimme zu erschauern. Fast zu viel scheint ihr seine Nähe, kaum kann sie »le bonheur accablant« seiner Gegenwart ertragen. Aber um wie viel furchtbarer ist doch der Wahnsinn des Ferneseins. Sie leidet im Zuviel des Glückes und verlangt sich doch immer noch mehr. Immer tiefer dringt sie ein in die Liebe:
»Tu ne sauras jamais comme je sais moi-même A quelle profondeur je t'atteins et je t'aime.«
Immer höher schwingt sich ihr Jubel auf, er zerreißt alle Dämme der Besinnung, und ihre ganze Seele flutet fessellos über in das neue Gefühl.
Tragödie
»II n'aimait pas ... J'aimais!«
Am 24 Juni 1810 trägt ein Beamter des Pariser Magistrats den Namen eines neugeborenen Kindes männlichen Geschlechts in die Register der Stadt ein und fügt der Meldung den bedeutsamen Vermerk bei: Vater unbekannt. Irgendein Freund Marcelinens dient als Zeuge, da »Olivier«, der geheimnisvolle Geliebte, nicht geneigt scheint, sich öffentlich zu bekennen. Jeder Legitimierung ihrer Beziehung, setzt er den Vorwand entgegen, sein Vater würde niemals in die Vermählung mit einer Schauspielerin einwilligen. In Wahrheit denkt er nur, das ihm lästige Verhältnis zu lösen. Marceline, mit allen Sinnen trunken von Liebe und Mutterglück, ahnt nichts von dem mählichen Erkalten seiner Leidenschaft. Sie glüht ihn an mit allen ihren Flammen, voll der Sorge um ihn gibt sie dem Fliehenden noch die zärtlichsten Wünsche mit, da er ihr ankündigt, er müsse verreisen, seinen Vater zu sehen, ihn zu überreden:
»Partir! tu veux partir! oui, tu veux voir ton père ... Va, dans tous les baisers d'un enfant qu'il adore Lui parler des baisers de l'enfant qu'il ignore: Mets sur son cœur mon respect, mon amour; Il est aussi mon pere, il t'a donné le jourl«
In Wirklichkeit promeniert der Ungetreue aber nach Italien und bleibt lange fern. Die Nachrichten von ihm fließen spärlich; aber sie, die unendlich Gütige, die Vertrauensvolle ahnt noch nicht die volle Wahrheit. Durch Zufall erfährt sie von seiner Rückkehr und zugleich das Entsetzliche, daß er längst mit einer anderen Frau in Beziehungen steht. Wie ein Blutsturz bricht die Erkenntnis aus ihr:
»Malheur à moi! Je ne sais plus lui plairel«
Mit einem Male wird sie der ganzen tragischen Wirklichkeit bewußt, und mit dem grauenhaften Irrtum erkennt sie schauernd die abgekartete Komödie, der sie zum Opfer gefallen. Sie erkennt, daß sie, auch diesmal wie so oft im Theater, ihr eigenes unendliches Gefühl an ein Spiel gewandt hat. Ihre Brust birst von Verzweiflung. Aber wem soll sie klagen, wem? Von Delia, der Freundin, ist sie verraten, alle andern Menschen hat sie vergessen, verloren über diesen einen. In dieser Herzensnot wirft sie sich an die Brust ihrer Schwester, und an sie gerichtet ist das unsterbliche Gedicht des Entsetzens, in dem die gellen Schreie der ersten Verzweiflung noch nicht in das strömende Metall der Worte eingeschmolzen sind. Spitz und heiß von ihrem Blute, durchstoßen die Schreie wie Dolche die zitternden Zeilen:
»Ma sœur, il est parti! Ma sœur, il m'abandonne! Je sais qu'il m'abandonne, et j'attends, et je meurs! Je meurs! Embrasse-moi! Pleure pour moi ... Pardonne! Je n'ai pas une larme, et j'ai besoin de pleurs. Tu gémis! Que je t'aime! Oh! jamais le sourire Ne te rendait plus belle aux plus beaux de nos jours.«
Sie weiß, daß er ihr verloren ist, aber sie will es nicht glauben. Sie betet, sie fleht um einen Betrug, um eine Hoffnung, weil sie die Wahrheit nicht ertragen kann. Gleichsam auf die Kniee wirft sie sich vor ihrer Schwester und bettelt, bettelt um eine fromme Lüge:
»Sans retour! Le crois-tu? Dis moi, que je m'égare, Dis, qu'il veut m'éprouver, mais qu'il n'est point barbare, Dis, qu'il va revenir, qu'il revient ... trompe-moi, Mais obtiens qu'il me trompe à son tour comme toi. Va le lui demander, va l'implorer ...«
Und dabei weiß sie ihn bei einer andern, sie weiß es, sie sieht es. In weißen, schlaflosen Nächten taucht das Bild greifbar nah auf:
»Oh comme il la regarde, oh comme il est près d'elle, Comme il lui peint l'ardeur qu'il feignit avec moi.«
Und sie flüchtet vor ihm, vor jeder Bewegung, vor seinem Blick, sie rettet sich zu ihren Schwestern auf das Land, in die Einsamkeit. Sie verläßt das Theater, sie gräbt sich ein in ihre Trauer, irgendwo in einem verlassenen Winkel Frankreichs. Das Kaiserreich stürzt um sie zusammen, die Völkerschlacht bei Leipzig wird geschlagen, die Kosaken ziehen ein in Paris, aber man spürt es nicht in ihren Versen, ihren Briefen. Ihre ganze Nation, Zeit und Raum, alles ist ihr, der echten Frau, gering gegen das Gefühl. Sie weiß nur, daß sie ihn liebt, noch immer liebt, trotzdem sie längst das verwegene Spiel durchschaut. Nur um den eigenen Stolz zu retten, das Gefühl zu entschuldigen, das dem Ungetreuen doppelt getreue, forscht sie im eigenen Verhalten nach einer Schuld. Sie sucht in sich einen Anlaß zu finden. Vergebens. Sie sucht und sucht in sklavischer Demut und muß es doch gegen den eigenen Willen verneinen:
»L'ai-je trahi? Jamais! Il eût mon âme entière; Hélas! j'étais étreint à lui comme le lierre.«
Aber trotz alledem gelingt es ihr nicht, ihn zu hassen, ihm zu zürnen. Resigniert gesteht sie's ein:
»Ah! je ne le hais pas, je ne sais point haïr«,
und bald weiß sie, daß es mehr ist als Nicht-Hassen; beschämt, vernichtet, erniedrigt wird sie gewahr, daß sie trotz alledem noch immer Liebe für ihn fühlt. Erschreckt vertraut sie es den Versen an, erschreckt über sich selbst:
»Ma sœur, je l'aime donc toujours, Quel aveu, quel effroi, quelle triste lumière.«
Und wie glücklich ist sie, da sie hört, daß er krank ist, wie glücklich, einen Vorwand zu finden vor sich selbst, ihn wieder lieben zu dürfen:
»Comment ne plus l'aimer quand il est malheureux.«
Endlich nach zwei Jahren Widerstand ist ihr ganz klar, daß keine Härte in ihr ist, kein Haß und kein Widerstand, und nichts als der Wunsch, ein einziger, brennender, glühender Wunsch, ihn wiederzusehen. Sie sucht, sie bettelt um eine Versöhnung, sie wendet sich an ihre Schwester, wendet sich selbst an Delia, die sie verraten hat, nur um ihn wiederzugewinnen. Bedingungslos kapituliert sie, erlöst gibt sie ihren Stolz preis:
»Fierté, j'ai plus aimé mon pauvre cœur que toi.«
Er läßt sich erbitten. Sie soll ihn wiedersehen. Und kaum daß sie es weiß, daß ihr Wunsch erfüllt werden soll, überkommt sie das alte Schreckgefühl. Sie zögert, sie sucht Entschuldigungen und findet sie schließlich:
»Dieu! sera-t-il encore mon maître? Mais, absent, ne l'était-il pas?«
Sie weiß, daß eine neue Verbindung nicht Glück mehr sein wird wie einst, ein Glück der Wollust und des Taumels, sondern ein Glück in Tränen, Glück des Mißtrauens; aber sie nimmt das Joch freudig auf sich, obwohl seiner Schwere bewußt. Wie eine Gefangene tritt sie vor ihn hin. Ihren Stolz hat sie zertreten und ihre Scham, schauernd beugt sie den Nacken für dieses Glück der Erniedrigung:
»Prenez votre victime et rendez lui sa chaîne, Moi, je vous rends un cœur encore tremblant d'amour.«
Constant Desbordes: Marceline Desbordes. Bleistiftzeichnung um 1820
Er hebt die Knieende zu sich empor, ein kurzes Zwischenspiel der Versöhnung beginnt. Aber dies von Demütigung und Mitleid genietete Beisammensein ist nicht von langer Dauer. Bald verläßt er sie wieder, und diesmal wird es ein Abschied für immer. Er verstrickt sich in andere Abenteuer, seine Gestalt verlischt im Namenlosen. Marceline faßt ihr Kind, ihren letzten Besitz, und wandert wieder zurück ins Leben. Die Zuflucht ihrer Liebe ist vernichtet, aber eine andere Macht im Tausch erstanden, Tröstung ihres Unglücks: die Dichterin in ihr ist geboren. Ihr Gefühl, zurückgestoßen von dem einen, entlädt sich nun gegen das All, beschwingte Verse entäußern ihre einsame Qual, ihre niedergehaltenen Tränen werden zu aufklingendem Kristall.
Der Verführer
»Mon secret c'est un nom.«
Musik hat ihrem Schmerz die Lippen entsiegelt. Jedes flüchtigste Beben ihres Herzens ist Strophe geworden, jeden Überschwang und jedes Verzagen ihres Gefühls hat sie ein Leben lang und immer noch in der feurigen Minute des Erleidens und Wiedererleidens lyrisch bekannt. Nackt und hüllenlos hat sie dem Winde der Welt jeden Schauer ihrer Sinne, jede Schmach ihrer Seele hingegeben, aber ihre Lippen blieben bis über die Todesstunde hinaus abwehrend verschlossen, wenn es den Namen galt, den Namen jenes einen Menschen, der diesen Sturm in ihr erweckte. Alles von sich hat sie verraten. Nur ihn nicht, der sie verriet.
Fünfzig Jahre jappt nun schon vergebens die französische Literaturgeschichte hinter diesem einen Geheimnis Marcelines her, Sainte-Beuve, ihr Freund und Vertrauter, allen voran. Mit Dissertationen und Kommentaren spüren sie auf allen ihren Wegen, ihren Biographieen nach, um den Namen dieses »Olivier« irgendwo aufzudecken, durch Licht und Schatten, durchs tausendfältig blühende Gestrüpp ihrer Verse folgt die ganze Meute jeder Spur, die sie arglos am Wege sinken ließ. Jedem Seufzer schnuppern sie nach, jede versickerte Träne graben sie auf: aber wunderbar und fast unbegreiflicherweise ist ihr schlichter Wille, die tiefe Scham ihres Verschweigens und die Pietät der nächsten Anverwandten bis heute noch immer stärker geblieben als ihre eitle Mühe. Mit keinem andern Namen ist er heute noch zu nennen als »Olivier«, dem Namen, den sie in ihren Versen ihm gibt und mit dem jener einzige erhaltene Liebesbrief zu ihm spricht. Siebzig Jahre, ein biblisches Menschenalter, nach ihrem Tode ist das Geheimnis noch so stark und unentweiht wie in jeder Stunde ihres Lebens.
Das wenige, das von ihm aufzuspüren gelang, weiß man nur durch sie, durch den Verrat ihrer Leidenschaft im Gedicht. Die eine Zeile bezeugt, daß er ein Dichter war und früh schon in engerem Kreise berühmt; jene andere Stelle stellt sein Alter fest, daß er um drei Jahre jünger war als sie selbst; viele Strophen rühmen die wunderbare, zärtliche, eindringliche Stimme, die sie immer und immer berauschte; und Briefe wiederum erzählen, daß er nach Italien ging und dort erkrankte. Der merkwürdigste Hinweis aber, der für die Feststellung immer entscheidend sein muß, geht von einem Gedichte aus. Dort sagt sie, daß in ihren Taufnamen ein gemeinsamer wiederkehrt. Sie sagt:
»Ton nom ... Tu sais, que dans mon nom le ciel daigna l'écrire«,
und späterhin nochmals:
»On ne peut pas m'appeler, sans te jeter vers moi, Car depuis mon baptême il m'enlace avec toi.«
Man mag denken, wie gierig die ganze Meute nachspürend in der Richtung dieses Fingerzeigs gestürmt ist. Marceline, Felicité, Josephe sind ihre drei Vornamen, und in der Scharade jenes andern Namens mußte also einer von ihnen wiederkehren. Dies und manch anderer flüchtiger Beweis hat die meisten verführt, Henri de Latouche als ihren Erlesenen zu vermuten. In Hyacinthe Joseph Alexandre Thabaud de Latouche ist Joseph die Bindung zu Marceline, auch der Beruf nähert sich dem Beweis, daß er ein Dichter und schon damals von einem gewissen Range war, und selbst die dritte Tatsache ist unbestreitbar, daß er als junger Mann zwei Jahre in Italien verbrachte und daß George Sand seine »sanfte und eindringliche« Stimme rühmt. Sainte-Beuve als Schnüffler und Indiskreter in Liebesdingen, der er war (durch seinen Vertrauensbruch wurden die Briefe Mussets an George Sand vorzeitig ausgeliefert), wollte auch hier den billigen Ruhm, schon zu Lebzeiten Marcelinens als Erster das Geheimnis aufgespürt zu haben. Er wollte Gewißheit und versuchte eine List, die nicht gerade edel genannt werden kann: eine Mitteilung eines Freundes ihrer besten Freundinnen mißbrauchend, der in manchen Andeutungen auf Latouche als den vermutlichen Liebhaber Marcelines hinwies, nahm er den Tod Latouches eilig zum Anlaß, einen jesuitisch geschickten Brief an Marceline zu richten, in dem er sie (als hätte er ihn nicht selbst vertraut gekannt) um Mitteilungen über seinen Charakter befragte. Seine geheime Hoffnung war, sie würde bei diesem schüchternen Klopfen alle Türen ihres Herzens öffnen und werde, sie, die aufrichtige, heroische und in ihrer Leidenschaft unbedachte Frau, in irgendeine Zeile ein gültiges Bekenntnis ihrer einstmaligen Neigung einfließen lassen.





























