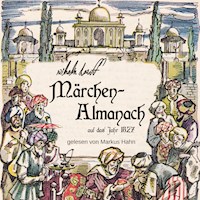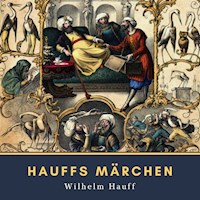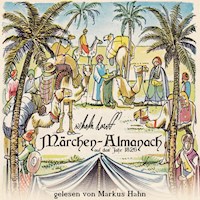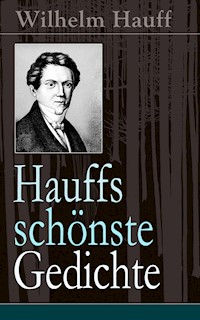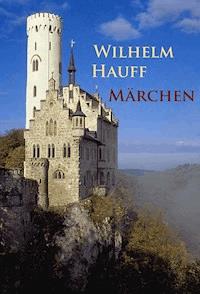
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Inhalt: Die Karawane Kalif Storch Die Geschichte von dem Gespensterschiff Die Geschichte von der abgehauenen Hand Die Errettung Fatmes Die Geschichte von dem kleinen Muck Das Märchen vom falschen Prinzen Der Scheik von Alessandria und seine Sklaven Der Zwerg Nase Der Affe als Mensch Die Geschichte Almansors Das Wirtshaus im Spessart Der Reußenstein Die Sage vom Hirschgulden Das kalte Herz Saids Schicksale Die Höhle von Steenfoll
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Märchen
Die Karawane
Es zog einmal eine große Karawane durch die Wüste. Auf der ungeheuren Ebene, wo man nichts als Sand und Himmel sieht, hörte man schon in weiter Ferne die Glocken der Kamele und die silbernen Röllchen der Pferde, eine dichte Staubwolke, die ihr vorherging, verkündete ihre Nähe, und wenn ein Luftzug die Wolke teilte, blendeten funkelnde Waffen und helleuchtende Gewänder das Auge. So stellte sich die Karawane einem Manne dar, welcher von der Seite her auf sie zuritt. Er ritt ein schönes arabisches Pferd, mit einer Tigerdecke behängt, an dem hochroten Riemenwerk hingen silberne Glöckchen, und auf dem Kopf des Pferdes wehte ein schöner Reiherbusch. Der Reiter sah stattlich aus, und sein Anzug entsprach der Pracht seines Rosses; ein weißer Turban, reich mit Gold bestickt, bedeckte das Haupt; der Rock und die weiten Beinkleider waren von brennendem Rot, ein gekrümmtes Schwert mit reichem Griff an seiner Seite. Er hatte den Turban tief ins Gesicht gedrückt; dies und die schwarzen Augen, die unter buschigen Brauen hervorblitzten, der lange Bart, der unter der gebogenen Nase herabhing, gaben ihm ein wildes, kühnes Aussehen.
Als der Reiter ungefähr auf fünfzig Schritt dem Vortrab der Karawane nahe war, spornte er sein Pferd an und war in wenigen Augenblicken an der Spitze des Zuges angelangt. Es war ein so ungewöhnliches Ereignis, einen einzelnen Reiter durch die Wüste ziehen zu sehen, daß die Wächter des Zuges, einen Überfall befürchtend, ihm ihre Lanzen entgegenstreckten.
»Was wollt ihr«, rief der Reiter, als er sich so kriegerisch empfangen sah, »glaubt ihr, ein einzelner Mann werde eure Karawane angreifen?«
Beschämt schwangen die Wächter ihre Lanzen wieder auf, ihr Anführer aber ritt an den Fremden heran und fragte nach seinem Begehr.
»Wer ist der Herr der Karawane?« fragte der Reiter.
»Sie gehört nicht einem Herrn«, antwortete der Gefragte, »sondern es sind mehrere Kaufleute, die von Mekka in ihre Heimat ziehen und die wir durch die Wüste geleiten, weil oft allerlei Gesindel die Reisenden beunruhigt.«
»So führt mich zu den Kaufleuten«, begehrte der Fremde.
»Das kann jetzt nicht geschehen«, antwortete der Führer, »weil wir ohne Aufenthalt weiterziehen müssen und die Kaufleute wenigstens eine Viertelstunde weiter hinten sind; wollt Ihr aber mit mir weiterreiten, bis wir lagern, um Mittagsruhe zu halten, so werde ich Eurem Wunsch willfahren.«
Der Fremde sagte hierauf nichts; er zog eine lange Pfeife, die er am Sattel festgebunden hatte, hervor und fing an in großen Zügen zu rauchen, indem er neben dem Anführer des Vortrabs weiterritt. Dieser wußte nicht, was er aus dem Fremden machen sollte; er wagte es nicht, ihn geradezu nach seinem Namen zu fragen, und so künstlich er auch ein Gespräch anzuknüpfen suchte, der Fremde hatte auf das: »Ihr raucht da einen guten Tabak«, oder: »Euer Rapp’ hat einen braven Schritt«, immer nur mit einem kurzen »Ja, ja!« geantwortet.
Endlich waren sie auf dem Platz angekommen, wo man Mittagsruhe halten wollte. Der Anführer hatte seine Leute als Wachen aufgestellt; er selbst hielt mit dem Fremden, um die Karawane herankommen zu lassen. Dreißig Kamele, schwer beladen, zogen vorüber, von bewaffneten Führern geleitet. Nach diesen kamen auf schönen Pferden die fünf Kaufleute, denen die Karawane gehörte. Es waren meistens Männer von vorgerücktem Alter, ernst und gesetzt aussehend, nur einer schien viel jünger als die übrigen, wie auch froher und lebhafter. Eine große Anzahl Kamele und Packpferde schloß den Zug.
Man hatte Zelte aufgeschlagen und die Kamele und Pferde rings umhergestellt. In der Mitte war ein großes Zelt von blauem Seidenzeug. Dorthin führte der Anführer der Wache den Fremden. Als sie durch den Vorhang des Zeltes getreten waren, sahen sie die fünf Kaufleute auf goldgewirkten Polstern sitzen; schwarze Sklaven reichten ihnen Speise und Getränke. »Wen bringt Ihr uns da?« rief der junge Kaufmann dem Führer zu.
Ehe noch der Führer antworten konnte, sprach der Fremde: »Ich heiße Selim Baruch und bin aus Bagdad; ich wurde auf einer Reise nach Mekka von einer Räuberhorde gefangen und habe mich vor drei Tagen heimlich aus der Gefangenschaft befreit. Der große Prophet ließ mich die Glocken eurer Karawane in weiter Ferne hören, und so kam ich bei euch an. Erlaubet mir, daß ich in eurer Gesellschaft reise! Ihr werdet euren Schutz keinem Unwürdigen schenken, und so ihr nach Bagdad kommet, werde ich eure Güte reichlich belohnen denn ich bin der Neffe des Großwesirs.«
Der älteste der Kaufleute nahm das Wort: »Selim Baruch«, sprach er, »sei willkommen in unserem Schatten. Es macht uns Freude, dir beizustehen; vor allem aber setze dich und iß und trinke mit uns.«
Selim Baruch setzte sich zu den Kaufleuten und aß und trank mit ihnen. Nach dem Essen räumten die Sklaven die Geschirre hinweg und brachten lange Pfeifen und türkischen Sorbet. Die Kaufleute saßen lange schweigend, indem sie die bläulichen Rauchwolken vor sich hinbliesen und zusahen, wie sie sich ringelten und verzogen und endlich in die Luft verschwebten. Der junge Kaufmann brach endlich das Stillschweigen: »So sitzen wir seit drei Tagen«, sprach er, »zu Pferd und am Tisch, ohne uns durch etwas die Zeit zu vertreiben. Ich verspüre gewaltig Langeweile, denn ich bin gewohnt, nach Tisch Tänzer zu sehen oder Gesang und Musik zu hören. Wißt ihr gar nichts, meine Freunde, das uns die Zeit vertreibt?«
Die vier älteren Kaufleute rauchten fort und schienen ernsthaft nachzusinnen, der Fremde aber sprach: »Wenn es mir erlaubt ist, will ich euch einen Vorschlag machen. Ich meine, auf jedem Lagerplatz könnte einer von uns den anderen etwas erzählen. Dies könnte uns schon die Zeit vertreiben.«
»Selim Baruch, du hast wahr gesprochen«, sagte Achmet, der älteste der Kaufleute, »laßt uns den Vorschlag annehmen.«
»Es freut mich, wenn euch der Vorschlag behagt«, sprach Selim, »damit ihr aber sehet, daß ich nichts Unbilliges verlange, so will ich den Anfang machen.«
Vergnügt rückten die fünf Kaufleute näher zusammen und ließen den Fremden in ihrer Mitte sitzen. Die Sklaven schenkten die Becher wieder voll, stopften die Pfeifen ihrer Herren frisch und brachten glühende Kohlen zum Anzünden. Selim aber erfrischte seine Stimme mit einem tüchtigen Zuge Sorbet, strich den langen Bart über dem Mund weg und sprach:
»So hört denn die Geschichte vom Kalif Storch.«
Als Selim Baruch seine Geschichte beendet hatte, bezeugten sich die Kaufleute sehr zufrieden damit. »Wahrhaftig, der Nachmittag ist uns vergangen, ohne daß wir merkten wie!« sagte einer derselben, indem er die Decke des Zeltes zurückschlug. »Der Abendwind wehet kühl, und wir könnten noch eine gute Strecke Weges zurücklegen.« Seine Gefährten waren damit einverstanden, die Zelte wurden abgebrochen, und die Karawane machte sich in der nämlichen Ordnung, in welcher sie herangezogen war, auf den Weg.
Sie ritten beinahe die ganze Nacht hindurch, denn es war schwül am Tage, die Nacht aber war erquicklich und sternhell. Sie kamen endlich an einem bequemen Lagerplatz an, schlugen die Zelte auf und legten sich zur Ruhe. Für den Fremden aber sorgten die Kaufleute, wie wenn er ihr wertester Gastfreund wäre. Der eine gab ihm Polster, der andere Decken, ein dritter gab ihm Sklaven, kurz, er wurde so gut bedient, als ob er zu Hause wäre. Die heißeren Stunden des Tages waren schon heraufgekommen, als sie sich wieder erhoben, und sie beschlossen einmütig, hier den Abend abzuwarten. Nachdem sie miteinander gespeist hatten, rückten sie wieder näher zusammen, und der junge Kaufmann wandte sich an den ältesten und sprach: »Selim Baruch hat uns gestern einen vergnügten Nachmittag bereitet, wie wäre es, Achmet, wenn Ihr uns auch etwas erzähltet, sei es nun aus Eurem langen Leben, das wohl viele Abenteuer aufzuweisen hat, oder sei es auch ein hübsches Märchen.« Achmet schwieg auf diese Anrede eine Zeitlang, wie wenn er bei sich im Zweifel wäre, ob er dies oder jenes sagen sollte oder nicht; endlich fing er an zu sprechen:
»Liebe Freunde! Ihr habt euch auf dieser unserer Reise als treue Gesellen erprobt, und auch Selim verdient mein Vertrauen; daher will ich euch etwas aus meinem Leben mitteilen, das ich sonst ungern und nicht jedem erzähle: die Geschichte von dem Gespensterschiff.«
Die Reise der Karawane war den anderen Tag ohne Hindernis fürder gegangen, und als man im Lagerplatz sich erholt hatte, begann Selim, der Fremde, zu Muley, dem jüngsten der Kaufleute, also zu sprechen:
»Ihr seid zwar der Jüngste von uns, doch seid Ihr immer fröhlich und wißt für uns gewiß irgendeinen guten Schwank. Tischet ihn auf, daß er uns erquicke nach der Hitze des Tages!«
»Wohl möchte ich euch etwas erzählen«, antwortete Muley, »das euch Spaß machen könnte, doch der Jugend ziemt Bescheidenheit in allen Dingen; darum müssen meine älteren Reisegefährten den Vorrang haben. Zaleukos ist immer so ernst und verschlossen, sollte er uns nicht erzählen, was sein Leben so ernst machte? Vielleicht, daß wir seinen Kummer, wenn er solchen hat, lindern können; denn gerne dienen wir dem Bruder, wenn er auch anderen Glaubens ist.«
Der Aufgerufene war ein griechischer Kaufmann, ein Mann in mittleren Jahren, schön und kräftig, aber sehr ernst. Ob er gleich ein Ungläubiger (nicht Muselmann) war, so liebten ihn doch seine Reisegefährten, denn er hatte durch sein ganzes Wesen Achtung und Zutrauen eingeflößt. Er hatte übrigens nur eine Hand, und einige seiner Gefährten vermuteten, daß vielleicht dieser Verlust ihn so ernst stimme.
Zaleukos antwortete auf die zutrauliche Frage Muleys: »Ich bin sehr geehrt durch euer Zutrauen; Kummer habe ich keinen, wenigstens keinen, von welchem ihr auch mit dem besten Willen mir helfen könntet. Doch weil Muley mir meinen Ernst vorzuwerfen scheint, so will ich euch einiges erzählen, was mich rechtfertigen soll, wenn ich ernster bin als andere Leute. Ihr sehet, daß ich meine linke Hand verloren habe. Sie fehlt mir nicht von Geburt an, sondern ich habe sie in den schrecklichsten Tagen meines Lebens eingebüßt. Ob ich die Schuld davon trage, ob ich unrecht habe, seit jenen Tagen ernster, als es meine Lage mit sich bringt, zu sein, möget ihr beurteilen, wenn ihr vernommen habt die Geschichte von der abgehauenen Hand.«
Zaleukos, der griechische Kaufmann, hatte seine Geschichte geendigt. Mit großer Teilnahme hatten ihm die übrigen zugehört, besonders der Fremde schien sehr davon ergriffen zu sein; er hatte einigemal tief geseufzt, und Muley schien es sogar, als habe er einmal Tränen in den Augen gehabt. Sie besprachen sich noch lange Zeit über diese Geschichte.
»Und haßt Ihr den Unbekannten nicht, der Euch so schnöd’ um ein so edles Glied Eures Körpers, der selbst Euer Leben in Gefahr brachte?« fragte der Fremde.
»Wohl gab es in früherer Zeit Stunden«, antwortete der Grieche, »in denen mein Herz ihn vor Gott angeklagt, daß er diesen Kummer über mich gebracht und mein Leben vergiftet habe; aber ich fand Trost in dem Glauben meiner Väter, und dieser befiehlt mir, meine Feinde zu lieben; auch ist er wohl noch unglücklicher als ich.«
»Ihr seid ein edler Mann!« rief der Fremde und drückte gerührt dem Griechen die Hand.
Der Anführer der Wache unterbrach sie aber in ihrem Gespräch. Er trat mit besorgter Miene in das Zelt und berichtete, daß man sich nicht der Ruhe überlassen dürfe; denn hier sei die Stelle, wo gewöhnlich die Karawanen angegriffen würden, auch glaubten seine Wachen, in der Entfernung mehrere Reiter zu sehen.
Die Kaufleute waren sehr bestürzt über diese Nachricht; Selim, der Fremde, aber wunderte sich über ihre Bestürzung und meinte, daß sie so gut geschätzt wären, daß sie einen Trupp räuberischer Araber nicht zu fürchten brauchten.
»Ja, Herr!« entgegnete ihm der Anführer der Wache. »Wenn es nur solches Gesindel wäre, könnte man sich ohne Sorge zur Ruhe legen; aber seit einiger Zeit zeigt sich der furchtbare Orbasan wieder, und da gilt es, auf seiner Hut zu sein.«
Der Fremde fragte, wer denn dieser Orbasan sei, und Achmet, der alte Kaufmann, antwortete ihm: »Es gehen allerlei Sagen unter dem Volke über diesen wunderbaren Mann. Die einen halten ihn für ein übermenschliches Wesen, weil er oft mit fünf bis sechs Männern zumal einen Kampf besteht, andere halten ihn für einen tapferen Franken, den das Unglück in diese Gegend verschlagen habe; von allem aber ist nur so viel gewiß, daß er ein verruchter Mörder und Dieb ist.«
»Das könnt Ihr aber doch nicht behaupten«, entgegnete ihm Lezah, einer der Kaufleute. »Wenn er auch ein Räuber ist, so ist er doch ein edler Mann, und als solcher hat er sich an meinem Bruder bewiesen, wie ich Euch erzählen könnte. Er hat seinen ganzen Stamm zu geordneten Menschen gemacht, und so lange er die Wüste durchstreift, darf kein anderer Stamm es wagen, sich sehen zu lassen. Auch raubt er nicht wie andere, sondern er erhebt nur ein Schutzgeld von den Karawanen, und wer ihm dieses willig bezahlt, der ziehet ungefährdet weiter; denn Orbasan ist der Herr der Wüste.«
Also sprachen unter sich die Reisenden im Zelte; die Wachen aber, die um den Lagerplatz ausgestellt waren, begannen unruhig zu werden. Ein ziemlich bedeutender Haufe bewaffneter Reiter zeigte sich in der Entfernung einer halben Stunde; sie schienen gerade auf das Lager zuzureiten. Einer der Männer von der Wache ging daher in das Zelt, um zu verkünden, daß sie wahrscheinlich angegriffen würden. Die Kaufleute berieten sich untereinander, was zu tun sei, ob man ihnen entgegengehen oder den Angriff abwarten solle. Achmet und die zwei älteren Kaufleute wollten das letztere, der feurige Muley aber und Zaleukos verlangten das erstere und riefen den Fremden zu ihrem Beistand auf. Dieser zog ruhig ein kleines, blaues Tuch mit roten Sternen aus seinem Gürtel hervor, band es an eine Lanze und befahl einem der Sklaven, es auf das Zelt zu stecken; er setze sein Leben zum Pfand, sagte er, die Reiter werden, wenn sie dieses Zeichen sehen, ruhig vorüberziehen. Muley glaubte nicht an den Erfolg, der Sklave aber steckte die Lanze auf das Zelt . Inzwischen hatten alle, die im Lager waren, zu den Waffen gegriffen und sahen in gespannter Erwartung den Reitern entgegen. Doch diese schienen das Zeichen auf dem Zelte erblickt zu haben, sie wichen plötzlich von ihrer Richtung auf das Lager ab und zogen in einem großen Bogen auf der Seite hin.
Verwundert standen einige Augenblicke die Reisenden und sahen bald auf die Reiter, bald auf den Fremden. Dieser stand ganz gleichgültig, wie wenn nichts vorgefallen wäre, vor dem Zelte und blickte über die Ebene hin. Endlich brach Muley das Stillschweigen. »Wer bist du, mächtiger Fremdling«, rief er aus, »der du die wilden Horden der Wüste durch einen Wink bezähmst?«
»Ihr schlagt meine Kunst höher an, als sie ist«, antwortete Selim Baruch. »Ich habe mich mit diesem Zeichen versehen, als ich der Gefangenschaft entfloh; was es zu bedeuten hat, weiß ich selbst nicht; nur so viel weiß ich, daß, wer mit diesem Zeichen reiset, unter mächtigem Schutze steht.«
Die Kaufleute dankten dem Fremden und nannten ihn ihren Erretter. Wirklich war auch die Anzahl der Reiter so groß gewesen, daß wohl die Karawane nicht lange hätte Widerstand leisten können.
Mit leichterem Herzen begab man sich jetzt zur Ruhe, und als die Sonne zu sinken begann und der Abendwind über die Sandebene hinstrich, brachen sie auf und zogen weiter.
Am nächsten Tage lagerten sie ungefähr nur noch eine Tagreise von dem Ausgang der Wüste entfernt. Als sich die Reisenden wieder in dem großen Zelt versammelt hatten, nahm Lezah, der Kaufmann, das Wort:
»Ich habe euch gestern gesagt, daß der gefürchtete Orbasan ein edler Mann sei, erlaubt mir, daß ich es euch heute durch die Erzählung der Schicksale meines Bruders beweise. Mein Vater war Kadi in Akara. Er hatte drei Kinder. Ich war der Älteste, ein Bruder und eine Schwester waren bei weitem jünger als ich. Als ich zwanzig Jahre alt war, rief mich ein Bruder meines Vaters zu sich. Er setzte mich zum Erben seiner Güter ein, mit der Bedingung, daß ich bis zu seinem Tode bei ihm bleibe. Aber er erreichte ein hohes Alter, so daß ich erst vor zwei Jahren in meine Heimat zurückkehrte und nichts davon wußte, welch schreckliches Schicksal indes mein Haus betroffen und wie gütig Allah es gewendet hatte.«
Die Karawane hatte das Ende der Wüste erreicht, und fröhlich begrüßten die Reisenden die grünen Matten und die dichtbelaubten Bäume, deren lieblichen Anblick sie viele Tage entbehrt hatten. In einem schönen Tale lag eine Karawanserei, die sie sich zum Nachtlager wählten, und obgleich sie wenig Bequemlichkeit und Erfrischung darbot, so war doch die ganze Gesellschaft heiterer und zutraulicher als je; denn der Gedanke, den Gefahren und Beschwerlichkeiten, die eine Reise durch die Wüste mit sich bringt, entronnen zu sein, hatte alle Herzen geöffnet und die Gemüter zu Scherz und Kurzweil gestimmt. Muley, der junge lustige Kaufmann, tanzte einen komischen Tanz und sang Lieder dazu, die selbst dem ernsten Griechen Zaleukos ein Lächeln entlockten. Aber nicht genug, daß er seine Gefährten durch Tanz und Spiel erheitert hatte, er gab ihnen auch noch die Geschichte zum besten, die er ihnen versprochen hatte, und hub, als er von seinen Luftsprüngen sich erholt hatte, also zu erzählen an: Die Geschichte von dem kleinen Muck.
»So erzählte mir mein Vater; ich bezeugte ihm meine Reue über mein rohes Betragen gegen den guten kleinen Mann, und mein Vater schenkte mir die andere Hälfte der Strafe, die er mir zugedacht hatte. Ich erzählte meinen Kameraden die wunderbaren Schicksale des Kleinen, und wir gewannen ihn so lieb, daß ihn keiner mehr schimpfte. Im Gegenteil, wir ehrten ihn, solange er lebte, und haben uns vor ihm immer so tief wie vor Kadi und Mufti gebückt.«
Die Reisenden beschlossen, einen Rasttag in dieser Karawanserei zu machen, um sich und die Tiere zur weiteren Reise zu stärken . Die gestrige Fröhlichkeit ging auch auf diesen Tag über, und sie ergötzten sich in allerlei Spielen. Nach dem Essen aber riefen sie dem fünften Kaufmann, Ali Sizah, zu, auch seine Schuldigkeit gleich den übrigen zu tun und eine Geschichte zu erzählen. Er antwortete, sein Leben sei zu arm an auffallenden Begebenheiten, als daß er ihnen etwas davon mitteilen möchte, daher wolle er ihnen etwas anderes erzählen, nämlich: Das Märchen vom falschen Prinzen.
Mit Sonnenaufgang brach die Karawane auf und gelangte bald nach Birket el Had oder dem Pilgrimsbrunnen, von wo es nur noch drei Stunden Weges nach Kairo waren - Man hatte um diese Zeit die Karawane erwartet, und bald hatten die Kaufleute die Freude, ihre Freunde aus Kairo ihnen entgegenkommen zu sehen. Sie zogen in die Stadt durch das Tor Bebel Falch; denn es wird für eine glückliche Vorbedeutung gehalten, wenn man von Mekka kommt, durch dieses Tor einzuziehen, weil der Prophet hindurchgezogen ist.
Auf dem Markt verabschiedeten sich die vier türkischen Kaufleute von dem Fremden und dem griechischen Kaufmann Zaleukos und gingen mit ihren Freunden nach Haus. Zaleukos aber zeigte dem Fremden eine gute Karawanserei und lud ihn ein, mit ihm das Mittagsmahl zu nehmen. Der Fremde sagte zu und versprach, wenn er nur vorher sich umgekleidet habe, zu erscheinen.
Der Grieche hatte alle Anstalten getroffen, den Fremden, welchen er auf der Reise liebgewonnen hatte, gut zu bewirten, und als die Speisen und Getränke in gehöriger Ordnung aufgestellt waren, setzte er sich, seinen Gast zu erwarten.
Langsam und schweren Schrittes hörte er ihn den Gang, der zu seinem Gemach führte, heraufkommen. Er erhob sich, um ihm freundlich entgegenzusehen und ihn an der Schwelle zu bewillkommnen; aber voll Entsetzen fuhr er zurück, als er die Türe öffnete; denn jener schreckliche Rotmantel trat ihm entgegen; er warf noch einen Blick auf ihn, es war keine Täuschung; dieselbe hohe, gebietende Gestalt, die Larve, aus welcher ihn die dunklen Augen anblitzten, der rote Mantel mit der goldenen Stickerei waren ihm nur allzuwohl bekannt aus den schrecklichsten Stunden seines Lebens.
Widerstreitende Gefühle wogten in Zaleukos Brust; er hatte sich mit diesem Bild seiner Erinnerung längst ausgesöhnt und ihm vergeben, und doch riß sein Anblick alle seine Wunden wieder auf; alle jene qualvollen Stunden der Todesangst, jener Gram, der die Blüte seines Lebens vergiftete, zogen im Flug eines Augenblicks an seiner Seele vorüber.
»Was willst du, Schrecklicher?« rief der Grieche aus, als die Erscheinung noch immer regungslos auf der Schwelle stand. »Weiche schnell von hinnen, daß ich dir nicht fluche!«
»Zaleukos!« sprach eine bekannte Stimme unter der Larve hervor. »Zaleukos! So empfängst du deinen Gastfreund?« Der Sprechende nahm die Larve ab, schlug den Mantel zurück; es war Selim Baruch, der Fremde.
Aber Zaleukos schien noch nicht beruhigt, ihm graute vor dem Fremden; denn nur zu deutlich hatte er in ihm den Unbekannten von der Ponte vecchio erkannt; aber die alte Gewohnheit der Gastfreundschaft siegte; er winkte schweigend dem Fremden, sich zu ihm ans Mahl zu setzen.
»Ich errate deine Gedanken«, nahm dieser das Wort, als sie sich gesetzt hatten. »Deine Augen sehen fragend auf mich - ich hätte schweigen und mich deinen Blicken nie mehr zeigen können, aber ich bin dir Rechenschaft schuldig, und darum wagte ich es auch, auf die Gefahr hin, daß du mir fluchtest, vor dir in meiner alten Gestalt zu erscheinen. Du sagtest einst zu mir: Der Glaube meiner Väter befiehlt mir, ihn zu lieben, auch ist er wohl unglücklicher als ich; glaube dieses, mein Freund, und höre meine Rechtfertigung!
Ich muß weit ausholen, um mich dir ganz verständlich zu machen. Ich bin in Alessandria von christlichen Eltern geboren. Mein Vater, der jüngere Sohn eines alten, berühmten französischen Hauses, war Konsul seines Landes in Alessandria. Ich wurde von meinem zehnten Jahre an in Frankreich bei einem Bruder meiner Mutter erzogen und verließ erst einige Jahre nach dem Ausbruch der Revolution mein Vaterland, um mit meinem Oheim, der in dem Lande seiner Ahnen nicht mehr sicher war, über dem Meer bei meinen Eltern eine Zuflucht zu suchen. Voll Hoffnung, die Ruhe und den Frieden, den uns das empörte Volk der Franzosen entrissen, im elterlichen Hause wiederzufinden, landeten wir. Aber ach! Ich fand nicht alles in meines Vaters Hause, wie es sein sollte; die äußeren Stürme der bewegten Zeit waren zwar noch nicht bis hierher gelangt, desto unerwarteter hatte das Unglück mein Haus im innersten Herzen heimgesucht. Mein Bruder, ein junger, hoffnungsvoller Mann, erster Sekretär meines Vaters, hatte sich erst seit kurzem mit einem jungen Mädchen, der Tochter eines florentinischen Edelmanns, der in unserer Nachbarschaft wohnte, verheiratet; zwei Tage vor unserer Ankunft war diese auf einmal verschwunden, ohne daß weder unsere Familie noch ihr Vater die geringste Spur von ihr auffinden konnten. Man glaubte endlich, sie habe sich auf einem Spaziergang zu weit gewagt und sei in Räuberhände gefallen. Beinahe tröstlicher wäre dieser Gedanke für meinen armen Bruder gewesen als die Wahrheit, die uns nur bald kund wurde. Die Treulose hatte sich mit einem jungen Neapolitaner, den sie im Hause ihres Vaters kennengelernt hatte, eingeschifft. Mein Bruder, aufs äußerste empört über diesen Schritt, bot alles auf, die Schuldige zur Strafe zu ziehen; doch vergebens; seine Versuche, die in Neapel und Florenz Aufsehen erregt hatten, dienten nur dazu, sein und unser aller Unglück zu vollenden. Der florentinische Edelmann reiste in sein Vaterland zurück, zwar mit dem Vorgeben, meinem Bruder Recht zu verschaffen, der Tat nach aber, um uns zu verderben. Er schlug in Florenz alle jene Untersuchungen, welche mein Bruder angeknüpft hatte, nieder und wußte seinen Einfluß, den er auf alle Art sich verschafft hatte, so gut zu benützen, daß mein Vater und mein Bruder ihrer Regierung verdächtig gemacht und durch die schändlichsten Mittel gefangen, nach Frankreich geführt und dort vom Beil des Henkers getötet wurden. Meine arme Mutter verfiel in Wahnsinn, und erst nach zehn langen Monaten erlöste sie der Tod von ihrem schrecklichen Zustand, der aber in den letzten Tagen zu vollem, klarem Bewußtsein geworden war. So stand ich jetzt ganz allein in der Welt, aber nur ein Gedanke beschäftigte meine Seele, nur ein Gedanke ließ mich meine Trauer vergessen, es war jene mächtige Flamme, die meine Mutter in ihrer letzten Stunde in mir angefacht hatte.
In den letzten Stunden war, wie ich dir sagte, ihr Bewußtsein zurückgekehrt; sie ließ mich rufen und sprach mit Ruhe von unserem Schicksal und ihrem Ende. Dann aber ließ sie alle aus dem Zimmer gehen, richtete sich mit feierlicher Miene von ihrem ärmlichen Lager auf und sagte, ich könne mir ihren Segen erwerben, wenn ich ihr schwöre, etwas auszuführen, das sie mir auftragen würde - Ergriffen von den Worten der sterbenden Mutter, gelobte ich mit einem Eide zu tun, wie sie mir sagen werde. Sie brach nun in Verwünschungen gegen den Florentiner und seine Tochter aus und legte mir mit den fürchterlichsten Drohungen ihres Fluches auf, mein unglückliches Haus an ihm zu rächen. Sie starb in meinen Armen. Jener Gedanke der Rache hatte schon lange in meiner Seele geschlummert; jetzt erwachte er mit aller Macht. Ich sammelte den Rest meines väterlichen Vermögens und schwor mir, alles an meine Rache zu setzen oder selbst mit unterzugehen.
Bald war ich in Florenz, wo ich mich so geheim als möglich aufhielt; mein Plan war um vieles erschwert worden durch die Lage, in welcher sich meine Feinde befanden. Der alte Florentiner war Gouverneur geworden und hatte so alle Mittel in der Hand, sobald er das geringste ahnte, mich zu verderben. Ein Zufall kam mir zu Hilfe. Eines Abends sah ich einen Menschen in bekannter Livree durch die Straßen gehen; sein unsicherer Gang, sein finsterer Blick und das halblaut herausgestoßene »Santo sacramento«, »Maledetto diavolo« ließen mich den alten Pietro, einen Diener des Florentiners, den ich schon in Alessandria gekannt hatte, erkennen. Ich war nicht in Zweifel, daß er über seinen Herrn in Zorn geraten sei, und beschloß, seine Stimmung zu benützen. Er schien sehr überrascht, mich hier zu sehen, klagte mir sein Leiden, daß er seinem Herrn, seit er Gouverneur geworden, nichts mehr recht machen könne, und mein Gold, unterstützt von seinem Zorn, brachte ihn bald auf meine Seite. Das Schwierigste war jetzt beseitigt; ich hatte einen Mann in meinem Solde, der mir zu jeder Stunde die Türe meines Feindes öffnete, und nun reifte mein Racheplan immer schneller heran. Das Leben des alten Florentiners schien mir ein zu geringes Gewicht, dem Untergang meines Hauses gegenüber, zu haben. Sein Liebstes mußte er gemordet sehen, und dies war Bianka, seine Tochter. Hatte ja sie so schändlich an meinem Bruder gefrevelt, war ja doch sie die Ursache unseres Unglücks. Gar erwünscht kam sogar meinem rachedürstigen Herzen die Nachricht, daß in dieser Zeit Bianka zum zweitenmal sich vermählen wollte, es war beschlossen, sie mußte sterben. Aber mir selbst graute vor der Tat, und auch Pietro traute sich zu wenig Kraft zu; darum spähten wir umher nach einem Mann, der das Geschäft vollbringen könne. Unter den Florentinern wagte ich keinen zu dingen, denn gegen den Gouverneur würde keiner etwas Solches unternommen haben. Da fiel Pietro der Plan ein, den ich nachher ausgeführt habe; zugleich schlug er dich als Fremden und Arzt als den Tauglichsten vor. Den Verlauf der Sache weißt du. Nur an deiner großen Vorsicht und Ehrlichkeit schien mein Unternehmen zu scheitern. Daher der Zufall mit dem Mantel.
Pietro öffnete uns das Pförtchen an dem Palast des Gouverneurs; er hätte uns auch ebenso heimlich wieder hinausgeleitet, wenn wir nicht, durch den schrecklichen Anblick, der sich uns durch die Türspalte darbot, erschreckt, entflohen wären. Von Schrecken und Reue gejagt, war ich über zweihundert Schritte fortgerannt, bis ich auf den Stufen einer Kirche niedersank. Dort erst sammelte ich mich wieder, und mein erster Gedanke warst du und dein schreckliches Schicksal, wenn man dich in dem Hause fände. Ich schlich an den Palast, aber weder von Pietro noch von dir konnte ich eine Spur entdecken; das Pförtchen aber war offen, so konnte ich wenigstens hoffen, daß du die Gelegenheit zur Flucht benützt haben könntest.
Als aber der Tag anbrach, ließ mich die Angst vor der Entdeckung und ein unabweisbares Gefühl von Reue nicht mehr in den Mauern von Florenz. Ich eilte nach Rom. Aber denke dir meine Bestürzung, als man dort nach einigen Tagen überall diese Geschichte erzählte mit dem Beisatz, man habe den Mörder, einen griechischen Arzt, gefangen. Ich kehrte in banger Besorgnis nach Florenz zurück; denn schien mir meine Rache schon vorher zu stark, so verfluchte ich sie jetzt, denn sie war mir durch dein Leben allzu teuer erkauft. Ich kam an demselben Tage an, der dich der Hand beraubte. Ich schweige von dem, was ich fühlte, als ich dich das Schafott besteigen und so heldenmütig leiden sah. Aber damals, als dein Blut in Strömen aufspritzte, war der Entschluß fest in mir, dir deine übrigen Lebenstage zu versüßen. Was weiter geschehen ist, weißt du, nur das bleibt mir noch zu sagen übrig, warum ich diese Reise mit dir machte.
Als eine schwere Last drückte mich der Gedanke, daß du mir noch immer nicht vergeben habest; darum entschloß ich mich, viele Tage mit dir zu leben und dir endlich Rechenschaft abzulegen von dem, was ich mit dir getan.«
Schweigend hatte der Grieche seinen Gast angehört; mit sanftem Blick bot er ihm, als er geendet hatte, seine Rechte. »Ich wußte wohl, daß du unglücklicher sein müßtest als ich, denn jene grausame Tat wird wie eine dunkle Wolke ewig deine Tage verfinstern; ich vergebe dir von Herzen. Aber erlaube mir noch eine Frage: Wie kommst du unter dieser Gestalt in die Wüste? Was fingst du an, nachdem du in Konstantinopel mir das Haus gekauft hattest?«
»Ich ging nach Alessandria zurück«, antwortete der Gefragte . »Haß gegen alle Menschen tobte in meiner Brust, brennender Haß besonders gegen jene Nationen, die man die gebildeten nennt. Glaube mir, unter meinen Moslemiten war mir wohler! Kaum war ich einige Monate in Alessandria, als jene Landung meiner Landsleute erfolgte.
Ich sah in ihnen nur die Henker meines Vaters und meines Bruders; darum sammelte ich einige gleichgesinnte junge Leute meiner Bekanntschaft und schloß mich jenen tapferen Mamelucken an, die so oft der Schrecken des französischen Heeres wurden. Als der Feldzug beendigt war, konnte ich mich nicht entschließen, zu den Künsten des Friedens zurückzukehren. Ich lebte mit einer kleinen Anzahl gleichdenkender Freunde ein unstetes und flüchtiges, dem Kampf und der Jagd geweihtes Leben; ich lebe zufrieden unter diesen Leuten, die mich wie ihren Fürsten ehren; denn wenn meine Asiaten auch nicht so gebildet sind wie Eure Europäer, so sind sie doch weit entfernt von Neid und Verleumdung, von Selbstsucht und Ehrgeiz.«
Zaleukos dankte dem Fremden für seine Mitteilung, aber er verbarg ihm nicht, daß er es für seinen Stand, für seine Bildung angemessener fände, wenn er in christlichen, in europäischen Ländern leben und wirken würde. Er faßte seine Hand und bat ihn, mit ihm zu ziehen, bei ihm zu leben und zu sterben.
Gerührt sah ihn der Gastfreund an. »Daraus erkenne ich«, sagte er, »daß du mir ganz vergeben hast, daß du mich liebst. Nimm meinen innigsten Dank dafür!« Er sprang auf und stand in seiner ganzen Größe vor dem Griechen, dem vor dem kriegerischen Anstand, den dunkel blitzenden Augen, der tiefen Stimme seines Gastes beinahe graute. »Dein Vorschlag ist schön«, sprach jener weiter, »er möchte für jeden andern lockend sein - ich kann ihn nicht benützen. Schon steht mein Roß gesattelt, erwarten mich meine Diener; lebe wohl, Zaleukos!« Die Freunde, die das Schicksal so wunderbar zusammengeführt, umarmten sich zum Abschied. »Und wie nenne ich dich? Wie heißt mein Gastfreund, der auf ewig in meinem Gedächtnis leben wird?« fragte der Grieche.
Der Fremde sah ihn lange an, drückte ihm noch einmal die Hand und sprach: »Man nennt mich den Herrn der Wüste; ich bin der Räuber Orbasan.«
Kalif Storch
Der Kalif Chasid zu Bagdad saß einmal an einem schönen Nachmittag behaglich auf seinem Sofa; er hatte ein wenig geschlafen, denn es war ein heißer Tag, und sah nun nach seinem Schläfchen recht heiter aus. Er rauchte aus einer langen Pfeife von Rosenholz, trank hier und da ein wenig Kaffee, den ihm ein Sklave einschenkte, und strich sich allemal vergnügt den Bart, wenn es ihm geschmeckt hatte. Kurz, man sah dem Kalifen an, daß es ihm recht wohl war. Um diese Stunde konnte man gar gut mit ihm reden, weil er da immer recht mild und leutselig war, deswegen besuchte ihn auch sein Großwesir Mansor alle Tage um diese Zeit. An diesem Nachmittage nun kam er auch, sah aber sehr nachdenklich aus, ganz gegen seine Gewohnheit. Der Kalif tat die Pfeife ein wenig aus dem Mund und sprach: »Warum machst du ein so nachdenkliches Gesicht, Großwesir?«
Der Großwesir schlug seine Arme kreuzweis über die Brust, verneigte sich vor seinem Herrn und antwortete: »Herr, ob ich ein nachdenkliches Gesicht mache, weiß ich nicht, aber da drunten am Schloß steht ein Krämer, der hat so schöne Sachen, daß es mich ärgert, nicht viel überflüssiges Geld zu haben.«
Der Kalif, der seinem Großwesir schon lange gerne eine Freude gemacht hätte, schickte seinen schwarzen Sklaven hinunter, um den Krämer heraufzuholen. Bald kam der Sklave mit dem Krämer zurück. Dieser war ein kleiner, dicker Mann, schwarzbraun im Gesicht und in zerlumptem Anzug. Er trug einen Kasten, in welchem er allerhand Waren hatte, Perlen und Ringe, reichbeschlagene Pistolen, Becher und Kämme. Der Kalif und sein Wesir musterten alles durch, und der Kalif kaufte endlich für sich und Mansor schöne Pistolen, für die Frau des Wesirs aber einen Kamm. Als der Krämer seinen Kasten schon wieder zumachen wollte, sah der Kalif eine kleine Schublade und fragte, ob da auch noch Waren seien. Der Krämer zog die Schublade heraus und zeigte darin eine Dose mit schwärzlichem Pulver und ein Papier mit sonderbarer Schrift, die weder der Kalif noch Mansor lesen konnte. »Ich bekam einmal diese zwei Stücke von einem Kaufmanne, der sie in Mekka auf der Straße fand«, sagte der Krämer, »Ich weiß nicht, was sie enthalten; euch stehen sie um geringen Preis zu Dienst, ich kann doch nichts damit anfangen.«
Der Kalif, der in seiner Bibliothek gerne alte Manuskripte hatte, wenn er sie auch nicht lesen konnte, kaufte Schrift und Dose und entließ den Krämer. Der Kalif aber dachte, er möchte gerne wissen, was die Schrift enthalte, und, fragte den Wesir, ob er keinen kenne, der es entziffern könnte.
»Gnädigster Herr und Gebieter«, antwortete dieser, »an der großen Moschee wohnt ein Mann, er heißt Selim, der Gelehrte, der versteht alle Sprachen, laß ihn kommen, vielleicht kennt er diese geheimnisvollen Züge.«
Der Gelehrte Selim war bald herbeigeholt. »Selim«, sprach zu ihm der Kalif, »Selim, man sagt, du seiest sehr gelehrt; guck einmal ein wenig in diese Schrift, ob du sie lesen kannst; kannst du sie lesen, so bekommst du ein neues Festkleid von mir, kannst du es nicht, so bekommst du zwölf Backenstreiche und fünfundzwanzig auf die Fußsohlen, weil man dich dann umsonst Selim, den Gelehrten, nennt.«
Selim verneigte sich und sprach: »Dein Wille geschehe, o Herr!« Lange betrachtete er die Schrift, plötzlich aber rief er aus: »Das ist Lateinisch, o Herr, oder ich laß mich hängen.« »Sag, was drinsteht«, befahl der Kalif, »wenn es Lateinisch ist.«
Selim fing an zu übersetzen: »Mensch, der du dieses findest, preise Allah für seine Gnade. Wer von dem Pulver in dieser Dose schnupft und dazu spricht: mutabor, der kann sich in jedes Tier verwandeln und versteht auch die Sprache der Tiere.
Will er wieder in seine menschliche Gestalt zurückkehren, so neige er sich dreimal gen Osten und spreche jenes Wort; aber hüte dich, wenn du verwandelt bist, daß du nicht lachest, sonst verschwindet das Zauberwort gänzlich aus deinem Gedächtnis, und du bleibst ein Tier.«
Als Selim, der Gelehrte, also gelesen hatte, war der Kalif über die Maßen vergnügt. Er ließ den Gelehrten schwören, niemandem etwas von dem Geheimnis zu sagen, schenkte ihm ein schönes Kleid und entließ ihn. Zu seinem Großwesir aber sagte er: »Das heiß’ ich gut einkaufen, Mansor! Wie freue ich mich, bis ich ein Tier bin. Morgen früh kommst du zu mir; wir gehen dann miteinander aufs Feld, schnupfen etwas Weniges aus meiner Dose und belauschen dann, was in der Luft und im Wasser, im Wald und Feld gesprochen wird!«
Kaum hatte am anderen Morgen der Kalif Chasid gefrühstückt und sich angekleidet, als schon der Großwesir erschien, ihn, wie er befohlen, auf dem Spaziergang zu begleiten. Der Kalif steckte die Dose mit dem Zauberpulver in den Gürtel, und nachdem er seinem Gefolge befohlen, zurückzubleiben, machte er sich mit dem Großwesir ganz allein auf den Weg . Sie gingen zuerst durch die weiten Gärten des Kalifen, spähten aber vergebens nach etwas Lebendigem, um ihr Kunststück zu probieren. Der Wesir schlug endlich vor, weiter hinaus an einen Teich zu gehen, wo er schon oft viele Tiere, namentlich Störche, gesehen habe, die durch ihr gravitätisches Wesen und ihr Geklapper immer seine Aufmerksamkeit erregt hatten.
Der Kalif billigte den Vorschlag seines Wesirs und ging mit ihm dem Teich zu. Als sie dort angekommen waren, sahen sie einen Storch ernsthaft auf und ab gehen, Frösche suchend und hier und da etwas vor sich hinklappernd. Zugleich sahen sie auch weit oben in der Luft einen anderen Storch dieser Gegend zuschweben.
»Ich wette meinen Bart, gnädigster Herr«, sagte er Großwesir, »wenn nicht diese zwei Langfüßler ein schönes Gespräch miteinander führen werden. Wie wäre es, wenn wir Störche würden?«
»Wohl gesprochen!« antwortete der Kalif. »Aber vorher wollen wir noch einmal betrachten, wie man wieder Mensch wird. - Richtig! Dreimal gen Osten geneigt und mutabor gesagt, so bin ich wieder Kalif und du Wesir. Aber nur um Himmels willen nicht gelacht, sonst sind wir verloren!«
Während der Kalif also sprach, sah er den anderen Storch über ihrem Haupte schweben und langsam sich zur Erde lassen. Schnell zog er die Dose aus dem Gürtel, nahm eine gute Prise, bot sie dem Großwesir dar, der gleichfalls schnupfte, und beide riefen: mutabor!
Da schrumpften ihre Beine ein und wurden dünn und rot, die schönen gelben Pantoffeln des Kalifen und seines Begleiters wurden unförmliche Storchfüße, die Arme wurden zu Flügeln, der Hals fuhr aus den Achseln und ward eine Elle lang, der Bart war verschwunden, und den Körper bedeckten weiche Federn.
»Ihr habt einen hübschen Schnabel, Herr Großwesir«, sprach nach langem Erstaunen der Kalif. »Beim Bart des Propheten, so etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen.« »Danke untertänigst«, erwiderte der Großwesir, indem er sich bückte, »aber wenn ich es wagen darf, möchte ich behaupten, Eure Hoheit sehen als Storch beinahe noch hübscher aus denn als Kalif. Aber kommt, wenn es Euch gefällig ist, daß wir unsere Kameraden dort belauschen und erfahren, ob wir wirklich Storchisch können.«
Indem war der andere Storch auf der Erde angekommen; er putzte sich mit dem Schnabel seine Füße, legte seine Federn zurecht und ging auf den ersten Storch zu. Die beiden neuen Störche aber beeilten sich, in ihre Nähe zu kommen, und vernahmen zu ihrem Erstaunen folgendes Gespräch:
»Guten Morgen, Frau Langbein, so früh schon auf der Wiese?«
»Schönen Dank, liebe Klapperschnabel! Ich habe mir nur ein kleines Frühstück geholt. Ist Euch vielleicht ein Viertelchen Eidechs gefällig oder ein Froschschenkelein?«
»Danke gehorsamst; habe heute gar keinen Appetit. Ich komme auch wegen etwas ganz anderem auf die Wiese. Ich soll heute vor den Gästen meines Vaters tanzen, und da will ich mich im stillen ein wenig üben.«
Zugleich schritt die junge Störchin in wunderlichen Bewegungen durch das Feld. Der Kalif und Mansor sahen ihr verwundert nach; als sie aber in malerischer Stellung auf einem Fuß stand und mit den Flügeln anmutig dazu wedelte, da konnten sich die beiden nicht mehr halten; ein unaufhaltsames Gelächter brach aus ihren Schnäbeln hervor, von dem sie sich erst nach langer Zeit erholten. Der Kalif faßte sich zuerst wieder: »Das war einmal ein Spaß«, rief er, »der nicht mit Gold zu bezahlen ist; schade, daß die Tiere durch unser Gelächter sich haben verscheuchen lassen, sonst hätten sie gewiß auch noch gesungen!«
Aber jetzt fiel es dem Großwesir ein, daß das Lachen während der Verwandlung verboten war. Er teilte seine Angst deswegen dem Kalifen mit. »Potz Mekka und Medina! Das wäre ein schlechter Spaß, wenn ich ein Storch bleiben müßte! Besinne dich doch auf das dumme Wort, ich bring’ es nicht heraus.«
»Dreimal gen Osten müssen wir uns bücken und dazu sprechen: mu - mu - mu -«
Sie stellten sich gegen Osten und bückten sich in einem fort, daß ihre Schnäbel beinahe die Erde berührten; aber, o Jammer! Das Zauberwort war ihnen entfallen, und so oft sich auch der Kalif bückte, so sehnlich auch sein Wesir mu - mu dazu rief, jede Erinnerung daran war verschwunden, und der arme Chasid und sein Wesir waren und blieben Störche.
Traurig wandelten die Verzauberten durch die Felder, sie wußten gar nicht, was sie in ihrem Elend anfangen sollten. Aus ihrer Storchenhaut konnten sie nicht heraus, in die Stadt zurück konnten sie auch nicht, um sich zu erkennen zu geben; denn wer hätte einem Storch geglaubt, daß er der Kalif sei, und wenn man es auch geglaubt hätte, würden die Einwohner von Bagdad einen Storch zum Kalif gewollt haben?
So schlichen sie mehrere Tage umher und ernährten sich kümmerlich von Feldfrüchten, die sie aber wegen ihrer langen Schnäbel nicht gut verspeisen konnten. Auf Eidechsen und Frösche hatten sie übrigens keinen Appetit, denn sie befürchteten, mit solchen Leckerbissen sich den Magen zu verderben. Ihr einziges Vergnügen in dieser traurigen Lage war, daß sie fliegen konnten, und so flogen sie oft auf die Dächer von Bagdad, um zu sehen, was darin vorging.
In den ersten Tagen bemerkten sie große Unruhe und Trauer in den Straßen; aber ungefähr am vierten Tag nach ihrer Verzauberung saßen sie auf dem Palast des Kalifen, da sahen sie unten in der Straße einen prächtigen Aufzug; Trommeln und Pfeifen ertönten, ein Mann in einem goldbestickten Scharlachmantel saß auf einem geschmückten Pferd, umgeben von glänzenden Dienern, halb Bagdad sprang ihm nach, und alle schrien: »Heil Mizra, dem Herrscher von Bagdad!«
Da sahen die beiden Störche auf dem Dache des Palastes einander an, und der Kalif Chasid sprach: »Ahnst du jetzt, warum ich verzaubert bin, Großwesir? Dieser Mizra ist der Sohn meines Todfeindes, des mächtigen Zauberers Kaschnur, der mir in einer bösen Stunde Rache schwur. Aber noch gebe ich die Hoffnung nicht auf - Komm mit mir, du treuer Gefährte meines Elends, wir wollen zum Grabe des Propheten wandern, vielleicht, daß an heiliger Stätte der Zauber gelöst wird.«
Sie erhoben sich vom Dach des Palastes und flogen der Gegend von Medina zu.
Mit dem Fliegen wollte es aber nicht gar gut gehen; denn die beiden Störche hatten noch wenig Übung. »O Herr«, ächzte nach ein paar Stunden der Großwesir, »ich halte es mit Eurer Erlaubnis nicht mehr lange aus; Ihr fliegt gar zu schnell! Auch ist es schon Abend, und wir täten wohl, ein Unterkommen für die Nacht zu suchen.«
Chasid gab der Bitte seines Dieners Gehör; und da er unten im Tale eine Ruine erblickte, die ein Obdach zu gewähren schien, so flogen sie dahin. Der Ort, wo sie sich für diese Nacht niedergelassen hatten, schien ehemals ein Schloß gewesen zu sein. Schöne Säulen ragten unter den Trümmern hervor, mehrere Gemächer, die noch ziemlich erhalten waren, zeugten von der ehemaligen Pracht des Hauses. Chasid und sein Begleiter gingen durch die Gänge umher, um sich ein trockenes Plätzchen zu suchen; plötzlich blieb der Storch Mansor stehen. »Herr und Gebieter«, flüsterte er leise, »wenn es nur nicht töricht für einen Großwesir, noch mehr aber für einen Storch wäre, sich vor Gespenstern zu fürchten! Mir ist ganz unheimlich zumute; denn hier neben hat es ganz vernehmlich geseufzt und gestöhnt.« Der Kalif blieb nun auch stehen und hörte ganz deutlich ein leises Weinen, das eher einem Menschen als einem Tiere anzugehören schien. Voll Erwartung wollte er der Gegend zugehen, woher die Klagetöne kamen; der Wesir aber packte ihn mit dem Schnabel am Flügel und bat ihn flehentlich, sich nicht in neue, unbekannte Gefahren zu stürzen. Doch vergebens! Der Kalif, dem auch unter dem Storchenflügel ein tapferes Herz schlug, riß sich mit Verlust einiger Federn los und eilte in einen finsteren Gang. Bald war er an einer Tür angelangt, die nur angelehnt schien und woraus er deutliche Seufzer mit ein wenig Geheul vernahm. Er stieß mit dem Schnabel die Türe auf, blieb aber überrascht auf der Schwelle stehen. In dem verfallenen Gemach, das nur durch ein kleines Gitterfenster spärlich erleuchtet war, sah er eine große Nachteule am Boden sitzen. Dicke Tränen rollten ihr aus den großen, runden Augen, und mit heiserer Stimme stieß sie ihre Klagen zu dem krummen Schnabel heraus. Als sie aber den Kalifen und seinen Wesir, der indes auch herbeigeschlichen war, erblickte, erhob sie ein lautes Freudengeschrei. Zierlich wischte sie mit dem braungefleckten Flügel die Tränen aus dem Auge, und zu dem größten Erstaunen der beiden rief sie in gutem menschlichem Arabisch: »Willkommen, ihr Störche! Ihr seid mir ein gutes Zeichen meiner Errettung; denn durch Störche werde mir ein großes Glück kommen, ist mir einst prophezeit worden!«
Als sich der Kalif von seinem Erstaunen erholt hatte, bückte er sich mit seinem langen Hals, brachte seine dünnen Füße in eine zierliche Stellung und sprach: »Nachteule! Deinen Worten nach darf ich glauben, eine Leidensgefährtin in dir zu sehen. Aber ach! Deine Hoffnung, daß durch uns deine Rettung kommen werde, ist vergeblich. Du wirst unsere Hilflosigkeit selbst erkennen, wenn du unsere Geschichte hörst.« Die Nachteule bat ihn zu erzählen, was der Kalif sogleich tat.
Als der Kalif der Eule seine Geschichte vorgetragen hatte, dankte sie ihm und sagte: »Vernimm auch meine Geschichte und höre, wie ich nicht weniger unglücklich bin als du. Mein Vater ist der König von Indien, ich, seine einzige unglückliche Tochter, heiße Lusa. Jener Zauberer Kaschnur, der euch verzauberte, hat auch mich ins Unglück gestürzt. Er kam eines Tages zu meinem Vater und begehrte mich zur Frau für seinen Sohn Mizra. Mein Vater aber, der ein hitziger Mann ist, ließ ihn die Treppe hinunterwerfen. Der Elende wußte sich unter einer anderen Gestalt wieder in meine Nähe zu schleichen, und als ich einst in meinem Garten Erfrischungen zu mir nehmen wollte, brachte er mir, als Sklave verkleidet, einen Trank bei, der mich in diese abscheuliche Gestalt verwandelte. Vor Schrecken ohnmächtig, brachte er mich hierher und rief mir mit schrecklicher Stimme in die Ohren:
‘Da sollst du bleiben, häßlich, selbst von den Tieren verachtet, bis an dein Ende, oder bis einer aus freiem Willen dich, selbst in dieser schrecklichen Gestalt, zur Gattin begehrt. So räche ich mich an dir und deinem stolzen Vater.’
Seitdem sind viele Monate verflossen. Einsam und traurig lebe ich als Einsiedlerin in diesem Gemäuer, verabscheut von der Welt, selbst den Tieren ein Greuel; die schöne Natur ist vor mir verschlossen; denn ich bin blind am Tage, und nur, wenn der Mond sein bleiches Licht über dies Gemäuer ausgießt, fällt der verhüllende Schleier von meinem Auge.«
Die Eule hatte geendet und wischte sich mit dem Flügel wieder die Augen aus, denn die Erzählung ihrer Leiden hatte ihr Tränen entlockt.
Der Kalif war bei der Erzählung der Prinzessin in tiefes Nachdenken versunken. »Wenn mich nicht alles täuscht«, sprach er, »so findet zwischen unserem Unglück ein geheimer Zusammenhang statt; aber wo finde ich den Schlüssel zu diesem Rätsel?«
Die Eule antwortete ihm: »O Herr! Auch mir ahnet dies; denn es ist mir einst in meiner frühesten Jugend von einer weisen Frau prophezeit worden, daß ein Storch mir ein großes Glück bringen werde, und ich wüßte vielleicht, wie wir uns retten könnten.« Der Kalif war sehr erstaunt und fragte, auf welchem Wege sie meine. »Der Zauberer, der uns beide unglücklich gemacht hat«, sagte sie, »kommt alle Monate einmal in diese Ruinen. Nicht weit von diesem Gemach ist ein Saal. Dort pflegt er dann mit vielen Genossen zu schmausen. Schon oft habe ich sie dort belauscht. Sie erzählen dann einander ihre schändlichen Werke; vielleicht, daß er dann das Zauberwort, das ihr vergessen habt, ausspricht.«
»O, teuerste Prinzessin«, rief der Kalif, »sag an, wann kommt er, und wo ist der Saal?«
Die Eule schwieg einen Augenblick und sprach dann: »Nehmet es nicht ungütig, aber nur unter einer Bedingung kann ich Euern Wunsch erfüllen.«
»Sprich aus! Sprich aus!« schrie Chasid. »Befiehl, es ist mir jede recht.«
»Nämlich, ich möchte auch gern zugleich frei sein; dies kann aber nur geschehen, wenn einer von euch mir seine Hand reicht.«
Die Störche schienen über den Antrag etwas betroffen zu sein, und der Kalif winkte seinem Diener, ein wenig mit ihm hinauszugehen.
»Großwesir«, sprach vor der Türe der Kalif, »das ist ein dummer Handel; aber Ihr könntet sie schon nehmen.«
»So«, antwortete dieser, »daß mir meine Frau, wenn ich nach Hause komme, die Augen auskratzt? Auch bin ich ein alter Mann, und Ihr seid noch jung und unverheiratet und könnet eher einer jungen, schönen Prinzessin die Hand geben.«
»Das ist es eben«, seufzte der Kalif, indem er traurig die Flügel hängen ließ, »wer sagt dir denn, daß sie jung und schön ist? Das heißt eine Katze im Sack kaufen!«
Sie redeten einander gegenseitig noch lange zu; endlich aber, als der Kalif sah, daß sein Wesir lieber Storch bleiben als die Eule heiraten wollte, entschloß er sich, die Bedingung lieber selbst zu erfüllen. Die Eule war hocherfreut. Sie gestand ihnen, daß sie zu keiner besseren Zeit hätten kommen können, weil wahrscheinlich in dieser Nacht die Zauberer sich versammeln würden.
Sie verließ mit den Störchen das Gemach, um sie in jenen Saal zu führen; sie gingen lange in einem finsteren Gang hin; endlich strahlte ihnen aus einer halbverfallenen Mauer ein heller Schein entgegen. Als sie dort angelangt waren, riet ihnen die Eule, sich ganz ruhig zu verhalten. Sie konnten von der Lücke, an welcher sie standen, einen großen Saal übersehen. Er war ringsum mit Säulen geschmückt und prachtvoll verziert. Viele farbige Lampen ersetzten das Licht des Tages. In der Mitte des Saales stand ein runder Tisch, mit vielen und ausgesuchten Speisen besetzt. Rings um den Tisch zog sich ein Sofa, auf welchem acht Männer saßen. In einem dieser Männer erkannten die Störche jenen Krämer wieder, der ihnen das Zauberpulver verkauft hatte. Sein Nebensitzer forderte ihn auf, ihnen seine neuesten Taten zu erzählen. Er erzählte unter anderen auch die Geschichte des Kalifen und seines Wesirs.
»Was für ein Wort hast du ihnen denn aufgegeben?« fragte ihn ein anderer Zauberer. »Ein recht schweres lateinisches, es heißt mutabor.«
Als die Störche an der Mauerlücke dieses hörten, kamen sie vor Freuden beinahe außer sich. Sie liefen auf ihren langen Füßen so schnell dem Tore der Ruine zu, daß die Eule kaum folgen konnte. Dort sprach der Kalif gerührt zu der Eule: »Retterin meines Lebens und des Lebens meines Freundes, nimm zum ewigen Dank für das, was du an uns getan, mich zum Gemahl an!« Dann aber wandte er sich nach Osten. Dreimal bückten die Störche ihre langen Hälse der Sonne entgegen, die soeben hinter dem Gebirge heraufstieg: » Mutabor!« riefen sie, im Nu waren sie verwandelt, und in der hohen Freude des neugeschenkten Lebens lagen Herr und Diener lachend und weinend einander in den Armen.
Wer beschreibt aber ihr Erstaunen, als sie sich umsahen? Eine schöne Dame, herrlich geschmückt, stand vor ihnen. Lächelnd gab sie dem Kalifen die Hand. »Erkennt Ihr Eure Nachteule nicht mehr?« sagte sie. Sie war es; der Kalif war von ihrer Schönheit und Anmut entzückt.
Die drei zogen nun miteinander auf Bagdad zu. Der Kalif fand in seinen Kleidern nicht nur die Dose mit Zauberpulver, sondern auch seinen Geldbeutel. Er kaufte daher im nächsten Dorfe, was zu ihrer Reise nötig war, und so kamen sie bald an die Tore von Bagdad. Dort aber erregte die Ankunft des Kalifen großes Erstaunen. Man hatte ihn für tot ausgegeben, und das Volk war daher hocherfreut, seinen geliebten Herrscher wiederzuhaben.
Um so mehr aber entbrannte ihr Haß gegen den Betrüger Mizra. Sie zogen in den Palast und nahmen den alten Zauberer und seinen Sohn gefangen. Den Alten schickte der Kalif in dasselbe Gemach der Ruine, das die Prinzessin als Eule bewohnt hatte, und ließ ihn dort aufhängen. Dem Sohn aber, welcher nichts von den Künsten des Vaters verstand, ließ der Kalif die Wahl, ob er sterben oder schnupfen wolle. Als er das letztere wählte, bot ihm der Großwesir die Dose. Eine tüchtige Prise, und das Zauberwort des Kalifen verwandelte ihn in einen Storch. Der Kalif ließ ihn in einen eisernen Käfig sperren und in seinem Garten aufstellen.
Lange und vergnügt lebte Kalif Chasid mit seiner Frau, der Prinzessin; seine vergnügtesten Stunden waren immer die, wenn ihn der Großwesir nachmittags besuchte; da sprachen sie dann oft von ihrem Storchabenteuer, und wenn der Kalif recht heiter war, ließ er sich herab, den Großwesir nachzuahmen, wie er als Storch aussah. Er stieg dann ernsthaft, mit steifen Füßen im Zimmer auf und ab, klapperte, wedelte mit den Armen wie mit Flügeln und zeigte, wie jener sich vergeblich nach Osten geneigt und Mu - Mu - dazu gerufen habe. Für die Frau Kalifin und ihre Kinder war diese Vorstellung allemal eine große Freude; wenn aber der Kalif gar zu lange klapperte und nickte und Mu - Mu - schrie, dann drohte ihm lächelnd der Wesir: Er wolle das, was vor der Türe der Prinzessin Nachteule verhandelt worden sei, der Frau Kalifin mitteilen.
Als Selim Baruch seine Geschichte beendet hatte, bezeugten sich die Kaufleute sehr zufrieden damit. »Wahrhaftig, der Nachmittag ist uns vergangen, ohne daß wir merkten wie!« sagte einer derselben, indem er die Decke des Zeltes zurückschlug. »Der Abendwind wehet kühl, und wir könnten noch eine gute Strecke Weges zurücklegen.« Seine Gefährten waren damit einverstanden, die Zelte wurden abgebrochen, und die Karawane machte sich in der nämlichen Ordnung, in welcher sie herangezogen war, auf den Weg.
Sie ritten beinahe die ganze Nacht hindurch, denn es war schwül am Tage, die Nacht aber war erquicklich und sternhell. Sie kamen endlich an einem bequemen Lagerplatz an, schlugen die Zelte auf und legten sich zur Ruhe. Für den Fremden aber sorgten die Kaufleute, wie wenn er ihr wertester Gastfreund wäre. Der eine gab ihm Polster, der andere Decken, ein dritter gab ihm Sklaven, kurz, er wurde so gut bedient, als ob er zu Hause wäre. Die heißeren Stunden des Tages waren schon heraufgekommen, als sie sich wieder erhoben, und sie beschlossen einmütig, hier den Abend abzuwarten. Nachdem sie miteinander gespeist hatten, rückten sie wieder näher zusammen, und der junge Kaufmann wandte sich an den ältesten und sprach: »Selim Baruch hat uns gestern einen vergnügten Nachmittag bereitet, wie wäre es, Achmet, wenn Ihr uns auch etwas erzähltet, sei es nun aus Eurem langen Leben, das wohl viele Abenteuer aufzuweisen hat, oder sei es auch ein hübsches Märchen.« Achmet schwieg auf diese Anrede eine Zeitlang, wie wenn er bei sich im Zweifel wäre, ob er dies oder jenes sagen sollte oder nicht; endlich fing er an zu sprechen:
»Liebe Freunde! Ihr habt euch auf dieser unserer Reise als treue Gesellen erprobt, und auch Selim verdient mein Vertrauen; daher will ich euch etwas aus meinem Leben mitteilen, das ich sonst ungern und nicht jedem erzähle: die Geschichte von dem Gespensterschiff.«
Die Geschichte von dem Gespensterschiff
Mein Vater hatte einen kleinen Laden in Balsora; er war weder arm noch reich und einer von jenen Leuten, die nicht gerne etwas wagen, aus Furcht, das Wenige zu verlieren, das sie haben. Er erzog mich schlicht und recht und brachte es bald so weit, daß ich ihm an die Hand gehen konnte. Gerade als ich achtzehn Jahre alt war, als er die erste größere Spekulation machte, starb er, wahrscheinlich aus Gram, tausend Goldstücke dem Meere anvertraut zu haben. Ich mußte ihn bald nachher wegen seines Todes glücklich preisen, denn wenige Wochen hernach lief die Nachricht ein, daß das Schiff, dem mein Vater seine Güter mitgegeben hatte, versunken sei. Meinen jugendlichen Mut konnte aber dieser Unfall nicht beugen. Ich machte alles vollends zu Geld, was mein Vater hinterlassen hatte, und zog aus, um in der Fremde mein Glück zu probieren, nur von einem alten Diener meines Vaters begleitet.
Im Hafen von Balsora schifften wir uns mit günstigem Winde ein. Das Schiff, auf dem ich mich eingemietet hatte, war nach Indien bestimmt. Wir waren schon fünfzehn Tage auf der gewöhnlichen Straße gefahren, als uns der Kapitän einen Sturm verkündete. Er machte ein bedenkliches Gesicht, denn es schien, er kenne in dieser Gegend das Fahrwasser nicht genug, um einem Sturm mit Ruhe begegnen zu können. Er ließ alle Segel einziehen, und wir trieben ganz langsam hin. Die Nacht war angebrochen, war hell und kalt, und der Kapitän glaubte schon, sich in den Anzeichen des Sturmes getäuscht zu haben. Auf einmal schwebte ein Schiff, das wir vorher nicht gesehen hatten, dicht an dem unsrigen vorbei. Wildes Jauchzen und Geschrei erscholl aus dem Verdeck herüber, worüber ich mich zu dieser angstvollen Stunde vor einem Sturm nicht wenig wunderte. Aber der Kapitän an meiner Seite wurde blaß wie der Tod. »Mein Schiff ist verloren«, rief er, »dort segelt der Tod!«
Ehe ich ihn noch über diesen sonderbaren Ausruf befragen konnte, stürzten schon heulend und schreiend die Matrosen herein. »Habt ihr ihn gesehen?« schrien sie. »Jetzt ist’s mit uns vorbei!«
Der Kapitän aber ließ Trostsprüche aus dem Koran vorlesen und setzte sich selbst ans Steuerruder. Aber vergebens! Zusehends brauste der Sturm auf, und ehe eine Stunde verging, krachte das Schiff und blieb sitzen. Die Boote wurden ausgesetzt, und kaum hatten sich die letzten Matrosen gerettet, so versank das Schiff vor unseren Augen, und als ein Bettler fuhr ich in die See hinaus. Aber der Jammer hatte noch kein Ende. Fürchterlicher tobte der Sturm; das Boot war nicht mehr zu regieren. Ich hatte meinen alten Diener fest umschlungen, und wir versprachen uns, nie voneinander zu weichen. Endlich brach der Tag an. Aber mit dem ersten Anblick der Morgenröte faßte der Wind das Boot, in welchem wir saßen, und stürzte es um. Ich habe keinen meiner Schiffsleute mehr gesehen. Der Sturz hatte mich betäubt; und als ich aufwachte, befand ich mich in den Armen meines alten treuen Dieners, der sich auf das umgeschlagene Boot gerettet und mich nachgezogen hatte. Der Sturm hatte sich gelegt. Von unserem Schiff war nichts mehr zu sehen, wohl aber entdeckten wir nicht weit von uns ein anderes Schiff, auf das die Wellen uns hintrieben. Als wir näher hinzukamen, erkannte ich das Schiff als dasselbe, das in der Nacht an uns vorbeifuhr und welches den Kapitän so sehr in Schrecken gesetzt hatte. Ich empfand ein sonderbares Grauen vor diesem Schiffe . Die Äußerung des Kapitäns, die sich so furchtbar bestätigt hatte, das öde Aussehen des Schiffes, auf dem sich, so nahe wir auch herankamen, so laut wir schrien, niemand zeigte, erschreckten mich. Doch es war unser einziges Rettungsmittel; darum priesen wir den Propheten, der uns so wundervoll erhalten hatte.
Am Vorderteil des Schiffes hing ein langes Tau herab. Mit Händen und Füßen ruderten wir darauf zu, um es zu erfassen. Endlich glückte es. Noch einmal erhob ich meine Stimme, aber immer blieb es still auf dem Schiff. Da klimmten wir an dem Tau hinauf, ich als der Jüngste voran. Aber Entsetzen! Welches Schauspiel stellte sich meinem Auge dar, als ich das Verdeck betrat! Der Boden war mit Blut gerötet, zwanzig bis dreißig Leichname in türkischen Kleidern lagen auf dem Boden, am mittleren Mastbaum stand ein Mann, reich gekleidet, den Säbel in der Hand, aber das Gesicht war blaß und verzerrt, durch die Stirn ging ein großer Nagel, der ihn an den Mastbaum heftete, auch er war tot. Schrecken fesselte meine Schritte, ich wagte kaum zu atmen. Endlich war auch mein Begleiter heraufgekommen. Auch ihn überraschte der Anblick des Verdecks, das gar nichts Lebendiges, sondern nur so viele schreckliche Tote zeigte. Wir wagten es endlich, nachdem wir in der Seelenangst zum Propheten gefleht hatten, weiter vorzuschreiten. Bei jedem Schritte sahen wir uns um, ob nicht etwas Neues, noch Schrecklicheres sich darbiete; aber alles blieb, wie es war; weit und breit nichts Lebendiges als wir und das Weltmeer. Nicht einmal laut zu sprechen wagten wir, aus Furcht, der tote, am Mast angespießte Kapitano möchte seine starren Augen nach uns hindrehen oder einer der Getöteten möchte seinen Kopf umwenden. Endlich waren wir bis an eine Treppe gekommen, die in den Schiffsraum führte. Unwillkürlich machten wir dort halt und sahen einander an, denn keiner wagte es recht, seine Gedanken zu äußern.